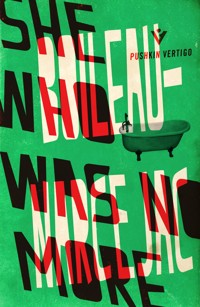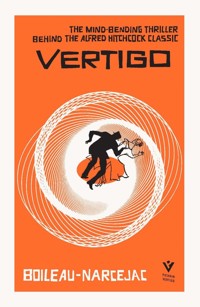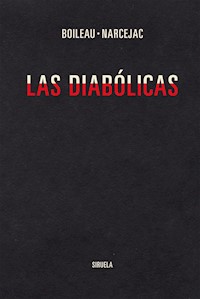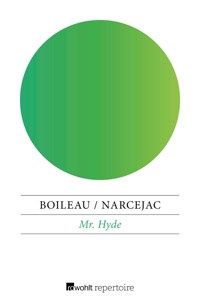4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ronan de Guer hat ein Geheimnis. Man hat den Endzwanziger verfrüht aus dem Gefängnis entlassen, wo er eine zehnjährige Haftstrafe verbüßt hat. Er hatte als jugendlicher Hitzkopf und leidenschaftlicher Anhänger der Bewegung «Keltische Front» einen Polizeibeamten erschossen und war wegen Mordes verurteilt worden. Zu all dem Schrecklichen kam, daß seine Braut, Catherine, die ein Kind von ihm erwartete, kurz nach seiner Verhaftung Selbstmord beging. Jetzt kennt er nur noch eines: sein Geheimnis, das er niemandem mitteilen kann, diesen geheimen Plan, den er, wenn er erst einmal seine volle Gesundheit zurückgefunden hat, in die Tat umsetzen wird. Auch Jean-Marie Quéré hat ein Geheimnis, das er auch in den beinahe zehn Jahren seiner Ehe für sich behalten hat und das, so nimmt er jedenfalls an, nur ein einziger Freund von ihm kennt, dem er in regelmäßigen Briefen sein Herz ausschüttet. Dieses Geheimnis bedrückt ihn mehr als die nun schon chronisch gewordene Arbeitslosigkeit. Er wagt schon gar nicht mehr, auf eine Änderung dieses Zustandes zu hoffen, denn jedesmal, wenn er tatsächlich wieder einmal eine Stellung gefunden hat, treffen seit kurzem dort anonyme Briefe ein, die ihn zwingen, seine neue Position selber zu beenden. Ronan und Jean-Marie machen es ihrer Umwelt nicht leicht. Sie stoßen die Menschen vor den Kopf, die es gut mit ihnen meinen, aber andererseits würden sich diese Menschen voll Abscheu von ihnen wenden, wenn sie ahnten, was jeder von ihnen in der Tiefe seines Herzens als Geheimnis mit sich herumträgt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Pierre Boileau • Thomas Narcejac
Die Unberührbaren
Aus dem Französischen von Elisabeth Uebe
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Ronan de Guer hat ein Geheimnis. Man hat den Endzwanziger verfrüht aus dem Gefängnis entlassen, wo er eine zehnjährige Haftstrafe verbüßt hat. Er hatte als jugendlicher Hitzkopf und leidenschaftlicher Anhänger der Bewegung «Keltische Front» einen Polizeibeamten erschossen und war wegen Mordes verurteilt worden. Zu all dem Schrecklichen kam, daß seine Braut, Catherine, die ein Kind von ihm erwartete, kurz nach seiner Verhaftung Selbstmord beging. Jetzt kennt er nur noch eines: sein Geheimnis, das er niemandem mitteilen kann, diesen geheimen Plan, den er, wenn er erst einmal seine volle Gesundheit zurückgefunden hat, in die Tat umsetzen wird.
Auch Jean-Marie Quéré hat ein Geheimnis, das er auch in den beinahe zehn Jahren seiner Ehe für sich behalten hat und das, so nimmt er jedenfalls an, nur ein einziger Freund von ihm kennt, dem er in regelmäßigen Briefen sein Herz ausschüttet. Dieses Geheimnis bedrückt ihn mehr als die nun schon chronisch gewordene Arbeitslosigkeit. Er wagt schon gar nicht mehr, auf eine Änderung dieses Zustandes zu hoffen, denn jedesmal, wenn er tatsächlich wieder einmal eine Stellung gefunden hat, treffen seit kurzem dort anonyme Briefe ein, die ihn zwingen, seine neue Position selber zu beenden.
Ronan und Jean-Marie machen es ihrer Umwelt nicht leicht. Sie stoßen die Menschen vor den Kopf, die es gut mit ihnen meinen, aber andererseits würden sich diese Menschen voll Abscheu von ihnen wenden, wenn sie ahnten, was jeder von ihnen in der Tiefe seines Herzens als Geheimnis mit sich herumträgt.
Über Pierre Boileau • Thomas Narcejac
Die beiden französischen Autoren Pierre Boileau (1906–1989) und Thomas Narcejac (1908–1998) haben zusammen zahlreiche Kriminalromane verfasst. Ihre nervenzerreißenden Psychothriller haben viele Regisseure zu spannenden Filmen inspiriert, am bekanntesten sind wohl «Die Teuflischen» und sein amerikanisches Remake «Diabolisch» und «Vertigo – Aus dem Reich der Toten», sicher einer der besten Filme von Alfred Hitchcock.
Inhaltsübersicht
Die Hauptpersonen
Jean-Marie Quéré
hat eine Vergangenheit, die er gern vergessen möchte. Nur gibt es jemanden, der das nicht zuläßt.
Hélène Quéré
wäre so gern stolz auf ihren Mann gewesen.
Ronan de Guer
hat ebenfalls eine Vergangenheit, aber keine Zukunft.
Hervé Le Dunff
macht bei einem Spiel mit, bis daraus Ernst geworden ist.
Catherine Jaouen
könnte einige Antworten geben, aber sie ist seit zehn Jahren tot.
Lieber Freund,
so haben Sie mich also wiedergefunden. Dank der Vorsehung, wie Sie sagen. Vielleicht! Aber Sie dürfen nicht glauben, daß ich die Absicht hatte, mich in Paris zu verstecken. Nein. Ich wollte nur in der Menge untergehen … verschwinden, um zu versuchen, ein neues Leben anzufangen. Mit voller Absicht habe ich alle Brücken abgebrochen. Sicherlich hätte ich Ihnen, die Sie jahrelang mein geistiger Vater gewesen sind, meine Zweifel anvertrauen müssen, aber ich kannte im voraus Ihre Antworten. Sie wären sehr kurz gewesen. Und ich fühlte mich bereits so zerschlagen, daß ich meiner Verzweiflung die herzzerreißende Szene ersparen wollte, in der wir beide uns gegeneinander gestellt hätten. Ich habe es vorgezogen, mich heimlich davonzumachen. Und ich muß Ihnen gestehen, es wäre mir lieber gewesen, wenn sich die Vorsehung, wie Sie es nennen, nicht in meine Angelegenheiten gemischt hätte. Ich bitte Sie um Verzeihung, wenn in meinen Worten so etwas wie Groll mitklingt. Aber seien Sie versichert, er richtet sich ganz allein gegen mich. Dieser Groll ist das Leiden, das diejenigen verzehrt, denen nicht die Gnade der Schizophrenie zuteil geworden ist. Ein Teil von mir behauptet sich immer noch, kann nicht zusammenbrechen, trotz der Erschütterungen, die ich mir auferlege. Ihr Brief hat das schwankende Gebäude noch ein bißchen mehr auf die Seite geneigt. Und jetzt – ich weiß nicht mehr – ich fühle mich zwischen Freude und Zorn hin und her gerissen. Aber ich glaube, daß trotz allem die Freude überwiegt.
Sie haben nicht den Fehler begangen, mir zu verzeihen. Ihre Verzeihung wäre für mich eine Beleidigung gewesen. Sie haben mir Ihre Arme geöffnet, und ich werde Ihnen vielleicht mein Herz ausschütten, da Sie versichern, Sie seien bereit, mich zu verstehen. Es ist wahr, zehn Jahre sind inzwischen vergangen. Zehn Jahre: genug Zeit, um Tadel in Neugier zu verwandeln. Da nun einer Ihrer Freunde mir just in dem Augenblick begegnet ist, als ich nach Hause zurückkehrte, und da er auch nicht verfehlt hat, Ihnen unverzüglich von dieser Begegnung zu berichten, so ist das wohl in der Tat mehr als nur ein glücklicher Zufall. Ich sehe darin ein noch undeutliches Zeichen für einen Wechsel, der mir womöglich mein Leben ein bißchen weniger mühsam gestalten möchte. Ich habe bisweilen so sehr das Bedürfnis, mich jemandem anzuvertrauen!
Ich werde Ihnen alles sagen, so wie man sich ausblutet. Zeit habe ich leider nur allzuviel, denn ich bin seit einigen Monaten arbeitslos. Heute möchte ich Ihnen nur danken. Ich bin nicht schuldig, aber es bringt mich aus der Fassung, wenn andere das behaupten. Ihnen nochmals danke.
Von ganzem Herzen
Jean-Marie Quéré
Lieber Freund,
ich habe vier Tage verstreichen lassen. Um wieder zur Ruhe zu kommen. Um nüchtern über mich sprechen zu können, wenn das möglich ist. Auf jeden Fall aber ohne Selbstgefälligkeit und ohne literarische Ausschmückungen. Ja, ich habe den Glauben verloren. Das ist ganz plötzlich gekommen. Es gibt berühmte Bekehrungen, blitzartige Erleuchtungen. Aber ich weiß, daß es auch plötzlichen Schiffbruch gibt. Mit einemmal ist der Horizont verschwunden. Sonnenklare Wahrheit kehrt sich um in trostlose Gewißheit. Man sieht nur noch die Kehrseite aller Dinge, ja schlimmer noch, man entdeckt, daß es eine Lichtseite eigentlich niemals gegeben hat. Das ist mir eines Abends passiert, es war ein Sonntagabend … Ich könnte Ihnen ganz genau Tag und Stunde nennen, so lebhaft ist die Erinnerung in meinem Gedächtnis geblieben.
Ich sah mir gerade eine Sendung an über das Leben der Tiere. Ich hatte einen anstrengenden Tag hinter mir und verfolgte nur mit halbem Interesse die Entwicklungsgeschichte eines im Schlamm herumplatschenden Flußpferdes, als die Kamera plötzlich auf eine Gruppe von Zebras umschwenkte, die bei einer Wasserstelle weidete.
Ich habe eine Schwäche für Zebras wegen ihrer Arglosigkeit und ihres Ungestüms. Sie haben so etwas an sich, wirken so pummelig, pausbäckig und schalkhaft, daß man unwillkürlich an seine Kindheit erinnert wird. Sie zupften ein Büschel Gras, hoben die Köpfe, spitzten die Ohren gegen die Geräusche ihrer Umgebung und ästen dann beruhigt weiter. Die Gegenwart einer Löwin hinter einem Busch hatten sie gar nicht wahrgenommen.
Ich sehe dieses Tier wieder vor mir, sprungbereit zusammengekauert. Alles an dieser Löwin deutete auf Mord. Mordlust ließ ihre Muskeln erzittern, und aus ihren Blicken schossen tödliche Pfeile. Plötzlich zeigten sich die Zebras beunruhigt und stoben alle auf einmal davon. Die Löwin machte sich sogleich an die Verfolgung, und zwar schlug sie einen schrägen Kurs ein, durch den sie ein Zebra von der bereits durch eine Staubwolke verdeckten Herde abtrennte. Da wußte ich, daß das Verbrechen seinen Gang nehmen würde.
Ähnliche Szenen hatte ich schon oft gesehen, ohne jedoch sonderliche Aufregung dabei zu empfinden. An jenem Abend aber sah ich der Jagd mit Entsetzen zu. In vollem Lauf sprang die Löwin ihr Opfer an und hängte sich mit ihren sämtlichen Krallen in seinen Rücken. Sie warf das Zebra um und suchte seine Kehle. Gleichzeitig stieß sie ihr heiseres Triumphgeheul aus. Die Kamera fing die beiden ineinander verschlungenen Tiere ein. Es folgte eine Großaufnahme vom Kopf des Zebras, ich sah die drollige kleine Bürste von hellem Haar zwischen seinen Ohren und vor allem, oh, vor allem sein Auge, in dem sich der Himmel spiegelte und darin schon die Geier kreisten – seine langen Mädchenwimpern, die noch ein letztes Mal auf- und zuschlugen. Dann entspannten sich langsam die wild ausschlagenden Läufe. Jetzt war es nur noch gut, um gefressen zu werden. Die Löwin warf den Körper mit einem einzigen Stoß zur Seite, blutige Striemen mischten sich mit den Fellstreifen. Ein einziger Biß der Raubtierzähne öffnete den warmen Bauch. Die Flanken der Löwin bebten im Orgasmus.
Mit klopfendem Herzen versuchte ich meine Empfindungen zu analysieren: Ekel, Abscheu, Auflehnung, Abwehr, wie soll ich es Ihnen erklären? Worte schossen mir durch den Kopf:… der Tod … Unmöglich … Ich sage nein …
Sie sind vielleicht der Meinung, ich sei das Opfer einer momentanen Depression gewesen und der Todeskampf eines Zebras sei wahrlich nicht dazu angetan, eine ganze Metaphysik über den Haufen zu werfen. Ich höre Sie sagen: «Das Böse ist nur durch den Menschen auf die Erde gekommen. Ehe es den Menschen gab, war die Welt unschuldig, usw. …» Aber die Denker haben stets ihre Augen verschlossen vor der Tatsache, daß die Lust am Töten im animalischen Leben tief verwurzelt ist. Und das ist mir damals in einem niederschmetternden Augenblick der Erkenntnis klargeworden. Diese Krallen, diese Zähne, die Schnäbel, die Stacheln, alles nur Folterinstrumente. Sie bringen das Leiden und dann erst den Tod. Und dieses Leiden ist die Freude des Angreifers. Das hatte ich soeben deutlich gesehen. Dieser sterbende Blick über die geliebten Dinge: die Savanne, den Himmel, den Wind in den Gräsern … Warum? Warum das Ende von allem?
Wenn Gott existiert, wenn er überall ist, dann muß er doch das Krachen der zerbrechenden Knochen hören, das von einem Ende unseres blutigen Planeten bis zum anderen die Stille der Tage und Nächte ausfüllt. Der fressende Planet. Der abscheuliche Jubel über den gestillten Hunger. Der Sieg der Raubtiere, der den Sieg des Menschen vorbereitet, ihn ankündigt. Vom Urtier bis zum Krieger ist keiner unschuldig. Dessen bin ich jetzt ganz sicher. Ich will nicht einmal mehr darüber diskutieren, denn wie Sie sich wohl vorstellen können, habe ich bereits gekämpft. Ich habe es von allen Seiten betrachtet, dieses Problem des Leidens. Aber ständig sah ich das verwirrte Auge des erschlagenen Tieres vor mir.
Hirngespinste? Sei’s drum! Vielleicht war ich bereits seit langem reif dazu, diese Gegenoffenbarung zu empfangen und mich von ihr durchdringen zu lassen. Aber, Recht oder Unrecht, ich fühlte mich gehalten, meine Handlungen mit meinen Überzeugungen übereinzustimmen. Ich konnte nicht mehr glauben. Was für eine unendliche Güte war das, so frage ich Sie, die vom Urbeginn der Zeiten den Mord gedeihen ließ? Bis hin zum Hügel von Golgatha? Ich wiederhole nochmals, daß ich nicht behaupte, recht zu haben. Ich sage nur, daß sich meine Augen geöffnet haben, daß ich begriffen habe … aber ich will Sie nicht weiter belästigen mit diesem Erlebnis, das mich verdorrt und ausgebrannt hat.
Ich mußte mich verstecken, mich in der anonymen Masse vergraben. Ich bin fortgegangen, ohne irgend jemanden zu benachrichtigen. Ich bin nach Paris gekommen. Paris, das bedeutet Einsamkeit im Gewimmel. Da ist es leicht, unterzutauchen. Und ich bin untergetaucht. Es ist mir gelungen, diesem herrenlosen Glauben, der sich wie ein verirrter Hund an meine Fersen heftete, zu entkommen, ihn abzuschütteln. Endlich habe ich mich frei gefühlt.
Sie können sich nicht vorstellen, was für ein Gefühl das ist, diese Freiheit, wenn alles erlaubt ist. Es gibt keine Gebote mehr, nur noch ein einziges Gesetz: das Verlangen. Diesmal war ich wirklich in einen Dschungel geraten. Ich konnte völlig ungestraft meinen Durst stillen. Aber unglücklicherweise bin ich kein besonders leidenschaftlicher Mensch. Und wenn man kein Geld hat, ist auch das Verlangen nichts weiter als ein Krampf der Phantasie. Ich war arm, und das bedeutete, daß ich auf der Seite derer stand, die gefressen wurden, und nicht auf der Seite der Fressenden. Nun ja, schließlich war ich darüber gar nicht mal allzu unglücklich. Ich hatte im Quartier Latin eine kleine möblierte Wohnung gefunden. Natürlich mußte ich dafür auch zahlen, und sie kostete mich ein gut Teil meines Geldes. Dazu kam das Essen im Gasthaus, und so waren meine Finanzen bald völlig ruiniert. Aber wenn ich an den Buchgeschäften und bei den Antiquitätenhändlern vorbeiging, konnte ich mir sagen: all das gehört mir, in gewissem Sinne!
In gewissem Sinne, das ist das Lieblingswort der Armen. Immer befindet sich ein Schaufenster zwischen ihnen und den Gegenständen. Ihre Hände haben kein Recht, etwas zu berühren, aber ihre Augen dürfen alles betrachten. Das ist «in gewissem Sinne» eine Art des Besitzens. Es war meine Art. In Gedanken kaufte ich tausend Dinge, leistete mir ungezählte Vergnügungen, deren Sinnlosigkeit mir im voraus bekannt war. So häufte ich also die Dinge an, ohne jemals von ihnen enttäuscht zu werden. Alles zog mich an, aber ich hängte mein Herz an nichts. Ich war weder glücklich noch unglücklich. Ich war einfach ein Überlebender, eine Person am falschen Platz.
Aber nun muß ich Ihnen von Marceau Langlois berichten. Der Name wird Ihnen etwas sagen. Marceau Langlois, ist das nicht der Autor von …? Er ist es. Der schier unerschöpfliche Autor von einhundertfünfzig Kriminalromanen, achtzig Liebesromanen und ungefähr hundert anderen Romanen, denn er schrieb einfach alles, wenn es nur rentabel war. Ich rede im Imperfekt von ihm, denn er ist vor einiger Zeit gestorben. Deswegen bin ich auch arbeitslos. Ja, ich war lange Jahre hindurch sein Sekretär. Das wird Ihnen unvorstellbar, wenn nicht sogar ungeheuerlich erscheinen. Aber warum in aller Welt, so frage ich Sie, hätte ich diese Beschäftigung ablehnen sollen? Vergessen Sie nicht, daß es für mich nichts Verbotenes mehr gibt. Und im übrigen war Langlois kein schlechter Mensch. Gewiß, ich gebe zu, er hatte etwas von einem Kuppler an sich. Seine Bücher waren von miesester literarischer Qualität. Sie haben sich wahrscheinlich niemals mit dieser Schundliteratur befaßt, Sie wissen nicht, auf welche Art sie zusammengebraut wird. Ich weiß es. Ich habe dabei eine Sprache gelernt, die ich bisher nicht kannte, und tausend Dinge über Sex, Gewalt und Verbrechen, von denen ich keine Ahnung hatte. Diese Literatur hat mich immun gemacht gegen die Erbärmlichkeit von Leib und Seele. Ich bin ihm dankbar dafür, daß ich begriffen habe, wie dumm dieses Geschreibe ist.
Langlois selbst war der geborene Schlaukopf. Als Journalist war er zu feige, um Sonderaufträge zu übernehmen, und zu schlau, um politische Artikel zu schreiben. Was übrigblieb, war die Gastronomie. So spezialisierte er sich in dieser Sparte, und dabei blieb ihm immer noch genügend Freizeit. Diese nutzte er, um einen ersten Kriminalroman über Drogen zu schreiben, und hatte damit einen ganz beachtlichen Erfolg. Er schrieb weiter und hängte den Journalismus bald an den Nagel, um sich voll und ganz der Herstellung solcher Machwerke zu widmen. Schon bald war er dabei ganz groß im Geschäft. Um sich herum brauchte er dazu einen kleinen «brain trust». (Er konnte zwar kein Englisch, aber Fremdwörter, die mit dem Geschäft zu tun hatten, ließ er wie Bonbons auf der Zunge zergehen.) Daß er mich engagierte, verdanke ich dem reinen Zufall und meiner äußeren Erscheinung, die immer schon wohlanständig und etwas schüchtern gewirkt hat. Er brauchte einen Sekretär, der diskret, schnell und zuverlässig arbeitete und außerdem bescheiden und unauffällig war. Mit meiner zweijährigen Lehrerfahrung und meinem etwas abgenutzten schwarzen Anzug gefiel ich ihm sogleich. Er verlangte keine Referenzen von mir, und ich hielt es nicht für angebracht, ihm die Gründe mitzuteilen, die mich nach Paris geführt hatten.
Für viertausend Francs im Monat durfte ich in seinem Schatten leben und die Berge von Post beantworten, die ihm ins Haus flatterten. Sie werden es nicht glauben, aber er ließ sich «Maître» nennen. Er war überzeugt, ein großer Schriftsteller zu sein, weil er tonnenweise Papier verkaufte. Unablässig schickte ich sein Foto mit Widmung überallhin. Von Zeit zu Zeit kam er in mein Büro, beugte sich über meine Schulter, und seine Zigarre wärmte mein Ohr. Er las den Brief, den ich gerade schrieb, und gab mir einen freundschaftlichen Klaps. «Sehr gut, Jean-Marie. Sie sind ein begabter Briefschreiber.» Er nannte mich gern Jean-Marie. «Das klingt ein bißchen komisch, aber sehr honorig», hatte er im Anfang zu mir gesagt. Ich empfing für ihn die Besucher und vor allem die Besucherinnen, die er nicht sehen wollte. Was da alles an mir vorbeispaziert ist, davon können Sie sich keine Vorstellung machen. Seine Romane zogen Scharen von reiferen Damen an, sie kamen daher und trugen ein Buch von ihm in der Hand, als wäre es eine Sammelbüchse. Vielleicht übertreibe ich ein bißchen, weil mich Marceaus Persönlichkeit immer etwas amüsiert hat, aber es ist eine Tatsache, daß ich oft bis sieben oder acht Uhr am Abend bleiben mußte, um mit der aufgestauten Post fertig zu werden. Es wäre ihm niemals in den Sinn gekommen, mir dafür eine Gratifikation zu geben. Oder vielmehr doch. Er überreichte mir immer sein neuestes Werk. Das waren Titel wie: Herz einer Jungfrau oder sonst etwas zu Herzen Gehendes. Das Peinliche daran war, daß ich die Bücher auch lesen mußte, denn er befragte mich darüber. «Nun, mein kleiner Jean-Marie, wie finden Sie meine Herzogin?»
«Sie ist sehr gut beobachtet.»
«Das ist genau das richtige Wort. Wenn Sie einmal zu schreiben anfangen – eines Tages werden Sie das bestimmt tun –, dann denken Sie immer daran: gute Beobachtung ist das ganze Geheimnis.»
Manchmal nahm er mich in seinem Bentley zu irgendeiner geschäftlichen Verabredung mit. Ich war aber nicht etwa nur dabei, um an dem Gastmahl teilzunehmen, sondern um sorgfältig auf die Gespräche zu achten, die in der euphorischen Stimmung bei Tisch meist sehr freizügig geführt wurden. Wenn wir nach Hause kamen, schrieb ich sie auf, und Marceau studierte sie aufmerksam.
«Dummköpfe! … Für wen halten die mich eigentlich?»
Dann hörte ich ihn telefonieren: «Hören Sie mal, mein Lieber, Sie haben mir doch gesagt … Aber ja, Sie haben das gesagt … Ach so, ja, gut. Das entschuldigt alles. Jeder Mensch kann sich irren!»
Nach und nach lernte ich das Leben kennen, das wirkliche Leben. Mir fielen alle die Stellen aus der Heiligen Schrift ein, in denen von den schlechten Reichen die Rede ist, von den Hurenböcken, Räubern und Dirnen. Ich sah diese Strolche aus der Nähe, und das ist etwas ganz anderes, oder wenn Sie so wollen, es ist das gleiche Gesindel, nur spielen sie dabei den Kavalier. Ein Wort von Renan kam mir in den Sinn: Die Wahrheit ist bisweilen traurig. Ich verdanke diesem armen Marceau eine Menge. Er ist an einem Herzinfarkt gestorben, mit dem Champagnerglas in der Hand, genau wie der Held seines Romans Aufgepaßt, Bulle. Bei seiner Beerdigung, die natürlich kirchlich war, wie es sich gehört, hatte sich die ganze Menschenmenge eingefunden, die gewöhnlich einem verstorbenen Star das Geleit gibt, gar nicht zu reden von etlichen verflossenen Geliebten, die angemessene Betrübnis zur Schau trugen.
Bei der Testamentseröffnung zeigte es sich, daß der schwerreiche Marceau mir nicht einen Centime hinterlassen hatte. Darüber hinaus war meine Lage alles andere als klar. Was war ich denn überhaupt als Sekretär eines verstorbenen Schriftstellers? Ein entlassener Arbeiter oder ein stellungsloser Angestellter? Wenn nicht Hélène für mich gesorgt hätte, ich weiß nicht, was dann aus mir geworden wäre. Hélène ist meine Frau. Ich habe im vorigen Jahr geheiratet. Aber das werde ich Ihnen später erzählen. Im Augenblick … aber wozu soll ich Sie langweilen mit dem Bericht über meine Wanderungen von einem Büro zum anderen?
Sie sind in gesicherter Stellung. Oh, das soll kein Vorwurf sein! Die Welt der Arbeitslosigkeit ist eine andere Welt, sie ist mit nichts zu vergleichen. Es ist nicht die Welt des Elends. Es ist eine Welt, in der jegliches Solidaritätsgefühl verschwunden ist. Eine Welt voller Papierkram, Eingaben, Formulare, Dokumente. Man ist scheintot vor lauter Warten, mit leerem Kopf und zitternden Beinen tritt man vor den Schaltern von einem Fuß auf den anderen. Man steht Schlange für eine Unterschrift, man steht Schlange für ein Dokument in dreifacher Ausfertigung, man steht Schlange für … Aber lassen wir das. Ihre Lebensbedingungen sind nicht mehr die meinen.
Sie könnten zum Beispiel glauben, ich sei bitter geworden oder fühlte mich gedemütigt. Nicht einmal. Ich würde eher sagen, daß ich in gewissem Sinne abgestumpft bin. Denn ich sehe keine Möglichkeit, wie sich die Dinge je wieder ändern könnten. Ich verstehe mich auf gar nichts, zumindest auf nichts, was sich unmittelbar in Geld umsetzen ließe. Zur Arbeit mit der Hand tauge ich nicht. Und für einen Verwaltungsposten bin ich nicht ausreichend qualifiziert. Außerdem verabscheue ich Zahlen. Und ich habe nicht das mindeste Rechtsgefühl. Also? …
Also lebe ich auf Sparflamme, einer aussichtslosen Zukunft entgegen, wie eine Muschel. Ich bekomme jetzt 40 % meines Mindestgehalts. Nein, ich habe nicht den Mut, Ihnen zu erklären, was das bedeutet. Dann werde ich 274 Tage lang nur noch 35 % bekommen, außerdem meine Tagesentschädigungen (aber nur während der ersten drei Monate) sowie meinen bezahlten Urlaub, ungefähr ein Zwölftel meines Gehalts. Zumindest glaube ich, daß das so ist. Alles in allem ist das eine Summe, die ausreicht und zugleich lächerlich ist. Ich bin wie ein Mann, der ins Wasser gefallen ist, der nahe daran ist zu ertrinken, aber immer noch atmen kann, vorausgesetzt, daß es keine Wellen gibt.
Zum Glück habe ich Hélène. Aber es muß ja weitergehen. Vor lauter Überlegungen schwirrt mir schon der Kopf. Ich schreibe Ihnen von einem Café aus. Die Tasse, der Marmortisch, das sind feste Dinge, das ist wirklich. Seit dem Tode von Marceau leide ich, wenn ich das so sagen darf, an einem gestörten Gefühl für die Wirklichkeit. Mir scheint, daß ich nur in einem schlechten Traum gefangen bin, daß ich aufwachen muß und die Rathausuhr schlagen höre, so wie früher. Aber die Tür zur Vergangenheit habe ich versperrt. Vor mir bleibt nur das Grau des Alltags.
Von ganzem Herzen der Ihre
Jean-Marie
Mein lieber Freund,
mein letzter Brief ist, glaube ich, vom 15. Ich hatte die Absicht, meinen Bericht unverzüglich fortzusetzen. Aber das ist wieder so ein Wort, das ich aus meinem Vokabular streichen muß. Alles, was irgendwie nach Planung oder Tatkraft aussieht, gibt es für mich nicht mehr. In Wahrheit habe ich nur herumgesessen und meine Zeit damit vergeudet, indem ich die Zeitungen auf der Suche nach irgendeinem höchst unwahrscheinlichen Stellenangebot durchblätterte. Mit einem roten Bleistift bewaffnet umrande ich gewisse Anzeigen, ich überlege hin und her, stelle Berechnungen an, wäge ab. Unbestimmte Vorstellungen, flüchtige Hoffnungen. Ich schweife von einem Bild zum anderen, von einer Zigarette zur anderen. Denn seit ich nicht mehr arbeite, habe ich zu rauchen angefangen. Wenn ich bemerke, daß es elf Uhr ist, mache ich ein paar Einkäufe. Ehe sie wegging, hat Hélène mir gesagt, ich solle Kartoffeln kochen und irgend etwas aufwärmen – ich weiß nicht mehr –, irgendein Fleisch, es steht auf der Liste, die sie mir jeden Morgen hinterläßt.
Also gut. Ich werde Ihnen von ihr erzählen. Ich werde eine Stunde lang schreiben und zwischendurch hin und wieder einen kleinen Schluck Kaffee trinken. Der Wirt kann nicht umhin, mich zu beobachten. Ich fasziniere ihn. Er glaubt, ich schreibe einen Roman. Wenn er bei mir vorbeigeht, flüstert er: «Geht es vorwärts, Monsieur Quéré?» Und er nickt mit dem Kopf wie jemand, der die großen Qualen eines Schriftstellers wohl versteht.
Hélène! Sie ist in Palluau geboren. Ich bin aus Pontivy, wie Sie wissen. Der Bretone und das Mädchen aus der Vendée! All das spricht für eine Verbindung. Und doch waren wir lange Zeit nichts weiter als Flurnachbarn. Sie wohnte in einem Zimmer mir gegenüber. Ich sah sie nur selten. Morgens ging ich später weg als sie, und am Abend kam ich später nach Hause. Manchmal sah ich sie in dem Frisiersalon, in dem sie arbeitet, oder aber am Sonntag, wenn sie zur Messe ging. Wenn ich nicht einmal eine sehr schwere Bronchitis bekommen hätte, die mich drei Wochen lang ans Bett fesselte, dann wären wir uns vielleicht für immer fremd geblieben. Aber sie hörte mich in der Nacht husten. Die Vermieterin erzählte ihr, daß ich krank sei und sich niemand um mich kümmere. Da kam sie mir zu Hilfe, mit sanfter Festigkeit und erstaunt über mein Schamgefühl. Als Mädchen vom Lande hatte sie eine ganze Reihe von Brüdern und Schwestern versorgen müssen, ehe sie in Paris in Stellung ging. «Los, drehen Sie sich um, nein, der Umschlag ist nicht zu heiß … So ein empfindliches Mannsbild. Lassen Sie den Umschlag eine Viertelstunde drauf. Und nicht mogeln!»
Ich hatte bisher keine andere Frau als meine Mutter kennengelernt. Diejenigen, denen ich bei Marceau begegnet war, in voller Kriegsbemalung oder zerlumpt wie die Zigeuner, die hatten mir nichts als Abscheu und Widerwillen eingeflößt. Hélène aber war natürlich, gesund, und ihre Hand beruhigte und heilte. Ich kam aus dem Staunen nicht heraus, als sie mein Zimmer betreten hatte. Im Handumdrehen war meine Junggesellenunordnung beseitigt. Alles lief wie am Schnürchen. Ich verlangte nichts Besseres, als mich ihr zu fügen.
Eines Tages traf sie auf Marceau, der gekommen war, um sich nach mir zu erkundigen. In Wirklichkeit wollte er nur wissen, ob ich bald wieder ins Büro kommen konnte. Da er selbst niemals krank war, hielt er jeden Menschen in seiner Umgebung, dem das passierte, für einen Schwächling und Drückeberger. Er machte einen großen Eindruck auf Hélène. Die Ärmste gehört genau wie ich zu den Leuten, die sich von Reichtum einschüchtern lassen. Und dann bewunderte sie ihn dermaßen als Autor. Kaum war er wieder zur Tür hinaus, als ich begann, das strahlende Bild des guten Mannes zu zertrümmern. Beinahe wäre sie böse geworden. In dem Augenblick merkte ich, daß ich verliebt war.
Ja, so hat alles angefangen. Ich war regelrecht verliebt. Wie dumm sie war, sich von diesem Jean de Fréneuse (mit diesem Namen zeichnete er einige seiner Romane) beeindrucken zu lassen. Ich wollte ihren Geschmack verbessern und lieh ihr ein paar Bücher, aber die langweilten sie. Unsere Beziehungen lockerten sich wieder, es war meine Schuld. Ich konnte es mir nicht verzeihen, daß ich mich von ihr derart angezogen fühlte. Ich war so davon überzeugt, daß das Leben keinen Sinn hat, daß es nur ein Trugbild ist. Wozu also Liebe, wie? … Das war doch nur so eine Gaunerei des Instinkts, weiter nichts.
Und dennoch richtete ich es so ein, daß ich Hélène über den Weg lief, daß wir ein Wort wechselten oder zumindest ein Lächeln. Danach warf ich mir selbst alle möglichen Schimpfnamen an den Kopf, was sehr leicht war, denn Marceau hatte in seinem Zorn ein unerschöpfliches Repertoire von Beiworten, und etliche davon paßten großartig auf mich.
Ein paar Wochen später wurde nun Hélène ebenfalls krank. Sie übt einen Beruf aus, der die Beine enorm strapaziert, was ich natürlich nicht wußte. Die Friseusen, die den ganzen Tag stehen, haben anscheinend häufig Krampfadern. Da sie gezwungen war zu liegen, nahm sie meine Dienste an, und ich entdeckte die andere Hélène, die Hélène, die sich nicht mehr zurechtmachen konnte, sich nicht mehr in den Schutz ihrer sicheren Eleganz stellen konnte. Sie litt darunter. «Schauen Sie mich nicht an!» sagte sie. Und da sah ich sie erst recht an, und ich war gerührt, denn da war sie, die echte Hélène. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen das erklären soll. Einmal gab es das junge Mädchen, das mich gepflegt hatte, das frisiert und parfumiert zu mir gekommen war und das ich so oft in meine Arme hätte schließen mögen. Das war … wie soll ich es nennen? Die Hélène der Liebe. Und jetzt sah ich die Hélène der Zuneigung. Die leidende Hélène, die es sich gefallen ließ, daß ich sie stützte, ihr das Kissen in den Rücken schob, und die mit ein wenig zitternder Stimme «Danke» murmelte. Und Zuneigung fiel mir sehr viel leichter als die Liebe.
Um ganz offen zu sein, vor der Liebe habe ich immer Angst gehabt. Ich habe Ihnen die Episode von dem gerissenen Zebra erzählt, die ein solches Trauma für mich war. Mir scheint, daß es in der Liebe ähnliches gibt, nur mit dem Unterschied, daß man nicht weiß, wer die Beute ist und wer das Raubtier. Ich gehe sogar so weit zu behaupten, daß ich Sex verabscheue. Dieses wilde Unterpfand, das die Natur an unserem Körper zurückgelassen hat, ist das etwa nicht das eigentliche Merkmal des Tieres? Während doch Zuneigung, Zärtlichkeit, sanft ist und Vertrauen bedeutet. In einem Wort, sie verbindet in sich all die Tugenden, die ich niemals besitzen, aber immer hochschätzen werde.
Vertrauen habe ich gesagt? Das leuchtete aus ihren Augen. Habe ich Ihnen schon gesagt, daß sie blaue Augen hat, Augen, die sich verschenken, während schwarze Augen, so wie die meinigen, sich eher verschließen. Sie war vom Leben nicht sehr verwöhnt worden, wie sie mir erzählte. Drei Brüder. Fünf Schwestern. Ein Bauernhof, der zu klein war, um die ganze Familie zu ernähren.
Frühe Übersiedlung in die Stadt. Zuerst Nantes. Dann Paris. Ich war viel weniger mitteilsam, zunächst einmal weil ich eher ein verschlossener Charakter bin. Und dann wollte ich ihr auch nichts sagen über meine Gewissenskonflikte, besonders da ich feststellte, daß sie als echtes Kind der Vendée auf eine bedingungslose Art gläubig war.
Ich erzählte ihr kurz von meiner Familie, von meinem Vater, der Notar gewesen war. Ich ließ durchblicken, daß es zwischen mir und den Meinen nicht zum besten stand. Alles in allem war die Annäherung bald vollzogen. Wir brauchten einander. Sie willigte ein, mich zu heiraten, aber nur unter einer Bedingung: sie wollte in Weiß heiraten und in der Kirche.
Diese Bedingung hätte beinahe alles zum Scheitern gebracht. Ich erklärte ihr, ich sei Atheist und könne mich nicht verstellen. In Wirklichkeit spielte ich ihr ein bißchen die Komödie des gutwilligen Ungläubigen vor, der ja gern glauben wollte, aber eben nicht die Gnade empfangen hatte. Vielleicht später einmal! Auf jeden Fall würde ich ihr jegliche Freiheit lassen für die Ausübung ihres Glaubens. Und wer weiß, auf die Dauer würde vielleicht ihr Beispiel mich doch noch bekehren.
Ich schwöre Ihnen, ich meinte das ganz aufrichtig. Ich bin in keiner Weise ein Fanatiker. Ich bin kein militanter Verfechter der gedanklichen Freizügigkeit. Hélène betrieb ihren Glauben inbrünstig. Sei’s drum. Ich möchte sogar behaupten, daß mir das gar nicht mißfiel. Ich fühlte mich wie ein Mann, der vor Kälte erstarrt ist und die Wärme sucht. In dieser Art von moralischem Niemandsland, in dem ich mich befand, war Hélènes Liebe eine unerwartete Chance. Wir heirateten in Paris. Marceau schickte mir aus London ein Glückwunschtelegramm, das auch das Versprechen einer Gehaltserhöhung enthielt, welches allerdings niemals eingelöst wurde.
Damit, mein lieber Freund, beende ich meinen Bericht. Es ist genug für heute. Ich werde Ihnen sicher noch oft von Hélène erzählen, denn wie Sie sich wohl vorstellen können, hat es im letzten Jahr zwischen uns genug Steine des Anstoßes gegeben. Ich hätte nicht gedacht, daß diese Frage der Religion derart zum Problem werden könnte. Das scheint doch vollkommen veraltet. Und dennoch …
Auf Wiedersehen, mein lieber Freund. Ich muß jetzt nach Hause und das Essen vorbereiten. Unterwegs werde ich noch Brot, Mineralwasser, Kaffee usw. kaufen. Ein Arbeitsloser wird schnell zum Botenjungen.
In herzlicher Freundschaft
Jean-Marie
Ronan hört seine Mutter im Erdgeschoß telefonieren.