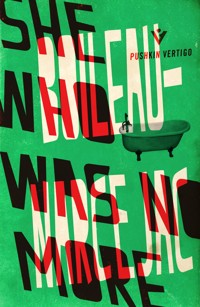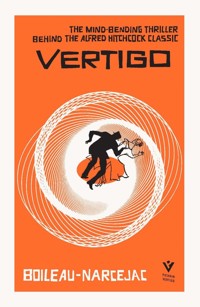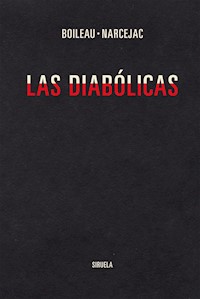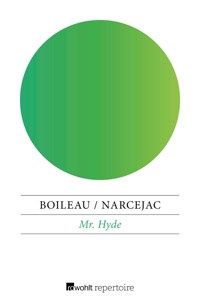9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Seit dem Unfall ist Richard Hermantier blind. Und jetzt, wo er gerade im Begriff ist, sich damit abzufinden, beginnen ihn diese kleinen verwirrenden Zufälle – sind es Zufälle? – zu beunruhigen. Angefangen hat es mit der Katze, die ihm auf den Schoß gesprungen ist und in der er seine gefleckte Rita zu ertasten geglaubt hatte. Christiane, seine Frau, hatte ihn in dem Glauben gelassen, aber das Dienstmädchen hatte dann von einer grauen Katze gesprochen. Dann war da die Sache mit dem Pfirsichbaum: Hermantier hatte die Stelle im Garten gefunden, wo er stehen mußte – aber da war nichts gewesen. Kein Baum. Drei Tage später hatte Christiane ihn dorthin geführt, und er hatte sogar einen saftigen Pfirsich abpflücken können. Und dann kam das mit der Steckdose: Sie befand sich auf einmal links vom Waschtisch, wo er doch genau wußte, daß sie früher auf der rechten Seite gewesen war … Sie haben für alles eine Erklärung – seine Frau, sein Bruder, sein Compagnon und die beiden Hausangestellten. Das Mädchen hat von einer anderen Katze gesprochen; er hatte den Pfirsichbaum eben doch nicht gefunden, und sein Ferienhaus in der Vendée, wohin sie ihn zur Erholung gebracht haben, ist renoviert worden … Was geht vor? Verschweigen sie ihm etwas? Steht es vielleicht schlimmer um ihn, als er weiß? Und dann sind da noch andere Wahrnehmungen, für die es – im Gegensatz zu Katzen, Bäumen und Steckdosen – keine Erklärung gibt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Pierre Boileau • Thomas Narcejac
Gesichter des Schattens
Aus dem Französischen von Ingeborg Hecht
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Seit dem Unfall ist Richard Hermantier blind. Und jetzt, wo er gerade im Begriff ist, sich damit abzufinden, beginnen ihn diese kleinen verwirrenden Zufälle – sind es Zufälle? – zu beunruhigen.
Angefangen hat es mit der Katze, die ihm auf den Schoß gesprungen ist und in der er seine gefleckte Rita zu ertasten geglaubt hatte. Christiane, seine Frau, hatte ihn in dem Glauben gelassen, aber das Dienstmädchen hatte dann von einer grauen Katze gesprochen. Dann war da die Sache mit dem Pfirsichbaum: Hermantier hatte die Stelle im Garten gefunden, wo er stehen mußte – aber da war nichts gewesen. Kein Baum. Drei Tage später hatte Christiane ihn dorthin geführt, und er hatte sogar einen saftigen Pfirsich abpflücken können. Und dann kam das mit der Steckdose: Sie befand sich auf einmal links vom Waschtisch, wo er doch genau wußte, daß sie früher auf der rechten Seite gewesen war …
Sie haben für alles eine Erklärung – seine Frau, sein Bruder, sein Compagnon und die beiden Hausangestellten. Das Mädchen hat von einer anderen Katze gesprochen; er hatte den Pfirsichbaum eben doch nicht gefunden, und sein Ferienhaus in der Vendée, wohin sie ihn zur Erholung gebracht haben, ist renoviert worden … Was geht vor? Verschweigen sie ihm etwas? Steht es vielleicht schlimmer um ihn, als er weiß?
Und dann sind da noch andere Wahrnehmungen, für die es – im Gegensatz zu Katzen, Bäumen und Steckdosen – keine Erklärung gibt …
Über Pierre Boileau • Thomas Narcejac
Die beiden französischen Autoren Pierre Boileau (1906–1989) und Thomas Narcejac (1908–1998) haben zusammen zahlreiche Kriminalromane verfasst. Ihre nervenzerreißenden Psychothriller haben viele Regisseure zu spannenden Filmen inspiriert, am bekanntesten sind wohl «Die Teuflischen» und sein amerikanisches Remake «Diabolisch» und «Vertigo – Aus dem Reich der Toten», sicher einer der besten Filme von Alfred Hitchcock.
Inhaltsübersicht
I
Hermantier ließ seine dicken, ungeschickten Finger über das perforierte Papier hin- und hergleiten, und seine Lippen bewegten sich; eine Sorgenfalte stand auf seiner Stirn. Von Zeit zu Zeit fing er wieder von vorn an, brummte, drückte seine Finger stärker auf, hielt den Atem an … Was war doch das noch? Er mußte die Fingerspitzen am Ärmel abwischen, weil er dauernd in Schweiß geriet. Und er nahm sein verbissenes Tasten wieder auf. Wieviel Löcher? Zwei oben, zwei unten. Nun? Welcher Buchstabe? Himmel noch mal! Welcher Buchstabe?
Er platzte heraus: «Ich hab’ genug davon, genug, genug! Man soll mich in Ruhe lassen. Ich hab’ das schulpflichtige Alter hinter mir!» Und er knallte das Lesebuch in die Ecke. In plötzlicher Wut ballte er die Fäuste, stieß das Tischchen von sich, stand auf und warf dabei seinen Stuhl um. Hinter ihm fiel etwas um, zerbrach mit dem hellen Klirren von Glasscherben. Schwer atmend, mit einem bösen Zug um den Mund drehte er sich um; er war zu groß, zu unbeholfen in diesem Dunkel voll von zerbrechlichen Gegenständen, die ihn daran hinderten zu gehen und sich zu bewegen. Er fluchte leise und verzweifelt. Niemals würde er das schaffen. Seit zwei Monaten arbeitete er wie ein Vieh. Seine mächtigen Pranken – früher so gewandt, wenn es galt, feine Werkzeuge zu handhaben – schienen alle Geschicklichkeit eingebüßt zu haben, seit sie die rätselhaften Erhöhungen dieser Blindenschrift abtasteten. Und schließlich, wozu? Warum sich so viel Mühe geben? Um imstande zu sein, Die Elenden zu lesen oder Die drei Musketiere? Lesen interessierte ihn nicht. Es hatte ihn nie interessiert. Christiane wußte das sehr wohl. Warum also bestand sie darauf?
Er machte ein paar unsichere Schritte. Mit der Hüfte streifte er ein Möbelstück. Nein, das war der Kamin. Nach einem Monat war er noch nicht imstande, sich in seinem eigenen Zimmer zurechtzufinden. Und da wagte man, vom sechsten Sinn der Blinden zu sprechen!
Einen Augenblick stand er reglos da, eine Hand flach an die Wand gedrückt, wie jemand, der erschöpft ist und sich ausruht; dann ging er mit schleppenden Schritten weiter. Am rechten Bein spürte er die Armlehne des Sessels. Da war das Fenster … Er stand vor dem Fenster, und gewiß war sein Gesicht von Licht überflutet, vielleicht von der Sonne, und doch milderte kein Schimmer die Dunkelheit, in die er versenkt war. Es war nicht einmal Dunkelheit. Es war das Nichts. Früher, wenn er die Augen schloß, wenn er die Handflächen auf die Lider drückte, dann sah er ein Schwarz – ein schönes Schwarz wie ein stockfinsterer Himmel, an dem gleich darauf Sonnen kreisten, Milchstraßen auftauchten, Sternenraketen zersprühten; und er hatte geglaubt, dies sei die Nacht der toten Augen. Jetzt würde er weiß Gott was dafür geben, tief in sich dies imaginäre Sternengewimmel wiederzufinden. Aber da war nichts mehr. Weder Finsternis noch Leere. Jäh hatte er die Umwelt gewechselt. Er war zum Lebewesen einer anderen Gattung geworden; weshalb aber wimmelte es dann in seinem Kopf noch immer von Bildern? Warum war er mit Hilfe seiner Erinnerungen noch immer aufs Schauen versessen? Jetzt sah er hinter dem unsichtbaren Fenster die Rhône, den Hügel von Fourvières … er hätte die Bäume am Kai zählen können. Alles zeichnete sich in seiner Erinnerung mit wunderbarer Deutlichkeit ab. Warum? Kann man denn ein Tier werden, das Gerüche und Geräusche erschnüffelt und erlauscht, wenn man von der Welt derer besessen ist, die sehen?
Mechanisch wischte er die Fensterscheibe ab, die von seinem Atem beschlagen sein mußte. Zehn Uhr. Im Erdgeschoß hatte eben die Uhr des Salons zehn geschlagen. Sie wurden nicht fertig damit, das Auto zu beladen.
«Glauben Sie, das hält?» rief Christiane.
«Lassen Sie das mal meine Sorge sein, Madame», erwiderte Clément.
Noch vor fünf Monaten hätte er sich nicht erlaubt, in diesem Ton zu antworten. Hermantier ging vom Fenster weg und wühlte in seinen Taschen. Wo hatte er nur seine Zigaretten hingesteckt? Eben lagen sie noch neben ihm auf dem Tischchen, als er über seiner Blindenschrift büffelte. Er hatte eine herausgenommen … und dann? Unaufhörlich mußte er sich so fragen … Alles, was nicht mehr griffbereit dalag, war verloren, hatte sich verflüchtigt … Und es gab endlose Grübeleien: ich war dort … ich bin aufgestanden … also … Die Zigaretten lagen vermutlich auf dem Teppich, mit der Blindenschrift hingeworfen. Hermantier ließ sich auf alle viere nieder und versuchte, vor sich herumzutasten. Der große Hermantier, Chef der Hermantier-Werke! Da kroch er, auf der Suche nach einer Zigarette, und von neuem überkam ihn eine schreckliche Wut. Er stieß sich an Tisch- und Stuhlbeinen und hatte sich schon hoffnungslos verirrt; er murmelte heftige Flüche, die ihn demütigten, ohne ihn zu erleichtern. Hinter ihm öffnete sich die Tür.
«Na, was machst du denn da? Oh, die Schale! Du hast sie zerbrochen!»
Er erhob sich, drehte den Kopf ins Ungewisse, in die Richtung, aus der Christianes Stimme kam.
«Macht nichts», sagte er, «ich kaufe eine neue. Warum hast du nicht geklopft?»
«Aber …»
«Hundertmal hab ich schon gesagt, man soll anklopfen, du wie jeder andere … Du willst wissen, warum ich … Du siehst ja: Ich suche meine Zigaretten.»
«Du hättest rufen sollen. Beweg dich nicht, du trittst gleich drauf.»
Das Zigarettenpäckchen wurde ihm in die Hand geschoben. Er roch Christianes Parfum.
«Wo bist du?»
«Hier. Ich hebe die Scherben auf, du könntest dir sonst weh tun. Und die Blindenschrift! Die hast du schön zugerichtet!» Aus ihrer Stimme klang Schmollen, auch Vorwurf, vielleicht sogar Ärger. Hermantier zündete sein Feuerzeug an, näherte es dem Gesicht, fuhr mit der Zigarette auf die Wärme der Flamme zu. Diese Bewegung gelang ihm jetzt fehlerlos.
«Ich will nichts mehr von dieser Blindenschrift hören», sagte er. «Im Werk habe ich Diktaphone, die Sekretäre und hier, zum Donnerwetter, was denn, ich habe ja schließlich noch eine Zunge.»
«Fluch doch nicht immerzu», murmelte Christiane, «du bist nicht geduldig, mein armer Freund. In deinem Zustand …»
«Was denn, in meinem Zustand?»
«Da! Man kann nichts sagen. Gleich ärgerst du dich.»
«Ich ärgere mich, weil ich das Wort nicht mag, Christiane. Mein Zustand … mein Zustand … Wenn man mich in einem Wägelchen spazieren führe, dann würde ich das verstehen. Ist Hubert noch nicht da?»
«Nein.»
«Ach! Der macht mich allmählich wütend.»
Mit dem Zeigefinger schob er den Jackenärmel zurück, um seine Armbanduhr frei zu machen, ließ aber gleich den Arm wieder sinken.
«Willst du mir noch etwas sagen, Christiane?»
«Ja. Es ist wegen der Garage.»
«Gut. Wieviel?»
«Fünfzehntausenddreihundertdreißig.»
«Verdammt. Marescal nimmt’s von den Lebendigen. Hast du die Rechnung?»
«Ja, hier.»
Es trat ein kurzes Schweigen ein, dann seufzte Hermantier.
«Stell den Scheck aus.»
Er zog sein Scheckbuch aus der Gesäßtasche und legte es vor sich hin. Christiane nahm es. Er hörte einen Stuhl knarren, dann kratzte Christianes Füllfederhalter über das Papier.
«Möchtest du unterschreiben?» fragte sie.
Mit langsamen Schritten kam er näher, sie führte seine Hand an den Tisch und schob ihm den Federhalter zwischen die Finger.
«Hier. Nein, etwas tiefer, da, gerade wo du bist.»
Ihre Stimme zitterte ein wenig. Wie wirke ich wohl, grübelte Hermantier. In einem heftigen Zug unterschrieb er.
«Ausgezeichnet», sagte Christiane.
Er war zufrieden, sie in Erstaunen gesetzt zu haben.
«Christiane», murmelte er, «ich bin vorhin vielleicht ein bißchen schroff gewesen. Aber wirklich, du kannst dir nicht vorstellen, wie mir die Blindenschrift auf die Nerven geht. Wenn sie mir nur zu irgend etwas nützlich wäre …»
«Auf dem Lande wird es dir guttun, wenn du dich beschäftigen kannst.»
Inzwischen hatte sie den Platz wieder gewechselt, und es schien ihm lächerlich, wenn er sich an jemanden wendete, der ihm nicht mehr gegenübersaß. Um etwas zu tun, nahm er seine schwarze Brille ab und ließ seine Finger über die zerstörten Augen gleiten.
«Ein Monat, das ist so kurz», sagte er.
«Ein Monat … oder mehr.»
«Aber nein. Es geht mir jetzt durchaus gut. Die Ruhe, die frische Luft … Ich schwöre dir, daß ich am ersten August wieder ins Werk zurückkehre.»
«Das wird der Arzt entscheiden.»
«Es ist bereits entschieden.»
Er setzte seine schwere Hornbrille wieder auf und fuhr fort:
«Hubert ist ein ordentlicher Kerl, ich bin der erste, der das anerkennt, aber es fehlt ihm an Autorität. Er kann mich nicht ersetzen … Und schließlich ist mein Platz im Werk.»
«Einmal könntest du dich doch ein wenig ausruhen.»
«Vier Monate Klinik, ein Monat Rekonvaleszenz und noch einen Monat Ferien … Ich finde, das ist genug Ruhe.»
Es klopfte. «Ja», rief Hermantier, «was ist los?»
«Madame, Monsieur Merville ist da. Er fragt, ob er eintreten darf.»
«Sie haben sich nicht an Madame zu wenden, sondern an mich», sagte Hermantier.
«Sehr wohl, Monsieur.»
«Lassen Sie ihn heraufkommen.»
«Sehr wohl, Monsieur.»
«Dieses Mädchen macht mich rasend», murmelte Hermantier. «Ich wette, für sie existiere ich gar nicht. Wie sieht sie aus?»
«Aber ich hab dir’s ja schon gesagt», antwortete Christiane. «Braun, klein, gewitzt.»
Hermantier versuchte, sich ein Mädchen vorzustellen, das braun, klein und gewitzt war. Das Bild blieb leblos. Es war wie ein Umriß ohne Gestalt und bereit, sich dauernd zu verformen.
«Ich mag dieses Mädchen ganz und gar nicht. Du hättest Blanche behalten sollen.»
«Sie wurde kindisch.»
«Möglich. Aber ich habe mich gut mit ihr verstanden.»
Schnelle Schritte auf dem Gang. Hubert.
«Guten Tag, Christiane.»
Er küßte ihr offenbar die Hand.
«Nun, lieber Freund, wie fühlen Sie sich heute morgen?»
«Danke», sagte Hermantier.
«Nicht zu müde?»
«Warum sollte ich müde sein? Sehe ich vielleicht nicht gut aus?»
«Aber doch, natürlich.»
Seiner Stimme fehlten Natürlichkeit und Wärme. Man hatte stets den Eindruck, als habe er etwas zu verbergen.
«Ich lasse euch allein», sagte Christiane. «Ich denke, daß wir in einer halben Stunde losfahren können. Setzen Sie sich, Hubert. Richard, biete ihm die Zigaretten an.»
Sie warteten, bis sich die Tür geschlossen hatte.
«Nun?» fragte Hermantier. «Haben Sie sie?»
«Ja.»
Hermantier streckte die Hand aus.
«Geben Sie her.»
Er schloß die Finger und befühlte mit seinem Daumen die runde Lampe und die Metallfassung. Er schwieg, und Hubert, der gewöhnlich so redselig war, verharrte ebenfalls in Schweigen. Ein Jahr unermeßlicher Anstrengungen, Forschungen, Versuche im Laboratorium und beträchtlicher Unkosten, um zu diesem Ergebnis zu kommen: zu der neuen Hermantier-Glühbirne!
Beinahe schüchtern fragte Hermantier:
«Brennt sie gut?»
«Sie brennt gut», sagte Hubert. «Sie ist wie natürliches Licht.»
«Drehen Sie sie an.»
«Aber …»
«Das macht nichts. Drehen Sie sie an. Auf dem Nachttisch steht eine Lampe.»
Er hörte Hubert Gegenstände hin- und herrücken, und er kam mit ausgestreckten Händen näher.
«Man kann es so nicht ganz beurteilen», sagte Hubert, «weil die Fensterläden nicht geschlossen sind.»
«Ich versichere Ihnen, das macht nichts», sagte Hermantier langsam. «Brennt sie?»
«Ja.»
Hermantier zog hinter der Brille seine Augenlider zusammen, und mit allen Kräften stellte er sich eine Lampe vor, die leuchtete wie der Tag.
«Was hat sie mir alles angetan», murmelte er. «Wie habe ich arbeiten müssen … Drehen Sie sie aus, Hubert.»
Es klickte.
«Danke. Und nun berichten Sie mir Einzelheiten. Die Sache muß gut gemacht werden, ja?»
«Unsere Vertreter werden etwa in vierzehn Tagen losfahren.»
«Warum nicht in dieser Woche?»
«Es hat keine Eile. Es ist noch nicht mal Juli.»
«Das ist mir egal. Es ist keine Minute zu verlieren. Haben Sie an die Reklame gedacht?»
«Natürlich. Ich habe einen Prospekt vorgesehen, der die charakteristischen Merkmale der Birne und eine Liste ihrer Hauptvorteile enthält.»
«Schlecht. Das wirkt nicht. Machen Sie ein Plakat … Die Birne in die rechte obere Ecke … eine sehr große Birne, die wie eine Sonne strahlt … und unten links … Blumen, ein ganzes Blumenfeld, Heliotrope zum Beispiel, die sich alle zum Licht hinwenden … Wissen Sie, was ich meine? Und Farbe, um Himmels willen! Alle Mauern müssen von ihr erstrahlen! Und dann … finden Sie eine Schlagzeile, die hinhaut, die zieht.»
«Meinen Sie nicht, daß ein Plakat … so ein Plakat … daß es ein bißchen, wie soll ich sagen …»
«Na, sagen Sie’s: vulgär! Aber gerade! Ich will den Bauern auf seinem Hof ansprechen, den Kohlenhändler im Keller seiner Bude, den Nachtwächter in seiner Rumpelkammer. Ich will, daß meine Lampe ebenso populär wird wie die Titelseite von Alice im Wunderland oder La Vache qui rit.»
«Darüber läßt sich streiten», sagte Hubert.
«Aber nein, mein kleiner Hubert. Ich habe recht, das ist ganz klar.»
Die Daumen in der Achselhöhle, trommelte Hermantier sich mit den Fingern auf die Brust und lachte. Er hatte Aschespuren auf der Weste, und sein Anzug war zerknittert, aber er war so groß, so breit, so korpulent, daß solche Nachlässigkeiten einen Teil seiner Persönlichkeit ausmachten und seine Vitalität unterstrichen. Nur die schwarze Brille paßte nicht dazu und sah aus wie eine Verkleidung.
«Arbeiten Sie mir einen kleinen Bericht aus», sagte er. «Wann werden Sie uns besuchen?»
«Wahrscheinlich in zwei Wochen. Ich werde die Feiertage ausnutzen und ein paar Tage Urlaub machen.»
«Gut, dann haben Sie Zeit genug. Kein langes Gerede, nicht wahr! Die Kostenvoranschläge, eine Übersicht über die laufenden Geschäfte und eine Skizze mit einem wirksamen Slogan … Wir werden alle mitsuchen … Veranstalten Sie einen Wettbewerb beim Personal. Ich bin sehr zufrieden, Hubert. Geben Sie mir noch mal diese Birne.»
Er nahm sie in die hohle Hand, sie war noch warm und nicht schwerer als eine Luftblase.
«Darin steckt Zukunft, mein Alter, wenn wir unseren Vorsprung einzuhalten verstehen. Wir werden sie schlagen, glauben Sie’s mir. In sechs Monaten werden Sie mir dankbar sein, daß ich ihnen die Stirn geboten habe. Wir sind stärker als sie, Hubert, merken Sie sich das gut. Gehen Sie nun. Bringen Sie mir drei Dutzend davon mit. Ich will, daß das Landhaus vollständig mit diesen Birnen ausgestattet wird. Oh, ich weiß, was Sie denken. Aber mir macht das Spaß. Und nun: raus! Sie müssen Post unterschreiben und die Abteilungsleiter empfangen, Sie Glüfckspilz! Mich bringt man inzwischen wie einen Kranken in die Vendée. Auf bald, mein kleiner Hubert, ich bin zufrieden, wirklich.»
«Auf bald, lieber Freund, und gute Besserung.»
Hubert ging, und Hermantier hörte Flüstern auf dem Gang.
«Wer redet da», fragte er mit seiner Bärenstimme, die einem immer etwas angst machen konnte.
«Ich.»
«Wer – ich?»
«Marceline, das neue Zimmermädchen.»
«Ja, und?»
«Es ist jemand da, der Monsieur sprechen möchte. Ein Freund von Monsieur.»
«Hat man Ihnen nicht gesagt, daß ich niemand empfangen will?» schrie Hermantier.
«Doch, Monsieur … Nur, der Herr besteht darauf. Monsieur Blèche … Er behauptet, daß …»
«Blèche? Sind Sie sicher? Aber so lassen Sie ihn doch herein, Himmeldonnerwetter!»
Blèche! Na also, das war kein schlechter Tag. Hermantier ging auf die Schwelle zu, stieß sich an der Wand und erreichte die Tür in dem Moment, als Blèche eintrat, so daß sie beinahe zusammengeprallt wären.
«Mein alter Richard», murmelte Blèche bewegt, «mein alter Kamerad.»
«Entschuldige», sagte Hermantier, «du hast mich wohl brüllen hören. Verstehst du, jetzt … Ich will nicht, daß man herkommt, um mich wie ein seltenes Tier zu bewundern. Manche würde das nur sehr freuen. Ich setze keinen Fuß mehr vor die Tür. Aber zu dir!»
«Ich war in Schottland, als ich von deinem Unfall erfuhr. Also ist es wahr, mein armer Richard … Gibt es keine Hoffnung mehr? Hast du wirklich das Augenlicht verloren?»
«Total. Setz dich. Da, schau.»
Hermantier nahm die Brille ab, und Blèche sah die schrecklichen Augen und die genähten Augenlider, die einen rötlichen Strich bildeten. Die Brauen waren versengt, und die Zickzacknarben führten auf Schläfen und Backenknochen zu.
«Oh! – mein armer Freund.»
«Ist es sehr häßlich?» fragte Hermantier. «Ich taste es vergeblich ab, richtig vorstellen kann ich mir’s nicht.»
Blèche preßte seine Hände gegeneinander, und schließlich murmelte er mit möglichst beherrschter Stimme:
«Nein, es ist nicht sehr häßlich … zumal, wenn du die Brille auf hast. Man muß es schon wissen, versichere ich dir. Aber wie ist der Unfall geschehen? Man hat mir von einer Explosion erzählt.»
«Eine Granate», sagte Hermantier. «Du weißt, daß wir in der Vendée ein großes Besitztum haben, an der Küste, bei Marans.
Die Deutschen hatten es während des Krieges besetzt. Sie haben den halben Park wegrasiert und die Mauerreste niedergelegt. Alles, oder beinahe alses mußte wieder aufgebaut werden. Da bin ich denn diesen Winter auf einen Sprung hingefahren, um alles mit dem Bauunternehmer zu regeln: Und ich habe angefangen, selbst anzupacken – du kennst mich ja … Ich hab bei einem alten Blockhaus den Boden bearbeitet. Meine Hacke stieß gegen eine Granate, die sich in die Erde gegraben hatte. Ich weiß nicht, wieso ich nicht ums Leben gekommen bin. Ein Wunder.»
«Du, der du so aktiv warst …» sagte Blèche. «Kannst du dich trotzdem um deine Fabriken kümmern?»
«Bis jetzt hab ich die Dinge ein bißchen schleppen lassen. Die Erschütterung war zu groß. Man zwingt mich sogar, noch einen Monat Ferien zu machen. Hubert vertritt mich.»
«Hubert?»
«Ja, Hubert Merville.»
«Kenn ich nicht.»
«Ja, natürlich. Du warst nicht in Frankreich, als er mein Teilhaber wurde. Das ist bald zwei Jahre her. Die Sache ist ganz einfach. Es war im August 46. Ich brauchte neues Kapital, und Hubert hatte gerade eine beträchtliche Erbschaft gemacht … Oh, er ist kein Genie, aber er hat, unter uns gesagt, gerade das, was ich nie habe lernen können. Er hat Manieren, verstehst du? Er kann reden. Er ist mein Botschafter. Trotzdem habe ich’s eilig, die Sache wieder in die Hand zu bekommen. Um so mehr als das Kartell uns das Leben schwer machen wird. Denn stell dir vor, meine Hauptkonkurrenten haben sich zusammengeschlossen. Sie hofften wohl, mich dabeizuhaben.»
«Und deine Frau? Könnte sie dir nicht helfen?»
«Christiane? Na, du kennst sie ja. Immer Präsidentin von irgendwas, Sekretärin von dem, Schatzmeisterin von jenem. Nein, Christiane ist das, was man eine sehr beschäftigte Frau nennt.»
Hermantier tastete, ergriff die Lehne seines Sessels und setzte sich schwerfällig.
«Es hat sich nichts geändert», murmelte er. «Ich verdiene das Geld, und sie geben’s aus. Mein Bruder … Erinnerst du dich an Maxime?»
«Das entfant terrible! Natürlich. Obgleich es verteufelt lange her ist. Wie geht es ihm? Seinem Herzen? Ihr wart mal schrecklich beunruhigt.»
«Glaubst du, daß man bei ihm irgend etwas wissen kann? Ein Lausbub, ein richtiger Lausbub. Seinen letzten Einfall würdest du nie erraten: er gehört zu einer Jazz-Band. Ja. Er spielt Saxophon. Du kannst dir denken, wie das seine Gesundheit fördert … Christiane kommt aus der Wut nicht heraus. Ein Hanswurst von Schwager … du kannst dir’s ja vorstellen. Und Gilberte, meine Stieftochter, die hat sich auf die Philosophie geworfen. Sie bereitet sich auf ich weiß nicht was für ein Diplom vor. Mit mir redet man nicht über solche Sachen, mit mir nicht, weißt du. Immerhin weiß ich, daß sie sich gerade mit irgendeinem Architekten verlobt hat. Die Ferien verbringt sie bei der Familie dieses Burschen, der natürlich keinen Sou besitzt. Noch einen, den ich mit in meinen Laden nehmen muß … Papa Hermantier hält noch was aus! Und dann wollen sie, daß ich mich obendrein auch noch ausruhe! Sie bilden sich ein, das Werk läuft durch seinen eigenen Schwung weiter.»
«Der Wagen ist fertig», rief Christiane von der Treppe her.
«Ich komme gleich», antwortete Hermantier. «Nein, mein Alter, rühr dich nicht. Sie warten auf mich. Jetzt müssen sie mal warten.»
«Ich freue mich, dich gesehen zu haben», sagte Blèche. «Aberich bin entsetzt, daß ich dich so finde. Mir kommt es so vor, als hättest du das letzte Mal mehr Spannkraft gehabt. Ich meine, wohlverstanden, nicht deine Augen und deine Gesundheit, sondern deine Stimmung.»
«Na! Ich hab’s doch gesagt», seufzte Hermantier, «an seiner Familie hat man immer schwer zu tragen. Und besonders an meiner. Bleib Junggeselle, alter Freund. Und wenn du eines Tages wirklich heiraten willst, dann nimm keine Direktorenwitwe, glaube mir. Vergeblich könntest du das Kapital verdoppeln oder verdreifachen, man würde in dir stets das Mädchen für alles sehen … Aber was machst du? Immer noch im Journalismus?»
«Immer noch. Ich bin hier, um schnell mal Mama zu umarmen, und heute abend fahre ich wieder nach Wien. Das macht einen kaputt, aber ich möchte mit keinem tauschen.»
«Nicht mal mit mir?»
«Nicht einmal das.» Sie lachten.
«Wenn ich denke», scherzte Hermantier, «man hätte uns, als wir in der Rue Sergent-Blandan in die Schule gingen, gesagt, daß du ein hervorragender Journalist werden würdest …»
«Und du ein Industriemagnat!»
«Oh, Magnat! Wir wollen nicht übertreiben. Aber das kommt vielleicht noch. Der Ehrgeiz ist alles, was mir bleibt.»
Unter dem Fenster hörte man hupen.
«Hörst du?» sagte Hermantier. «Sie sind soweit. Dann muß ich bereit sein.»
«Wen nimmst du mit?»
«Meine Frau, das Mädchen und den Chauffeur. Maxime kommt im Laufe der Woche zu uns. Und Hubert wird versuchen, zur 14. Juli-Feier auf einen Sprung zu kommen.»
«Ihr werdet spät ankommen. Wie weit ist es? Mindestens siebenhundert Kilometer!»
«Siebenhundertfünfzig. Aber Clément fährt gut, und der Wagen ist bequem. Ein Buick! Christiane konnte sich mit einem französischen Wagen nicht mehr begnügen. Wir sind heute nachmittag da.»
«Du wirst dich langweilen.»
«Nein. Dort draußen nicht. Ich werde Raum haben und nicht überall anstoßen wie hier. Im Gegenteil, ich glaube, ich werde aufatmen. Und vor allem keine Post, keine Langweiler. Ich weiß nicht mal, ob das Telefon repariert worden ist.»
«Ich mache, daß ich wegkomme», sagte Blèche. «Ich will nicht, daß man dir meinetwegen eine Szene macht.»
«Oh, auf eine Szene mehr kommt’s nicht mehr an. Kommst du bald wieder vorbei? Im September könnten wir zusammen ein kleines Abendessen veranstalten.»
«Im September nicht, aber sicher um Weihnachten. Falls man mich nicht etwa nach Abadan oder nach Hanoi schickt.»
«Du hast Glück. Komm, hilf mir, damit ich mich auf der Treppe nicht hinlege.»
Sie gingen hinaus, langsam den Gang entlang und die ersten Stufen hinunter.
«Sag mir’s ehrlich», fing Hermantier wieder an, «bin ich nicht zu sehr entstellt? Ich frage dich … wegen Christiane …»
Blèche zögerte.
«Das ist schwer zu beurteilen, mein armer Freund. Natürlich kann man es deutlich sehen. Aber es ist nicht … abstoßend, nein.»
«Danke. Und sonst merkst du mir nichts an?»
«Was willst du damit sagen?»
«Ich meine eben … ich weiß nicht … nun, von den Augen und meinem zurechtgeflickten Gesicht abgesehen?»
«Davon abgesehen hast du doch nichts. Warum fragst du?»
«Eine Idee … Ich habe den Eindruck, daß alle mich meiden … daß sie Angst vor mir haben. Ja, das ist es: Angst vor mir. Sie meiden mich, als ob ich ansteckend sei, oder genauer, als hätte ich noch irgend etwas außer meiner Verunstaltung, irgendetwas, was sie nicht ertragen können.»
«Worauf willst du hinaus?»
«Hat meine Frau jetzt eben nicht mit dir gesprochen und dir Verhaltungsmaßregeln gegeben?»
«Ich bin ihr nicht einmal begegnet.»
Sie gingen durch die Diele.
«Entschuldige, Blèche, dir kann ich ja alles sagen. Ich versuche, kräftig und unbekümmert auszusehen, aber ich weiß wohl, daß ich sehr angeschlagen bin, viel mehr, als man glaubt. Dein Besuch hat mir Freude gemacht, weißt du.»
«Mein alter Richard!»
Sie gaben sich die Hand. Hermantier fühlte sich plötzlich elend. Er mochte die Hand, die er zwischen die seinen gepreßt hatte, nicht loslassen.
«Auf Wiedersehen. Besuch mich wieder.»
Er öffnete die Hände und war allein in seiner Nacht.
«Christiane», rief er, «Christiane!»
Das schnelle Klappern von Absätzen hallte wider.
«Endlich ist er gegangen … wie kann man zu dieser Zeit kommen! Marceline, schließen Sie überall ab. Vergessen Sie den elektrischen Zähler nicht! Komm, Richard, nimm das!»
Hermantier tastete das Holzstück ab, das sie in seine Hand gedrückt hatte.
«Was ist denn das?»
«Ein Stock!»
«Ich … einen Stock! Ich kann gut allein gehen.»
Im selben Augenblick mußte er mitten auf dem Trottoir stehenbleiben – er war vollständig verloren. Christiane nahm ihn am Arm, und gehorsam ließ er sich führen. Das Auto fuhr an. Hermantier drückte sich in eine Ecke. Jetzt hatte er Stunden und Stunden vor sich, um nachzudenken, um die gleichen Gedanken wiederzukäuen und zu versuchen, hinter das Geheimnis zu kommen. Was habe ich noch außer meinen toten Augen, grübelte er. Was ist da noch, wovor sie sich alle fürchten? Tausend Einzelheiten ließ er an sich vorüberziehen, winzige, dürftige, aber untrügliche Einzelheiten. Er hielt es nicht länger aus und beugte sich zu Clément.
«Fahren Sie in die Rue Bichat», sagte er, «und setzen Sie mich in Nr. 32 ab.»
«Aber Richard», murmelte Christiane, «wir haben keine Zeit. Und dann … wie würde ich dastehen?»
«Ich steige allein aus. Ich kenne den Weg. Als sie ihren Mann verloren hat, bin ich ein paarmal dagewesen.»
«Aber warum heute?»
«Ich will ihr vor dem Wegfahren auf Wiedersehn sagen. Ich habe die alte Blanche sehr gern gehabt.»
Gegen seinen Willen zitterte seine Stimme vor Gereiztheit. Christiane antwortete nicht. Früher hätte sie sicher geantwortet. Noch so ein Umstand mehr. Das Auto verließ das Zentrum. Man konnte kein Straßenbahnklingeln mehr hören, und der Verkehr schien viel langsamer. Da, zwei Schritte entfernt, war die Rue Bichat mit ihren Bistros, in denen die Angestellten des Güterbahnhofs ihren Apéritif tranken, und die Kinder am Trottoir entlang Himmel und Hölle spielten. Hermantier sah alles deutlich vor sich, aber das Bild war erstarrt wie auf einer Postkarte.
Ein vorsichtiges Bremsen brachte den Buick zum Stehen. Hermantier öffnete den Wagenschlag.
«Monsieur ist genau dem Eingang gegenüber», sagte Clément.
«Ich werde nicht lange bleiben», kündigte Hermantier an.
Das Trottoir war schmal, es war eine Sache von wenigen Schritten, und doch mußte er gegen ein Schwindelgefühl ankämpfen, seine Stirn wurde feucht, und schwach und matt kam er am Eingang an. Er fühlte Stein unter seinen Fingern und bewegte sich langsam vorwärts, die Hand an der Mauer. Der schlimme Augenblick war vorüber. Er tastete die Briefkästen ab, es waren wohl ein Dutzend, und voller Freude hatte er die Mauer wieder. Die Hauptsache war, sich an etwas zu halten und nicht im Leeren zu suchen. Mit dem Fuß fand er mühelos die erste Stufe. Nichts leichter, als eine Treppe hinaufzusteigen. Nicht die geringste Möglichkeit einer Falle. Hermantier machte auf der dritten Etage halt. Die Tür rechts war es. Der Schlüssel steckte, und er erkannte sofort das Getrippel der alten Frau. Halb öffnete er die Tür.
«Hermantier», murmelte er. «Ich bin es, meine gute Blanche.»
«Oh, Sie sind es, Monsieur! Wenn ich das geahnt hätte!»
«Darf ich einen Augenblick reinkommen?»
Sie waren beide gerührt, sprachen gleichzeitig und stießen in der engen Diele aneinander.
«Geben Sie mir die Hand», sagte sie endlich und ließ ihn in einen Raum treten, in dem es nach Wachs und Feuchtigkeit roch. Sie schob ihm einen knarrenden Ledersessel mit abgenutzter Armlehne hin.
«Ich fahre in Urlaub», erklärte Hermantier. «Es geht mir jetzt sehr viel besser. Ich bin ganz außer Gefahr.»
«Ich bin so froh. Monsieur muß wissen, daß ich seinetwegen graue Haare bekommen habe. Man hielt Sie wirklich für verloren.»
«Ja?»
«Jeder, bei Gott. Madame, Monsieur Hubert, Monsieur Maxime … In allen Ecken sprach man davon. Sie versuchten, beruhigt auszusehen, aber ich ließ mich nicht täuschen.»
Hermantier erriet, daß sie sich entfernte und hörte das Geräusch, mit dem sie leise das Fenster schloß. Er griff nach seiner Brieftasche, und ohne zu zählen nahm er ein Bündel Scheine heraus.