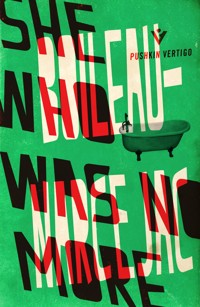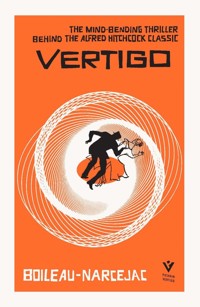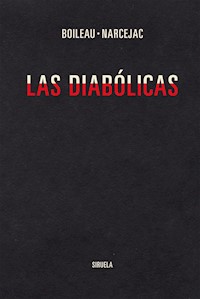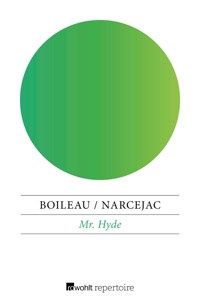9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Mann ringt mit einer jungen Frau um ihr Leben – telefonisch. Er hat in Nizza auf privater Basis Telefonseelsorge eingerichtet, und die Anruferin ist eine von vielen. Er kann ihr die Tat nicht ausreden, aber er kann die Polizei benachrichtigen – so wird Zina gerade noch rechtzeitig gefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Für Fléchelle ist der Fall damit erledigt – seine Aufgabe ist die telefonische Betreuung der Verzweifelten. Nicht aber für Laube, den Versicherungsangestellten aus Genf, der sich ursprünglich aus statistischen Gründen für Fléchelles Aufzeichnungen interessierte. Nun macht er jedoch eine seltsame Erfahrung: Was bisher für ihn ein Posten in einer Zahlenkolonne war, ist plötzlich ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden; Statistik hat sich in Schicksal verwandelt. Laube beschließt, der schönen und rätselhaften Zina zu helfen. Zina macht es ihm nicht leicht, und Laube muß sich mit unendlicher Geduld vortasten. Dabei kommt etwas Beunruhigendes zutage: Seit einigen Jahren scheint das Mädchen vom Unglück verfolgt zu sein. Mehrere Male ist sie um Haaresbreite dem Tode entronnen. Natürlich gibt es immer Unfälle – aber in dieser Häufung? Kann das noch Zufall sein? Die Antwort kann nur in Zinas Vergangenheit zu finden sein, und Laube macht sich auf, diese Vergangenheit zu erforschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Pierre Boileau • Thomas Narcejac
Parfum für eine Selbstmörderin
Aus dem Französischen von Ilka Pollack
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Ein Mann ringt mit einer jungen Frau um ihr Leben – telefonisch. Er hat in Nizza auf privater Basis Telefonseelsorge eingerichtet, und die Anruferin ist eine von vielen. Er kann ihr die Tat nicht ausreden, aber er kann die Polizei benachrichtigen – so wird Zina gerade noch rechtzeitig gefunden und in ein Krankenhaus gebracht.
Für Fléchelle ist der Fall damit erledigt – seine Aufgabe ist die telefonische Betreuung der Verzweifelten. Nicht aber für Laube, den Versicherungsangestellten aus Genf, der sich ursprünglich aus statistischen Gründen für Fléchelles Aufzeichnungen interessierte. Nun macht er jedoch eine seltsame Erfahrung: Was bisher für ihn ein Posten in einer Zahlenkolonne war, ist plötzlich ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden; Statistik hat sich in Schicksal verwandelt. Laube beschließt, der schönen und rätselhaften Zina zu helfen.
Zina macht es ihm nicht leicht, und Laube muß sich mit unendlicher Geduld vortasten. Dabei kommt etwas Beunruhigendes zutage: Seit einigen Jahren scheint das Mädchen vom Unglück verfolgt zu sein. Mehrere Male ist sie um Haaresbreite dem Tode entronnen. Natürlich gibt es immer Unfälle – aber in dieser Häufung? Kann das noch Zufall sein?
Die Antwort kann nur in Zinas Vergangenheit zu finden sein, und Laube macht sich auf, diese Vergangenheit zu erforschen.
Über Pierre Boileau • Thomas Narcejac
Die beiden französischen Autoren Pierre Boileau (1906–1989) und Thomas Narcejac (1908–1998) haben zusammen zahlreiche Kriminalromane verfasst. Ihre nervenzerreißenden Psychothriller haben viele Regisseure zu spannenden Filmen inspiriert, am bekanntesten sind wohl «Die Teuflischen» und sein amerikanisches Remake «Diabolisch» und «Vertigo – Aus dem Reich der Toten», sicher einer der besten Filme von Alfred Hitchcock.
Inhaltsübersicht
Die Hauptpersonen
ZINA MAKOWSKA
wollte Selbstmord begehen und verschweigt den Grund
HERVÉ LAUBE
will ihr helfen und wird unwissentlich in ein Komplott einbezogen
MARIE-ANNE NELLI
will Gutes tun und erfährt Schlechtes
PHILIPPE NELLI
will nichts Böses tun, aber er ist auch nur ein Mensch
FLÉCHELLE
will an Fremden gutmachen, was er an seinem Sohn versäumt hat
COMMISSAIRE BONATTI
will eingreifen und findet keinen Ansatzpunkt
Die Personen dieses Romans sind frei erfunden, und der Ort der Handlung ist willkürlich gewählt. Die Autoren haben sich lediglich die jedem Romanschriftsteller zustehende Freiheit genommen, Erdachtes mit der Wirklichkeit entnommenen, aber frei gestalteten Elementen zu durchsetzen.
Dennoch möchten sie den Einrichtungen ihre Anerkennung aussprechen, die es sich seit einigen Jahren zur Aufgabe gemacht haben, verzweifelten Menschen zu helfen. Sollte es diesem Roman gelingen, nicht nur der Unterhaltung zu dienen, sondern das große Publikum auf die barmherzige Tätigkeit dieser noch so wenig bekannten Gruppe aufmerksam zu machen, so hätte er sein Ziel damit voll erreicht.
«EINGEHÄNGT», SAGTE FLÉCHELLE UND LEGTE GELASSEN DEN HÖRER AUF DIE Gabel zurück.
«Aber wir müssen etwas unternehmen!» drängte Laube. Fléchelle stopfte als Antwort seine Pfeife. Rauchen! Mehr konnte man nicht tun. Laube zündete sich eine Zigarette an.
«Sie spüren sofort, wenn man sich aufregt», fuhr Fléchelle fort, «und dann wagen sie nichts mehr zu sagen. So gehen sie einem verloren. Ich habe lange geglaubt, daß sie Wärme von uns erwarten, Schwung. Keineswegs. Sie erwarten Ruhe, vor allem Ruhe. Natürlich keine Gleichgültigkeit. Sie müssen spüren, daß man ganz einfach ihre Sache in die Hand nimmt, ohne sie zu dramatisieren, ohne sich besonders aufzudrängen. Genau wie ein Arzt, der sich durch den Anblick von Blut nicht aus der Fassung bringen läßt. Sie können mir glauben, jemand, der sich umbringen will» – er stieß zwei bläuliche Rauchwölkchen aus –, «der blutet innerlich und hat Angst. Setzen Sie sich, Monsieur. Die Nacht ist lang. Sogar in dieser Jahreszeit.»
Laube zog seine Jacke aus und hing sie mit einigem Unbehagen hinter die Tür. Es kam ihm hier alles etwas schmuddelig vor. Der Raum schien früher ein Lebensmittelgeschäft gewesen zu sein. Auf den Fliesen konnte man noch sehen, wo die Theke gestanden hatte, und an den Wänden hatten die Regale schwarze Streifen hinterlassen. Außerdem roch es. Ein abgestandener Geruch von überreifem Obst, Gepökeltem und Petroleum. Laube setzte sich neben das Telefon in den Luftzug des Ventilators.
«Glauben Sie, daß sie noch einmal anruft?»
«Nicht ausgeschlossen», entgegnete Fléchelle, «aber erst später, wenn der Verkehr aufhört. Solange noch Autos und Leute auf der Straße zu hören sind, geht es noch. Erst wenn es gegen Morgen ruhig wird, so um zwei Uhr herum, überkommt sie die Verzweiflung.»
Laube sah auf den Wecker, der auf der Schreibtischecke neben Fléchelles Thermosflasche stand. Elf Uhr. Fléchelle rührte sich nicht, aber er atmete so schwer, daß die Stuhllehne knarrte. Wie alt mochte er sein? Sechzig? Siebzig? Ein Phänomen, hatte Marie-Anne Nelli gesagt, er hat alles organisiert und die ersten Freiwilligen ausfindig gemacht. Er ist sehr stolz auf seine Telefonseelsorge. Auf alle anderen Fragen hatte sie Laube geantwortet: Warten Sie ab!
«Ein junges Mädchen?» fragte Laube.
«Ich glaube.»
«Was hat sie genau gesagt?»
«Das Übliche. Daß sie am Ende ist. Daß ihr niemand mehr helfen kann. Die übliche trotzige Klage.»
«Und warum hat sie eingehängt?»
Fléchelle zog ausgiebig an seiner Pfeife. Seine grauen Augen sahen zum Telefon. Er zog die buschigen Brauen hoch. «Vielleicht hatte sie das Gefühl, daß jemand mithört. Sie glauben nicht, wie mißtrauisch die sind. So ähnlich wie Süchtige.»
«Hat sie von einem Hotel aus angerufen?»
«Bestimmt!»
Laube ärgerte sich über Fléchelles Sicherheit. «Sie hätte ja selbst Telefon haben können. Nizza ist in dieser Hinsicht weiter als viele andere Städte.»
Am liebsten hätte er den Satz sofort wieder zurückgenommen, so ungeschickt und pedantisch kam er ihm vor. Was wußte er schon von Selbstmördern? Er besaß nur Zahlen, Statistiken, Prozentsätze. Fléchelle hingegen hatte Kampferfahrung.
«Ich kenne das», sagte Fléchelle nur. «Wer nachts anruft, ist fast immer auf der Durchfahrt. Das sind die schlimmsten Fälle. Wissen Sie, was das heißt, ein Hotelzimmer, Monsieur?»
Laube war pikiert. «Immerhin reise ich schließlich des öfteren.»
Fléchelle sah ihn prüfend an und zog dabei an seiner Pfeife, die ständig ausgehen wollte. «Es gibt solche und solche Hotels. Ich meine nicht die, in denen Sie verkehren.»
«Ich wohne nicht in Palast-Hotels!» protestierte Laube.
«Ich meine die anderen, von denen Sie gar keine Vorstellung haben. Wenn man erst einmal so weit gekommen ist, daß man dort lebt, dann entdeckt man, was Alleinsein bedeutet. Und dann stirbt man. Im allgemeinen können wir da nichts machen. Sie rufen bei uns an. Aus Hohn. Am nächsten Tag bekommen wir Bescheid vom Kommissariat. Es interessiert uns nämlich, mit wem wir es zu tun gehabt haben. Sie brauchen nur in die Kartei zu sehen.» Er zeigte mit dem Pfeifenstiel auf einen weißen Holzschrank.
Neugierig stand Laube auf und öffnete die Schranktür. Er sah Dutzende von sorgfältig aufgereihten Ordnern dort stehen, von denen er einen herausnahm.
LOMBARDI, GINA, 22JAHRE
Die ordentliche, etwas schwerfällige Schrift war ohne Zweifel die von Fléchelle. Der Ordner enthielt Zeitungsausschnitte und Handnotizen. Laube nahm sich vor, alles bis ins kleinste durchzuarbeiten. An einen Bericht war ein Zettel angeheftet; Laube entzifferte die Worte:
Alle haben mich im Stich gelassen –
ich mache Schluß.
Gina
«Wenn sich keine Familienangehörigen melden», erklärte Fléchelle, «nehmen wir Papiere und Briefe an uns für unser Archiv. Schließlich ist Selbstmord eine Krankheit wie jede andere. Vielleicht findet eines Tages jemand beim Studium unserer Unterlagen ein Heilmittel dagegen.»
«Könnte ich diese Unterlagen fotokopieren?» fragte Laube.
Fléchelle zögerte.
«Madame Nelli hat Sie unterrichtet», beharrte Laube. «Ich vertrete eine Gruppe von Versicherungsgesellschaften in Lausanne. Sie können sich denken, warum wir uns für das Problem des Selbstmords interessieren.»
«Wenn Madame Nelli einverstanden ist …» Fléchelle gab nur ungern nach.
«Oder haben Sie etwas dagegen?»
«Nein, natürlich nicht. Aber ich verstehe nicht, was das mit Geld zu tun hat.»
Laube wollte antworten, aber Fléchelle kam ihm zuvor: «Nicht nötig, ich will es nicht wissen. Auf jeden Fall steht fest, daß wir hier mehr Selbstmorde zu verzeichnen haben als anderswo. Ich kann Ihnen meine Kurven zeigen. Ich mache mir nämlich auch meine Aufzeichnungen. Vielleicht nicht sehr wissenschaftlich, aber ganz aufschlußreich. – Kaffee, Monsieur Laube?»
Er schraubte den Becherverschluß der Thermosflasche ab und goß dampfenden Kaffee hinein. «Wirklich nicht? Ich war Zahlmeister bei der Handelsmarine. Zwanzig Jahre lang. Wußten Sie das? Sie können mir glauben, Kaffee macht den Matrosen.» Er kostete vorsichtig.
Laube zählte die Akten. Etwa 450 bis 500. Arbeit für einen guten Monat.
«Haben Sie sich viele Notizen gemacht?» fragte er, «kann ich sie abschreiben?»
«Wenn Sie was damit anfangen können», meinte Fléchelle. «Es sind hauptsächlich Notizen von persönlichem Interesse. Zum Beispiel hier: Südwind. Bei Südwind haben wir immer Selbstmorde. Vor allem die Alten scheinen ihn zu spüren.»
«Rufen die auch an?»
«Fast nie. Sie haben nichts mehr zu sagen. Sie geben einfach auf. Und Schluß!»
«Und wer ruft bei Ihnen an?»
«Frauen. Zu achtzig Prozent. Immer das gleiche Motiv: Liebeskummer. Der Liebhaber läßt sie sitzen, und sie haben kein Geld mehr Oder sie sind in anderen Umständen, und der Mann will sie nicht heiraten. Oder es sind Ältere, und der junge Galan will nichts mehr von ihnen wissen. Das kommt vielleicht am häufigsten vor. Sie können sich nicht vorstellen, wie vielen reiferen Frauen hier die letzten Illusionen vergehen.» Fléchelle tat sich noch ein Stück Zucker in den Kaffee und sah nachdenklich zu, wie es zerging. «Eine komische Stadt», murmelte er. «Ein Dampfer! Genau wie ein großer Liniendampfer. Oben in der ersten Klasse Luxus, Feste, Roben, Juwelen und Katzenjammer am nächsten Morgen. Und dann die Leute, die gezwungenermaßen reisen, und deren sieben Sachen in einem Koffer Platz haben. Und dazwischen die Mannschaft. Stewards, die mit betrunkenen Millionärinnen schlafen, Trimmer, die Koks handeln, und der blinde Passagier, der in einem Laderaum verdurstet. Das Ganze in Lichterglanz und Musik verpackt. Und ein Selbstmordversuch pro Woche.»
«So viele?»
«Ja. Zum Glück schaffen sie es nicht immer. Oft wird Selbstmord begangen, um die anderen aus ihrer Gleichgültigkeit zu reißen und ihnen ein schlechtes Gewissen zu verschaffen.» Fléchelle kam in Fahrt und war so erfüllt von seinem Thema, daß er darüber seinen Kaffee vergaß. Er sah ins Weite wie ein Pianist, der sich von seinen musikalischen Inspirationen mitreißen läßt.
«Einige werden auch von den Nachbarn aufgefischt», fuhr er dann fort, «und wir, wir retten alles in allem jeden Zehnten. Aber die, das kann ich Ihnen schwören, holen wir von sehr weit zurück.»
«Ist den ganzen Tag jemand am Apparat?»
«Natürlich. Volle vierundzwanzig Stunden.»
«Wie viele sind Sie?»
«An die vierzehn.»
«Woher holen Sie sich Ihre Leute?»
Fléchelle lächelte, und Laube merkte, daß er schon wieder ungeschickt gewesen war. «Wir holen unsere Leute nicht. Es kann kommen, wer will. Wir wollen keine Behörde werden.»
«Nehmen Sie jeden x-beliebigen?»
«Wer hierher kömmt, ist kein x-beliebiger. Seine ganze Zeit hergeben heißt, sein Bestes geben. Meine ich wenigstens.» Seine grauen Augen richteten sich auf Laube. Wollten sie sagen, daß Laube vielleicht nicht sein Bestes …
«Wahrscheinlich drücke ich mich nicht richtig aus», sagte Laube, «ich sehe die Dinge von meinem Gesichtspunkt aus, abstrakt sozusagen. Ich habe einen Bericht zu schreiben.»
«Ich verstehe», antwortete Fléchelle mit der gleichen versteckten Ironie. «Allerdings ist es ziemlich schwierig, wenn man unsere Tätigkeit genau und vollständig beschreiben will, von Gefühlen abzusehen.»
«Von welchen Gefühlen, genauer gesagt?»
Fléchelle kniff die Augen zusammen, als bemühe er sich, einen kurzen Schmerz zu unterdrücken. «Ich weiß nicht, wie man das nennt», sagte er schließlich, «ich hoffe, daß Sie das allmählich selber fühlen. Alle, die zu uns kommen, empfinden dasselbe. Leider können wir sie nicht alle dabehalten.»
«Warum nicht?»
Fléchelle zeigte auf das Telefon. «Deswegen! Es gehört eine besondere Stimme dazu. Jemandem, der leidet, hält man die Hand oder den Kopf. Schon die Berührung wirkt beruhigend. Aber wir, wir haben nur unsere Stimme. Wenn die Stimme markant ist, wenn sie zum Beispiel zuviel Akzent oder zuviel Timbre hat oder zu laut ist, zu persönlich, kommt diese Berührung nicht zustande. Sie müssen jemanden hören, der nichts Besonderes ist. Diese Leute stellen Fragen ins Leere, an imaginäre Personen. Im Grunde sprechen sie mit sich selber, wie Gefangene. Die Antwort gibt das Gefängnis mit seinem Echo. Sie können sich nicht vorstellen, wie schwierig es ist, passende Stimmen zu finden.»
Laube hörte verwundert zu. War das eine Marotte von Fléchelle, oder machte er sich über seinen Besucher lustig, diesen Grünschnabel, diesen Vertreter der Bürokratie? «Woher kommen Ihre Mitarbeiter?»
«Aus allen Schichten.»
«Ältere Leute?»
«Nicht unbedingt. Aber die meisten sind Pensionäre. Lehrer, Offiziere, Ingenieure.»
«Auch Frauen?».
«Nein. Ich bin dagegen. Zu gefühlsbetont. Wenn sich jemand umbringen will, darf man ihm vor allem nicht mit Bitten kommen. Dadurch nimmt man ihn zu wichtig.»
«Ich nehme an, daß Ihre Mitarbeiter katholisch sind.»
«Nicht alle. Hier wird nicht gepredigt. Es darf nicht einmal so aussehen, als wolle man urteilen. Hier wird keine Absolution erteilt und nicht behandelt. Wir sind weder Priester noch Ärzte.»
«Dann verstehe ich nicht …»
«Es ist auch schwer zu begreifen. Ich kann selber nicht genau sagen …» Fléchelle schraubte den Becher wieder vorsichtig auf die Flasche.
«Im Grunde», fuhr er fort, «lassen wir das alte Asylrecht wieder aufleben. Man trägt sich mit Selbstmordgedanken, wenn man kein Zuhause mehr hat, wenn man nicht mehr weiß, wo man hingehen soll. Wenn man sich aus der Gemeinschaft ausgestoßen fühlt. Wir sind für sie so eine Art Ersatzgemeinschaft. Wir sind nicht so oder so. Wir haben kein Etikett. Wir sind einfach da. Bei uns ruft man an. Wir antworten. Wir bekommen oft schreckliche Dinge erzählt. Wir hören zu wie Leute, die sich von nichts und nie überraschen lassen. Auch ein Verbrecher hat Anspruch auf unsere Aufmerksamkeit. Jedes lebende Wesen hat einen Anspruch auf Aufmerksamkeit. Das ist zum mindesten meine Meinung. Entschuldigen Sie, Philosophie liegt mir nicht.»
Er hielt Laube, der sich eine Zigarette genommen hatte, sein brennendes Feuerzeug hin, und Laube war sogleich tief gerührt von dieser Geste.
«Ich muß mich entschuldigen», sagte er, «ich habe gedacht, Sie leisten so eine Art Erste Hilfe, wie ein Hilfsposten des Roten Kreuzes. Ich bin in Genf aufgewachsen.»
«Madame Nelli hat es mir erzählt. Das ist kein Nachteil.» Fléchelle lächelte wieder mit einer Art rauher Herzlichkeit, und Laube stellte fest, daß er Lust hatte, zu reden, genau wie die, die bei Fléchelle anriefen.
«Ich komme Ihnen sicher unmenschlich vor mit meinen Karteikarten», sagte er. «Die Pflege menschlicher Beziehungen gehört nicht zum Beruf eines Versicherungsmathematikers.»
«Ich weiß nicht einmal, was das ist», warf Fléchelle ein.
«Meine Arbeit besteht darin, Sterblichkeitstabellen nach Alter, Geschlecht und Beruf aufzustellen, um die Zahlungssätze zu ermitteln. Ich arbeite mit Wahrscheinlichkeiten, die sich aber mit den materiellen Lebensbedingungen verändern. Daher ist es ständig nötig, die verschiedensten Ermittlungen anzustellen.»
«Nicht gerade ein Vergnügen», meinte Fléchelle. «Wenn ich recht verstehe, ermitteln Sie die Wirtschaftlichkeit des Todes.»
«Sozusagen ja. Aber wir beschränken uns nicht auf die Feststellung von Tatsachen. Wir versuchen auch vorzubeugen.»
«Durch Propaganda», sagte Fléchelle, «durch Vorträge, Broschüren. Guter Mann! Menschenliebe ist … Na ja, ich will Sie nicht kränken.»
Laube ging zur Tür und warf einen kurzen Blick auf den menschenleeren Platz. Ein zweifarbiges Auto parkte mit laufendem Motor vor dem Kommissariat nebenan. Die Stadt schlief, beleuchtet wie ein historisches Denkmal. Wo war das Mädchen, das angerufen hatte? Vielleicht hatte sie einen Revolver bei sich oder ein Röhrchen mit Tabletten. Sie wartete, daß die Nacht zu Ende ging. Vielleicht blickte sie in diesem Moment auf die leere Straße oder auf irgendeine von einem Scheinwerfer angestrahlte Palme. Das Lebensgeräusch in ihr wollte noch nicht verstummen.
Laube drehte sich um. Fléchelle hatte einen Arm über die Stuhllehne gelegt, die Beine übereinandergeschlagen und rauchte friedlich. Laube spürte plötzlich ein unerklärbares Schuldgefühl in sich aufsteigen. Er ging schweigend ein paar Schritte auf und ab.
«Nein», murmelte er schließlich, «Sie haben mich nicht gekränkt. Ich kann nichts dafür, daß ich all das nicht kenne.» Er deutete mit einer Armbewegung auf Zimmer, Telefon und Aktenschrank. «Ich hatte das Glück», fuhr er fort, «ein sorgloses Leben geführt zu haben. Ob es glücklich war, ist eine andere Frage. Ich bin finanziell völlig unabhängig. Aber ich wollte etwas Nützliches tun.»
«Davon bin ich überzeugt», sagte Fléchelle höflich.
Laube ballte die Fäuste in der Tasche und nahm seine Wanderung wieder auf. Mit Leuten wie diesem Fléchelle, diesem nüchternen Mystiker, konnte man nicht diskutieren. Asylrecht! Lauter Worte! Eines schönen Tages muß man sich doch wieder auf den Weg machen, und dann erwartet einen am Tor die Einsamkeit. Das Klingeln des Telefons schreckte ihn auf wie ein Gewehrschuß. Das ist sie, dachte er.
Fléchelle nahm ohne Eile ab. «Ja, ich höre Sie sehr gut … Nein, das tut mir leid. Wenden Sie sich an die Feuerwehr … Nein! Ich sagte bereits, damit haben wir nichts zu tun. Bitte sehr.» Er legte auf.
«Wer war das?» fragte Laube.
«Eine Frau, deren Katze auf das Dach geklettert ist. Sie kann sie nicht herunterholen. Das kommt alle Augenblicke vor. Die Leute halten uns für einen Hilfsdienst. Wir werden gebeten, Hunde zu suchen oder für einen Wohnungskauf Ratschläge zu erteilen. Manchmal wenden sich die Leute an uns, als wären wir ein Leserbriefkasten. Ich nehme ständig zu, und mein Verlobter liebt nur schlanke Frauen. Was soll ich tun?» Fléchelle brach in Gelächter aus und war plötzlich nur noch ein alter, etwas gewöhnlicher Mann.
«Denen würde ich etwas anderes erzählen», sagte Laube.
«Auf keinen Fall. Es kommt vor, daß die, die uns wirklich brauchen, uns zuerst ganz abwegige Fragen stellen, um die Lage zu erkunden und sich ein Hintertürchen offenzuhalten. Ich erinnere mich da an einen Fall … Der Anrufer war ein Junge. Er erzählte etwas von seinem Führerschein, den man ihm gestohlen habe. In Wirklichkeit hatte er die Absicht, eine Dummheit zu machen. Wir haben ihn gerade noch aufgefischt.» Fléchelle war wieder ernst geworden. «Bei Jungen», schloß er, «muß man besonders vorsichtig sein.»
Eine Frage ging Laube seit einiger Zeit durch den Kopf. Mit betont gleichgültiger Stimme fragte er: «Würden Sie mir erlauben, das Telefon einmal zu übernehmen?»
«Nein!» Die Antwort kam ohne Zögern.
«Ich habe wohl nicht die richtige Stimme?»
Fléchelle stand auf und fuhr sich mehrmals mit den Fingern durch die kurzgeschorenen weißen Haare. Dann wischte er sich Hals und Ohren mit dem Taschentuch ab, ohne Laube aus den Augen zu lassen. «Sie denken, ich bin ein komischer Alter, nicht wahr?» sagte er. «Ich übertreibe und ziehe vielleicht sogar eine Show ab.»
«Nicht im geringsten!»
«Trotzdem sage ich Ihnen: nein! Sie sind zu jung!»
«Ich bin zweiunddreißig.»
«Monsieur Laube, von Mann zu Mann: Wieviel Frauen hat es in Ihrem Leben gegeben?»
Laube fühlte, wie er rot wurde.
«Sehen Sie», sagte Fléchelle. Er klopfte seine Pfeife vorsichtig über dem Aschenbecher aus. «Bei diesem Spiel», fuhr er fort, «ist guter Wille nicht genug. Man muß schon einiges eingesteckt haben. Und ich will Ihnen etwas sagen …» Er senkte die Stimme, als fürchte er einen unerwünschten Zuhörer: «Man muß sogar selber einmal vor dem Selbstmord gestanden haben. Man muß das selber durchgemacht haben.»
Das Telefon schreckte Laube auf. Warum ließ Fléchelle keine leisere Klingel installieren? Fléchelle setzte sich rittlings auf den Stuhl und griff nach dem Hörer.
«Ja, bitte, ich höre.» Er drehte sich zu Laube um und flüsterte: «Da ist sie wieder.» Gleichzeitig hielt er ihm den zweiten Hörer hin. Von weit entfernt hörte man jemand atmen und dann das Rascheln von Papier.
«Sind Sie allein?» fragte die Stimme. (Wieder der schnelle und unregelmäßige Atem, jetzt so nah, daß Laube ihn zu spüren glaubte.) «Wenn nicht, lege ich auf.»
«Ich bin allein», sagte Fléchelle in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete.
Peinlich berührt setzte sich Laube auf die Tischecke. Die Angst der Unbekannten teilte sich ihm mit. Er preßte den Hörer an das Ohr, daß es schmerzte.
«Kann ich offen reden?»
Es war eine kleine, dünne, etwas zittrige Stimme, die von der Entfernung und der Nacht verschluckt zu werden schien. Fléchelle brachte die Kraft auf, zu lachen, als amüsiere ihn die Frage. Seine Antwort klang, als spräche er zu einem schüchternen Kind, das man ein wenig aufmuntern müsse.
«Natürlich! Sagen Sie mir alles. Alles, was Ihnen gerade einfällt.»
«Schwören Sie, daß niemand bei Ihnen ist?»
Laube wollte schon seinen Hörer weglegen, aber Fléchelle winkte ihm ab. «Wissen Sie, wieviel Uhr es ist?» fragte er. «Die Leute schlafen um diese Zeit. Sie können sprechen. Ich bin der einzige, der Ihnen zuhört, und wenn Sie es wünschen, vergesse ich alles wieder.»
Der Atem ging jetzt stoßweise. «Ich bringe mich um», sagte die Stimme.
Fléchelle schwieg. Es herrschte eine so tiefe Stille, daß das Ticken des Weckers fast unerträglich wurde. Fléchelle hätte protestieren sollen. Laube hatte die richtigen Worte auf der Zunge und bewegte unbewußt die Lippen. Fléchelle wartete. Ein dünner Faden Schweiß rann ihm über die Schläfe.
«Ich bringe mich um.» Eine weitere, nicht endenwollende Sekunde.
«Sie haben Zeit», sagte Fléchelle, als hätte er gerade sorgfältig das Für und Wider erwogen.
Etwas Idiotischeres hätte er kaum sagen können, dachte Laube.
«Ich habe kein Geld mehr», sagte die Stimme, «nichts mehr. Keine Hoffnung mehr.»
Fléchelle hatte die Augen geschlossen. Er ließ die Stille einwirken, und Laube begriff, daß er damit eine Absicht verfolgte: er wollte den Gegner aufhalten, überraschen und aus der Fassung bringen. Er soll ihr das fehlende Geld anbieten, dachte Laube. Ich habe welches. Ich gebe ihm, was er braucht – wenn er bloß etwas sagen wollte, Herrgott, wenn er sich bloß entschließen wollte!
«Wie alt sind Sie?» fragte Fléchelle.
«Dreiundzwanzig.»
«Tragen Sie sich schon lange mit diesem Gedanken?»
Am anderen Ende setzte der Atem aus. Die Frage hatte ins Schwarze getroffen. Dann hörte Laube einen tiefen Seufzer. Er wischte sich die feuchte Hand an der Hose ab.
«Ja», sagte die Stimme.
«Seit wann?»
Die Antwort kam wie ein Schrei aus tiefer Seele. «Seit meiner frühesten Jugend!» Die Unbekannte mußte sich bewegt haben. Etwas Schweres fiel auf einen Teppich. Ein Aschenbecher? Ein Buch? Eine Waffe?
«Aber das interessiert niemanden», schrie die Stimme, «keinen Menschen!»
«Doch! Mich!» entgegnete Fléchelle.
«Wer sind Sie?»
«Ein alter Mann», sagte Fléchelle, wobei er instinktiv den Rücken krümmte. «Ein sehr alter Mann. Ich könnte Ihr Großvater sein.»
Der Atem ging schneller. Laube war es, als ob das Schluchzen am Ende der Leitung in seiner eigenen Kehle aufstieg. In derselben Sekunde hatte die Unbekannte die Verbindung unterbrochen, und Fléchelle legte den Hörer auf, ehe er Laube ansah.
«Glauben Sie …» fragte Laube.
«Nein», sagte Fléchelle, «noch nicht. Aber leicht wird es nicht werden.»
Laube ließ den zweiten Hörer sinken. Seine Hand zitterte. Seine Beine ebenfalls. «Schrecklich», murmelte er.
«Schrecklicher als Sie glauben, Monsieur Laube. Dieses Mädchen will sich wirklich umbringen.»
«Und jetzt?»
«Abwarten!» Fléchelle zog seine Pfeife aus der Tasche.
LAUBE BAND SEINE KRAWATTE AB. DIE STRENGE KORREKTHEIT, DIE ER sich seit jeher auferlegt hatte, dieses ängstliche Bemühen, immer ein makelloses Äußeres zu bewahren, diese allmählich angenommene, manchmal schmerzliche Angewohnheit, sich stets selbst zu beobachten, alles war weggefegt.
«Es muß sich doch herausfinden lassen, woher der Anruf kommt», sagte er.
«Nicht beim Selbstwählverkehr», sagte Fléchelle. «Und selbst angenommen, wir wissen, woher er kommt … Ich gehe hin, frage nach der Zimmernummer. Natürlich will man wissen, warum. Ich antworte, es handelt sich um einen Selbstmordversuch, und schon kann man sehen, welche Wirkung das hat. Der Portier begleitet mich. Wir klopfen an, und eine wütende Stimme im Zimmer schickt uns zum Teufel. Wie stehe ich da! Drei oder vier solche Vorkommnisse, und man läßt uns in kein Hotel mehr. Das ist ganz klar!»
«Ja, aber wenn sich hinter der Tür nichts rührt?» warf Laube ein.
«Dann heißt es, die oder der Betreffende schläft bereits, und ich soll wieder gehen und die Gäste nicht verrückt machen.»
«Sie brauchen doch nur zu sagen, daß man bei Ihnen angerufen hat.»
«Das kann ich nicht beweisen. Außerdem dürfen Sie nicht vergessen, daß Sie hier in einer Touristenstadt sind und daß sich die Durchreisenden oft eigenartig aufführen. Unsere Telefonseelsorge ist geliefert, wenn ich sie zu sehr der Kritik aussetze.»
«Trotzdem muß man etwas tun!» schrie Laube aufgebracht.
«Sicher», sagte Fléchelle, «abwarten!»
Laube wären fast die Nerven durchgegangen. Er nahm sich vor, sich in seinem Bericht Luft zu machen. Er würde die Unfähigkeit dieser Einrichtungen betonen, ihre primitive materielle Organisation, die Gleichgültigkeit der Behörden. Erst einmal mußte mit dieser elenden Dilettantenarbeit Schluß gemacht werden. Eine einzige Telefonleitung, während doch mehrere Verzweifelte gleichzeitig um Hilfe bitten konnten! Er wandte sich wieder Fléchelle zu.
«Und wenn nun jemand anruft und die Leitung eine Stunde lang blockiert? Was wird dann aus dem Mädchen?»
Fléchelle sah Laube unter seinen struppigen Augenbrauen hervor mit diesem durchdringenden Blick an, der so ungemütlich war. «Keine Angst, sie geht uns nicht verloren.»
«Aber stellen Sie sich vor …»
«Meine Vorstellungskraft ist gleich Null.»
«Wenn Sie drei oder vier Anschlüsse hätten!»
«Dann wären wir ein Import-Export-Büro.»
Laube fühlte plötzlich den Drang, an die Luft zu gehen. Zu dieser Stunde ging die Nacht zu Ende, und es kam eine frische Brise vom Meer auf. Vor dem Kommissariat reckte sich ein Polizist in Hemdsärmeln. Von dem ganz in der Nähe gelegenen Blumenmarkt her kam ein bestimmter Geruch wie aus einem Friseurladen. Dabei kenne ich dieses Mädchen gar nicht, dachte Laube. Alkoholiker, Süchtige, Selbstmordkandidaten, alle die Leute, die er als Exzentriker bezeichnete, verursachten ihm einen eigenartigen Ekel. Sie waren schmutzig, gewöhnlich. Die Berührung mit ihnen widerte ihn an. Er band mit peinlicher Genauigkeit seine Krawatte und strich sich die Haare glatt. Er hatte sich abreagiert und ging in den Raum zurück. Fléchelle war bei seiner zweiten Tasse Kaffee.
«Machen Sie sich keine Sorgen, Monsieur Laube», sagte er. «Sie wird schon wieder anrufen. Ich weiß jetzt, woran sie mich erinnert. Vergangenes Jahr hatte ich eine Kleine, 17 Jahre alt. Sie hat uns drei Tage in Atem gehalten. Drei volle Tage.»
«Haben Sie sie gerettet?»
«Natürlich. Ihr Vater hatte wieder geheiratet, und sie war eifersüchtig.»
«Und deswegen …?»
«Deswegen. Eine elende Welt!»
Laube nahm seine Jacke und vergewisserte sich mechanisch, ob alles an seinem Platz war. Taschentuch in der rechten Tasche, Zigaretten und Feuerzeug in der linken. Brieftasche, Kamm im Etui. Er hätte sich verabschieden können. Die Nacht ging zu Ende, und er hatte gesehen, was er wollte. Worauf wartete er noch?
Da er daran gewöhnt war, sich zu beobachten, keine Ausflüchte gelten zu lassen und sich die ungeschminkte Wahrheit zu sagen, mußte er sich eingestehen, daß er wegen Fléchelle blieb. Er wollte sehen, wie Fléchelle die Situation meisterte oder aber versagte. Fléchelles Selbstsicherheit ärgerte ihn. Wenn er, Laube, einmal vor dem Selbstmord gestanden hätte, wäre er bis zum Ende gegangen, ohne Aufschub, ohne diese jämmerlichen Geständnisse, ohne diese Art, sich in aller Öffentlichkeit auszuziehen. Zum Glück würde er nie auf den Gedanken kommen, sich umzubringen. Einen verstümmelten Körper zurückzulassen … undenkbar! Frauen, ja, und dicke Männer wie Fléchelle auch! Die lieben das Theatralische!
Das Telefon unterbrach ihn. Wie unter einem Zwang nahm er den Hörer und erkannte die Stimme sofort, als Fléchelle abnahm.
«Sie brauchen keine Angst zu haben», sagte Fléchelle. «Sie sind nicht allein, mein Kleines. Was ist denn los?»
Sie suchte nach Worten, stammelte, und Laube fragte sich, ob sie nicht schon unter Einfluß eines Schlafmittels stand. Fléchelle hatte ohne Zweifel denselben Eindruck, denn er fragte hastig: «Haben Sie etwas geschluckt?»
«Nein.»
«Wirklich nicht?»
«Wirklich nicht.»
«Dann ist noch nichts verloren. Hören Sie! Sprechen wir einmal vernünftig miteinander. Sie haben kein Geld mehr?»
«Nein.»