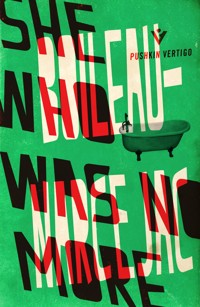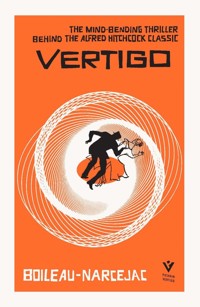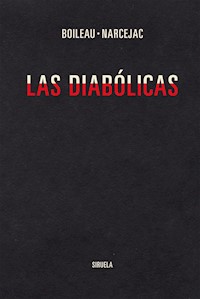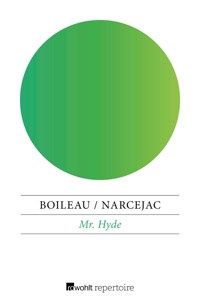9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf Drängen der Mutter entschließt sich die schüchterne und unerfahrene Christine, den netten, aber biederen Bernard zu heiraten. Leider wird die Ehe noch langweiliger, als sie sich das vorgestellt hat. Und so verliebt sie sich Hals über Kopf in den gutaussehenden und interessanten Maler Dominique. Doch dem ist seine Karriere wichtiger als jede Frau. Als ihm in Amerika der große Erfolg winkt, läßt er Christine allein in Paris zurück. Für sie hat das Leben jeden Sinn verloren. Völlig durcheinander, setzt sie sich in die Badewanne und schneidet sich die Pulsadern auf. Im letzten Moment wird sie gerettet. Aber die Grenzerfahrung hat ihr eine neue Lebenskraft verliehen – eine mörderische …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Pierre Boileau • Thomas Narcejac
Im Mord vereint
Aus dem Französischen von Constanze Philippi
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Auf Drängen der Mutter entschließt sich die schüchterne und unerfahrene Christine, den netten, aber biederen Bernard zu heiraten. Leider wird die Ehe noch langweiliger, als sie sich das vorgestellt hat. Und so verliebt sie sich Hals über Kopf in den gutaussehenden und interessanten Maler Dominique.
Doch dem ist seine Karriere wichtiger als jede Frau. Als ihm in Amerika der große Erfolg winkt, läßt er Christine allein in Paris zurück. Für sie hat das Leben jeden Sinn verloren. Völlig durcheinander, setzt sie sich in die Badewanne und schneidet sich die Pulsadern auf. Im letzten Moment wird sie gerettet. Aber die Grenzerfahrung hat ihr eine neue Lebenskraft verliehen – eine mörderische …
Über Pierre Boileau • Thomas Narcejac
Die beiden französischen Autoren Pierre Boileau (1906–1989) und Thomas Narcejac (1908–1998) haben zusammen zahlreiche Kriminalromane verfasst. Ihre nervenzerreißenden Psychothriller haben viele Regisseure zu spannenden Filmen inspiriert, am bekanntesten sind wohl «Die Teuflischen» und sein amerikanisches Remake «Diabolisch» und «Vertigo – Aus dem Reich der Toten», sicher einer der besten Filme von Alfred Hitchcock.
Inhaltsübersicht
Die Hauptpersonen
Christine Vauchelle
macht eine umwerfende Erfahrung
Bernard Vauchelle
liebt seine Briefmarken und Christine
Marthe Roblin
kämpft um ihre Firma
Geneviève Vauchelle
lebt nur für ihren Sohn
Dominique Lapierre
erobert alle
Stéphane Legris
ist genial und naiv
Prince
hat ganz klare Vorlieben
Inspektor Morucci
macht eine verblüffende Entdeckung
Wir bitten unsere Leser, uns Berichte über die Visionen kurz vor dem Tod zu schicken, die sie selbst erlebt haben und die uns für zukünftige Forschungen nützlich sein können.
Dres. Osis und Horaldsson
Ich hätte es nicht gewagt, diesen langen (zu langen) Bericht zu schreiben, wenn die Zeilen, die ich zitiert habe, mir nicht zufällig unter die Augen gekommen wären. Aber ist es wirklich ein Zufall? … Wie dem auch sei, bevor ich Zeugnis ablege, muß ich einiges über mich selbst sagen, um – wenn möglich – zu beweisen, daß ich niemals aufgehört habe, mir Fragen zu stellen, zu zweifeln, vernünftige Erklärungen für Tatsachen zu suchen, die so wenig vernünftig sind. Ich möchte hinzufügen, daß ich diese Tatsachen niemandem anvertraut habe, nicht einmal meiner armen Mutter, so unwahrscheinlich sind sie auf den ersten Blick.
Schließlich muß ich noch bekennen, daß ich nicht schreiben kann; ich meine, nicht so schreiben wie ein Schriftsteller. Ich wiederhole, daß es sich hier um einen Bericht handelt, so nüchtern und sachlich wie ein Protokoll sein soll. Ich kann nichts dafür, daß ich nicht Stunden, sondern Tage, und vielleicht Monate, erlebt habe, die schrecklich waren, und wenn meine Empfindungen sich in meine Darstellung der Ereignisse einschleichen. Man muß versuchen, die ersteren zu verstehen, wenn man die Bedeutung der letzteren ermessen will.
Ich heiße Christine Vauchelle, geborene Roblin. Ich bin sechsundzwanzig Jahre alt. Ich wohne in der Nähe der Gare Saint-Lazare, Rue de Chateaudun, wo mein Mann, Briefmarkenhändler von Beruf, sein Geschäft hat. Seine Mutter, Geneviève Vauchelle, ist Witwe und lebt bei uns. Auch meine Mutter ist Witwe. Im übrigen erscheinen alle diese Einzelheiten sicherlich in einer Akte der Kriminalpolizei. Ich kann daher in diesem Bericht auf überflüssige Informationen verzichten. Ich werde sie nach und nach einfließen lassen, wenn sie für die Verständlichkeit meiner Darstellung notwendig erscheinen. Wenn jemand sich für meinen Fall interessiert, braucht er nur die Akte Vauchelle einzusehen.
Noch etwas. Mir wurde immer gesagt, ich sei sehr schön. An der Sorbonne, wo ich mich ohne große Begeisterung auf ein Diplom für klassische Literatur vorbereitete, war ich immer von einem Schwarm geiler männlicher Wesen umgeben; ich finde kein anderes Wort. Es machte mir Spaß, aber ich war von Natur reserviert und hätte mich gehütet, sie zu ermutigen. Sinnlichkeit war nicht meine Stärke. Dafür war ich schrecklich sentimental. Ich wartete auf die große Liebe. Ja, das hört sich naiv an, aber ich war ganz einfach naiv. Wie war bloß diese Mischung aus literarischer Bildung und frustrierter Einfalt möglich? Ich las mit gleichem Interesse «Hamlet» und Filmromane. In meinem Zimmer hingen nebeneinander die Fotos von Paul Valéry und Gary Cooper. Offengestanden, ich hatte keine Lust zu arbeiten, und ich langweilte mich unsäglich. Wie konnte ich mich unter diesen Bedingungen auf eine Heirat einlassen?
Ich war unabhängig und auf meine Freiheit erpicht. Meine Mutter verdiente gut. Ich hatte eine Menge gute Freundinnen. Wirklich, ich verstehe es nicht. Oder ich sehe vielmehr nur eine Erklärung: die tief verwurzelte Gleichgültigkeit, die mich jedem Tag mit einem Gefühl von Trägheit und Resignation entgegensehen ließ. Ich kannte Bernard Vauchelle gut. Er amüsierte Mama und mich durch seine verschrobene Art, er war förmlich und machte ständig Komplimente. Man hatte immer den Eindruck, er reibe sich die Hände, wenn er sich mit wohlgesetzten Worten an meine Mutter wandte. «Er geht mir ganz schön auf die Nerven», seufzte Mama, «aber er ist ein guter Junge, und für seine schlechte Erziehung kann er nichts.» Ich muß hier anmerken, daß seine und meine Mutter sich wenig mochten, obgleich sie sich mit allen Zeichen der Freundschaft überschütteten. Sie waren Spiel- und Klassenkameradinnen gewesen und später Arbeitskolleginnen, als sie Sekretärinnen bei der Firma Vauchelle et Roblin wurden. Und wie es nicht nur in Romanen, sondern auch im Leben häufig vorkommt, aus den Sekretärinnen wurden Ehefrauen; die eine Geneviève Vauchelle, und die andere Marthe Roblin. Aber Vauchelle, der sehr viel älter war als seine Frau, hatte einen großen Sohn aus erster Ehe, nämlich Bernard. Ich sage es lieber gleich, Bernard war einundfünfzig Jahre alt, als wir heirateten.
Wir paßten denkbar schlecht zueinander, aber meine Mutter, die nach dem Tod meines Vaters die Firma Roblin leitete und mit Arbeit überhäuft war, wollte mich, wie sie es ausdrückte, «versorgt» wissen, und Geneviève Vauchelle, Hauptaktionärin der Firma, betrübte es, ihren Sohn als Junggesellen alt werden zu sehen. So wurden Bernard meine Vorzüge immer wieder gepriesen und umgekehrt. Bernard war ziemlich häßlich, aber arbeitsam, reich und was weiß ich noch. Es nützte nichts, daß ich meiner Mutter entgegenhielt, der Briefmarkenhandel sei kein Beruf.
«Es gibt wichtigere Dinge im Leben», antwortete sie. «Das Wichtigste ist der Charakter. Zugegeben, Bernard ist verschroben. Aber er ist ein sanfter, netter, gefälliger Mann, der es im Leben nicht immer gut hatte. Sein Vater war ein Schürzenjäger. Seine Mutter brannte mit einem Amerikaner durch. Zum Glück war Geneviève da. Ihr hatte er es zu verdanken, daß er bis zum Tod von Vauchelle ein Zuhause hatte. Aber es ist schließlich normal, daß er jetzt daran denkt, eine Familie zu gründen. Und er liebt dich.»
«Hat er dir das gesagt?»
«Er nicht. Das würde er sich nicht trauen. Aber Geneviève.»
«Aber ich liebe ihn nicht.»
«Weil du ihn zu wenig kennst. Und außerdem Liebe, Liebe, du redest ständig von Liebe. Wenn du so viel zu tun hättest wie ich, würdest du einsehen, daß die Liebe zwar sehr schön ist, sich aber schneller abnutzt als alles andere.»
«Was ist alles andere?»
Sie sagte es nicht, aber es war leicht zu erraten. Alles andere war für sie Erfolg, Macht, der Stolz, die Beste zu sein. Sie war die geborene Herrscherin.
«Und», fügte sie manchmal in scherzhaftem Ton hinzu, «wenn man sich bei einem Ehemann langweilt, dann nimmt man sich einen Liebhaber.»
Und sie lachte schallend, um deutlich zu machen, daß es nur ein Scherz war. Sie schockierte gern, durch derbe Redensarten und gewollte Taktlosigkeiten, die sie für ein männliches Privileg hielt. Sie wußte, daß ihre Arbeiter sich hinter ihrem Rücken lustig machten und murmelten: «Was für eine Type!» Ich verabscheute dieses Gehabe, und wenn ich mich nach und nach an den Gedanken gewöhnte, eines Tages Madame Vauchelle zu sein, dann vor allem, weil ich es leid war, zu Hause in einer Art ständiger Unruhe zu leben. Meine Mutter hatte einen sehr schönen Salon, aber es waren immer Besucher da, die Sorte mit Aktenkoffer, die Zigarre rauchen und Whisky trinken und darauf warten, empfangen zu werden, während im Büro der Sekretärin eine Schreibmaschine klappert und das Telefon klingelt. Sagte ich es schon? Die Bilder, die mein Vater für teures Geld gekauft hatte – er verstand nichts davon und ließ sich leicht übers Ohr hauen – waren durch Poster an den Wänden ersetzt worden, auf denen Katamarane und Trimarane dargestellt waren, kurz alle Luxusboote, die in Antibes das Ansehen der Firma Roblin begründet hatten.
Und ich gebe zu, der Anblick war erstaunlich. Gewiß verursachten mir diese über das Wasser fliegenden Spinnen ein unüberwindliches Unbehagen, andererseits fesselten die gewaltige Takelage und die riesig geblähten Spinnaker das Auge durch eine Art urwüchsiger Poesie, und wenn ich durch den Salon ging, der mehr und mehr einem Wartezimmer glich, dachte ich immer: «Bin ich wirklich eine Roblin? Ich, die Stille und Frieden so sehr liebt!»
Diese Einzelheit ist von Bedeutung, und es gibt im übrigen in diesem Bericht keine überflüssige Einzelheit. Hätte ich ein Zuhause gehabt, das meinen Wünschen entsprach, ich hätte nie ein Auge auf Bernard geworfen. Aber was mir an ihm gefiel, war – wie soll ich es sagen? – es war das Verschlossene, fast Verhuschte an ihm. Er war klein, schlank, gediegen. Immer in schwarzen Samt gekleidet, mit einer Fliege als hellerem Tupfer, bewegte er sich geräuschlos auf dem dicken, grauen Teppichboden seines geräumigen Büros. Seine Finger trommelten auf den Rücken seiner Ordner, und vorsichtig zeigte er eine Briefmarke unter Zellophan, die er nur von weitem sehen ließ, als hätte sein Besucher eine ansteckende Krankheit. Er verkündete respektvoll: «Der Regenbogen von Couzinet, die braun und blaue Mauritius. Sie ist sehr teuer. Ich habe sie einem befreundeten Chirurgen versprochen. Aber hier eine andere, die zu haben ist. Republik Mali, gezahnt. Die Santa Maria, ein schwarz-blau-rotes Exemplar von besonderer Schönheit.»
Er sprach über seine Briefmarken nicht wie ein Händler, sondern eher wie ein Maler, den der Gedanke quält, sich von seinen Bildern zu trennen. Er rieb sich wieder die Hände, und von Ferne beobachtete ihn sein Kater, der auf dem Schreibtisch saß. Er war ganz schwarz, nur auf der Brust hatte er einige weiße Haare. Er schien ein Ebenbild von Bernard zu sein, so als hätte die Natur nach der Erschaffung des Mannes noch etwas übrig gehabt und zum Spaß dieses kleine, beunruhigende Double hervorgebracht.
Schwere Vorhänge waren ständig vor die Fenster gezogen. Nur die Deckenlampe beleuchtete das Zimmer, in dem zwei Clubsessel wie ein aufmerksames Publikum vor dem Schreibtisch standen. Keine Aschenbecher; ein graues Telefon, Pinzetten, Lupen, ein Katalog. Alles war gedämpft, die Außenwelt drang nur in Form der bunten Bilder hier ein, deren Preis nur mit leiser Stimme genannt wurde. Ich schwöre, daß ich nicht übertreibe. Bernard Vauchelle war einer jener Spezialisten, vergleichbar den Diamantenhändlern, die in Amsterdam, in London, in New York über die Edelsteine herrschen, aber damals wußte ich das nicht.
Ich fand ihn ein bißchen lächerlich mit seiner Manie, die Türdrücker abzuwischen, wenn er aus seinem Refugium herauskam. In den Taschen hatte er einen Vorrat an Kleenex-Tüchern. Schnell und fast verschämt rieb er die Klinke, dann zerknüllte er das Papier und warf es zur Freude von Prince hinter sich. Und Prince sprang auf, schlug nach der Kugel, biß hinein, ließ sie vor sich herlaufen, legte sich darauf, oder er sprang mit allen vier Pfoten in die Luft oder näherte sich ihr schräg mit gebuckeltem Rücken, den Schwanz hochgestellt, die Zähne gefletscht, mit mörderischer Miene. Bernard machte seine Besucher auf ihn aufmerksam. «Er spielt gern. Mögen Sie Katzen?» Sie sagten aus Höflichkeit ja. Auch ich sagte ja, und doch fürchtete ich mich vor Prince. Auf der Ecke des Schreibtisches sitzend, den Schwanz graziös an die Pfoten gelegt, musterte er mich mit eisiger Gleichgültigkeit, und da ich die Augen nicht senkte, schloß er langsam die Pupillen, so daß nur ein stechender grüner Blick übrigblieb.
Ich war der Eindringling. Lange vor mir hatte er gespürt, daß ich in seine Domäne eindringen würde. Auf Bitten von Bernard kam ich recht häufig, um mich um seine Post zu kümmern, denn er schrieb ungern, aber in erster Linie war es ein Vorwand, damit ich zu ihm kam. Schließlich entließ er, übrigens aus einem fadenscheinigen Grund, seine Sekretärin. Beschäftigungslos, von meiner Mutter angetrieben, von Madame Vauchelle ermuntert – wenn auch etwas zögernd –, nahm ich das Angebot von Bernard unter zwei Bedingungen an: ich würde ihm unentgeltlich helfen und außerdem nur vorübergehend. So könnte ich jederzeit wieder aufhören.
Er sagte zu allem ja. Ich sah nichts kommen. Zweimal in der Woche, dienstags und freitags, saß ich in einem kleinen Raum neben dem Büro und erledigte die Post, wozu mir ein Tonband die Anweisungen lieferte. Manchmal rief Bernard mich, um mich einem wichtigen Kunden vorzustellen, als wollte er mich enger an seine Arbeit binden, und ich erriet schnell, daß er stolz auf mich war, auf meine Schönheit (man verzeihe mir den Ausdruck), auf meine Art, mich zu kleiden, immer sehr schlicht, aber mit einer natürlichen Eleganz, die ich von meinem Vater hatte.
Er nahm sich heraus, mich vor seinen Besuchern «Christine» zu nennen, in einem vertraulichen Ton, der Bettgeheimnisse anzudeuten schien, und das war der Anlaß für unseren ersten Streit. Er brach aus, als Dominique dagewesen war.
«Ich kann Sie aber doch nicht immerzu Mademoiselle Roblin nennen», entschuldigte er sich.
«Gut», sagte ich, «wenn Sie in Gegenwart von Dritten mit mir sprechen, reden Sie mich eben nicht an. Oder nennen Sie mich meine Mitarbeiterin.»
Prince, der graziös seine kleine runde Pfote leckte, hörte diskret zu, aber ich bin fast sicher, daß er aufsah, als Bernard, der seinerseits nie etwas erriet, «Monsieur Dominique Lapierre» ankündigte.
Auch ich hatte keine Vorahnung. Sicher, Dominique sah gut aus. Er war jung, gut angezogen, blond, wie man sich die Wikinger in der Sage vorstellt, mit gepflegten Manieren, aber was soll’s, auch er sammelte Briefmarken, und das schien mir für einen freien Menschen eine unwürdige Beschäftigung. Ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Auch Bernard beschäftigte sich mit Briefmarken, aber er verbrachte nicht die Zeit damit, sie in Alben zu kleben. Dominique tat es; er war wirklich Sammler. Abends saß er sicher mit der Lupe über seine Marken gebeugt und zählte ihre Zähne, warum auch nicht? Ich konnte ihn mir so gut am Steuer eines Porsche vorstellen, und was tat er statt dessen: Er verfiel in diese Manie alter Leute und saß mit angehaltenem Atem da, um die wertvollen Bilder nicht zu beschädigen.
Enttäuscht und irritiert ging ich in mein Büro zurück. Warum enttäuscht? Warum irritiert? Dummköpfe sprechen von Liebe auf den ersten Blick. Dabei sollte jeder wissen, wie Viren wirken. Sie verkapseln sich in einer Zelle, gewinnen dort sehr langsam an Kraft oder sterben ab. Das Wichtige für sie ist, daß sie das Land der Verheißung gefunden haben, sich dort niederlassen und es in Besitz nehmen. Der Virus «Dominique» sollte eines Tages Christine verzehren, bis nur noch ein paar Knochen von ihr übrig blieben, wie man sie im Wüstensand verstreut findet.
Und eben das wäre beinahe eingetroffen. Aber inzwischen hatte ich Bernard geheiratet. «Inzwischen», das bedeutet Wochen und sogar Monate, die wir vis-à-vis und Seite an Seite verbrachten, in denen wir sogar Emotionen teilten, denn ich verfolgte mit großem Interesse einige besonders delikate Verhandlungen und fieberte schließlich wie ein Fan bei einem Match.
Einmal hatten wir eine überdruckte «Vietnam»-Marke zum 30. Jahrestag der Schlacht um Diên Bièn Phu. Sie war gezahnt und vielfarbig. Ho Chi Minh und sein Stab waren auf ihr dargestellt. Die Verkaufsverhandlungen waren sehr aufregend, und ich hatte Gelegenheit, an Bernard Geduld, Kaltblütigkeit und Entschlossenheit festzustellen, Eigenschaften, die ich ihm nie zugetraut hätte. Zum Dank spendierte er mir ein tolles Abendessen. Warum hätte ich ablehnen sollen? Und warum hätte ich verstimmt sein sollen, als ich am Morgen neben meinem Telefon einen Strauß Rosen fand? Ich ließ mich im Lauf der Zeit einfangen, aber ich sagte zu Mama:
«Zugegeben. Er gewinnt bei näherer Bekanntschaft. Aber ich werde mich nie an seine Marotten gewöhnen. Kannst du mir erklären, warum er immer an irgend etwas herumwischt? Selbst bei seinen besten Kunden wischt er alles ab, was sie angefaßt haben.»
«Und wenn ihr ins Restaurant geht?»
«Das gleiche. Er muß wischen. Und weißt du, was er mir geantwortet hat? Was er in der Hand hat, ist sein, sogar ein Besteck oder eine Serviette. Die Fingerabdrücke der anderen flößen ihm Abscheu ein.»
«Und bei dir?»
«Nun ja, ich glaube, wenn ich gegangen bin, wischt er meinen Tisch, meine Schreibmaschine und meinen Notizblock mit Kleenex ab.»
Mama amüsierte sich sehr.
«Dein Bernard ist reizend. Worüber beklagst du dich? Er raucht nicht. Er trinkt nicht. Er hat keine Weibergeschichten»
«Davon weiß ich nichts. Ich spioniere ihm nicht nach.»
Mama lachte auf.
«Es wäre zu komisch, ein Schürzenjäger mit Kleenex. Nein, Kleines, glaub mir. Die kleinen Marotten schützen vor den großen Anfechtungen. Der Junge ist in Ordnung. Sei nett zu ihm.»
Ich tat es, und es machte mir immer weniger Mühe. Ich wartete auf den Augenblick, wo er sich über mich beugen, mich küssen, sich mir endlich erklären würde, denn ich spürte, daß er sich immer mehr angezogen fühlte, und dieses Versteckspiel nahm mich ganz gefangen und reichte aus, die Leere meines Lebens zu füllen. Es gelang mir nicht zu erkennen, ob dieses ständige Sichkümmern Liebe war, in Wahrheit war ich eine jener jungen Frauen, die sich frei glauben und die … Ich bitte um Verzeihung. Nur keine Theorie. Es ist nur wichtig zu wissen, daß ich an Bernards Mutter keinerlei heimliche Feindseligkeiten entdeckte. Was die beiden sprachen, wenn ich nicht da war, weiß ich nicht. Aber ich denke, daß sie ihn ermutigte, sei es auch nur aus Gründen der Konvention, denn Konventionen ersetzten ihr Moral und Religion. Und da sie – ganz im Gegenteil zu meiner Mutter – viel ausging und Besuch hatte, begann sie natürlich, sich vor Gerede zu fürchten. Kurz, schon halb bereit, war ich wie ein Vogel, den die Katze holen wird.
Hier muß ich einflechten, daß Bernard das Einverständnis seiner Mutter nicht reichte. Er brauchte auch das von Prince. So wagte ich die ersten Annäherungsversuche. Ich streichelte ihn zwischen den Ohren und kraulte ihn unter dem Kinn. Er lehnte nicht ab, verweigerte mir aber jedes zufriedene Schnurren. Er sah nur seinen Herrn an und schien ihm zuzuflüstern: «Das alles tue ich für dich. Wenn nur ihr Nagellack besser riechen würde!» Er gähnte, miaute herzerweichend und sprang auf den Boden. Bernard lächelte.
«Verzeihen Sie ihm», sagte er. «Wir beide sind eingefleischte Junggesellen.»
Er konzentrierte sich, bevor er fortfuhr:
«Was mich betrifft, so hängt es nur von Ihnen ab.»
Das war sein Heiratsantrag.
Ich verstand nicht gleich. Da zog er ein Etui aus der Tasche, öffnete es mit zittrigen Fingern und zeigte mir einen Ring, der feurig glänzte.
«Für Sie», sagte er mit erstickter Stimme.
Er wagte nicht, ihn mir an den Finger zu stecken. Ich war es, die ihn sich plötzlich begehrlich auf den Ringfinger schob, und wir standen uns mit angehaltenem Atem gegenüber.
«Wollen Sie?» sagte er schließlich.
Er zog mich an sich und verpatzte seinen ersten Kuß auf meine Lippen; denn unsere Nasen stießen aneinander. «Oh! Pardon!» sagte er und ließ mich los; das rettete uns. Wir brachen in Lachen aus.
In diesem Moment begann ich, ihn zu lieben … Weil er so linkisch war, so schüchtern, so großmütig und ganz einfach, weil er es war, und er begann, mir zu gefallen. Ich ergriff die Initiative zu einem richtigen Kuß, die Arme um seinen Hals geschlungen, die linke Hand hinter seinem Nacken ausgestreckt, und wurde nicht müde, den Rubin zu betrachten, der sein Feuer versprühte, wie eine magische Blume von Blütenblättern aus Diamanten umgeben. Er war es, der sich löste, und als wir uns trennten, sagte er noch etwas Rührendes:
«Verzeihen Sie, Christine; ich bin es nicht gewöhnt.»
Oh! Mir war klar, daß er Frauen und Zärtlichkeiten nicht gewöhnt war! Er sah mich hingerissen an.
«Ich bin so glücklich», sagte er. «Ich werde es Mama sagen.»
Aber ich will unsere Verlobung nicht beschreiben. Ich merke nur an, daß Madame Vauchelle sich damit begnügte, den Kopf zu schütteln und dabei meinen Ring anzusehen, während meine Mutter etwas später einen kleinen, ergriffenen Schrei ausstieß, als sie den Stein aus der Nähe betrachtete und ausrief: «Sieben oder acht Millionen. Ich kenne mich aus!»
Die Dinge nahmen ihren Lauf, und ich aß mittags fast täglich mit Bernard in einem Restaurant in der Nähe der Gare Saint-Lazare. Dort lernte ich ihn besser kennen, sein Gesicht wurde mir vertraut. Seine Schläfen lichteten sich; wenn er lächelte, furchten Krähenfüße seine Augenwinkel. Er war sehr dunkelhaarig, und sein Kummer war ein Bart, der die Backen bläulich färbte und sich jedem Rasierer zu widersetzen schien.
Bei der Arbeit trug er eine Brille, eine auf der Nase zum Prüfen der Briefmarken, eine zweite für die Ferne in der Brusttasche. Eines Tages, als er Zucker in seinen Kaffee tat, drei Stücke, und eine Tüte mit Gebäckkrümeln für Prince einsteckte, fragte er mich:
«Sie finden mich wohl alt?»
Verlegen protestierte ich: «Aber nein, ganz und gar nicht», und fügte hinzu: «Schau, Bernard, sollten wir uns nicht duzen?»
Er wurde rot, faßte hektisch meine Hand auf dem Tisch, und ich begriff, daß er meine Absicht mißverstand. Das Du war für ihn das Sakrament der Ehe. Meine Frage machte ihn verlegen und schien ihm gleichzeitig zukünftige Wollust zu versprechen.
«Danke», sagte er. «Sie sind …, du bist …»
Das Weitere hörte ich nicht, so sehr erstaunte mich sein Gefühlsausbruch. Wirklich ein seltsamer kleiner Mann, an den ich mich für immer binden würde. Wir gingen hinaus. Er nahm meinen Arm, wie es von jetzt an seine Gewohnheit wurde, aber an der Art, wie er ein bißchen zurückblieb, merkte ich, daß er etwas sagen wollte und nicht wußte wie. Langsam bewegten wir uns in der Menge vorwärts, die zu jeder Tageszeit auf den Bahnhof zustrebt. Der Ort war für den Austausch von Vertraulichkeiten ungeeignet. Aber gerade das bewog ihn zu sprechen. Er hielt mich zurück, und mit abgewandtem Blick fragte er:
«Vor mir? Hat es da andere gegeben?»
Ich erinnere mich, daß wir wenige Schritte von einem Blumengeschäft entfernt waren. Ein Lehrmädchen begoß Geranien, und ein Aushängeschild empfahl: «Sag es mit Blumen». Armer Bernard! Ohne Zögern log ich. Warum ihm mit dem Eingeständnis einiger Flirts ohne Folgen Kummer bereiten?
«Natürlich nicht!»
Er beharrte fast boshaft:
«Sag nicht, daß du auf mich gewartet hast.»
Dann faßte er sich wieder, zog mich in den Laden und kaufte mir einen großen Strauß Rosen.
«Sogar am hellichten Tag habe ich manchmal Alpträume», flüsterte er, und es sollte scherzhaft klingen. «Es ist, weil, weißt du, ich …»
Es kam häufig vor, daß er seine Sätze nicht beendete. Diesmal ergänzte ich mühelos: ich liebe dich. Aber er sprach es nie aus. Er war so verschwiegen wie seine Katze. Und wahrscheinlich auch so eifersüchtig, wie ich aus manchem feindseligen Schweigen erriet. Zum Beispiel konnte er Stéphane nicht ausstehen.
Ich wollte erst später von Stéphane sprechen, der eine wichtige Rolle in diesem Bericht spielt. Aber, da er mir an dieser Stelle in den Sinn kommt, kann ich ihn auch gleich vorstellen.
Stéphane Legris, vierunddreißig Jahre alt, recht gut aussehend, unverheiratet, ehrgeizig, diplomierter Architekt und ein großer Segelspezialist. Ich möchte sagen, er war im Schiffbau das, was Saint-Laurent in der Haute Couture ist. Er entwarf Schiffe, wie man ein Kleid entwirft. In der kleinen Welt der Sportboote genoß er großes Ansehen. Er arbeitete seit mehreren Jahren für meine Mutter oder vielmehr, er bediente sich ihrer, um immer weiter und höher hinaufzukommen. Alle wußten, daß die Werft Roblin eigentlich er war. Das ging soweit, daß man einen Trimaran oder ein einschaliges Boot einen «Legris» nannte, wie man von einem Lancia oder einem Alfa Romeo spricht.
Er war der Stolz und der Kummer meiner Mutter. Bei jeder Gelegenheit stritten sie sich schrecklich. Er wagte es, sie eine «Krämerseele» und «armselige Spießbürgerin» zu nennen, und sie konterte damit, daß sie gewisse, zu aufwendige Projekte ablehnte, aber sie brauchten sich gegenseitig zu sehr, um ihren Vertrag zu lösen.
Bernard konnte ihn, wie man so sagt, nicht riechen. Er war zu korrekt, um seine Feindseligkeit zu zeigen, wenn wir ihn zufällig trafen, aber er hatte unter verschiedenen Vorwänden immer wieder abgelehnt, die Firma Roblin in Antibes zu besuchen, und hätte ihn auch nie auf ein Glas Wein eingeladen.
«Was hast du gegen ihn?» fragte ich eines Tages.
«Nichts», antwortete er. «Oder vielmehr seine Art, wie er dich ansieht, als ob … Schon gut! Du kannst dich ja mit ihm treffen.»
So gab es zwischen Bernard und mir einige Kontroversen, vor allem wegen unserer Mütter.
Mit dem Herannahen der Hochzeit wurde Madame Vauchelle unangenehm, kratzbürstig und bissig.
«Mach dir nichts draus», sagte Bernard, «auch deine Mutter hat ihre Macken. Und, siehst du, selbst Prince schmollt. Die werden sich wieder einkriegen.»
Bald begannen die Mühseligkeiten, die jeder Hochzeit vorangehen: Anproben, Briefe schreiben, Besuche. Als Bernard verkündete, wir würden eine Hochzeitsreise machen, platzte Madame Vauchelle:
«Wer kümmert sich um den Kater? … Und überhaupt, eine Hochzeitsreise, was für eine Idee! In deinen Mappen sind alle Landstriche der Welt vertreten, die fünf Kontinente, ganz zu schweigen von den Fürstentümern Monaco, San Marino, Andorra … Reicht euch das nicht?»
Dieser Ausbruch kam so unerwartet, war so deplaciert und absurd, daß Bernard in Lachen ausbrach. Seine Mutter stand auf und zeigte mit anklagendem Finger auf ihn.
«Bist du in letzter Zeit nicht reichlich abgespannt, mein armes Kind? Sie sollten ihn zur Vernunft bringen, Christine, jetzt, wo …»
Auch sie beendete ihre Sätze nicht. So war man selbst verantwortlich für den Sinn, den man ihnen unwillkürlich gab.
Kurz und gut, die Trauung fand am 24. Juli bei schrecklicher Hitze statt. Und, wie ich es vorausgeahnt hatte, fiel die Hochzeitsreise aus.