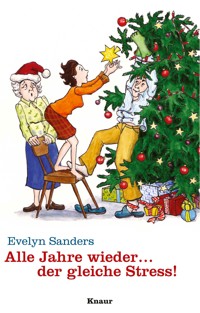6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Werden sie denn nie erwachsen? Willkommen im turbulenten Familienleben der Sanders! Der Stoßseufzer einer geplagten, aber glücklichen Nur-Hausfrau und fünffachen Mutter! Bei den Sanders' ist es endlich soweit: Sohn Sascha heiratet, die Zwillinge machen Abitur und verlassen das Elternhaus, um zu studieren. Nach schier nicht enden wollenden Turbulenzen kehrt Ruhe im Sanderschen Haushalt ein. Aber der Schein trügt... Begleiten Sie Familie Sanders auf ihren humorvollen Abenteuern in Deutschland, England und Frankreich. Vom Campingplatz über Weihnachten bis hin zu einer Reise nach Mombasa - bei dieser sympathischen und liebenswert chaotischen Familie wird es nie langweilig! Werden sie denn nie erwachsen von Bestsellerautorin Evelyn Sanders ist ein herzerfrischend witziger Roman über die Höhen und Tiefen einer Großfamilie. Eine charmante und unterhaltsame Geschichte, die auf wahren Begebenheiten basiert und zeigt, dass das Leben eben doch die besten Geschichten schreibt!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Evelyn Sanders
Werden sie denn nie erwachsen?
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Es scheint endlich soweit zu sein! Als letzte haben die Zwillinge ihr Abitur in der Tasche, und die fünffachen Eltern atmen auf: Nach drei Jahrzehnten Brutpflege werden sie ihr haus und ein wenig Zeit für sich selber haben … Irrtum! Sohn Sascha heiratet und findet keine Wohnung, die Zwillinge studieren und finden auch keine, und schon wird es eng. Da ergreifen Mutter und Tochter Stefanie die Flucht. Im Wohnmobil quer durch Frankreich. Klappt anfangs auch ganz gut …
Inhaltsübersicht
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 1
Du brauchst ein Schwiegermutterkleid«, sagte Nicole, nachdem sie meinen Schrank inspiziert und nichts gefunden hatte, was ihrer Ansicht nach dem feierlichen Anlaß entsprechen würde. »Und einen Hut!« ergänzte Katja.
»Lieschen Windsor hat auch immer einen auf.«
»Ich bin nicht die Queen, einen Hut habe ich noch nie getragen, werde es also auch jetzt nicht tun, und wenn das Sascha nicht paßt, soll er ohne mich heiraten!«
Ich war wütend! Sogar mehr als das, denn seit Tagen drehte sich alles nur noch um diese vermaledeite Hochzeit, an die noch immer keiner so recht glauben wollte. Ausgerechnet Sascha, unseren Miniatur-Casanova, der erstens nie und zweitens auf keinen Fall vor seinem dreißigsten Geburtstag heiraten wollte, hatte es als ersten erwischt. Mit siebenundzwanzig. Und was hatte er sich geangelt? Eine Engländerin! Folglich hatte die Hochzeit in England stattzufinden, und folglich hatte ich nach Ansicht meiner achtzehnjährigen Zwillingstöchter irgendwas in grauer Seide zu tragen, weil doch »alle Engländer so schrecklich konservativ« seien.
»Du kannst nicht im Hosenanzug in die Kirche gehen«, blockte Nicki meinen dezenten Hinweis auf den reichhaltigen Bestand meiner Lieblingskleidung ab, »da biste doch gleich unten durch. Und Sascha auch. Immerhin repräsentieren wir als einzige den deutschen Anhang dieser Mischehe, und wenn ich mir vorstelle, wie Victorias ellenlange Verwandtschaft uns unter die Lupe nehmen wird, würde ich am liebsten gar nicht mitkommen. Englische Hochzeit! Da gibt’s ja nicht mal was Vernünftiges zu essen.« Sie schüttelte sich. »Die können doch alle nicht kochen. Oder weshalb sonst stammen die meisten Gewürzsoßen aus England?«
Unter diesem Aspekt hatte ich die bevorstehenden Feierlichkeiten noch nicht betrachtet. »Wir fahren nicht nach England, um unsere Mägen zu strapazieren, sondern um eurem Bruder auf seinem schweren Gang seelischen Beistand zu leisten.«
»Den braucht er nicht, schließlich heiratet er ja freiwillig«, sagte Katja lakonisch. »Ich wünsche ihm bloß, daß seine Ehe länger hält als sämtliche Küchenmaschinen, die sie zur Hochzeit kriegen werden.« Dabei fiel ihr etwas ein. »Was schenkt ihr eigentlich?«
»Das Honorar für den Scheidungsanwalt«, sagte ich patzig.
Nein, so ganz hatte ich mich noch immer nicht mit dem Gedanken abgefunden, daß Sascha tatsächlich heiraten wollte. Seine Verlobung, die er uns morgens um fünf Uhr telefonisch mitgeteilt hatte, als er sich irgendwo zwischen Hongkong und Singapur befand, hatten wir natürlich nicht ernst genommen, obwohl sein Vater gemeint hatte, gegen ein hübsches Thai-Mädchen in der Familie hätte er gar nichts einzuwenden. Doch verlobt sei noch nicht verheiratet, und überhaupt könne das alles auch nur ein Hörfehler gewesen sein, immerhin sei die Verbindung miserabel gewesen, wahrscheinlich hätte ich statt verliebt eben verlobt verstanden.
»Wenn er jedesmal anrufen würde, sobald er sich verliebt hat, dann würden die Telefonrechnungen sein Einkommen um ein Mehrfaches übersteigen«, erwiderte ich. »Aber du hast ja recht. Noch ist er nicht verheiratet, und Felix hat sowieso prophezeit, daß er sich mindestens dreimal verloben würde, bevor er zum erstenmal Ernst macht.«
Felix ist langjähriger Freund unserer Familie, Patenonkel und mit Sicherheit Geheimnisträger, was Saschas vergangenes Liebesleben betrifft.
Ernsthaft beunruhigt war ich erst nach dem zweiten Anruf. Der kam aus Durban, diesmal via Satellit, wodurch die Verständigung erheblich verbessert wurde und keinerlei Zweifel an den konkreten Anweisungen meines Sohnes mehr zuließ. »Kannst du bitte umgehend meine Geburtsurkunde nach England schicken?« Es folgten ein Mädchenname sowie eine äußerst komplizierte Anschrift, die mir Sascha sicherheitshalber einzeln durchbuchstabierte.
»Wozu brauchst du …«
Meine Frage wurde elegant mit dem Hinweis abgeblockt, jede Minute Satellitentelefon koste ungefähr sieben Dollar, und er habe bereits an die vierzig in den Himmel geschickt. »Ich schreibe dir ganz ausführlich, sobald ich ein bißchen Zeit habe.«
Die schien er in den letzten Wochen jedoch nie gehabt zu haben. Ein paar Ansichtskarten waren gekommen, darunter eine mit einem kurzbehosten Nikolaus, der Badelatschen trug und Glitzerketten an eine Palme hängte. Der Text lautete: »Wir liegen hier am Strand, trinken Piña Colada und singen Weihnachtslieder. Herzliche Grüße.« Abgestempelt war sie in Barbados. Das nächste Lebenszeichen kam vom Panamakanal, aus Tahiti folgte auch noch eines, und danach hörte ich überhaupt nichts mehr vom ihm. Bis die Anrufe kamen. Zwischendurch hatten wir uns zwar kurz gesehen, doch zu diesem Zeitpunkt war von einer Verlobung nicht mal andeutungsweise die Rede gewesen.
Aber vielleicht sollte ich lieber ganz von vorne anfangen.
Im zarten Alter von siebzehn Jahren war Sascha zu der Erkenntnis gelangt, sein derzeitiger Bildungsstand genüge vollkommen, ein Abitur brauche er nicht, er habe das Leben als Taschengeldempfänger satt und wolle endlich selber Geld verdienen. Sein um ein Jahr älterer Bruder Sven war der gleichen Ansicht – wer seinerzeit wen überredet hatte, haben wir niemals mit letzter Sicherheit herausbekommen –, und so herrschte eine Zeitlang innerhalb der Familie ein ausgesprochen frostiges Klima. Der väterlichen Weigerung, die Knaben von der Schule zu nehmen, setzten sie passive Resistenz entgegen, die blauen Briefe sowie das folgende Donnerwetter quittierten sie mit einem Achselzucken, und acht Wochen später blieben sie sitzen. Beide!
Das Familienoberhaupt kapitulierte zähneknirschend. Sohn eins durfte seine Lehre als Landschaftsgärtner beginnen, Sohn zwei wurde nach Bad Harzburg in Marsch gesetzt, um dort unter der Ägide von Rolfs Schulfreund eine Ausbildung als Restaurantfachmann zu absolvieren. Nach vier Monaten flog er wieder raus. Wegen angeblicher Renitenz. Die Hoffnungen seines Vaters, Sascha würde nun doch den relativ bequemen Schulalltag dem Erwerbsleben vorziehen, erfüllten sich trotzdem nicht. »Der Job macht mir Spaß, aber nicht unbedingt unter Aufsicht eines Sklaventreibers! Oder findest du es normal, in einem Müllcontainer herumzukriechen und nach irgendwelchen verlorengegangenen Rechnungen zu suchen?«
Rolf fand das auch nicht normal, vermittelte seinem Sohn eine weitere Ausbildungsstätte, diesmal in einem Nobelrestaurant, wo Sascha noch vor Ablauf der regulären Lehrzeit eine glänzende Prüfung hinlegte.
»Jetzt geht’s ans Verdienen«, verkündete er strahlend, »mit dem Zeugnis komme ich in jedem Haus unter! Ich suche mir natürlich nur die besten aus.« Sprach’s, verschickte Bewerbungen und bekam als erste Zuschrift einen Brief vom Wehrbereichskommando, das ihn als Vaterlandsverteidiger beanspruchte.
»Ich verweigere!« erklärte Sascha sofort. »Ich laß mir doch nicht eine Knarre in die Hand drücken!«
Allerdings war ihm das damals noch übliche Verfahren zu langwierig, sein Ausgang zu ungewiß, und die Möglichkeit, als Zivi in einem Krankenhaus Bettpfannen leeren zu müssen, erschien ihm auch nicht gerade verlockend.
»Ich weiß gar nicht, weshalb du dich so sträubst«, sagte Sven, »nach der Grundausbildung kommst du sowieso ins Offizierskasino. Oder glaubst du, die haben da diplomierte Essenträger zu Dutzenden herumlaufen?«
Sascha sah das ein und fügte sich ins Unvermeidliche. Das Unvermeidliche nannte sich Grundausbildung und vermittelte mir einen umfassenden Einblick in die bundeswehreigene Garderobe. An jedem Wochenende röhrte die Waschmaschine, und wenn ich hinterher fluchend am Bügelbrett stand, weil das Verteidigungsministerium offenbar auch Mütter zwangsverpflichtete und zu Sonntagsarbeit verdammte, erklärte Rekrut Sascha mit schöner Regelmäßigkeit: »Ich könnte die Klamotten ja in der Kaserne waschen lassen, aber hinterher sind immer die Knöpfe kaputt, und dann müßte ich jedesmal neue drannähen.«
Nach drei Monaten konnte ich meine Wäscherei schließen. Sascha bekam als Kasino-Ordonnanz weiße Jacken mit ein bißchen Gold obendran und festvernieteten Knöpfen, die auch dem stabilsten Bügelautomaten widerstanden. Morgens durfte er ausschlafen, weil die Herren Offiziere das auch taten, dafür kam er abends spät ins Bett, doch daran war er ja gewöhnt. Nun empfand er seine Zwangsrekrutierung auch nicht mehr unbedingt als Hemmschuh auf seinem Weg zum Hotelmanager, denn er mußte die Konfirmationsfeier vom Majorstöchterlein organisieren und wenig später die Verlobungsparty eines Oberleutnants. Angst vor der Arbeit hatte er nicht, er wehrte sich nur sehr tapfer dagegen, genoß seine unbestrittenen Privilegien und ließ vorzugsweise die Hilfskräfte schaffen. Er war allgemein beliebt und bis auf die Bezahlung sogar zufrieden.
Alles ging so lange gut, bis sich ein frustrierter Hauptmann im Kasino vollaufen ließ, zu mitternächtlicher Stunde Sascha das Du anbot und seinem Bruder im Geist Bundeswehr-Interna erzählte, wobei es sich keineswegs um militärische Geheimnisse handelte, die Sascha ohnehin nicht interessierten, sondern um pikante Einzelheiten aus dem Privatleben höherer Chargen. Und die wiederum interessierten ihn brennend.
Es kam, wie es kommen mußte. Der wieder nüchtern gewordene Hauptmann entsann sich des peinlichen Plauderstündchens und strebte die möglichst umgehende Entfernung seines neuen Duzbruders an. Ihm fehlte nur noch ein plausibler Grund, und den fand er nicht. Also wurde Sascha zunächst einmal beurlaubt, denn er hatte ja diverse, bei der Bundeswehr nicht vorgesehene Überstunden abzubummeln.
Die beste Methode, eine unbequem gewordene Person loszuwerden, besteht darin, sie wegzuloben. Folglich erklärte der Her Hauptmann dem Herrn Oberst, daß der Gefreite Sanders aufgrund seiner beruflichen Qualifikationen in dieser kleinen Garnison am völlig falschen Platz sei, er gehöre vielmehr an einen namhaften Truppenstandort, wo man seine Fähigkeiten sicher mehr zu schätzen wisse.
Dem Herrn Oberst war das egal. Er ließ sich ohnehin nur sehr selten im Kasino blicken, denn es gab zu Hause eine Frau Oberst sowie zwei überreife Töchter, die der Papa zu den gesellschaftlich höherstehenden Veranstaltungen begleiten mußte, damit sie vielleicht doch noch passende Ehemänner finden würden. Und damit war, nach Ansicht der Frau Oberst jedenfalls, im unmittelbaren Kasernenbereich wohl kaum zu rechnen.
Als sich Sascha nach einer zehntägigen Ruhepause wieder zum Dienstantritt meldete, wurde ihm ein Marschbefehl ausgehändigt. Ihm blieb gerade noch Zeit genug, sich von einigen Kameraden zu verabschieden, insbesondere jedoch von jenem Schreibstubengefreiten, der ihm unter dem Siegel der Verschwiegenheit alle Einzelheiten mitteilte, die zu der plötzlichen Versetzung geführt hatten, einschließlich der Lobeshymne, die jener vertrauensselige Hauptmann gesungen hatte.
Etliche Stunden später stand Sascha in einer anderen Schreibstube, wo man auf sein Kommen zwar vorbereitet war, aber nicht wußte, was man mit ihm anfangen sollte. Man brauchte keine Kasino-Ordonnanz, weil das Offizierskasino wegen mangelnder Inanspruchnahme schon vor längerer Zeit aufgelöst worden war; die nahe gelegenen Bars und Kneipen boten mehr Unterhaltung. Was man brauchte, waren Leute, die etwas von Panzern verstanden, doch genaugenommen brauchte man die auch nicht mehr, man hatte schon übergenug.
»Dann kann ich ja nach Hause gehen«, sagte Sascha.
»Könntste, aber kannste nich.« Der Schreibstubenmensch blätterte in den Papieren. »Wie lange haste noch? Elf Monate? Bißchen zu lange für ’ne Zwischenlösung. Was haste denn gelernt?«
»Restaurantfachmann.«
»Restaurants ha’m wir nich, und in der Kantine ist Selbstbedienung. Ich will ja auch bloß wissen, als was du ausgebildet bist.«
»Hab’ ich doch schon gesagt, als Restaurantfachmann.«
»Beim Bund, du Pfeife!!!«
»Ach so«, sagte Sascha gedehnt, während er krampfhaft überlegte, was er außer Strammstehen, Scheibenschießen und Gepäckmärschen gelernt hatte. »Ein paarmal bin ich mit einem Motorrad durch die Botanik gefräst.«
»Also Kradmelder«, meinte sein Gegenüber befriedigt. Dann kratzte er sich am Kopf. »Die ha’m wir hier aber gar nicht. Möchte wissen, welcher Trottel dich hierhergeschickt hat.«
Das hätte ihm Sascha ganz genau sagen können, aber diesmal hielt er doch lieber den Mund.
»Geh erst mal in deine Stube und richte dich häuslich ein. Nachher kommste wieder, vielleicht ist mir bis dahin etwas eingefallen.«
Wenn Einfalt und Pedanterie zusammentreffen, entsteht Verwaltung. In den folgenden Wochen wurde Sascha regelrecht verwaltet, was in der Praxis bedeutete, daß er hin und her geschoben wurde. Ein paar Tage lang putzte er Antennen, und als sie glänzten, kamen sie wieder ins Materiallager, wo sie erneut vor sich hin rosteten. Dann hatte man ein Motorrad aufgetrieben, und statt Antennen wienerte Sascha Kolbenringe und Auspuffanlage. Fahren durfte er aber nicht, weil dieses Motorrad offiziell gar nicht existierte und niemand wußte, wie der Spritverbrauch hätte verbucht werden sollen.
Auch im Manöver wußte man mit Sascha nichts Rechtes anzufangen. Es fand irgendwo an der Küste statt, doch weil er weder ein Geschütz bedienen konnte noch jemals einen Panzer von innen gesehen hatte, wurde er zum Wacheschieben abkommandiert. Man setzte ihn in eine Holzhütte Marke Bauarbeiter-Klosett mitten auf den Strand, drückte ihm ein Nachtglas in die Hand und ließ ihn das Meer absuchen, denn es könnte sich vielleicht doch mal ein Fischerboot in das Sperrgebiet verirren. Da dieser Küstenteil aber schon seit Jahren als Truppenübungsplatz requiriert und zur Bannmeile für jeden Zivilverkehr erklärt worden war, hielt Sascha seinen Beobachtungsposten für genauso überflüssig wie überhaupt seine ganze Anwesenheit bei der Bundeswehr. Er las sich im Schein einer Taschenlampe durch zwei Kriminalromane und meldete am nächsten Morgen »Keine besonderen Vorkommnisse«.
Auch die längsten Manöver gehen mal zu Ende. Wieder in der Kaserne, hatte man für den Gefreiten Sanders noch immer keine angemessene Tätigkeit gefunden. Die fand er dann selber. Er hatte entdeckt, daß in der Sporthalle kein intaktes Tischtennisnetz mehr zu finden war, die beiden Fußbälle je ein Loch hatten und von dem angeblich vorhandenen Inventar mindestens die Hälfte fehlte. »Nicht mal ein anständiges Basketballspiel kann man durchziehen, weil der eine Korb wackelt und vom anderen nur noch der Ring da ist. Gibt’s denn hier niemanden, der sich mal darum kümmert?«
»Doch«, erklang eine befehlsgewohnte Stimme aus dem hinter der Schreibstube gelegenen Zimmer, »Sie!«
Von da an verbrachte Sascha den größten Teil des Tages an einer zum Schreibtisch umfunktionierten Tischtennisplatte und beschriftete Formulare in fünffacher Ausfertigung. Niemand kümmerte sich um ihn, denn genaugenommen war er ja nur inoffiziell vorhanden, beim nächsten Manöver vergaß man ihn regelrecht, und hätte er nicht zwei Wochen vor Ablauf seiner Dienstzeit schriftlich auf diese Tatsache hingewiesen, dann säße er womöglich noch heute in seiner Sporthalle und würde Trillerpfeifen sortieren.
Dem staatlichen Zugriff endlich entronnen und mit einem mittelgroßen Schuldenberg im Rücken – sein Antrag auf Erstattung des Benzingeldes für die Heimfahrt war schon bei der ersten Instanz im Papierkorb gelandet –, sah sich Sascha vor die Notwendigkeit gestellt, nunmehr Geld zu verdienen. »Dabei weiß ich gar nicht, ob ich das noch kann. Richtig arbeiten, meine ich«, seufzte er, lustlos die Hotel- und Gaststättenzeitung durchblätternd, »die suchen überall junge, dynamische Kräfte, die an selbständiges Arbeiten gewöhnt sind. Dazu müßte man ja denken können, aber was ist, wenn man sein Hirn vor anderthalb Jahren in der Kleiderkammer abgeliefert hat?«
»Ich hoffe doch stark, man hat es dir wieder ausgehändigt?«
»Da bin ich mir nicht so sicher«, antwortete mein Sohn. »Übrigens, wie schreibt man Commis de rang? Mit zwei m?«
Freiheit ist der Zwang, sich zu entscheiden. Sascha entschied sich für ein Hotel der gehobenen Preisklasse, nicht allzuweit weg vom Heimathafen, denn so ganz hatte er sich wohl doch noch nicht abgenabelt, aber weit genug weg, um vor gelegentlichen Überfällen seiner Familie halbwegs sicher zu sein. »Wehe, wenn ihr jemals dort aufkreuzt und erwartet, daß ich euch Sauerampfersuppe oder Wachtelbrüstchen an den Tisch trage.«
Das erwarteten wir auch gar nicht, weil ein Mittagessen in dieser Umgebung unseren Etat bei weitem überschritten hätte und nicht mal steuerlich absetzbar gewesen wäre. Im allgemeinen ließ Rolf sich von seinen Kunden einladen, und wenn er doch mal Gastgeber spielen mußte, dann sorgte er dafür, daß die Gäste zu uns nach Hause kamen, weil es sich in privater Atmosphäre doch viel besser verhandeln lasse. Kochen durfte ich, und statt eines anständigen Trinkgeldes bekam ich bestenfalls ein Kompliment und zum Abschied einen Handkuß.
Trotz Saschas Warnung rückten wir aber doch einmal geschlossen an, allerdings nur zum Kaffeetrinken, und mußten uns sagen lassen, daß Herr Sanders niemals zum Nachmittagsservice eingeteilt werde, denn der sei überwiegend den Auszubildenden vorbehalten. Dank unserer verwandtschaftlichen Beziehungen fielen die Eisbecher für die Zwillinge jedoch besonders groß aus, und die zum Kaffee servierten Pralinen hatten wir auch nicht bestellt.
Nach einem knappen Jahr Waldeinsamkeit hatte Sascha genug von Vogelgezwitscher und winterlichem Schneeschippen, und außerdem »schwebt man in ständiger Lebensgefahr, seitdem der Golfplatz eröffnet worden ist. Fragt nicht, wie oft mir auf dem Weg zum Personalhaus schon ein Ball um die Ohren geflogen ist. Die lernen doch alle noch.«
Es folgte ein kurzes Zwischenspiel in Heilbronn, und dann endlich betrat Sascha den blankgewienerten Parkettboden jenes Luxusschuppens, der zwar nicht die große Welt bedeutete, in dem sie jedoch verkehrte. Zu Hause sahen wir ihn kaum noch, was nicht so sehr an der Entfernung lag, sondern an seiner neuen Liebe Sabine, aber wenn er tatsächlich mal aufkreuzte, dann warf er mit illustren Namen aus Politik und Wirtschaft um sich und fragte uns ganz unschuldig, ob er nicht vielleicht doch den ihm angebotenen Job als Butler beim Fürsten Sowieso annehmen solle.
»Ein Butler muß mehr können als Ente tranchieren«, warf ich ein, »und soviel ich weiß, hast du noch nie ein Plätteisen angefaßt. In höheren Kreisen trägt man keine Jeans, sondern messerscharfe Bügelfalten.«
»Und du hast noch nie mit Fürsten verkehrt«, konterte Sascha, »da gibt es doch genug Arbeitssklaven, die für so was zuständig sind. Ich hätte ja nur die Oberaufsicht.«
»Quatsch, du mußt immer in gestreiften Hosen neben der Haustür stehen mit ’m Silbertablett in der Hand und ›Durchlaucht lassen bitten‹ sagen.« Nicki hatte noch keine Folge der Endlosserie Das Haus am Eaton Place verpaßt.
»Dämliche Gans« war alles, was Sascha dazu einfiel. Möglicherweise hatte ihn die Vorstellung, das abendliche Dinner mit weißen Handschuhen servieren zu müssen, doch etwas abgeschreckt – er zog ja nicht mal bei zehn Grad unter Null welche an –, denn dieses Thema ist nie wieder zur Sprache gekommen.
Wer ihm nun eigentlich den Floh ins Ohr gesetzt hatte, weiß ich bis heute nicht, es mußte wohl eine ganze Menge Frust zusammengekommen sein. Krach mit Sabine, die in London ihre Englischkenntnisse aufbessern wollte, regnerisches Herbstwetter, allgemeine Unzufriedenheit und nicht zuletzt der ewig gleiche Trott. Jedenfalls stand Sascha eines Tages mitten im November vor der Tür, hinter sich sein bis zum Dachgepäckträger vollgepfropftes Auto, und erklärte rundheraus, er werde jetzt eine Weltreise machen.
»Ach ja?«
Einen neuen Koffer nebst dazugehöriger Reisetasche hatte er schon gekauft, und seine ins Hellviolette schimmernde Hose paßte so gar nicht zu dem wolkenverhangenen Himmel. »Und wie gedenkst du dieses Unternehmen zu finanzieren?«
Sicher, er hatte gut verdient, aber das meiste davon auch wieder ausgegeben. Für den englischen Sportwagen zum Beispiel, angeblich billig aus vierter Hand erworben, oder für seine Garderobe, die garantiert nicht aus einem Versandhauskatalog stammte. Rücklagen hatte er bestimmt nicht. Hatte er nicht erst unlängst behauptet, das Leben sei ungerecht, denn andernfalls käme man nämlich alt auf die Welt und könne für die Jugend beizeiten das nötige Geld sparen, um sie richtig zu genießen.
»Überhaupt nicht«, griff Sascha meine Frage auf, »ich kriege sogar Geld dafür!«
Das hatte ich ja geahnt! Früher nannte man ihn Gigolo, wenn eine begüterte Witwe oder zweimal Geschiedene der gehobeneren Altersklasse einen dreißig Jahre jüngeren Mann aushielt; heute heißt er »Ständiger Begleiter«, doch unterm Strich kommt das gleiche dabei heraus: Sie hat das Geld, er hat alles andere, und wenn er das nicht hat, muß er zumindest jung sein. Sascha erfüllte alle Voraussetzungen. Er war gerade vierundzwanzig geworden, war groß, schlank, sah gut aus und verfügte über sehr viel Charme, wovon wir zu Hause allerdings kaum etwas merkten, denn da brauchte er ihn ja nicht. Kein Wunder also, wenn so eine überreife Matrone, die vermutlich eine Luxussuite in dem Nobelschuppen bewohnte und in der Hotelgarage einen Bentley parkte, meinen unerfahrenen Sohn umgarnt und ihm als Gegenleistung für etwas Zuwendung eine Weltreise in Aussicht gestellt hatte. Vielleicht würde sie ihn sogar als Butler ausgeben, auch alleinstehende Frauen haben manchmal einen, ist ja schließlich ein ganz seriöser Beruf … wahrscheinlich ahnte Sascha gar nicht, worauf er sich da eingelassen hatte …
»Wer ist die Frau???« fauchte ich ihn an.
»Welche Frau?«
»Na, dieses Weibsstück, das dir die Reise bezahlt.«
Erst sah er mich fassungslos an, doch dann wieherte er plötzlich los. »Määm, ich denke, du liest keine Heftchenromane?« brachte er schließlich, immer wieder von Lachsalven unterbrochen, heraus. »Hast du etwa geglaubt, ich hätte mich von so einer abgetakelten Tante als eine Art Reiseleiter anheuern lassen?« Er suchte nach einem Taschentuch, fand keins, holte ein Blatt Küchenkrepp, schmiß dabei die ganze Rolle herunter und fing wieder an zu lachen.
»Ich weiß gar nicht, was daran so lächerlich ist«, sagte ich pikiert.
»Kannst du dir etwa vorstellen, wie ich mit Kosmetikköfferchen in der einen Hand und Hutschachtel in der anderen, unterm Arm womöglich noch einen hechelnden Yorkshireterrier, hinter einer vollschlanken Mittfünfzigerin die Gangway raufstapfe?«
Vorstellen konnte ich mir das durchaus, und außerdem: »Nicht jede Frau über fünfzig ist dick! Ich zum Beispiel habe immer noch Größe vierzig.«
»Du tust ja auch was. Haushalt, Brutpflege und so weiter, aber diese reichen alten Schachteln langweilen sich doch den ganzen Tag, kompensieren ihren Frust mit Gourmet-Menüs und wundern sich, wenn das Chanelkostüm, extra für sie angefertigt und aus Paris eingeflogen, an ihnen aussieht wie von Neckermann.« Verächtlich winkte er ab. »Laß mich mit diesen exaltierten Weibern in Ruhe! Ich bin froh, daß ich sie nicht mehr sehen muß.«
»Ja, aber wenn du nicht …« Ich habe wohl ein bißchen sehr hilflos ausgeschaut, denn er drückte mir einen flüchtigen Kuß auf die Stirn und stiefelte treppaufwärts. »Einzelheiten erzähle ich nachher, wenn die ganze Sippe da ist«, brüllte er von oben herunter, »sonst muß ich alles dreimal wiederkäuen.« Eine Tür knallte zu, und Sekunden später dröhnte die voll aufgedrehte Stereoanlage durchs Haus. »Take it easy …« hörte ich noch, bevor ich nach den Wattestöpseln suchte.
Während des Abendessens erfuhr die staunende Familie, daß sich Sascha zusammen mit einem Freund bei verschiedenen Reedereien beworben hatte, aufgrund der offenbar sehr guten Referenzen auch unbesehen angeheuert worden war und sich nunmehr Steward nennen durfte, der Anfang Dezember in Southampton an Bord gehen werde.
»Was ist denn das für ’n Kahn?« wollte Katja wissen.
»Ein großes Passagierschiff. MS LIBERTY heißt es.«
»Noch nie gehört.« Und nach kurzem Überlegen: »Bist du sicher, daß es sich nicht um die Fähre zwischen Dover und Calais handelt?«
Er warf ihr nur einen mitleidigen Blick zu. »Warte ab, bis ich euch die ersten Ansichtskarten schicke, zum Beispiel von Hawaii oder den Bahamas. Aus Hongkong kriegt ihr auch eine und aus Tokio.«
Zwei Wochen lang nervte er uns von morgens bis abends, dann endlich fuhr ich ihn zum Flughafen, wünschte ihm eine gute Reise und Neptuns Wohlwollen. In Wirklichkeit war mir zum Heulen zumute, was ich auf der Heimfahrt auch ausgiebig tat. Natürlich mußte man eines Tages seine Kinder hergeben, sie loslassen und auf ihren eigenen Weg schicken. Aber doch nicht gleich bis nach Australien!
Wenigstens die anderen vier blieben mir noch, obwohl Sven seit längerem in Stuttgart wohnte und Steffi ebenfalls ausgezogen war, doch die zehn Kilometer ließen sich leichter überwinden als zehntausend. Die Zwillinge hatten noch zwei Schuljahre vor sich, danach würden sie wohl auch verschwinden, irgendwo irgendwas studieren. Momentan schwankten die Berufsziele noch zwischen Reiseleiter auf den Malediven und Biochemiker bei BASF, doch das würde sich wohl noch ein paarmal ändern.
Erschreckend deutlich wurde mir klar, daß sich unser Haus immer mehr leerte und der Tag abzusehen war, an dem Rolf und ich allein in unseren vier Wänden sitzen würden und bloß noch Fotoalben begucken konnten. »Weißt du noch, damals in Monlingen, als Sven den ersoffenen Maulwurf …«
Energisch rief ich mich zur Ordnung. Noch war es ja nicht soweit, noch bevölkerten die Zwillinge beziehungsweise mehr noch deren Freundesscharen das Haus, noch kreuzte Steffi regelmäßig bei uns auf, hauptsächlich dann, wenn sie mal wieder Krach mit Horst Herrmann hatte – erwachsen war sie mit ihren einundzwanzig Jahren auch noch nicht geworden.
Von Sascha trudelten Postkarten ein, schöne bunte mit schönen bunten Marken drauf, und alle zeigten sie Palmen, mal mit, mal ohne Strand, aber immer mit Meer im Hintergrund. Ich fand, daß der Pazifische Ozean genauso aussah wie der Indische und beide sich nicht vom Atlantischen unterschieden. Auf Teneriffa wachsen auch Palmen.
Irgendwann im Mai stellte Sascha seine baldige Heimkehr in Aussicht – die Karte war fast einen Monat unterwegs gewesen –, und drei Tage nach ihrer Ankunft klingelte das Telefon. »Hallo, Määm, ich bin in Reykjavik, fliege gleich nach Brüssel und bin um sieben in Frankfurt. Kannst du mich abholen? Aber nicht am Flughafen, sondern am Busbahnhof.« Es knackte in der Leitung, und das Gespräch war weg.
»Das ist Sascha gewesen«, erklärte ich meinem zeitungslesenden Ehemann, »er ist in Island.«
»Was macht er denn da? Ich denke, er schippert durch die Südsee?«
Das allerdings fragte ich mich auch. »Hat er nicht gesagt. Ich soll ihn heute abend in Frankfurt abholen. Vorher muß er aber noch nach Brüssel.«
Nachdenklich faltete Rolf die Zeitung zusammen. »Eine merkwürdige Reiseroute: Bist du sicher, daß du dich nicht geirrt hast?«
So sicher war ich mir keineswegs mehr. Andererseits hatte ich mich bisher noch immer auf mein Gehör verlassen können, und das hatte eindeutig »Frankfurt, Busbahnhof, sieben Uhr« verstanden. »Wie spät ist es?«
»Kurz nach eins. Warum?«
»Na prima! Wir haben Pfingstsamstag, zwei Feiertage vor uns, die Geschäfte sind zu, und Sascha war nicht eingeplant.« In Gedanken überflog ich meine Vorräte in der Kühltruhe, mußte jedoch einsehen, daß ich weder mit vier verschiedenen Eissorten noch mit eingefrorenen Maultaschen oder einem halben Dutzend Gläsern Bienenhonig das Feiertagsmenü würde verlängern können. Seitdem kürzlich das Kühlaggregat ausgefallen war und ich diese Panne erst bemerkt hatte, als sich auf dem Kellerboden Erdbeersaft mit Bratensoße und Schokoladeneis zu einer klebrigen Masse vermischt hatte, war ich vorsichtiger geworden und stopfte die Truhe nicht mehr mit preiswerten Sonderangeboten voll. Die zwölf aufgetauten Schnitzel waren zusammen mit den Rouladen in der Mülltonne gelandet und hatten noch Tage später mein Gewissen strapaziert.
»Jetzt habe ich nicht genug zum Essen im Haus«, lamentierte ich von neuem, »die Lammkoteletts sind genau abgezählt.«
»Ich verzichte auf meins«, brüllte Sven von oben, »wie ich dich kenne, hast du dir ja doch wieder Hammel andrehen lassen.« Noch im Schlafanzug, schlurfte er die Treppe herunter, schlappte weiter in die Küche, holte zwei Gläser aus dem Schrank, goß in das eine Orangensaft und hielt das zweite unter die Wasserleitung. »Is’ Aspirin im Haus, Määm?«
»Ja, oben im Bad.«
Er stöhnte mitleiderregend. »Hättste das nicht früher sagen können? Da komme ich doch gerade her.«
»Davon sieht man aber nichts, du machst im Gegenteil einen reichlich zerknitterten Eindruck.«
Müde winkte er ab. »Wer morgens zerknittert aufwacht, hat den ganzen Tag viele Entfaltungsmöglichkeiten. Ich glaube, ich gehe noch mal schlafen.«
Getreu der Devise, wonach hohe Feiertage am billigsten im Kreise der Familie verbracht werden können, war Sven gestern nachmittag eingetrudelt, hatte sich gegen Abend »nur auf ein kleines Bier« abgeseilt und war vermutlich irgendwann zwischen Mitternacht und Morgen ins Bett gefallen. »Wann bist du eigentlich nach Hause gekommen?« fragte ich beiläufig. »Ich habe dich gar nicht mehr gehört.«
»Spät. Oder früh, ganz wie du willst. Hab’ ein paar alte Klassenkameraden getroffen, und da haben wir uns natürlich festgelabert. Als der Pfalzgraf zugemacht hat, haben wir noch bei Erwin weitergebechert. Mens sana in Campari Soda.« Er stöhnte noch ein bißchen lauter. »Am besten lege ich mich noch ’ne Stunde aufs Ohr, mir geht’s nämlich gar nicht gut.«
Auffallend langsam, als ob er Widerspruch erwartete, schlich er die Treppe hinauf. Sollte er nur, ich wußte genau, wie ich ihn munter kriegen würde. »Dein Bruder kommt heute abend.«
»Na und?« murmelte er, schien dann aber doch zu begreifen, was ich eben gesagt hatte. »Sascha? Was will der denn hier?«
»Ostereier suchen«, sagte ich pampig. »Er hat vorhin angerufen und gebeten, daß ihn jemand nachher in Frankfurt abholt.«
Ungläubig schüttelte Sven den Kopf. »Ich denke, der Kahn ist ein Kreuzfahrtschiff. Wie kommt denn das nach Frankfurt? Der Main hat doch gar nicht genug Tiefgang für so ’n Riesenpott.«
Da gab ich es auf. »Jetzt steck erst mal dein Haupt unter kaltes Wasser, zieh dich an, und dann reden wir weiter.« Doch er ließ nicht locker. »Nu mal im Ernst, Määm, wie kommt Sascha so plötzlich nach Deutschland? Ich denke, der gurkt durch die Karibik?«
»Dein Vater sucht ihn in der Südsee, du in der Karibik – meine Güte, habt ihr denn noch nie was von Flugzeugen gehört?«
Ein verstehendes Lächeln zog über Svens Gesicht. »Sind das nicht diese modernen Geräte, mit denen man bei schlechtem Wetter schneller als je zuvor dreihundert Kilometer weit von der Stelle entfernt landet, an die man eigentlich wollte?« Ihm mußte wohl noch der Rückflug aus seinem letztjährigen Urlaub in den Knochen stecken, als der Stuttgarter Flughafen wegen Nebel geschlossen worden war.
»Das kann heute nicht passieren, die Sonne scheint ja.« Dann fiel mir noch etwas ein. »Übrigens sollen wir ihn vom Busbahnhof abholen.«
Stille. Plötzlich schallendes Gelächter. »Heiliger Himmel, muß der Junge pleite sein!«
Fünf Minuten vor sieben hatten wir nicht nur den Busbahnhof, sondern gleich daneben einen Parkplatz gefunden, und zehn Minuten nach sieben waren wir überzeugt, daß wir uns geirrt hatten. Weit und breit war kein Mensch zu sehen, keine Reisenden mit Koffer, keine Abholer mit Blümchen, nicht mal irgend etwas Uniformiertes, das man um eine Auskunft hätte bitten können.
Nach einer weiteren Viertelstunde hatte Sven genug. »Hier stimmt doch was nicht. Ich gehe mal rüber zum Hauptbahnhof, vielleicht kriege ich da etwas raus.«
»Und ich muß zu Hause anrufen«, sagte ich sofort, froh, diese öde Gegend, in der es nur Baustellen mit herrenlosen Kränen gab, wenigstens vorübergehend verlassen zu können. »Dein Vater glaubt sonst, ich hätte seinen Wagen an einen Brückenpfeiler gesetzt.«
»Du mußt hierbleiben. Es könnte ja sein, daß der Bus in der Zwischenzeit doch noch auftaucht.«
Dabei bezweifelte ich schon, daß hier jemals einer vorbeigefahren war. »Beeil dich bitte, ich komme mir im wahrsten Sinne des Wortes wie bestellt und nicht abgeholt vor.«
Sven hatte sich wirklich beeilt. Atemlos kam er zurückgespurtet und nickte schon von weitem mit dem Kopf. »Wir stehen richtig, aber wann der Bus eintrudelt, konnte mir die Tante bei der Auskunft auch nicht sagen. Er hätte schon längst dasein müssen.«
Das allerdings war mir schon vorher bekannt gewesen. »Na schön, warten wir eben weiter. Jetzt hältst du die Stellung, und ich gehe telefonieren.«
Rolf wunderte sich überhaupt nicht. »Hast du denn geglaubt, so ein Überlandbus ist pünktlich? Wir haben Pfingsten, die Autobahnen sind überfüllt.«
»Da, wo wir stehen, müssen aber alle Leute schon angekommen sein. Kein Mensch ist mehr auf der Straße.«
Als ich zur Haltestelle zurückkam, hatte Sven Gesellschaft gekriegt. Ein älteres Ehepaar trippelte ungeduldig von einem Fuß auf den anderen, zwei Teenager unbestimmbaren Geschlechts kickten eine leere Coladose durch die Gegend, ein etwa fünfjähriges Mädchen hockte halb schlafend auf einer riesigen Kühltasche, und Opa war auch noch da mit Trachtenjoppe und Gamsbarthut. Wenn die alle zusammengehörten, mußten sie in einem Kleintransporter angereist sein.
»Die warten auch auf den Bus«, erläuterte Sven überflüssigerweise.
»Das habe ich mir beinahe gedacht.«
Im Laufe der nächsten halben Stunde erfuhr ich, daß die so zahlreich versammelte Familie zum Empfang des heimkehrenden Sohnes angetreten sei. »Der fährt nämlich zur See und hat jetzt Urlaub. Die ganze Welt hat er schon gesehen, und dabei ist er erst sechsundzwanzig Jahre alt.«
»Meiner auch«, sagte ich erfreut, obwohl das nicht so ganz stimmte, denn bisher hatte Sascha erst bestenfalls die halbe umrundet. »Wie heißt denn das Schiff?«
»LIBERTY«, antwortete Papa stolz. »Das ist ein ganz großes Passagierschiff.«
»Weiß ich, mein Ableger ist nämlich auch drauf.« Nachdem ich noch kurz das Mißverständnis korrigiert und den als meinen Ableger bezeichneten Sascha der Gattung Homo sapiens zugeordnet hatte, wurde ich darüber aufgeklärt, daß der andere Sohn Stefan heiße, als »Stuart« im großen Speisesaal tätig sei, weil er doch bei seinem Onkel im Allgäu richtig Kellner gelernt habe, »und nun wird er wohl viel zu erzählen haben. Morgen haben wir ein großes Fest, da kommen alle Verwandten, sogar der Vetter vom Stefan aus Bremen und seine Patin aus dem Westerwald. Seine drei Nichten haben wir gleich mitgebracht, denn ihre Mutter, also dem Stefan seine Schwester, steht zu Hause und kocht.«
Die Aufzählung weiterer Onkel und Tanten blieb uns erspart, denn endlich bog ein verstaubter Bus um die Ecke. »Da kommt er!« schrie der eine Teenager, während der andere der Coladose einen letzten Tritt versetzte und sich dann mit ausgebreiteten Armen mitten auf die Fahrbahn stellte.
»Na-di-ne, komm sofort zurück!« kreischte Mama. »Hilf dem Großi bei der Fahne!«
Papa hatte sich der beiden langen Stangen bemächtigt, die seitwärts an einem Bauzaun lehnten, umhüllt von einem weißen Tuch. Als es zu voller Bettlakengröße auseinandergerollt war, konnte ich auch die mit Wasserfarben gepinselten Buchstaben entziffern: Willkommen zu Hause, Stefan.
Mama hatte das schlafende Mädchen an Uropa weitergereicht und die Kühltasche geöffnet. Zum Vorschein kamen zwei Flaschen Sekt nebst einer noch zugeschweißten Pakkung Plastikbecher. »Wir müssen doch die gesunde Heimkehr begießen«, sagte Mama, mit dem ersten Korken kämpfend. »Sie kriegen auch ein Gläsle ab.«
Der Bus hielt, zischend öffnete sich die Tür, und dann standen sie vor uns, die beiden braungebrannten Burschen, und wirkten zwischen uns Bleichgesichtern reichlich exotisch.
»Hi!« grüßte Sascha, etwas herablassend das Empfangskomitee musternd, während Stefan erst gar nicht zu Wort kam. Die gesamte Sippe war auf ihn zugestürzt, Mama, mit der noch immer ungeöffneten Flasche in der Hand, umhalste ihn und ließ ihm nicht mal Zeit, seine Tasche abzustellen.
»Bloß weg hier!« zischelte uns Sascha zu. »Der Kerl geht mir allmählich auf den Senkel.«
Doch dazu kamen wir noch nicht. Erst mußte Sascha schnell ein Glas Sekt trinken, weil »der Freund von unserem Stefan wird doch sicher mit uns anstoßen wollen«, was er denn auch notgedrungen tat. Anschließend mußte er noch Papa die Hand geben und Opa, mußte Papas Visitenkarte einstecken, damit er den Stefan bald mal besuchen könne (»Das erste Dorf hinter Kempten, wo Edeka draußen dransteht, das sind wir!«), und dann endlich durften wir uns verabschieden.
»Genau so habe ich mir seinen Verein vorgestellt«, schimpfte Sascha, »die letzten zwei Stunden hat er von nichts anderem erzählt. Von wegen Freund« – er schüttelte sich, als wollte er ein lästiges Insekt abstreifen –, »ich hab’ den vorher ja kaum gekannt. So ’ne Flasche hätte überhaupt nicht in unsere Crew gepaßt. Wir hatten nur zufällig denselben Weg.«
Als wir im Auto saßen, den Kofferraumdeckel mit Strippe fixiert, weil er nicht mehr zugegangen war, machte Sven zum erstenmal wieder den Mund auf. »Wie kommst du von da unten« – auf nähere Bezeichnungen wollte er sich wegen mangelnder geographischer Kenntnisse wohl nicht einlassen – »nach. Island, von da nach Brüssel und dann mit ’nem popligen Bus nach hier?«
»Weil’s der schnellste Weg war.«
»Ach? – Na ja, wenn ich nach Stuttgart will, fahre ich auch immer über München.«
»Und billiger war’s außerdem«, ergänzte Sascha, bevor er sich zu einer näheren Erklärung herabließ. Demnach wäre ein Direktflug Miami–New York–Frankfurt ein paar hundert Dollar teurer gewesen als der Umweg über Island, nur gab es von dort keine Verbindung nach Frankfurt, so war als letzte Möglichkeit Brüssel geblieben. Und von dort wiederum wäre erst am nächsten Tag wieder eine Maschine in die Mainmetropole gegangen. »Ich wußte gar nicht, daß Busfahren so teuer ist«, beendete er seinen Bericht, »ein Flugticket hätte auch nicht viel mehr gekostet.«
»Und nun erzähl mal, wie das so ist auf ’m Kahn«, forderte Sven ihn auf. »Ich hatte eigentlich damit gerechnet, daß du mit einem Millionärstöchterlein aufkreuzt oder wenigstens mit was Exotischem, Typ Bali oder Java.«
»Quatsch«, murmelte Sascha nur, und dann sagte er gar nichts mehr. Er war nämlich eingeschlafen.
Wenn ich mir nun eingebildet hatte, er würde seinen Seesack an den Nagel hängen und wieder seßhaft werden, so wurde ich sehr schnell eines Besseren belehrt. »In sechzehn Tagen muß ich wieder in Southampton sein. Hab’ ich euch eigentlich schon gesagt, daß ich auf der Kju-Iii-Tu angeheuert habe?«
Nein, hatte er nicht. Er hatte überhaupt recht wenig erzählt, und wenn er nach so kurzer Zeit schon wieder den Kahn wechseln wollte, mußten wohl schwerwiegende Gründe vorliegen. Oder war er am Ende gar nicht freiwillig gegangen? Was war das überhaupt für ein Name? Kju-Iii-Tu, so heißt doch kein anständiges Schiff? »Warum bleibst du denn nicht auf der LIBERTY?«
»Würdest du nicht zugreifen, Määm, wenn du dich verbessern könntest?«
»Natürlich! Nur kann ich nicht verstehen, weshalb du dir dazu ausgerechnet ein chinesisches Schiff ausgesucht hast. Kju-Iii-Tu, was heißt denn das auf deutsch?«
Er grinste nur. »QUEEN ELIZABETH Zwo. Vielleicht hast du schon mal was davon gehört.«
Jetzt ging mir endlich ein Licht auf. Einige Fachausdrücke hatte ich inzwischen gelernt, wußte, daß man unter »Crossing« die Atlantik-Route England–New York zu verstehen hatte und »Overnight« bedeutete, daß das Schiff auch nachts im Hafen blieb und nicht, wie bei Kreuzfahrten üblich, auf hoher See dem nächsten Ziel entgegenfuhr, doch daß man hinter diesem vermeintlich chinesischen Namen das Kürzel QE II zu suchen hatte, konnte ich nun wirklich nicht ahnen. »Ist das nicht überhaupt das größte Passagierschiff der Welt?«
»Nee, die NORWAY ist einen Meter länger und noch ein bißchen breiter, deshalb geht sie auch nicht durch den Panamakanal, die muß immer unten rum.«
Keine Ahnung, was unten rum bedeutete, war mir auch egal. Die QUEEN ELIZABETH kannte jeder, zumindest dem Namen nach, die LIBERTY hatte niemand gekannt, und das hatte mich immer gewurmt. Ich wurde oft gefragt, was denn aus Sascha geworden sei, man sähe ihn ja gar nicht mehr, und wenn ich dann erzählte, er sei als Steward mit der LIBERTY gerade auf Weltreise, hatte ich schon häufig genug zu hören bekommen: »So? Des Schiff kenn i net. Onsers hat LEXORNO g’hoißa, wo mer die Kreizfahrt mitgemächt haba im Middelmeer.« Jetzt konnte ich wenigstens auftrumpfen!
Doch vorher mußte Sascha noch mal schnell nach England. Wegen Sabine. »Ich glaube, die hat sich umorientiert«, vermutete er, »ihre Briefe wurden immer kürzer und sachlicher.«
»Wenn du dich bei ihr genauso häufig gemeldet hast wie bei uns, kann ich das verstehen. Schon so manche Liebe ist an der Geographie zugrunde gegangen.«
Also flog Sascha nach London und war schon zwei Tage später wieder zurück. »Sie hat ’n andern«, freute er sich, »einen Piloten von den British Airways. Jetzt überlegt sie, ob sie nicht auf Stewardeß umsatteln soll. Englisch hat sie inzwischen prima gelernt, aber mit Technik hat sie doch noch nie was am Hut gehabt. Sie müßte ja schon froh sein, wenn sie sich bei der Vorführung der Sauerstoffmasken nicht erwürgt.«
Anscheinend machte ihm die geplatzte Beziehung überhaupt nichts aus, und das wunderte mich ein bißchen. Immerhin hatten die beiden fast zwei Jahre zusammengelebt. »Hast du dich etwa auch – äh, umorientiert?«
»Auf die Frage habe ich schon lange gewartet«, meinte er grinsend, »aber du brauchst keine Angst zu haben, Schwiegermutter wirst du vorläufig bestimmt nicht.«
Das zumindest war beruhigend, doch: »Gibt es denn keine hübschen Mädchen an Bord?« Ich dachte an die Traumschiff-Serie im Fernsehen und an Steward Viktor, der seine Freizeit häufig mit attraktiven weiblichen Passagieren verbracht hatte – in allen Ehren natürlich, bestenfalls händchenhaltend, weil diese Seifenoper ja im Vorabendprogramm ausgestrahlt wurde. Nach dem dritten hingehauchten Kuß auf die Stirn hatte ich jedesmal den Eindruck bekommen, daß dieser schöne Steward ein geschlechtsloses Wesen sein mußte.
Sascha war garantiert keins. Bevor er mit Sabine seßhaft wurde, hatte er uns beinahe alle drei Monate eine neue Freundin vorgestellt, bis Rolf ein rigoroses Bräutemitbringeverbot erteilt hatte. Deshalb konnte ich mir auch nicht vorstellen, daß mein Sohn plötzlich der gesamten Weiblichkeit abgeschworen haben sollte.
Hatte er auch nicht. »Natürlich gibt es mal einen Flirt«, gestand er bereitwillig, »aber was Ernstes ist nie draus geworden. Du kannst doch in einem Heringsfaß keine Forelle angeln.«
Womit das Thema erst einmal abgeschlossen war.
Die restlichen Tage bis zu seiner Abreise verbrachte er überwiegend schlafend, und wenn er gerade mal wach war, nervte er. An fangfrische Langusten und gerade vom Baum geholte tropische Früchte gewöhnt, bezeichnete er meine tiefgefrorenen Kabeljaufilets als Fischfutter und die Dosenpfirsiche als Glibber. »Hast du schon mal eine frisch geerntete Ananas gegessen?«
»Selbstverständlich. Ich lasse sie mir ja täglich von Südafrika einfliegen!« Dieser bornierte Jüngling hatte offenbar sämtliche Maßstäbe verloren und keine Ahnung mehr, wie es in einem deutschen Normalhaushalt zuging. Er schwärmte von der chinesischen Küche, die man natürlich nur in Hongkong richtig genießen kann, zählte in allen Einzelheiten auf, was zu einer indonesische Reistafel gehört, und hatte noch nie ein so exzellentes Steak gegessen wie in Buenos Aires. Wenn man ihm glauben wollte, hatte er sich auf dem Schiff vorwiegend von Kaviar und Hummermayonnaise ernährt (»Auf dem Mitternachtsbüfett steht das Zeug kiloweise herum«), und hätte er uns nicht Fotos gezeigt, auf denen er in Affenjäckchen mit Silbertablett in der Hand zu sehen war, dann wäre mein damals geäußerter Verdacht vielleicht doch wieder aufgeflammt. Schließlich sehnte ich den Tag seiner Abreise regelrecht herbei, und als es endlich soweit war, ließen wir ihn ohne großes Bedauern ziehen.
Katja war es, die uns allen aus der Seele sprach: »Ich liebe meinen Bruder wirklich, aber am meisten liebe ich ihn, wenn er mindestens hundert Kilometer weit weg ist.«
Kapitel 2
Was schenkt man seinen Kindern zum Abitur? Um die Jahrhundertwende ist wohl spätestens zu diesem Zeitpunkt die goldene Uhr fällig gewesen, sofern der Primaner sie nicht schon zur Konfirmation bekommen hatte. Heute besitzt jeder Abiturient mindestens drei Armbanduhren mit zum jeweiligen Outfit passendem Ziffernblatt. Gold ist spießig, Plastik ist in.
Ganz begüterte Väter pflegten seinerzeit ihren gerade der Schule entronnenen Nachkommen einen Scheck zu überreichen und sie auf Reisen zu schicken, damit sie sich von den Strapazen des Lernens erholen sowie ihren Horizont erweitern könnten. Als Begleitperson wurde etwas Zuverlässiges aus dem Bekanntenkreis erwählt, meist ein sogenannter väterlicher Freund oder – wenn die zu begleitende Person weiblichen Geschlechts war – die ältliche und selbstverständlich unverheiratete Kusine zweiten Grades, der man auf diese Weise auch mal etwas Gutes tun konnte. Erkorenes Ziel war meistens Italien, erstens wegen des Wetters und zweitens wegen der Bildung.
Die heutigen Abiturienten buddelten allerdings schon im Windelalter Löcher in den Strand von Rimini, wußten bereits als Grundschüler, an welcher Imbißbude in Marbella die Fritten am billigsten sind, und wenige Jahre später, als sie sich noch mit den ersten französischen Vokabeln herumschlugen, beherrschten sie den tiefschürfenden Satz »Wo kommst du her?« schon in vier verschiedenen Sprachen. Nein, mit Auslandsreisen kann man den jetzt Neunzehnjährigen nicht mehr imponieren. In Österreich sind sie im Landschulheim gewesen, in Frankreich als Austauschschüler, die Klassenfahrt war ins Elsaß gegangen, und Holland hatte man mit dem Schachclub besucht. Studienreisen? Aber selbstverständlich, hatten wir doch auch schon. Eine Woche Berlin zum Beispiel, vom Kultusministerium bezuschußt zwecks Besichtigung der Mauer, die man jetzt allerdings nur noch in Form von kleinen bunten Bröckchen käuflich erwerben kann. Dann mußte man noch den Reichstag durchwandern und auf dem Alexanderplatz seinen Zwangsumtausch in Schallplatten oder Bücher einwechseln, womit der Kultur meist Genüge getan war und man sich dem Studium von Schaufensterauslagen und Diskotheken widmen konnte.
Eine Reise als Belohnung fürs bestandene Abitur fiel also aus. Was dann? Ein eigenes Auto? In unserem Fall hätten es normalerweise gleich zwei sein müssen, Zwillinge kriegen ja grundsätzlich alles doppelt, und außerdem … sie hatten schon eins! Größenwahn war es nicht gewesen, dem die Mädchen ihre schon etwas bejahrte Ente zu verdanken hatten, auch nicht die mehr oder weniger regelmäßigen, mit anklagendem Unterton vorgebrachten Bemerkungen wie: »Uwe hat den alten Wagen von seinem Vater gekriegt, der hat sich nämlich einen neuen gekauft!« Oder: »Daniela darf das Auto von ihrer Mutter benutzen, wann sie will.« Abgesehen davon, daß die ach so beneidenswerten Freunde samt und sonders älter und schon im Besitz der begehrten Führerscheine waren, hielt ich es aus rein pädagogischen Gründen für übertrieben, gerade erst achtzehn gewordenen Teenagern ein eigenes Auto vor die Tür zu stellen. An diesem Vorsatz hielt ich fest, bis das vorletzte Schuljahr begann..
Ländliche Gymnasien haben große Vorteile. Die Kriminalität beschränkt sich auf das nächtliche Besprühen der Schulhauswände mit gerade gängigen Parolen (We don’t need no education) oder die mutwillige Zerstörung eines Fensterrollos, was eine extra gebildete Untersuchungskommission zur Folge gehabt hatte (die wie die meisten Untersuchungskommissionen zu keinem Ergebnis gekommen war!), aber es hatte weder Schlägereien gegeben noch Drogenprobleme. Sogar die beiden sehr alternativ eingestellten neuen Lehrer war man wieder losgeworden. Ihre eigenwilligen Unterrichtsmethoden, nämlich mit gekreuzten Beinen auf den Tischen zu sitzen und Atemübungen zu praktizieren, hatten zwar den Schülern recht gut gefallen, nicht aber den Eltern. Yoga statt Geographie? Die Kinder sollten doch erst einmal lernen, wo Indien überhaupt liegt! Es dauerte auch nicht lange, da waren die beiden Selbstbesinnungs-Fetischisten an eine andere Schule versetzt worden, und daß die Erdkundestunden mangels kompetenter Lehrkräfte bis zum Schuljahresende größtenteils ausfielen, wurde hingenommen.
Eine ländliche Schule, die ihre Schüler aus den mehr oder weniger weit entfernten Ortschaften bezieht – deshalb heißt es ja auch Einzugs-Gymnasium –, muß für Transportmöglichkeiten sorgen. Sie heißen Schulbusse und fahren zweimal täglich, nämlich morgens vor Schulbeginn und mittags nach Schulschluß. Da sie in der Regel mindestens ein halbes Dutzend Dörfer abklappern, sind diejenigen Schüler am schlechtesten dran, die als erste eingebaggert werden. Die Zwillinge gehörten dazu und mußten früh um sieben an der Haltestelle sein. Folglich waren sie umgekehrt auch die letzten, die wieder ausgeladen wurden. Mittagessen gab es bei uns nie vor zwei Uhr, oft genug später, weil es unterwegs eine ampelgeregelte Baustelle gegeben hatte, die morgens noch nicht dagewesen war, oder weil plötzlich ein Reifen platt gewesen war oder der Fahrer auf dem Abstellplatz die Zeit verpennt hatte. Wie oft es statt der zerkochten Salzkartoffeln schließlich Kartoffelbrei gegeben hat, weiß ich nicht mehr. Nudeln warf ich grundsätzlich erst in den Topf, wenn die Mädchen vor der Tür standen. Dann gab es bei uns eben Mittagessen, wenn andere Leute schon die Kaffeetassen auf den Tisch stellten.
Doch daran kann man sich gewöhnen. Problematisch wurde die ganze Sache allerdings, als mit der »erweiterten Oberstufe« die Kurse begannen. Da hatte Nicki in der dritten und vierten Stunde Chemie, danach nichts mehr und erst am Nachmittag wieder Computer-AG und Musik. Katja dagegen, die von Naturwissenschaften nichts hielt und alles, was abwählbar gewesen war, auch prompt abgewählt hatte, mußte morgens zur ersten Stunde antreten, weil da der Deutsch-LK begann. Im Anschluß daran kam Geschichte, ein Fach, auf das Nicki verzichtet hatte, und danach war sie fertig. Dafür hatte sie am nächsten Tag acht Stunden und Nicole bloß fünf.
Nun waren die Zwillinge zum erstenmal getrennte Wege gegangen, und schon wuchs sich dieser Entschluß zur Katastrophe aus. Ich verbrachte einen Teil des Tages auf der Landstraße, fuhr die eine Tochter um zehn zur Schule, holte die andere um halb drei ab, nahm die erste gleich mit, obwohl sie noch eine Stunde Zeit gehabt hätte, holte sie um fünf wieder ab … versuchte, Fahrgemeinschaften zu organisieren, kapitulierte, weil tatsächlich alle sieben Schüler aus unserem Ort sieben verschiedene Stundenpläne hatten, schimpfte, fluchte, kannte inzwischen jeden Kilometerstein auf der Strecke und hatte schließlich die Nase voll. Sechs Wochen später hatten die Mädchen ihre Führerscheine und eine Woche darauf die Ente.
Fortan holte ich Nudeln und Waschpulver wieder mit dem Fahrrad. Ich hatte nämlich nicht berücksichtigt, daß diese hübschen rosa Scheine nicht nur zum Fahren der Ente berechtigten, sondern quasi ein Freibrief für das Requirieren jedes familieneigenen Fahrzeugs waren. Und davon gab es mehrere. Das väterliche Auto stand allerdings erst abends zur Verfügung, doch immer noch früh genug, um damit in die Disko, ins Kino oder auch nur fünf Straßen weiter zur Freundin zu fahren. Wenn Steffi mal wieder Krach mit Horst Herrmann gehabt hatte und samt Übernachtungsköfferchen bei uns vor der Tür stand, wurde sofort ihr Polo beschlagnahmt, denn mit der Ente war gerade Katja unterwegs, und Nicki mußte dringend zwecks Klärung der Schallschwingungen zu Mark, weil der in Physik viel besser war als sie. Die Fahrräder rosteten in der Garage still vor sich hin, als Führerscheinbesitzer ist man über diese Drahtesel erhaben, die Gesundheitswelle hatte gerade erst das Stadium des Joggens erreicht, Radeln war noch nicht wieder in.
Im Notfall war ja immer noch mein Auto da. Und Notfälle gab es beinahe täglich. Sie wurden regelmäßig beim Abendessen diskutiert.
»Ich fahre doch morgen nicht mit Nicki zur ersten Stunde hin, wenn ich erst zur vierten dasein muß«, moserte Katja.
»Dann nimmt Nicki den Bus, du die Ente, und mittags kommt ihr zusammen zurück. Wo liegt da das Problem?«
»In den Sternen. Ich habe nachmittags noch Astronomie.«
Kleine Denkpause, dann hatte ich die Lösung. »Ihr kommt beide zum Essen nach Hause, und später fährt Nicki wieder rüber.«
»Und wie komme ich nach Sinsheim? Wir haben doch morgen das Volleyball-Turnier«, protestierte Katja.
Jetzt meldete sich das Familienoberhaupt zu Wort: »Wenn ich euch so höre, frage ich mich wirklich, wie ich die Schulzeit überlebt habe. Ich mußte jeden Tag mit dem Fahrrad fahren, neun Kilometer hin und wieder zurück. Bei Wind und Wetter. Und mir hat das auch nicht geschadet.«
Katja nickte nur. »Weißt du, Paps, je älter du wirst, desto weiter wird dein Schulweg. Im vorigen Jahr sind es noch sieben Kilometer gewesen.«
»Na ja, im Winter mußte ich immer einen Umweg fahren, weil der Feldweg zugeschneit war«, verteidigte sich Rolf, »und wenn man die zusätzlichen Kilometer mit dem Jahresdurchschnitt …«
»Ich glaub’s dir ja, Papi, aber hier gibt es bloß Landstraße, und da landest du als Radfahrer irgendwann als Kühlerfigur auf ’nem Daimler. Bernd ist erst neulich zehn Meter durch ein Maisfeld gefräst, weil ihn sonst so ein Midlife-crisis-Geschoß aufgespießt hätte.« Und als sie seine fragende Miene sah, ergänzte sie: »’n Porsche.«
Jedenfalls endete auch diese Debatte wieder mit einem Kompromiß. Katja würde die Ente nehmen und Nicki meinen Wagen, damit ihre Schwester am Nachmittag Ball spielen konnte.
»Und was wird aus meinem Friseurtermin?« fragte ich zaghaft.
»Na, die paar hundert Meter kannste doch zu Fuß gehen.« Als ich später den Tisch abräumte – die Zwillinge hatten sich wie üblich mit unaufschiebbaren Verpflichtungen entschuldigt –, sagte ich resignierend zu meinem zeitungslesenden Ehemann: »War das noch eine schöne Zeit, als die beiden im richtigen Alter waren.«
»Wann soll denn das gewesen sein?«
»Vor ein paar Monaten. Zu alt, um nachts zu schreien, aber zu jung, um sich meine Autoschlüssel zu krallen.«
Wir hatten den Zwillingen ein Benzinkontingent ausgesetzt, das großzügig bemessen war und ihnen neben dem Schulweg noch kleinere Extratouren gestattete. Trotzdem reichte es nie. Taschengeld und gelegentliche Nebenverdienste wurden größtenteils in Treibstoff umgesetzt, damit sie in die Disko oder ins Kino fahren konnten. Vorher mußten sie aber noch Ulf und Mark und Svenja aufsammeln, die ihnen dafür den Eintritt bezahlten. Den wiederum hätten sie mühelos selbst aufbringen können, hätten sie nicht das Benzin gebraucht, um Ulf und Mark und Svenja abzuholen.
Den ersten Strafzettel konnte Nicole noch abfangen, bevor er Rolf in die Hände fiel. Da die Ente auf seinen Namen lief, waren alle amtlichen Bescheide – Reparaturrechnungen inbegriffen – an ihn adressiert. Der nächste landete denn auch auf seinem Schreibtisch.
»Wer hat am Siebzehnten das Auto auf einem Behindertenparkplatz abgestellt?«
»Das war ich«, gab Katja sofort zu, »aber nur für fünf Minuten, weil ich …«
»Bist du behindert?« donnerte ihr Vater.
»Ja, geistig«, kommentierte Nicki halblaut.
»Bist du behindert?« wiederholte Rolf.
»Ich war behindert«, behauptete Katja prompt, »da hatte ich noch die beiden Finger in Gips.«
»Dann hättest du sowieso nicht fahren dürfen«, tobte Rolf. »Hätte man dich erwischt, wäre nämlich ich drangewesen.«
»Stimmt gar nicht, ich bin achtzehn und deshalb strafmündig.«
»Schön, daß du das einsiehst. Dann bezahle gefälligst auch den Strafzettel.«
»Mach ich ja. Gleich am nächsten Ersten.« Und dann, ziemlich kleinlaut: »Oder würdest du vielleicht … Du kannst es mir ja wieder vom Taschengeld abziehen. Danke.« Weg war sie, steckte aber noch einmal den Kopf durch die Tür. »Du mußt die Sache mal andersherum sehen, Paps. Wer sein Vaterland liebt, freut sich über ein Knöllchen. Es beweist doch, daß die öffentliche Verwaltung funktioniert.«
Weihnachten kam und ging, und wir hatten noch immer nichts gefunden, womit wir unsere Töchter für das demnächst fällige und natürlich glänzende Abitur belohnen konnten. Rolf war ohnehin dagegen. »Wieso die? Du hättest eine Anerkennung verdient für dreizehn Jahre Nachhilfeunterricht, für Frustabbau, Seelentrost, für Chauffeurdienste, für … ach, das weißt du doch viel besser als ich.«
»Großartige Idee«, sagte ich sofort, »und womit gedenkst du mich zu belohnen?«
So genau festlegen wollte er sich nun auch wieder nicht. »Mal sehen, vielleicht ein paar Tage Berlin? Natürlich erst, wenn der ganze Rummel hier vorbei ist.«
So allmählich warf »der Rummel« seine Schatten voraus. Vorzugsweise in Gestalt eines lang aufgeschossenen, bebrillten Jünglings namens Heiko, der jeden Nachmittag auftauchte und sofort mit Nicki in den oberen Gemächern verschwand.
»Was treiben die da eigentlich?« erkundigte ich mich schließlich bei Katja, die den Knaben nur mit einem kurzen »Hi!« zu begrüßen pflegte, um sich dann wieder ihrer jeweiligen Beschäftigung zu widmen. »Die machen Mathe. Am Vierzehnten sind wir mit der Abi-Klausur dran.«
»So bald schon?« fragte ich erschrocken.
»Wieso bald? Sechs Tage sind doch eine lange Zeit!«
Nun war mir hinlänglich bekannt, daß Katja mein mangelndes Begriffsvermögen für alles, was mit Zahlen zu tun hat, geerbt hatte. Über den Lehrsatz des Pythagoras war ich eigentlich nie hinausgekommen, und Katja hatte nicht einmal den kapiert. Auf meine Frage, ob sie es nicht für opportun halte, an den offenbar kostenlosen Nachhilfestunden teilzunehmen, schüttelte sie nur den Kopf. »Vergeudete Zeit. Was ich in neun Jahren nicht verstanden habe, werde ich in der letzten Woche auch nicht mehr begreifen. Mathe habe ich sowieso abgehakt. Wenn ich drei Punkte kriegen würde, wäre ich schon happy.«
(Sie bekam einen und ging damit in die Annalen des Gymnasiums ein als die Schülerin mit dem miesesten Mathe-Abitur, das jemals abgeliefert worden war.)
Überhaupt hatte ich den Eindruck, daß sie die bevorstehende Bewährungsprobe ein bißchen zu sehr auf die leichte Schulter nahm. Nicki paukte in jeder freien Minute, hatte bei den Mahlzeiten neben dem Teller Block und Bleistift liegen, seitdem ihr einmal beim Zerteilen ihres Schnitzels die Lösung für ein geometrisches Problem eingefallen war, und wenn man sie irgend etwas Belangloses fragte, bekam man als Antwort ein Genuschel, das ungefähr klang wie »die Koordinationsbindung gleich koordinative, dative oder semipolare Bindung …«
»Weißt du eigentlich, wovon du da redest?« wollte Rolf einmal wissen.
»Nee, deshalb lerne ich es ja auch auswendig«, gab Nicki zurück, »… steht der Atombindung nahe …«
»Was man sowieso nicht begreift, kann man wenigstens auch nicht vergessen«, sagte Katja, fuhr übers Wochenende zum Skilaufen, versäumte auch nicht die Geburtstagsparty ihrer zweitbesten Freundin, und wenn sie mal wirklich etwas las, dann waren es der Sportmoden-Katalog oder das Rezept für Chop-suey. »Ich kloppe mir doch nicht von morgens bis abends die Birne voll mit Dingen, die ich später ohnehin nie brauche. Wer will schon von einer Reiseleiterin Genaueres über den Westfälischen Frieden wissen?« Sprach’s, klapperte mit den Autoschlüsseln und verschwand.
Stimmt ja, ihr gegenwärtiges Berufsbild bestand aus einem palmengesäumten Strand irgendwo in fernen Ländern, an dem sie den größten Teil des Tages verbringen und nebenher einige Touristen betreuen würde, die sich eine solche Reise leisten konnten. Seit neuestem war der Bereich Touristik sogar zum Studienfach erhoben worden, was Katja außerordentlich begrüßte. Studieren wollte sie auf jeden Fall, nur hatte sie bisher noch nichts Passendes finden können. Noch vor einem Jahr hatte sie auf Fragen besorgter Verwandter, womit sie denn in näherer Zukunft ihren Lebensunterhalt zu bestreiten gedächte, geantwortet: »Weiß ich noch nicht. Vielleicht haben sie meinen Beruf ja noch gar nicht erfunden.«
Dann begannen die schriftlichen Arbeiten. Ich entfernte mich nie weiter als fünf Meter vom Telefon, wartete auf den erlösenden Anruf, der natürlich nie kam, weil sämtliche Prüfungskandidaten entweder die richtig beantworteten Fragen feiern oder die vermasselte Klausur in Tränen und/oder Alkohol ertränken mußten. Beides spielte sich in der schulnahen Pizzeria ab, konnte dreißig Minuten dauern oder dreihundert, und wenn dann wirklich das Telefon klingelte, hörte ich eine etwas kleinlaute Stimme: »Könntest du uns bitte abholen? Es ist besser, wenn wir uns jetzt nicht hinters Steuer klemmen.«
Am 22. Januar war der Streß vorbei, Ende Januar bekam Rolf die Nachricht, daß seine vor Monaten beantragte Kur bewilligt und bereits in zwei Wochen anzutreten sei. Sofort klickerte es bei mir. »Hattest du nicht mir eine Reise versprochen?«
»Du kannst ja mitkommen«, sagte er lauwarm, denn die wenigsten Ehemänner legen bei derartigen Unternehmungen Wert auf die Begleitung ihres Weibes, weil das die Freizeitgestaltung erheblich beeinträchtigt. Nicht umsonst wohnen wir in einem Kurort, ich weiß also Bescheid!