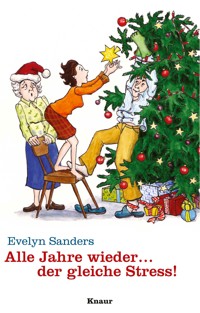6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Aus den drei älteren Sprösslingen der Sanders-Sippe sind Teenager mit großem Mundwerk und sehr eigenen Ideen geworden. Die ersten Freundinnen tauchen auf und sorgen für beträchtliche Gefühlsturbulenzen. Doch auch die jüngeren Zwillinge wissen nach wie vor einiges beizutragen zum allgemeinen Familienchaos... Wie gut, dass es die Mutter gibt, mit Nerven so dick wie fünf Drahtseile! Für alle, die süchtig sind nach der Familie Sanders: Dieser Roman er- zählt mit viel Herz und Verstand, wie?s weiterging nach Mit Fünfen ist man kinderreich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Evelyn Sanders
Jeans und große Klappe
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 1
Mami, hat eigentlich jeder König einen Augapfel?«???
»Na ja, hier steht nämlich: ›Der König hütete seine Tochter wie seinen Augapfel.‹«
Zum Kuckuck noch eins! Wann werden die Autoren von Lesebüchern endlich begreifen, daß ihre Konsumenten keine märchengläubigen Kinder mehr sind, sondern fernsehtrainierte Realisten, die sich nicht mit nebulosen Vergleichen abspeisen lassen. Ich erkläre also meiner neunjährigen Tochter Katja seufzend, was ein Augapfel ist und weshalb man ihn hüten muß.
Katja ist noch nicht zufrieden. »Wenn der doch aber angewachsen ist, dann braucht man ihn gar nicht zu hüten, der geht ja sowieso nicht verloren.«
Erfahrungsgemäß ist es in solchen Fällen angebracht, das Thema zu wechseln. »Wieso lest ihr in der dritten Klasse überhaupt noch Märchen?«
»Weil Frau Schlesinger die schön findet. Außerdem sollen wir das gar nicht lesen, sondern bloß die Tunwörter herausschreiben. Ist ›hütete‹ ein Tunwort?«
Jetzt schaltet sich Zwilling Nicole ein. »Natürlich ist das ein Tunwort, schließlich kannst du doch sagen: ›Ich tu die Schafe hüten‹!«
O heiliger Scholastikus, oder wer immer für die Einführung der allgemeinen Schulpflicht verantwortlich gemacht werden kann, hab’ Erbarmen! Da bemüht man sich jahrelang, seinen Kindern ein halbwegs vernünftiges Deutsch beizubringen, und kaum marschieren sie jeden Morgen bildungsbeflissen in ihren Weisheitstempel, vergessen sie alles und tun Schafe hüten.
Zum Glück taucht Stefanie auf, dreizehn Jahre alt, Gymnasiastin, mit den Lehrmethoden in Grundschulen aber noch hinlänglich vertraut.
»Jetzt mach’ den beiden bitte mal klar, warum Verben Tunwörter heißen, wenn man tun überhaupt nicht sagen darf!«
Steffi macht sich an die Arbeit. Sie kennt das schon. Bei der Mengenlehre muß sie auch immer einspringen. Die habe ich bis heute nicht begriffen. Als ich noch zur Schule ging, rechneten wir mit Zahlen und nicht mit Schnitt-, Rest- und Teilmengen.
Angeblich sollen die Kinder mit Hilfe der modernen Lehrpläne ein besseres Verständnis für Mathematik entwickeln. Stefanie hat in Mathe eine Vier.
Die Zwillinge haben inzwischen begriffen, was sie machen sollen, und schreiben eifrig. Wenn man sie jetzt sieht, die blonden Köpfe über die Hefte gebeugt, kann man sie tatsächlich für Zwillinge halten. Sonst nicht. Besucher, die nicht mit den Familienverhältnissen vertraut sind, vermuten in den beiden bestenfalls Schwestern, von denen die eine mindestens anderthalb Jahre älter ist. Nicole überragt ihre andere Hälfte um eine ganze Kopflänge, hat ein schmales Gesicht, braune Augen und ein sehr ausgeglichenes Naturell. Katja ist ein Quirl, aus ihren blauen Augen blitzt förmlich der Schalk, und um ihre Schlagfertigkeit beneide ich sie täglich aufs neue. Beleidigt ist sie nur, wenn man ihr doch sehr fortgeschrittenes Alter nicht respektiert und der Schaffner keine Fahrkarte verlangt, weil »der Kleine ja noch umsonst fährt«.
»Erstens bin ich ein Mädchen, und zweitens bin ich neun!« tönt es dann prompt zurück. Im Hinblick auf die Preise der öffentlichen Verkehrsmittel bin ich von Katjas Wahrheitsliebe nicht immer begeistert.
Als kürzlich ein Handarbeitsgeschäft neu eröffnet wurde und die Inhaberin kleine Werbegeschenke verteilte, kam Katja voller Empörung von ihrem Inspektionsgang zurück und erklärte mir drohend: »Wehe, wenn du in dem Laden mal irgend etwas kaufst. Nicki hat eine Stickkarte gekriegt, und mir hat die alte Krähe bloß einen Luftballon geschenkt. Den sollte ich mitnehmen zum Kindergarten. Na, der habe ich vielleicht was erzählt!«
Unsere Familie besteht aber nun keineswegs nur aus den drei Mädchen. Wie es der Statistik und auch einer ungeschriebenen Regel entspricht, hat der erste Nachkomme seit alters her ein Knabe zu sein. Der unsere heißt Sven, ist gerade volljährig geworden und trägt die Last des Erstgeborenen mit stoischem Gleichmut. Alle in ihn gesetzten Erwartungen hat er prompt mißachtet. Natürlich sollte er etwas ganz Besonderes werden, Diplomat mit internationalen Weihen, Dozent in Harvard oder wenigstens Wissenschaftler mit Aussicht auf den Nobelpreis. Selbstverständlich würde er die Intelligenz seines akademisch gebildeten Großvaters väterlicherseits mitbringen sowie die aufrechte Gesinnung seiner preußisch-beamteten Vorfahren mütterlicherseits, von der einem deutschen Beamten nachgesagten Ordnungsliebe ganz zu schweigen. (Svens Zeugnisse waren mehr als mittelmäßig, und sein Zimmer sah jahrelang aus, als sei gerade ein Hurrikan durchgefegt.) Natürlich würde er auch Durchsetzungsvermögen besitzen und sich für alles interessieren, was das Leben ihm bieten würde. (Sven ließ sich bereits im Kindergartenalter von Jüngeren verdreschen und interessierte sich ausschließlich für Tiere, vorzugsweise für kleinere, etwa vom Maikäfer an abwärts.) Eine Zeitlang züchtete er Goldhamster und studierte ihr Familienleben. Sein Vater schöpfte wieder Hoffnung. Schließlich hatte sich Konrad Lorenz auch bloß mit Gänsen beschäftigt und trotzdem den Nobelpreis bekommen.
Nachdem Sven jahrelang Spinnen, Asseln und ähnliches Gewürm seziert, katalogisiert und in Weckgläsern aufbewahrt hatte, schmiß er eines Tages das ganze Eingemachte in die Mülltonne und widmete sich der heimischen Flora. Jetzt wurden die Staubgefäße von Gladiolen mikroskopiert, Kreuzungsversuche zwischen Astern und Dahlien unternommen – sie sind aber nicht geglückt – und eine Verbesserung der Rasenstruktur in unserem Garten ausprobiert. Seitdem kämpfen wir vergeblich gegen den Gemeinen Wiesenklee an.
Immerhin hat Sven die etwas eigenartigen Auswüchse seiner Naturverbundenheit zu seiner Lebensaufgabe gemacht. Er will Gartenbau-Ingenieur werden.
Da die Diskrepanz zwischen Wunschdenken und Realität hinsichtlich der Zukunft seines Stammhalters ziemlich früh offenkundig wurde, verlagerte der etwas enttäuschte Vater seine Hoffnungen auf Sohn Nr. 2.
Sascha wurde anderthalb Jahre nach Sven geboren und berechtigte schon im zarten Kindesalter zu den hoffnungsvollsten Erwartungen. Bereits mit 15 Monaten kannte sein Tatendrang keine Grenzen, und seine körperliche Leistungsfähigkeit bewies er zum erstenmal sehr nachhaltig, als er den brennenden Weihnachtsbaum umstieß. Eine größere Katastrophe wurde durch das zufällige Vorhandensein einer gefüllten Kaffeekanne verhindert, aber wir brauchten neue Gardinen, und gleich nach Neujahr mußte der Maler kommen.
Als Sascha zwei Jahre alt war, schmiß er seinen Bruder in den Goldfischteich. Mit drei Jahren demolierte er durch eine in diesem Alter ungewohnte Treffsicherheit das nagelneue Luxusauto eines Nachbarn, der einem längeren Krankenhausaufenthalt nur durch die Reaktionsschnelle entging, mit der er hinter seiner Staatskarosse Deckung nahm. Der Versicherungsvertreter, seit zwei Jahren Dauergast in unserem Haus, erwog schon einen Berufswechsel.
Mit vier Jahren sprang Sascha vom Dreimeterbrett, obwohl er überhaupt noch nicht schwimmen konnte, und erreichte mehr tot als lebendig den Deckenrand. Mit viereinhalb fiel er aus einem sechs Meter hohen Apfelbaum – selbstredend war es ein fremder – und brach sich zum erstenmal den Arm. Mit fünfeinhalb kam er in die Schule.
Hier ließ seine Aktivität schlagartig nach. Den Sprung aufs Gymnasium schaffte er nur mit Ach und Krach, und daß er nicht wieder geflogen ist, verdankt er wohl hauptsächlich seiner Klassenlehrerin. Während einer der zahlreichen Rücksprachen, zu denen ich regelmäßig zitiert wurde, vertraute sie mir seufzend an: »Manchmal möchte ich den Bengel ja zum Fenster hinauswerfen, aber irgendwie mag ich ihn trotzdem. Ich habe immer noch die Hoffnung, daß er eines Tages aufwacht. Seine Intelligenz ist mindestens genauso groß wie seine Faulheit.«
Demnach muß Sascha ein Genie sein! Bisher versteht er es aber meisterhaft, diese Tatsache zu verbergen.
Dann kam Stefanie, ein dunkelhaariges, dunkeläugiges Bilderbuchbaby mit Löckchen, Grübchen und allen sonstigen Attributen, die man sich für ein Mädchen wünscht. Sobald sie auf ihren ziemlich stämmigen Beinchen stehen konnte, brach sie in ohrenbetäubendes Gebrüll aus, wenn ich ihr ein Kleid anziehen wollte. Sie bestand auf Hosen (darauf besteht sie auch heute noch), warf ihre Puppen auf den Misthaufen und wünschte sich zum Geburtstag Fußballschuhe. Alle Versuche, wenigstens äußerlich ein Mädchen aus ihr zu machen, scheiterten. Als der Zeitpunkt nahte, an dem die Merkmale ihres Geschlechts sichtbar wurden, rangierte sie alle Pullover aus und klaute die Sporthemden ihrer Brüder. Die waren natürlich viel zu groß, hingen wie Säcke um ihren Körper und verbargen alle verräterischen Anzeichen.
Das Verhältnis zu ihren Brüdern ist – gelinde gesagt – gespannt. Mit Sven verträgt sie sich ganz gut, weil der sie mit der Weisheit des Alters betrachtet und ihr gegenüber ein großväterliches Gebaren an den Tag legt. Zwischen Steffi und dem vier Jahre älteren Sascha herrscht permanenter Kriegszustand. Spätestens nach drei Minuten blaffen sie sich gegenseitig an, nach fünf Minuten liegen sie sich in den Haaren. Ältere und somit erfahrenere Mütter versicherten mir immer wieder, das sei ganz natürlich und müsse so sein. Beurteilen kann ich das nicht, ich bin ein Einzelkind.
Aufgewachsen in Berlin, er- und verzogen von Eltern, Großeltern, Urgroßmutter und Tante, wurde ich erst mit fünfzehn einigermaßen selbständig, als wir nach Düsseldorf zogen und die Verwandtschaft hinter uns ließen. Meine ersten Brötchen verdiente ich als Redaktionsvolontärin bei einer Tageszeitung und schrieb für die Lokalredaktion Berichte über Verbandstreffen der Kaninchenzüchter und Jahrestagungen des Schützenvereins von 1886. Freitags marschierte ich mit Presseausweis dreimal ins Kino, um den interessierten Lesern meine Meinung über neu ins Programm aufgenommene Filme mitzuteilen. Weil man aber beim besten Willen keine Lobeshymnen singen kann, wenn man ›Heimat, deine Sterne‹ oder ›Der Rächer von Arkansas‹ über sich ergehen lassen muß – die besseren Filme behielten sich natürlich die arrivierteren Kollegen vor –, protestierten die Kinobesitzer bald gegen mein Erscheinen. Künftig schrieb ich nur noch über Taubenzüchter und Briefmarkensammler. Ich wollte meine journalistische Laufbahn schon an den Nagel hängen und notfalls Schuhverkäuferin werden, als ein wagemutiger Verleger eine Kinderzeitung gründete und Mitarbeiter suchte. Meine Bewerbung hatte Erfolg, statt über ›Wildwest in Oberbayern‹ schrieb ich jetzt über ›Pünktchen und Anton‹, und bevor die Zeitschrift nach anderthalb Jahren ihr Erscheinen wieder einstellte, heiratete ich noch schnell ihren Chefredakteur.
Böse Zungen haben später behauptet, dieser Herr habe sich mehr seinen Mitarbeiterinnen als seiner beruflichen Tätigkeit gewidmet und deshalb sei der »Dalla« auch eingegangen. Dagegen muß ich mich entschieden verwahren! Nur durch meine aufopferungsvolle Arbeit, die mich oft genug bis in die Abendstunden an die Redaktionsräume gefesselt hatte, ist die Zeitschrift überhaupt alle 14 Tage pünktlich erschienen! Unser Boß wurde erst in den späten Nachmittagsstunden richtig munter und erwartete von seinem Stab dasselbe.
Der Ex-Chefredakteur, nunmehr Ehemann und stellungslos, besann sich auf seine frühere Ausbildung, die mal am Setzkasten angefangen und auf der Kunstakademie geendet hatte, vermischte diese Kenntnisse mit seiner angeborenen Überredungsgabe sowie einem mittlerweile erworbenen Organisationstalent und wurde Werbeberater. Das ist er noch heute.
Seine angetraute Gattin, die er von ihren acht Stunden Büroarbeit erlöst hatte, damit sie vierzehn Stunden im Haushalt arbeiten konnte, beschäftigte sich anderthalb Jahrzehnte ausschließlich mit Brutpflege und Haushaltsführung, wenn man von dem unbezahlten Nebenjob als Sekretärin, Buchhalterin, Telefonistin und Steuerberaterin einmal absieht. Ihre literarischen Ambitionen tobte sie in langen Briefen an die Verwandtschaft aus, später auch in den Hausaufsätzen ihrer schulpflichtigen Kinder. Ob die Lehrer davon begeistert waren, entzieht sich meiner Kenntnis – vermutlich wußten sie es nicht –, die Verwandtschaft jedenfalls war es. Entfernte Tanten, die ich bestenfalls zu Weihnachten mit einer vorgedruckten Karte und herzlichen Festtagsgrüßen beglückte, spielten in ihren Dankschreiben auf irgendwelche familiären Ereignisse an, von denen sie eigentlich gar keine Ahnung haben konnten. Schließlich erfuhr ich von meiner Großmutter, daß sie die für sie bestimmten Briefe zu Rundschreiben umfunktionierte und allen möglichen Leuten schickte. Sogar ihren Kränzchenschwestern las sie längere Passagen daraus vor.
Mißtrauisch geworden forschte ich weiter. Der väterliche Großvater pflegte meine Briefe mit sich herumzutragen und sie seinen Skatbrüdern vorzulesen, wobei ich um der Wahrheit willen zugeben muß, daß er Familieninterna aussparte und sich nur auf Schilderungen beschränkte, die seine Urenkel betrafen. Meine Freundin brachte Saschas Schandtaten bei gelegentlichen Klassentreffen zu Gehör, und meine Lieblingstante übersetzte einzelne Briefstellen ins Englische, um sie in verständlicher Form weitergeben zu können. Sie lebt in Los Angeles.
Meine erste Reaktion war Empörung. Wie kann man persönliche Briefe … wenn auch nur auszugsweise … und wen interessierte es überhaupt, wann und warum bei uns der Haussegen schiefhing?
Dann kamen die Antworten. Tante Lotti wollte wissen, wie denn die Sache mit der Theateraufführung ausgegangen war, und Onkel Henry forderte nähere Einzelheiten über den einzementierten Weihnachtsbaum an.
Der Gatte Rolf, dem ich kopfschüttelnd den vermehrten Posteingang vorlegte, empfahl mir, künftige Briefe auf Matrize zu schreiben und an Dauerabonnenten zu verschicken. »Aber per Nachnahme, damit du wenigstens die Portokosten wieder reinkriegst!«
Wann ich auf die Idee gekommen bin, über unsere Familie ein Buch zu schreiben, weiß ich nicht mehr. Vermutlich damals, als Sven und Sascha zum soundsovielten Mal zum Polizeirevier zitiert wurden, weil sie etwas ausgefressen hatten. Ich sehnte mich mal wieder nach unserer dörflichen Idylle zurück, in der es keinen Polizeiposten gegeben hatte und Lausbubenstreiche von den Betroffenen unbürokratisch-handfest und daher sehr nachhaltig behandelt worden waren. Andererseits war die Idylle ja gar nicht so idyllisch gewesen, und wenn wir die helfende Hand unserer Wenzel-Berta nicht gehabt hätten …
Kurz und gut, ich setzte mich an die Schreibmaschine (Jahrgang 1949 und schon ziemlich altersschwach) und fing an zu tippen. Die Familie, an gelegentlich ausbrechenden Eifer bei der Beantwortung von Privatbriefen gewöhnt, ertrug das Geklapper mit Fassung. Nach drei Wochen äußerte Rolf die Vermutung, ich müßte nunmehr wohl die gesamte Post der vergangenen zwei Jahre erledigt haben, einschließlich Glückwünschen, Kondolenzschreiben und Festtagsgrüßen.
Ein Windstoß lüftete mein sorgsam gehütetes Geheimnis. 43 Manuskriptblätter segelten durch das geöffnete Fenster in den Garten, wo sie von Sven zwar diensteifrig eingesammelt, aber nebenbei auch oberflächlich gelesen wurden.
Die Bombe platzte. Die Familie ebenfalls.
»Mußt du denn jetzt auch auf dieser Welle mitschwimmen? Selbstverwirklichung oder wie der Quatsch sonst noch heißt? Knüpf’ doch wenigstens Teppiche, dann haben wir alle was davon!« Das war Sven.
Sascha war praxisbezogener: »Für so was sitzt du nun stundenlang an der Schreibmaschine, aber meinen Knopf von den Jeans hast du immer noch nicht angenäht. Die Tasche vom Parka ist auch ausgefranst!«
Rolf sagte überhaupt nichts und beschränkte sich auf ein mitleidiges Lächeln. Ein paar Tage später meinte er gönnerhaft: »Du kannst mir ja mal dein Manuskript zeigen, vielleicht läßt sich wirklich etwas daraus machen.«
»Du bist nicht mehr mein Chef und ich nicht mehr dein Textlieferant!« giftete ich zurück. »Kümmere dich lieber um deine Bandnudeln!« Seit Tagen schon suchte er nach einem zugkräftigen Slogan für ein neues Teigwarenprodukt.
Die Knaben wollten Leseproben, kriegten keine, fingen an zu sticheln.
»Schade um das viele schöne Papier!«
»Wieviel zahlt eigentlich das Fernsehen für Verfilmungsrechte?«
»Hast du schon Autogrammpostkarten?«
Nur nicht hinhören! redete ich mir selbst gut zu, wenn ich nachmittags mit Schreibmaschine, Zigaretten und Kaffeekanne in Steffis Zimmer zog, die zwar pflichtgemäß gegen ihre zeitweilige Ausbürgerung protestierte, sich aber ohnehin so gut wie nie in ihren eigenen vier Wänden aufhielt.
Kurz vor Weihnachten hatte ich mein Opus beendet, stopfte 198 beschriebene Blätter in eine Schublade und widmete mich schuldbewußt und daher mit doppeltem Eifer der Festtagsbäckerei. Die Kinder hatten bereits ernsthaft eine Übersiedlung zu den Großeltern erwogen, denn normalerweise waren sie um diese Jahreszeit schon fündig geworden, wenn sie Pirschgänge in den Vorratskeller unternommen hatten. Diesmal waren die Keksdosen aber noch alle leer. Und Steffis Haferflockenplätzchen fraß nicht mal der Hund von gegenüber.
Was macht man nun mit einem Buchmanuskript, wenn man nicht Konsalik heißt und nicht Kishon, wenn man am vorletzten Ende der Welt lebt, keine einschlägigen Beziehungen hat und neben dem Frühstücksteller des öfteren so ermunternde Zeitungsausschnitte entdeckt wie beispielsweise den Hinweis, daß jährlich etwa 80 000 Neuerscheinungen auf den deutschen Buchmarkt kommen? Entweder man resigniert, was nun aber nicht meinem Charakter entspricht, oder man begibt sich in die ortsansässige Buchhandlung, bekundet ein bisher nicht geäußertes Interesse an literarischen Angeboten und deckt sich mit zwei Dutzend verschiedenen Verlagsprogrammen ein. Diesen Schatz trägt man nach Hause, wo man tunlichst die Literaturpäpste aussortiert, weil sie natürlich gar nicht in Betracht kommen. Schließlich ist man ja nicht größenwahnsinnig.
Die verbliebenen Prospekte breitet man auf dem Fußboden aus und kehrt ihnen den Rücken zu. Dann wirft man einen Pfennig über die Schulter. Ich versuchte es dreimal. Der erste rollte unter die Zentralheizung, der zweite landete im Papierkorb, und erst der dritte blieb liegen. Alsdann entwirft man ein Begleitschreiben, schickt das Manuskript ab und hofft, daß der Verleger beim Empfang desselben erstens Humor, zweitens nicht gerade einen Bestseller-Autor zu Besuch und drittens gut gefrühstückt hat. Der meine hatte. Name und Anschrift stehen auf Wunsch zur Verfügung.
Kapitel 2
Wir leben in einem Kurort. Es ist nur ein kleiner und wohl hauptsächlich einigen Versicherungsanstalten bekannt, die vorzugsweise ihre noch nicht kurerfahrenen Mitglieder hierherschicken. Beim nächstenmal wollen die aber auch woanders hin. Warum? Ich weiß es nicht.
Gekurt wird hier mit Sole. Ob die nun eine Begleit- oder Folgeerscheinung oder nur ein Nebenprodukt der Salzgewinnung ist, kann ich nicht sagen, jedenfalls baut man schon seit Jahren kein Salz mehr ab. Die Sole jedoch plätschert immer noch, füllt das Freibad, das Hallenbad, den Sprudelbrunnen und in gesundheitsfördernder Dosierung das Kurmittelhaus bzw. die dort befindlichen Inhalationsgeräte, Badewannen und was es sonst noch an therapeutischen Hilfsmitteln gibt. Behandelt werden laut Prospekt sämtliche Erkrankungen der Atemwege, aber auch andere Leiden, für die normalerweise Internisten zuständig sind.
Dann gibt es noch unverhältnismäßig viele Fußkranke hier, Patienten mit demolierter Bandscheibe und solche mit gebrochenen Gliedern. Die kommen aber nicht wegen der Sole, sondern wegen der orthopädischen Klinik, jahrzehntelang das am höchsten gelegene Bauwerk dieses Ortes, nunmehr jedoch von modernen Wohnsilos überrundet. Stefanie kennt übrigens den gesamten Ärztestab und die halbe Schwesternschaft der Klinik. Wenn sie nicht gerade selbst in der Ambulanz sitzt und auf Röntgenaufnahme, Verbandwechsel oder Gipsarm wartet, dann besucht sie wenigstens eine Freundin, die gerade ihren Knöchelbruch oder ihren Bänderriß auskuriert.
Natürlich ist diese orthopädische Klinik nicht die einzige Bettenburg im Ort. Wir haben mehrere Sanatorien, allesamt noch ziemlich neu und entstanden während der wirtschaftlichen Hochkonjunktur, als noch so ziemlich jeder Arbeitnehmer alle zwei Jahre »in Kur ging«, und sein Chef sich freute, wenn er wieder zurückkam, weil er keine Vertretung gefunden hatte. Inzwischen hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt ja etwas geändert, und hörte man zumindest während der Sommermonate auf den hiesigen Straßen fast nur rheinischen oder Berliner Dialekt, so überwiegt jetzt wieder der schwäbische.
Apropos schwäbisch. Verwaltungstechnisch liegt Bad Randersau in Baden-Württemberg, wenn auch in der äußersten Ecke; geographisch gehört es nach Baden, mentalitätsmäßig nach Schwaben und sprachlich irgendwo dazwischen.
Ein Stuttgarter Schwabe schwätzt anders als ein Heilbronner Schwabe, aber beide können sich ohne Schwierigkeiten verständigen. Ein Bad Randersauer Schwabe schwätzt ein Konglomerat von schwäbisch, badensisch, pfälzisch, durchsetzt mit ein paar alemannischen Brocken und gekrönt von einer Grammatik, die Herrn Duden selig im Grabe rotieren lassen würde, könnte er sie hören.
Als wir vor acht Jahren hierherzogen, waren unsere drei Ältesten der deutschen Sprache recht gut mächtig und gegen Dialekteinflüsse gefeit. Anders die Zwillinge. Sie besuchten den hiesigen Kindergarten, sprachen zu Hause hochdeutsch, auf der Straße »einheimisch«, und wenn sie unter sich waren, kauderwelschten sie ihre ureigene Mischung. »Hast du au alls scho die kloine Kätzle in Bettina seine Oma ihre Scheune gesehen?«
Ein Kurort – hierorts Heilbad genannt – lebt von seinen Kurgästen und folglich auch für dieselben. Die Einwohner werden deshalb auch in sporadischen Abständen durch Aufrufe im Gemeindeblättchen angehalten, alles für das Wohlergehen der Kurgäste zu tun. Besonderer Wert gelegt wird auf regelmäßige Gehsteigreinigung, sommerlichen Blumenschmuck und die Einhaltung der Baderegeln, die zumindest im Hallenbad sehr streng gehandhabt werden. Man darf nur im Kreis schwimmen, und auch das nur in einer Richtung.
Außer den bereits genannten Einrichtungen gibt es ferner: Ein Kurhaus mit Bühne, wo in regelmäßigen Intervallen das Tegernseer Bauerntheater, die Württembergische Landesbühne und gelegentlich prominente Fernsehstars gastieren; letztere bedingen höhere Eintrittspreise sowie Kartenvorverkauf. Im Kurhaus finden auch der Silvester- und der Rosenball statt, desgleichen die gehobeneren Faschingsfeste. Die anderen werden in die Mehrzweckhalle verlegt. Da es sich hierbei um die Turnhalle handelt, fällt in den Tagen vor und nach derartigen Großveranstaltungen der Sportunterricht in den Schulen aus.
Neben dem Kurhaus mit Restaurationsbetrieb und dreimal wöchentlich Tanztee gibt es noch diverse Gaststätten mit »Stimmungsmusik«. Der fest engagierte Hammondorgel- oder Akkordeonspieler genießt bereits den Vorteil der 36-Stunden-Woche, denn fast alle Tanzvergnügen enden pünktlich um 22 Uhr, weil Zapfenstreich ist. Kasernierte Kurgäste müssen um 22.30 Uhr zu Hause sein. Die Privaten haben natürlich unbefristeten Ausgang.
Wir haben etwa zwei Dutzend Kneipen – Imbißhalle und Reiterklause eingeschlossen –, ein wirklich herrliches Freibad, das auch außerhalb des Landkreises bekannt ist und an Wochenenden von Heidelberger, Mannheimer und sogar Stuttgarter Mitbürgern bevölkert wird, einen Minigolfplatz, einen Reitstall und eine Kurbibliothek. Nicht zu vergessen den zauberhaften Mischwald mit sehr gepflegten Wegen, mit Schutzhütten, die nach Einbruch der Dunkelheit von Liebespärchen frequentiert werden (das läßt sich unschwer an den eingeritzten Herzchen mit Monogramm erkennen), mit Reitwegen, Brombeersträuchern, Pilzen und last, but not least dem Waldsee. Der ist zwar klein, aber sehr romantisch und dient den Kurgästen als lebender Abfalleimer für harte Brötchen und von den auf Diät gesetzten Patienten verschmähten Vollkornbrotscheiben. Die Karpfen im Waldsee sind auch alle wohlgenährt und so zutraulich, daß sie vermutlich jedem aus der Hand fressen würden, wenn man es versuchte. Sascha hat sogar einmal zwei Karpfen geangelt, und zwar mit einem Stück Bindfaden und einer aufgebogenen Büroklammer. Verboten ist das trotzdem.
Für Jogging-Freunde und sonstige Gesundheitsapostel gibt es auch einen Trimmpfad mit zwanzig Haltepunkten, wo man die auf Blechschildern illustrierten Freiübungen veranstalten kann. Manchmal begegnet man tatsächlich schwitzenden Mitbürgern, die sich an Reckstangen hochrangeln oder Holzbalken verschiedener Stärke schwingen, falls diese nicht gerade einmal wieder von einem weniger gesundheitsbewußten Kaminbesitzer als Feuerholz geklaut worden sind.
Man sieht also, daß für Gesundheit und Freizeitvergnügen unserer Kurgäste sehr viel getan wird. Wer nicht gut zu Fuß ist und trotzdem lustwandeln möchte, kann es im Kurpark tun, wo es mehr Bänke als Bäume gibt. Die Kurparkschwäne auf dem Kurparksee mögen übrigens kein Brot mehr, sie fressen lieber Salat.
Wer wandern will, kann auch das zur Genüge tun. Bedauerlicherweise liegen alle sehenswerten Ausflugsziele außerhalb der Gemeindegrenzen, was besonders die ortsansässigen Gastwirte etwas verbittert. Deshalb besteht wohl auch die zwar immer abgestrittene, trotz allem aber seit jeher vorhandene Rivalität zwischen Bad Randersau und dem 5 Kilometer entfernten Nachbarort, der dank seines mittelalterlichen Stadtkerns schon oft den Hintergrund für Fernsehspiele und Trachtenfeste abgegeben hat. Darum ist er auch bekannter. Hübscher ist er auf jeden Fall.
An Sehenswürdigkeiten hat Bad Randersau eigentlich nur sein Wasserschloß zu bieten, das dann auch auf fast jeder Ansichtskarte und mehrmals im Prospekt wiederzufinden ist. Eine Zeitlang diente es sogar als Kurheim, nun wird es umgebaut. Sollte es jemals fertigwerden, dann zieht hier die Stadtverwaltung ein.
Zum Wasserschloß gehört auch ein Wehrturm, der zwar etwas abseits, dort aber schon seit über 500 Jahren steht. Man hat ihn des Denkmalschutzes für würdig befunden, und nun muß immer um ihn herumgebaut werden. Das neu errichtete Gemeindezentrum, über dessen Sinn und Zweck noch allgemein gerätselt wird, steht auch in seinem Windschatten.
Über das Wohl und Weh der 13 874 ständigen und der wechselnden Zahl vorübergehender Bewohner wachen die Polizei und der Herr Bürgermeister. Letzterer ist sehr beschäftigt, was die interessierten Untertanen allwöchentlich im Gemeindeblatt nachlesen können. Es gibt so gut wie keine Ausgabe, in der wir unser Stadtoberhaupt nicht beim Pflanzen einer Eiche (Tag des Baumes) bewundern können, beim Startschuß zum Sackhüpfen (Tag des Kindes), beim Überreichen eines Präsentkorbes für einen langgedienten Verwaltungsangestellten oder beim Besichtigen der neuerworbenen Drehleiter für die freiwillige Feuerwehr. Besucht uns gar ein Abgesandter der Landesregierung, dann gibt es eine wahre Bilderflut im Blättchen: Der Herr Bürgermeister bei der Begrüßung, der Herr Bürgermeister bei der Entgegennahme des Gastgeschenks, der Herr Bürgermeister im Kreise seiner Mitarbeiter (v. l. n. r. Gemeinderatsmitglied Sowieso, Stadtoberamtmann Soundso …), der Herr Bürgermeister bei der Verabschiedung des hohen Gastes. In der nächsten Nummer folgt dann der genaue Wortlaut der Tischreden.
Nun besteht Bad Randersau nicht nur aus Kurgästen, und seine Dauereinwohner können nicht von Kneipen und Friseuren allein leben. Deshalb gibt es drei Supermärkte und einige Tante-Emma-Läden, zwei Apotheken, ein Textilkaufhaus, drei Schuhgeschäfte, einen Handarbeitsladen, diverse andere Geschäfte, eine Post und eine Verkehrsampel. Nicht zu vergessen den Bahnhof in Himbeereisrosa, auf dem um 18.51 Uhr der letzte Zug abfährt, und drei Bankfilialen. Eine davon wurde unlängst zur Mittagsstunde überfallen und beraubt, was ein Verkehrschaos zur Folge hatte. Sämtliche Zufahrtsstraßen wurden gesperrt; die von dieser unerwarteten Gewalttat völlig überraschte Polizei kontrollierte gewissenhaft Autofahrer und auch ein paar gammelnde Jugendliche, die irgendwo am Stadtrand zelteten, aber den Bankräuber erwischte sie nicht. Wie später ermittelt wurde, hatte er den Tatort mit dem fahrplanmäßigen Eilzug um 13.21 Uhr Richtung Heilbronn verlassen. »Fahre sicher mit der Bundesbahn!«
Nun wird jeder (mit Recht!) fragen, weshalb wir überhaupt hergezogen sind, wenn es mir doch ganz offensichtlich hier gar nicht gefällt. Diese Vermutung ist übrigens falsch. Man kann hier wirklich recht gut leben, zumindest sehr geruhsam, aber als typisches Großstadtgewächs fällt es mir immer noch schwer, mich mit den kleinstädtischen Unzulänglichkeiten abzufinden. Ich wäre seinerzeit auch lieber in einen etwas größeren Ort gezogen, aber dieser Wunsch scheiterte an der zu Unrecht propagierten Kinderfreundlichkeit bundesdeutscher Hausbesitzer.
Den letzten Hauswirt hatte unsere zahlreiche Nachkommenschaft nicht gestört, hauptsächlich wohl deshalb, weil er fünfzig Kilometer entfernt wohnte und seinen als Kapitalanlage gedachten Neubau in einem 211-Seelen-Dorf an normale Sterbliche nicht vermieten konnte. Er war ein paar Nummern zu groß geraten. So lebten wir ein Jahr lang fern der Zivilisation und in friedlicher Gemeinschaft mit Katzen, Wühlmäusen, Käfern und Kellerasseln, bis der Hauswirt pleite machte und das Haus samt vierbeinigem Inventar verkaufen mußte. Das zweibeinige bekam die Kündigung, setzte drei Makler in Lohn und Brot, besichtigte wochenlang Luxusbungalows und Drei-Zimmer-Einliegerwohnungen, fand sich schon mit dem Gedanken der Übersiedlung in ein Obdachlosenasyl ab und entdeckte sozusagen in letzter Minute ein akzeptables Domizil, das sofort bezogen werden konnte. Der Standort war unter diesen Umständen natürlich Nebensache, außerdem erschien mir Bad Randersau nach der Einöde Heidenbergs sogar als Rückkehr ins Paradies. Aber auch Adam und Eva sind ja bekanntlich nicht zufrieden gewesen.
Schon während der Umzugsvorbereitungen war ich ständig zwischen Heidenberg und Bad Randersau gependelt, hatte Blumentöpfe transportiert, Fenster ausgemessen und die Nachbarschaft schonend auf die kommende Invasion vorbereitet. Die war dann aber ganz beruhigt, daß wir nur fünf eigene Kinder hatten und es sich bei den übrigen acht bis zehn, die unentwegt in Haus und Garten herumquirlten, lediglich um neuerworbene Freunde handelte. Sascha hatte bereits vier feste und ein paar andere, die auch »schwer in Ordnung« waren, Sven schwankte noch zwischen einem knapp Zwei-Zentner-Knaben und einem hochaufgeschossenen Vierzehnjährigen, der Griechisch lernte, und Stefanie sortierte alle sechs- und siebenjährigen Nachbarskinder durch und entschied sich für eine stämmige Achtjährige, die Katharina hieß und wie ein Junge aussah. Die Zwillinge äußerten noch keinen Wunsch nach Kommunikation, sondern begnügten sich damit, Haus und Garten zu erforschen und bei diesen Streifzügen die Kellertreppe hinunterzufallen, die Finger in der Balkontür einzuklemmen und schließlich samt Roller in ein Baggerloch zu stürzen. Wir nahmen zum erstenmal die Unfallstation der orthopädischen Klinik in Anspruch.
Die dritte Karteikarte, ausgestellt auf Sascha, wurde vier Wochen später angelegt. Zu seinem Freundeskreis gehörte ein Knabe namens Andreas, Andy genannt, der nicht nur technisch begabt war, sondern darüber hinaus mitunter merkwürdige Einfälle hatte. So hatte er Sascha ziemlich schnell von den Vorteilen einer direkten Sprechverbindung von seinem zu unserem Haus überzeugen können. Da ich in Physik immer eine Vier hatte und bis heute noch nicht erklären kann, wie ein ganz normales Telefon funktioniert, sind mir natürlich die technischen Einzelheiten dieses Sprechfunks nicht mehr geläufig. Ich weiß nur, daß irgendwo eine Antenne angebracht werden sollte, und Andy hielt den oberen Teil der Regenrinne für den geeigneten Standort. Nun hätte man denselben zwar vom Zimmerfenster aus erreichen können, aber Sascha zog den direkten Weg vor. Die Regenrinne war nicht mehr ganz neu, außerdem »hat dieses Kamel von Andy immerzu an dem Draht gezogen«, jedenfalls segelte Sascha abwärts, landete in den Buschrosen und wurde anschließend, bäuchlings auf den Rücksitzen liegend, in die Klinik gekarrt. (Seitdem zieht er eine Badehose wirklich nur noch zum Baden an.)
In den folgenden Jahren gehörten Saschas Mannen schon fast zur Familie, und deshalb sollen sie lieber gleich kurz vorgestellt werden:
Andy wurde schon erwähnt. Er fiel mir gleich in den ersten Tagen durch exzellente Höflichkeit auf und durch die Bereitwilligkeit, mit der er gegen die letzten Nachwirkungen des gerade überstandenen Umzugs ankämpfte. Andy schlug Nägel in die Wände, und zwar dort, wo sie hin sollten, und nicht dort, wo Sven am leichtesten in die Mauer kam; Andy räumte Pappkartons weg und holte Zigaretten. Andy fing die ausgebüxten Zwillinge ein und verpflasterte Steffis aufgeschürftes Knie; Andy holte von zu Hause Verbandszeug, weil Sven in Ermangelung von Isolierband unser Leukoplast zum Reparieren der Tischlampe gebraucht hatte. Andy wollte sogar den Rasen mähen. Der Rasenmäher war kaputt. Das war er schon seit sechs Wochen.
»Haben Sie Handwerkszeug?«
Natürlich hatten wir welches! Bloß wo?
Andy holte eigenes und machte sich ans Werk. Nach einer Stunde gab der Mäher bereits röchelnde Töne von sich. Beim zweiten Startversuch verwandelte er sich in ein feuerspeiendes Ungetüm, beim dritten riß die Zündschnur ab. Andy gab nicht auf. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit knatterte die Maschine dann auch wirklich schön gleichmäßig vor sich hin, und Andy schnitt stolz eine breite Schneise in den Löwenzahn, unter dem wir den Rasen vermuteten. Allerdings stellte er sofort wieder den Mäher ab und wischte sich das Grünzeug aus Gesicht und Haaren. Auf rätselhafte Weise hatte der Grasauswerfer die Richtung geändert und spuckte den gemähten Rasen senkrecht nach oben.
»Ich nehme das Ding lieber mal mit nach Hause«, meinte Andy etwas kleinlaut. »Mein Vater kriegt das schon wieder hin.«
Den Staubsauger hat er allerdings prima repariert, wenn auch die Ersatzteile annähernd so teuer waren wie ein neues Gerät. Und daß die Heizplatte von der Kaffeemaschine wieder funktionierte, hatte ich auch Andy zu verdanken. Man konnte ihm ja keine Schuld dafür geben, daß seitdem das Wasser unten herauslief.
»Klarer Fall von Materialmüdigkeit«, bekräftigte denn auch Sascha, »der Automat ist doch schon fast zwei Jahre alt.«
Dritter im Bunde war Manfred. Groß, dunkler Lockenkopf, sehr zurückhaltend und ein bißchen wortkarg, letzteres aber nur, wenn Erwachsene in Hörweite waren. Manfred hatte den Kopf voller Dummheiten und brütete ständig neue aus. Andy steuerte im Bedarfsfalle sein technisches Know-how bei, und Sascha war meist ausführendes Organ. Wurden weitere Hilfskräfte gebraucht, traten Wolfgang und Eberhard auf den Plan.
Wolfgang war reinblütiger Schwabe, sprach unverfälschten Dialekt und verstand mich genausowenig wie ich ihn. Anfangs mußte Sascha dolmetschen, später brauchte er nur noch Wolfgangs Antworten zu übersetzen, weil der inzwischen Hochdeutsch konnte. Nach einem halben Jahr etwa vermochten wir uns endlich ganz zwanglos zu unterhalten.
Eberhard, Hardy genannt, war mir sofort sympathisch. Er war Berliner (ich auch), aufgewachsen in Kreuzberg (ich nicht) und seiner Heimatsprache treu geblieben. Übrigens war er der einzige des ganzen Vereins, der nicht das Gymnasium besuchte, sondern die ortsansässige Realschule.
»Meine Mutter hat jesacht, zum Studieren bin ick sowieso zu dämlich. Außerdem soll ick ja mal den Laden von Opa übernehmen, und der braucht keenen Tischler mit Latein!«
Wieso es Hardy vom heimischen Kreuzberg ins schwäbische Randersau verschlagen hatte, habe ich nie herausbekommen. Es hatte irgend etwas mit der kranken Oma und den türkischen Gastarbeitern zu tun.
Sven wurde zwar von Saschas Freundeskreis akzeptiert und mischte manchmal kräftig mit, aber er hatte auch seine eigenen Kumpane, die von Sascha jedoch rundweg abgelehnt wurden:
»Die Typen kannste alle abhaken! Sieh dir doch bloß mal den Jochen an, das ist der mit den Hexenmetern. Dauernd redet der so geschwollen!«
»Es handelt sich um Hexameter, und darunter versteht man ein griechisches Versmaß, du hoffnungsloser Ignorant!« Sven führte mal wieder sein fortgeschrittenes Alter ins Treffen.
»Na, wenn schon. Und diese andere Flasche hat doch auch ’ne Meise, Breitmaul, oder wie der heißt.«
»Der heißt nicht Breitmaul, der heißt Breitkopf!« berichtigte Sven.
»Ist doch auch egal. Breitmaul würde übrigens viel besser passen, der Kerl kann doch den Spargel quer fressen!«
Der Konversation unter Brüdern mangelt es oft an Eleganz. Davon abgesehen hatte Sascha sogar recht. Der Knabe Breitkopf besaß in der Tat einen ungewöhnlich großen Mund. Außerdem züchtete er Kakteen. Dieser Pflanzengattung hatte Sven bisher noch keine Beachtung geschenkt, und so stürzte er sich mit Feuereifer in ein neues Forschungsgebiet. Seitdem haben wir auch Kakteen. Bei der letzten Zählung waren es 82.
Svens Freunde traten relativ selten in Erscheinung. Einmal, weil sie am entgegengesetzten Ende des Ortes wohnten, zum anderen, weil Sven lieber zu ihnen ging. »In diesen Kindergarten hier kann man doch keinen halbwegs normalen Menschen einladen!«
Stefanie zog eine Weile mit Katharina herum, freundete sich mit einer rothaarigen Isabell, danach mit einer flachsblonden Kirsten an und lief schließlich mit fliegenden Fahnen zu Angela über. Es dauerte nicht lange, und die beiden klebten zusammen wie Pech und Schwefel.
Stefanie schlief bei Angela, Angela schlief bei Stefanie. Wenn Angela ihre Oma besuchte, stiefelte Stefanie mit. Wenn Stefanie zum Zahnarzt ging, wurde sie von Angela begleitet. Trug Angela einen roten Pullover, dann zog Stefanie auch einen an. Wenn Angela ihren alljährlichen Heuschnupfen bekam und in unseren Sesselecken ihre benutzten Taschentücher deponierte, räumte Steffi sie bereitwillig weg. Die beiden hingen aneinander wie siamesische Zwillinge und würden es vermutlich heute noch tun, wenn Angela nicht nach München verzogen wäre. Die Freundschaft ging an beiderseitiger Schreibfaulheit zugrunde. Oder an Herrn Minister Gscheidle, der bei der Festsetzung von Telefongebühren nicht das Mitteilungsbedürfnis von Elfjährigen berücksichtigt hatte.
Nicole und Katja erklärten sämtliche Besucher des Kindergartens zu ihren Freunden, reduzierten diese Anzahl so nach und nach auf ein rundes Dutzend und entschieden sich schließlich für Bettina und Andrea.
Womit die handelnden Personen endlich komplett wären!
Kapitel 3
Mami, was kostet eigentlich ein Anorak?« Sascha feuerte seinen Ranzen neben den Kühlschrank, angelte sich eine Kohlrabiknolle vom Tisch und kaute geräuschvoll darauf herum.
»Mindestens fünfzig Mark, meistens mehr. Weshalb interessiert dich das überhaupt? Du hast doch erst im Frühjahr einen neuen bekommen«.
»Der ist jetzt aber weg!«
»Was heißt weg?«
»Na ja, im Fundbüro war er nicht, und am Bahnhof hat ihn auch niemand abgegeben, also ist er weg!«
Jetzt reicht es allmählich! Als wir für unsere Knaben den gehobeneren Bildungsweg planten, hatten wir natürlich gewisse Kosten einkalkuliert. Monatskarten, Kakaogeld, Turnhemden mit Schulemblem und ähnliche Dinge, die nicht unter die Rubrik Lehrmittelfreiheit fallen. Dann kamen noch Arbeitshefte dazu, in die man etwas hineinschreibt und die man deshalb selber kaufen muß, Zirkelkästen, Aquarellfarben …, von den regelmäßigen Unkostenbeiträgen für den Werkunterricht oder die Zeichenstunden ganz zu schweigen. Rolf stellte fest, daß Bildung teuer ist, und erhöhte zähneknirschend das Haushaltsgeld.
Nicht eingeplant waren allerdings die zusätzlichen Kosten für Gebrauchsartikel, die im Zug liegenblieben und dann auf Nimmerwiedersehen verschwanden. Ausgenommen einen Regenschirm, von dem aber schon zwei Speichen gebrochen waren und den der ehrliche Finder deshalb wohl auch abgeliefert hatte.
Es ist wirklich bemerkenswert, was während einer siebenminütigen Bahnfahrt alles abhanden kommen kann. Angefangen hatte die Verlustserie mit Svens Atlas, den er beim Abschreiben als Unterlage benutzt und dann im Zug vergessen hatte. Kostenpunkt: 29,75 Mark. Als nächstes fehlte Saschas linker Turnschuh. Er war im Laufe einer handgreiflichen Auseinandersetzung aus dem offenen Abteilfenster geflogen. Preis: 20 Mark. Dann blieben ein Schal hängen und eine Wolljacke, der eine vermißte seinen Füller, der andere einen Pullover, und wie viele Handschuhe auf der Strecke geblieben sind, weiß ich schon gar nicht mehr. Nun war es zur Abwechslung mal ein Anorak.
»Mein Sohn, jetzt habe ich die Nase voll! Den neuen Anorak wirst du selbst bezahlen, und zwar werde ich ihn dir ratenweise vom Taschengeld abziehen!«
»Nee, also das geht nicht, weil das nämlich unsozial ist. Wenn ein Angestellter mal Mist baut und deshalb ein Auftrag oder so was in die Binsen geht, kürzt man ihm ja auch nicht gleich das Gehalt.«
»Wenn dieser Angestellte aber fortwährend Fehler macht, kündigt man ihm. Diese Möglichkeit habe ich leider nicht, also wirst du für deine Schusseligkeit jetzt mal selber geradestehen!«
Sascha paßte das überhaupt nicht. »Kannst du mir nicht lieber eine runterhauen?«
»Das hättest du wohl gerne?«
Jetzt mischte sich Sven ein: »Halte die Raten aber möglichst klein. Sascha wartet doch schon sehnsüchtig auf den Ersten, weil er seine Spielschulden bezahlen muß. Von dem, was ich noch von ihm kriege, will ich erst gar nicht reden.«
Ich hatte nur ein Wort verstanden. »Was für Spielschulden?«
»Der verliert doch dauernd beim ›Fuchsen‹ und nun steht er bei Wolfgang mit zwei Mark dreiundachtzig in der Kreide.«
Nun begriff ich überhaupt nichts mehr. »Und was ist … wie heißt das? ›Fuchsen‹ denn überhaupt? Spielt man das mit Karten?«
»Nee, mit Pfennigen. Ist auch ganz harmlos.« Sven erklärte mir bereitwillig die Regeln. So etwas Ähnliches hatte ich als Kind auch gespielt, allerdings mit Murmeln.
Spielschulden sind Ehrenschulden! Irgendwo hatte ich das mal gelesen, und in früheren Zeiten mußte man sich deshalb standesgemäß erschießen. Diese Gefahr bestand wohl hier noch nicht, aber Ehrbegriffe werden bereits von Jugendlichen gepflegt.
»Dann mache ich dir einen anderen Vorschlag.« Aber zuerst entriß ich meinem Zweitgeborenen die Mohrrübe, auf der er jetzt herumknabberte. »Gib her, die brauche ich für die Suppe. Wie wäre es also, wenn du das Geld abarbeiten würdest? Keller aufräumen, Unkraut jäten, und der Wagen könnte auch mal wieder eine gründliche Wäsche nebst Politur vertragen.«
Sascha sah mich an, als hätte ich von ihm verlangt, freiwillig Vokabeln zu lernen.
»Du meinst, ich soll richtig arbeiten? Nicht bloß mal Brot holen oder Garage ausfegen?«
»Genau! Nach dem Essen kannst du gleich anfangen. Am besten mit dem Unkraut!«
»Und meine Hausaufgaben?«
»Gib doch bloß nicht so an«, konterte Sven mitleidslos, »die schreibst du doch sowieso von mir ab.«
Obwohl Sven anderthalb Jahre älter ist als sein Bruder, gingen beide in dieselbe Klasse. Während des entscheidenden vierten Grundschuljahres hatte sich unser Ältester mehr für Regenwürmer und Mistkäfer interessiert als für die Oberrheinische Tiefebene, und sein Abschlußzeugnis hätte ihn eigentlich zum Besuch einer Sonderschule verpflichtet. Ob nun ein verspäteter Ehrgeiz oder sein gelehrter Freund Sebastian die Ursache war, weiß ich nicht, jedenfalls entwickelte der zurückgebliebene Knabe plötzlich einen unerwarteten Bildungseifer und schaffte mit einjähriger Verspätung doch noch den Sprung aufs Gymnasium.
Rolf hatte das sogar ganz praktisch gefunden. Ihm schwebte etwas von gegenseitiger Hilfe und Gemeinschaftsarbeit vor, was Sascha dann auch durchaus wörtlich nahm. Sven machte die Arbeit, und Sascha bewies Gemeinsinn, indem er sich völlig auf seinen Bruder verließ und vertrauensvoll alles von ihm abschrieb. Und was der nicht wußte, das wußte dann eben ein anderer. So war Sascha immer der erste vor Unterrichtsbeginn in der Schule und wartete auf den zweiten, von dem er abschreiben konnte.
Mein Sohn arbeitete also seine Schulden ab. Er strich den Gartenzaun oder wenigstens Teile davon, und auch die nur auf einer Seite. Er räumte den Keller auf, das heißt, er stapelte alles in einer Ecke übereinander und erweckte so den Anschein, als habe er enorm viel Platz geschaffen. Er zupfte Unkraut. Da es sich hierbei um Pflanzen handelt, hinter deren Vorzüge wir bloß noch nicht gekommen sind, ließ er prompt alles stehen, was nicht einwandfrei als Brennessel zu klassifizieren war. Gehorsam wusch er auch den Wagen und hatte gerade mit dem Polieren des linken Kotflügels angefangen, als Rolf ihm das Silberputzmittel aus der Hand riß und ihn aus der Garage scheuchte.
»Bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Mit dem Zeug kannst du doch nicht auf Lack herumwischen.«
»Steht doch aber drauf: Putzt alles, was glänzen soll«, verteidigte sich sein Filius.
»Raus!!!«
Immerhin hatte Sascha schon drei Viertel seines neuen Anoraks »verdient«, obwohl ich ihm eigentlich die Hälfte davon wieder hätte abziehen müssen, weil das Resultat seiner Fronarbeit doch ziemlich weit von deutscher Gründlichkeit entfernt war. Andererseits mußte ich auch den guten Willen honorieren.
»Wenn du jetzt noch im Wohnzimmer die Fenster putzt, sind wir quitt«, erklärte ich meinem Sprößling. Es schadet einem künftigen Ehemann gar nichts, wenn er aus eigener Erfahrung weiß, wie viele Rumpfbeugen zum Reinigen übermannshoher Fensterscheiben nötig sind.
»Wird gemacht!« Bereitwillig verschwand Sascha im Garten. Minuten später prasselte ein Gewitterregen an die Scheiben, ein Naturwunder, denn draußen schien die Sonne, und kein Wölkchen war zu sehen. Ich raste ins Wohnzimmer und stellte fest, daß Sascha den Gartenschlauch voll aufgedreht und den dicken Strahl direkt auf die Fenster gerichtet hatte. An der Terrassentür bildete sich bereits ein Rinnsal und sammelte sich auf dem Parkettboden mit Marschrichtung Küche.
»Bist du verrückt? Sofort aufhören!«
Sascha verstand offenbar kein Wort und winkte mir fröhlich zu.
»Nimm den Schlauch weg!« brüllte ich noch lauter.
Sascha nickte und richtete den Wasserstrahl auf das obere Drittel der Scheiben. Jetzt tropfte es auch aufs Fensterbrett.
»Auf-hö-ren!!«
Sascha zuckte mit den Schultern und malte Wasserkringel. Ich rannte durchs Wohnzimmer, durchs Eßzimmer, durch den großen Flur, durch den kleinen Flur, durch die Haustür, die Treppe hinunter, den Weg am Haus entlang bis zum Wasserhahn und drehte ihn aufatmend zu. Sascha kam mit dem tropfenden Schlauch um die Ecke: »Meinst du, das reicht schon?«
»Du bist wohl restlos übergeschnappt! Geh mal rein und sieh dir die Ferkelei drinnen an. Was hast du dir bei dieser Wasserschlacht eigentlich gedacht? So putzt man doch keine Fenster.«
»Soll ich vielleicht jede Scheibe einzeln abwischen? Du machst das alles immer viel zu umständlich, so was muß man rationalisieren.«
»Darunter versteht man doch Arbeitseinsparung, nicht wahr? Dann kannst du erst einmal im Wohnzimmer den Fußboden aufwischen, anschließend machst du die Terrassenmöbel sauber, hängst die ganzen Strohmatten auf und legst den Sumpf trocken, der mal ein Blumenbeet war. Was dir dein Bruder erzählt, wenn er seine klatschnassen Schuhe findet, kannst du dir vielleicht selber ausmalen!«
Für die nächste Stunde war Sascha hinreichend beschäftigt, und während er mit dem Fuß das Scheuertuch über den Parkettboden schob, erging er sich in langwierigen Betrachtungen über Fensterputzen im allgemeinen und Kinderarbeit im besonderen.
»Früher hat das immer Wenzel-Berta gemacht«, maulte er und verteilte das Wasser gleichmäßig auf dem Fensterbrett, »warum haben wir jetzt eigentlich keine Hilfe?«
Das war eine Frage, die sich ebenso leicht wie erschöpfend beantworten ließ: Weil es keine gab! Vorsichtige Rückfragen bei meiner Nachbarin, die trotz allem so einen dienstbaren Geist besaß, hatten schon vor Wochen eine gewisse Ernüchterung gebracht.
»Fra Schröter putzt scho seit fuffzehn Johr bei mir un kommt nur noch aus Gfälligkeit. E neue Stelle tät sie niemals uffnehme.«
»Ich will sie ja gar nicht abwerben«, beteuerte ich erschreckt, »aber vielleicht kennt sie jemanden, der zu uns kommen würde.«
Frau Billinger klärte mich also geduldig darüber auf, daß es Putzfrauen erstens überhaupt nicht mehr gebe, und wenn, dann würden sie zweitens in den ortsansässigen Kliniken und Kurheimen arbeiten, weil man ihnen dort nicht so genau auf die Finger sehe, und drittens gehe zu kinderreichen Familien sowieso niemand mehr.
»Eigentlich hatte ich ja auch mehr an eine richtige Hausgehilfin gedacht, die bei uns wohnt«, bekannte ich schüchtern.
Frau Billinger sah mich an, als sei ich ein lästiges Insekt. »Wo hawe Sie denn bisher gelebt? Die junge Dinger gehe entweder in die Fabrik, oder sie schaffe als Zimmermädle und Serviererinnen. Do hawe sie feschte Arbeitszeite, Trinkgelder und obends frei. Seie Se froh, wenn Se überhaupt e Putzfrau finne. Versuche Se’s doch mol mit einer von de Gaschtarbeiterinnen, do soll es ja noch welche gewe, die zum Putze kommen. Ich tät so jemand allerdings niemols in mei Haus lasse.«
Wir fanden eine Jugoslawin, die erst seit drei Wochen in Deutschland lebte, außer »danke« und »wo ist das Rathaus bittää« kein Wort Deutsch sprach, und so mußte ich ihr jeden Morgen erst mit Händen und Füßen begreiflich machen, was ich von ihr wollte. Wenn wir gemeinsam Betten bezogen oder Wäsche aufhängten, erteilte ich Schnellkurse in deutscher Umgangssprache. Nach vier Monaten konnte sich Jelena schon recht gut verständigen. Darauf kündigte sie, um in der nahegelegenen Textilfabrik künftig Unterhosen und Badeanzüge zu nähen. Das sei leichter und werde auch besser bezahlt.
»Das hast du nun von deinen pädagogischen Ambitionen«, schimpfte Rolf und beschloß, die Sache nunmehr selbst in die Hand zu nehmen. »Irgendwo muß es doch noch junge Mädchen geben, die lieber mit vierjährigen Kindern spielen als Waschbecken scheuern.«
»Wir haben aber auch welche«, gab ich zu bedenken.
»Du weißt doch ganz genau, was ich meine«, erklärte mein Gatte unwirsch. »Im übrigen sind die Jungs alt genug, um ihr Badezimmer selber sauberzuhalten.«
»Das erzähle ihnen mal!«
Rolf nahm Rücksprache mit dem Direktor der hiesigen Realschule. Er habe doch sicher Schülerinnen, die einen sozial-pädagogischen oder hauswirtschaftlichen Beruf ergreifen wollten, wozu ja bekanntlich auch ein gewisses Praktikum gehöre, und ob der Herr Direktor nicht vielleicht über die Zukunftspläne seiner Abschlußklasse informiert sei?
Der Herr Direktor war es nicht. Möglich, daß der Klassenlehrer …, allerdings sei der momentan im Landschulheim. Die Klasse übrigens auch. Und ob Rolf denn schon mal beim Arbeitsamt gewesen sei?
Rolf fuhr nach Heilbronn. Der Sachbearbeiter war sichtlich erfreut. »Ihre Tochter will ein Haushaltspraktikum machen? Aber natürlich haben wir geeignete Angebote, mehr als genug sogar.«
Das Mißverständnis wurde geklärt und der Herr merklich kühler. »Nein, da kann ich Ihnen gar nicht helfen. Wenn Sie keine Kinder hätten und Ihre Frau auch berufstätig wäre, ließe sich vielleicht etwas finden, aber so …? Haben Sie es schon mit einer Anzeige versucht?«
Rolf gab in den beiden einschlägigen Tageszeitungen und im Gemeindeblättchen Inserate auf, die etwaigen Interessenten eine Art kostenlosen Urlaub versprachen, aber es meldete sich trotzdem niemand. Lediglich ein Vertreter erschien und pries eine Universalmaschine an, die mir nicht nur eine Haushaltsgehilfin ersetzen, sondern auch mein Leben verschönern würde.
Aber dann rief doch noch jemand an. Rolf war am Apparat, schaltete abrupt vom sachlich-geschäftsmäßigen auf den verbindlich-liebenswürdigen Plauderton, versicherte der gnädigen Frau, daß ihre Tochter wie unser eigenes Kind aufgenommen werden würde, versprach dem Herrn Bundeswehrmajor, daß Herrenbesuche selbstverständlich nicht gestattet seien, und lud Elternpaar nebst Tochter zwecks Besichtigung von Haus und Familie ein.
Anscheinend hatte alles den Ansprüchen genügt, denn der Herr Major bekundete seine Zustimmung. Und die gnädige Frau war sehr angetan von dem großen Garten, weil doch die arme Silvia ein bißchen blaß sei und sich möglichst viel in der frischen Luft aufhalten solle. Warum nicht? Gartenarbeit ist bekanntlich sehr gesund und sogar Rentnern noch zuträglich.
Silvia war siebzehn Jahre alt, sah aus wie fünfzehn und benahm sich manchmal wie zwölf. Sie wollte Säuglingsschwester werden, würde aber erst in einem dreiviertel Jahr mit ihrer Ausbildung beginnen können.
Die Kinder mochten sie auf Anhieb. Sven spielte Klavier und half freiwillig beim Abtrocknen, was er bei mir nicht einmal in Ausnahmefällen tat, und Sascha sorgte für Rückendeckung, wenn sich Silvia mit ihrem Freund traf, von dem Vater Major offenbar gar nichts ahnte. Steffi ließ sich von ihr die beiden verkorksten Mathearbeiten unterschreiben, so daß ich überhaupt nichts davon erfuhr und mir reichlich albern vorkam, als ich später in der Schule die vermeintlich ungerechtfertigte Vier im Zeugnis reklamierte.