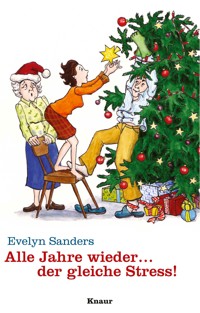6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es gibt Leute, die behaupten, dass sich Mütter auf nichts im Leben so freuen wie auf die Hochzeit ihrer Kinder. Evelyn Sanders hingegen, die nicht nur erfolgreiche Bestsellerautorin ist, sondern schon mehrfach als "Mutter der Braut" mit von der Partie war, weiß ganz andere Geschichten zu erzählen - und zwar nicht nur über die Heirat ihrer Tochter, sondern auch über Weihnachtsgeschenke der besonderen Art und andere Familienkatastrophen! "Wer die Sanders-Sippe noch nicht kennt, sollte sie endlich kennen lernen!" Czerwensky Buch Service
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 661
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Evelyn Sanders
Menschenskinder … nicht schon wieder!
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
»Menschenskinder … nicht schon wieder eine Hochzeit! Ich zahle ja noch an der letzten!« Radau im Sanders’schen Reihenhaus, als hätten sie es nicht schon vorher wissen müssen: denn mit fünfen ist man nicht nur kinder- sondern auch sorgenreich. Die Zeiten von Jeans und großer Klappe sind endgültig vorbei. Jetzt wird geheiratet! Das langerwartete dreizehnte Lesevergnügen von und mit Evelyn Sanders!
Inhaltsübersicht
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 1
Nein! Nicht schon wieder eine Hochzeit! Ich zahle ja noch an der letzten!«
Es war Rolfs Entsetzensschrei, der durch das ganze Haus gellte, jedoch sofort von Steffis noch lauter gebrülltem Protest übertönt wurde: »Übertreib nicht so maßlos! Wir haben im Juli schon unseren dritten Hochzeitstag, und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du die Sauna in monatlichen Raten abstotterst. Schon wegen der Zinsen! Und sooo kostenintensiv kann sie überhaupt nicht gewesen sein! Wenn wir nämlich mal zu viert drinsitzen, hat jeder Einzelne höchstens so viel Platz wie auf’m Baustellen-Klo.«
Das allerdings stimmte! Mit dem ungefähr dreifachen Volumen einer normalen Hundehütte füllt dieser Holzverschlag die für ihn vorgesehene Fläche im Bad restlos aus, hätte also gar nicht größer sein dürfen, doch die optische Symmetrie des Raumes war auf Kosten der Bequemlichkeit gegangen, was Schwiegersohn Hannes im Nachhinein bedauert, Schwiegervater Rolf dagegen gleich von vornherein außerordentlich begrüßt hatte.
Eine größere Sauna wäre um einiges teurer gewesen, und die Aussicht, sie hin und wieder benutzen zu können, hatte Rolf sowieso nicht gereizt. Er hasst saunieren und hat unser Hochzeitsgeschenk nur ein einziges Mal betreten. Das war damals im Hochsommer gewesen, als das Möbel endlich installiert worden war, die künstlichen Kohlen noch nicht geglüht hatten und die einzigen Tropfen auf dem Fichtenholzboden die aus dem Sektglas gewesen waren, mit denen die Sauna höchst feierlich ihrer Bestimmung übergeben worden war.
»Ich rede ja nicht von deiner Hochzeit«, hörte ich den mir vor einigen Jahrzehnten angetrauten Ehemann seine Tochter anblaffen, »sondern von Saschas. Die war teurer!«
»Wieso?«, hakte Stefanie sofort nach. »Ich denke, jeder kriegt die gleiche Summe, wenn er heiratet.«
»Das ja, doch für Saschas Auftrieb musste ich mich – übrigens auf ausdrücklichen Wunsch deiner Mutter! – zusätzlich komplett neu einkleiden, weil ich mich in meinem dunklen Anzug angeblich nicht mehr sehen lassen konnte.«
»Das hättest du schon bei unserer Hochzeit nicht gekonnt«, knurrte Steffi, »aber wir haben ja auch nicht bei Grafens gefeiert, und für ein simples Restaurant am Stadtrand waren grauer Zwirn und Hose mit Schlag natürlich gut genug, auch wenn das edle Teil mindestens fünfzehn Jahre alt gewesen ist.«
»Siebzehn!«, sagte Rolf. »Aber höchstens zweimal pro Jahr getragen.«
Das hatte man ihm auch angesehen! Und wenn ich nicht schon Wochen vor Saschas Hochzeit bei eben jener Hose heimlich die wichtigste Naht mit einer Rasierklinge angeritzt und danach auf einer Kostümprobe bestanden hätte, wäre der ›gute Anzug‹ bestimmt ein weiteres Mal zum Einsatz gekommen. So aber gab es gleich beim Hinsetzen ein unverkennbares und sehr unangenehmes Geräusch, das sogar meinen Mann überzeugte. Kopfschüttelnd hatte er die aufgeplatzte Naht betrachtet. »Das kann man wohl nicht mehr reparieren?«
»Doch, könnte man«, hatte ich ganz lässig gesagt, »würde aber nichts nützen, weil es doch wieder reißt. Ich passe auch nicht mehr in meine Kleider von vor zwanzig Jahren« (wäre fatal, am Ende müsste ich sie wirklich noch tragen!), »finde dich also damit ab, dass auch du mindestens eine Nummer größer brauchst.«
Wohlversehen mit den Adressen einschlägiger Herrenausstatter war er tatsächlich ganz allein losgezogen und erst nach Ladenschluss zurückgekommen, mit nicht nur einem Anzug, sondern zweien, dazu einem halben Dutzend Hemden, drei Krawatten und sündhaft teuren Schuhen. »Ich wusste gar nicht mehr, dass neue Anzüge gleich auf Anhieb so bequem sein können«, hatte er gestaunt und sie mir noch am selben Abend vorgeführt. »Die sitzen doch erstklassig, nicht wahr? Waren ja auch nicht ganz billig.«
»Sie werden sich schon noch amortisieren«, hatte ich ihn getröstet und taktvoll verschwiegen, dass die Hosen nicht nur eine, sondern sogar zwei Nummern größer waren als seine anderen. »Immerhin musst du im Laufe der nächsten Jahre noch zwei Töchter verheiraten und eventuell auch irgendwann deinen ältesten Sohn.«
»Den bestimmt nicht!« Behutsam hatte Rolf die Jacketts auf die vorsorglich mitgebrachten breiten Bügel gehängt (normalerweise genügt ihm für diesen Zweck die Stuhllehne) und sich zu mir umgedreht. »Als ich unlängst mal auf den Busch geklopft und gefragt habe, ob das mit seiner Sandra etwas Ernstes sei, hat er bloß genuschelt: ›Heirate spät, dann dauert die Ehe nicht so lange!‹ Wie findest du das?« Liebevoll strich er über die Revers seiner Neuerwerbungen – hatte er bei mir schon lange nicht mehr getan! – und sah mich herausfordernd an.
»Sandra ist längst out, das hast du bloß noch nicht mitgekriegt, weil dich ja das Liebesleben deiner Nachkommen viel zu wenig interessiert, aber dass Sven die momentan von ihm favorisierte Jessica zu deiner Schwiegertochter machen wird, glaube ich nicht. Sie hat aufgeklebte Fingernägel, Angst vor Mäusen und wechselt täglich die Handtücher.«
Besonders Letzteres war bei Sven auf völliges Unverständnis gestoßen, denn er selbst bevorzugt dunkelblaues Frottee, bei dem die Spuren flüchtigen Händewaschens erst nach acht bis zehn Tagen auffallen, wenn die Handtücher anfangen steif zu werden (vielleicht sollte ich bei dieser Gelegenheit erwähnen, dass unser Erstgeborener in zwei Jahren vierzig wird und die Unarten der pubertären Phase eigentlich abgelegt haben sollte).
Überhaupt müsste ich erst einmal meine Sippe vorstellen und ihren Werdegang vom Windelalter bis zur unlängst erfolgten Verbeamtung auf Lebenszeit (ein Wort, das der Duden bis heute doch glatt ignoriert!) schildern …
Oberhaupt der Familie (zumindest auf amtlichen Formularen) ist Rolf, der jahrzehntelang namhaften, meist jedoch weniger bekannten Firmen geholfen hat, ihre Produkte an den Mann bzw. an die Frau zu bringen. Seitdem wir mit der Fernsehwerbung leben müssen, würde ich diese Art des Broterwerbs auf der Karriereleiter ziemlich weit unten ansiedeln, aber damals galt ein Werbeberater (neudeutsch Art-Director) auch ein bisschen als Künstler, und denen hat man ja schon immer einiges nachgesehen. War auch nötig, denn in den sechziger Jahren hatte die deutsche Durchschnittsfamilie – statistisch gesehen – einskommaundetwas Kinder, in der Realität also zwei, dafür hatten soundsoviel Ehepaare keine, und wer mehr hatte, war entweder Italiener, Türke oder asozial.
Wir hatten fünf. Zwei Jungs, drei Mädchen, dazu diverses Kleinvieh, das sich während unserer häufigen Umzüge glücklicherweise immer mal wieder dezimierte, wechselnde, mitunter etwas absonderliche Haushaltshilfen, meistens jedoch keine, dafür aber nur ein Auto, mit dem eben jenes Oberhaupt häufig tagelang unterwegs war. Einen Zweitwagen bekam ich erst, als er eigentlich schon in die Kategorie überflüssiger Luxus fiel, weil die Kinder nicht mehr zum Sportklub oder zur Disko gebracht werden mussten, sondern für Kino und Fitnessstudio ihre eigenen Autos benutzten. Sehr betagte Vehikel natürlich, mit immer bloß noch ein paar Monaten TÜV, aber größtenteils selbst verdient und nur manchmal ein bisschen gesponsert. So kurvte Sven monatelang in einer rollenden Litfasssäule herum, von oben bis unten mit Werbung beklebt, die von Salamander-Schuhen bis zu Buttermilch so ziemlich alle Sparten des Konsumangebots umfasste. Lediglich auf das Logo vom Sex-Shop hatte er schweren Herzens verzichtet, obwohl die angeblich am meisten gezahlt und ihm darüber hinaus beim Einkauf Rabatt eingeräumt hätten.
Beruflich waren unsere Ableger verschiedene Wege gegangen. Sven hatte sich auf Garten- und Landschaftsbau geworfen (daher stammt auch seine Vorliebe für dunkle Handtücher), Sascha hatte Restaurantfachmann gelernt, war zwei Jahre lang als Steward auf der Queen Elizabeth II. ein paar Mal über die Weltmeere geschippert, hatte auf dem Kahn seine Vicky kennen gelernt und ein Jahr später geheiratet. Die »englische Hochzeit« ist uns heute noch unvergesslich; von der bevorstehenden Scheidung haben wir erst erfahren, als sie schon beinahe ausgesprochen war.
Steffi hatte nach erfolgreicher Abschlussprüfung und einigen Monaten Schreibtischtätigkeit bei einer Versicherung festgestellt, dass sie eigentlich gar keine Lust zu einem Bürojob hatte und doch erst einmal gründlich überlegen wollte, auf welch weniger eintönige Weise sie künftig ihre Brötchen verdienen könnte. Eine Zeit lang überführte sie Autos für einen Mietwagen-Service, jobbte in einer Diskothek, verliebte sich in den falschen Mann, danach in den richtigen, der dann doch wieder der falsche war, aber dass aller guten Dinge drei sind, hat sich bewahrheitet, als sie Hannes kennen lernte. Sie hat ihn nicht nur geheiratet (oder er sie, darüber besteht zwischen den beiden noch immer Uneinigkeit), sondern in seiner Firma auch genau den Job gefunden, von dem sie gar nicht gewusst hatte, dass es ihn gibt. Doch davon später.
Bleiben noch die zwei restlichen Nachkommen, Nicole und Katja, die größte Überraschung meines Lebens, denn wer rechnet schon mit Zwillingen, wenn es in den eigenen Familien noch niemals welche gegeben hat und Ultraschall – damals zumindest – lediglich ein im Bereich der Physik angesiedelter Begriff war? In Großstadt-Krankenhäusern wird man über dieses nützliche Gerät wohl schon verfügt haben, in gynäkologischen Landpraxen wusste man vermutlich noch nicht einmal, was das überhaupt ist. Jedenfalls hat eine werdende Zwillingsmutter heutzutage wenigstens acht Monate lang Zeit, sich mental und nicht zuletzt finanziell auf den doppelten Zuwachs vorzubereiten (vom werdenden Vater gar nicht zu reden, denn dem schwant ja höchstens, was da so an Kosten auf ihn zukommt, von den tatsächlichen hat er glücklicherweise noch keine Ahnung), ich dagegen wurde vor die vollendete Tatsache gestellt! Aber der Mensch wächst bekanntlich mit seinen Aufgaben, außerdem verfügte ich schon über eine gewisse Praxis im Umgang mit Kindern (dass auch aus den niedlichsten und liebenswertesten Babys mal Teenager werden, wusste ich allerdings noch nicht, Sven war gerade erst zehn Jahre alt geworden), doch ohne Wenzel-Berta, die treue Seele in unserer damals nur auf Wanderkarten verzeichneten Dorf-Einöde, wäre ich vermutlich in Schwermut versunken oder hätte mich vom nächsten Weinberg gestürzt. Rundherum gab es ja nichts anderes, wenn man von den paar Wiesen mit ihren unermüdlich käuenden Kühen drauf mal absieht. Für eine Großstadtpflanze wie mich ein nicht gerade stimmungsfördernder Anblick.
Schließlich kam der Tag, an dem wir in die Zivilisation zurückkehrten und uns in einem kleinen Kurort nahe Heilbronn niederließen, wo die paar Bauern, die es noch gab, ihre Kühe im Stall behielten, weil sie ihre Wiesen längst als Bauland verkauft hatten. Und die Weintrauben mussten sie auch im Supermarkt holen.
Ein paar Kilometer von der Stadtmitte entfernt schlängelt sich der Neckar durch eine sehr geschichtsträchtige Gegend, denn auf so ziemlich allen umliegenden Burgen hat Götz von Berlichingen (Goethe sei Dank, ohne ihn würde den ja kaum jemand kennen) zeitweise gewohnt oder wenigstens einmal genächtigt. Wird behauptet! Da die heutigen Raubritter jedoch nicht mehr auf Burgen leben, sondern in Finanzämtern, hat man die am besten erhaltenen Gemäuer erst restauriert und dann modernisiert, auf dass zahlende Gäste bei gedämpftem Licht (elektrisch) und angenehm durchwärmt (Zentralheizung) aus dem Fenster der ehemaligen Kemenate über das Neckartal blicken und sich ausmalen können, wie wenig anheimelnd es in diesen Steinkästen vor ein paar hundert Jahren gewesen sein muss.
Sascha hatte beschlossen, seine zweite Hochzeit auf einer dieser Burgen zu feiern. Einmal wegen der Romantik, zum anderen, weil er den Geschäftsführer kannte. Mit Ausschlag gebend war auch die etwas abseits stehende und nur über einen steilen Sand-Schotterweg erreichbare kleine Kapelle gewesen, notwendiges Ambiente für eine stilvolle Trauung. Die Zeremonie auf dem Standesamt hatte schon vor ein paar Monaten stattgefunden, und erst achtzehneinhalb Stunden vorher war Sascha eingefallen, dass er gar keinen Trauzeugen hatte, jedoch auf den in derartigen Situationen immer bereitwilligen Hausmeister, Pförtner oder Aktenboten nur im äußersten Notfall zurückgreifen würde. Hektische Telefongespräche zwischen Düsseldorf und den diversen Wohnsitzen der restlichen Sippe folgten, doch der Bräutigamsvater konnte nicht, ich wollte nicht, Sven war nicht erreichbar, Stefanie hatte Grippe, Nicki die rechte Hand in Gips, nur Katja fiel so schnell nichts ein – höchstens die Tatsache, dass sie eigentlich noch vorher zum Friseur müsste. Im Morgengrauen bretterte sie nach Düsseldorf, bezeugte durch diverse Unterschriften die soeben erfolgte Eheschließung des Sascha Sanders mit der nunmehr rechtmäßigen Gattin Nastassja, nahm zusammen mit Bruder, neuer Schwägerin und der zweiten Trauzeugin ein dem feierlichen Ereignis angemessenes Mittagsmahl ein, setzte sich wieder ins Auto und war sieben Minuten vor Beginn des Elternabends in der Schule. Das übrige Kollegium hatte schon überlegt, wie man den Angehörigen der Viertklässler das unentschuldigte Fehlen ihrer Klassenlehrerin plausibel machen sollte.
Im Hochsommer folgte die »richtige« Trauung, also zu einem Zeitpunkt, der schönes Wetter und die einem Brautkleid zuträglichen Temperaturen wenn schon nicht garantierte, so doch wenigstens erwarten ließ. Die Sonne knallte dann auch wirklich schon morgens vom wolkenlosen Himmel, und als wir die neun Autos endlich nebeneinander auf dem Parkplatz aufgereiht hatten, stand uns immer noch der Aufstieg zur Kapelle bevor. Es hatte wochenlang kaum geregnet, jeder Schritt wirbelte Staubwölkchen auf, der Sand knirschte zwischen den Zähnen, und als wir endlich oben waren, sahen die Männer in ihren dunklen Anzügen alle einheitlich graubepudert aus. Rolf warf mir bitterböse Blicke zu; sein inzwischen der Altkleidersammlung zugeführtes »gutes Stück« war aus wesentlich leichterem Stoff gewesen.
»Gibt’s hier nichts zu trinken?«, krächzte Sven.
»Erst hinterher.« Zum wiederholten Mal wischte sich Sascha die Schweißtröpfchen von der Stirn. »Nicht mal ’ne Wasserleitung?« Nein, es gab auch keine Wasserleitung, nur Sonne, wenig Schatten und einen Pastor, der immer wieder seinen Kopf durch die Tür steckte und kopfschüttelnd wieder einzog, weil die Braut noch immer nicht da war. Dabei konnte er doch in der angenehm temperierten Kapelle warten, während wir draußen in der brütenden Hitze schmorten. Sascha nutzte die Zeit, uns mit der neuen Verwandtschaft bekannt zu machen. Wir schüttelten gegenseitig die Hände, murmelten den üblichen konventionellen Schwachsinn, wonach wir uns alle freuten, endlich die Bekanntschaft von X und Y zu machen, von denen wir ja schon so viel gehört hatten (hatten wir wirklich?), lobten oder missbilligten das Bilderbuchwetter – je nachdem, ob das jeweilige Gegenüber luftig gekleidet war oder allzu sichtbar transpirierte – und wünschten nichts sehnlicher, als endlich aus der Sonne herauszukommen. Mir taten sowieso schon die Füße weh, denn ich hatte nicht nur neue Schuhe an, sondern auch noch welche mit ganz dünnen Sohlen, Riemchen und hohen Absätzen, für die Schotterwege das reine Gift sind.
Nastassja hatte unserer ohnehin nicht gerade kleinen Familie zwei unverehelichte Brüder zugeführt sowie eine verheiratete Schwester nebst Gatten, mit der ich mich später unbedingt mal unterhalten musste, denn ihre drei Söhne benahmen sich so vorbildlich, wie ich das bei meinen beiden nie hingekriegt hatte. Stunden später, als die Knaben sogar untereinander immer noch friedlich blieben und sich nicht einmal verbal in die Haare gerieten, kam ich zu der Vermutung, dass das Bremer Klima der Erziehung männlicher Nachkommen wohl zuträglicher sein musste als das süddeutsche.
Die Brüder der Braut waren mit weiblicher Seitendeckung erschienen, die offenbar im Laufe des Tages eine recht kostspielige Vorliebe für Campari entwickelte, ein Getränk, für das ich gelegentlich auch etwas übrig habe, nur nicht gerade bei dreißig Grad im Schatten und erst recht nicht schon ab mittags um eins. Als Sascha Tage später die Abrechnung für seine Hochzeitsfeier bekommen hatte, rief er auch prompt an und sprach mir seine Hochachtung aus. »Siebzehn Campari orange, und man hat dir überhaupt nichts angemerkt!« Dabei hatte ich nicht mal einen getrunken!
Leider fehlten Nastassjas Eltern, denn die hätte ich wirklich gern kennen gelernt. Sascha hatte so begeistert von ihnen gesprochen; allerdings hatte die Mutter gesundheitliche Probleme, und allein hatte der Vater nicht kommen wollen. Verständlich, doch wozu gibt es Videofilme? Einer der drei selbst ernannten Kameramänner hatte immer seinen Apparat vor dem Gesicht.
Endlich Motorengeräusch, dann kam auch schon Steffis Cabrio in Sicht. Im Schneckentempo kroch der Wagen die Steigung herauf, hinten drin, sich am zurückgeschlagenen Verdeck festklammernd, die Braut mit den zwei Jungfern – ihren Töchtern aus erster Ehe. Nette Mädchen, noch verschüchtert gegenüber so vielen neuen Onkels und Tanten, doch im Laufe des Tages tauten sie auf, und inzwischen fühlen sie sich bei uns fast wie zu Hause.
Zwanzig Meter vor dem Eingang zur Kapelle hielt Steffi an. »Hier kommt schon wieder so ein Bombenkrater, kann mal jemand kontrollieren, ob ich da durchkomme? Ich hab nämlich Angst, dass ich mir den Auspuff abreiße. Wäre beim letzten Schlagloch beinahe passiert!« Sie sah ein bisschen gestresst aus, hatte nicht eingesehen, dass die Braut gefahren werden wollte – »die paar Meter … sie hat doch auch Beine bis zum Boden!« – doch ich konnte Nastassja verstehen. Es ist natürlich viel wirkungsvoller, graziös aus einem offenen Wagen zu steigen, als nach einem wenn auch nur kurzen Aufstieg japsend vor dem Kirchlein zu stehen.
Der Hochzeitszug formierte sich, dann schritten wir in die Kapelle, dankbar für Schatten und Kühle. Das Harmonium war leicht verstimmt, die davor sitzende Dame offenbar in Eile, mit dem Gesang klappte es auch nicht so richtig, weil kaum jemand wollte (oder konnte), aber der Pastor freute sich, denn er hatte eine schöne Rede vorbereitet, die bestimmt von dem sonst gängigen Text abgewichen ist. Man traut ja doch nicht so häufig ein Paar, von dem jeder Teil schon eine Ehe hinter sich hat. Ein bisschen störend waren nur unsere Videofilmer, die sich vor lauter Eifer gegenseitig vors Objektiv gerieten, und als Sven stolperte und in letzter Sekunde Halt suchend eine Säule umarmte, bevor er dem Pastor in den Rücken gefallen wäre, wurde er höflich aber bestimmt vor die Tür gesetzt. Deshalb gibt es auf einem Teil seines Filmes auch eine Menge Nahaufnahmen von diversen Wiesenkräutern sowie zweimal einen ausgedehnten Schwenk übers Neckartal.
Nach dem gemeinsamen kläglichen Abgesang, zu dem sich niemand berufen zu fühlen schien, ging es wieder hinaus in die Hitze. Unter dem einzigen, ein bisschen Schatten spendenden Baum erwartete uns ein weiß gedecktes Tischchen mit Kühltaschen und zwei dahinter aufgereihten dienstbaren Geistern. Mit beneidenswerter Fertigkeit öffneten sie Sektflaschen, füllten Gläser, reichten sie herum. Auf Wunsch mit Orangensaft. Der war dann auch zuerst alle. Kaum jemand wollte Alkohol.
»Ich tippe auf 27 Grad«, sagte Hannes, sein nur halb geleertes Glas unauffällig in ein Grasbüschel kippend.
»Der Sekt?«, fragte ich erstaunt, denn für meinen Geschmack war er sogar ein bisschen zu kalt.
»Nee, die Temperatur. Dabei ist es noch nicht mal zwölf Uhr.« Nach einem kurzen Rundblick öffnete er den obersten Hemdenknopf. »Was meinst du, wie lange müssen wir hier rumstehen?«
»Na, bis die Flaschen leer sind«, vermutete jemand von der neuen Verwandtschaft, von der ich noch immer nicht genau wusste, wer denn nun zu wem gehörte. Die Frauen waren in der Überzahl, also mussten noch Freundinnen von Nastassja darunter sein. Sascha hatte ja auch seinen österreichischen Freund Thomas eingeladen, der ihm schon bei seiner ersten Hochzeit in England als »best man« so hilfreich zur Seite gestanden, inzwischen selbst geheiratet hatte und mit Frau sowie selig im Kinderwagen vor sich hin glucksendem Säugling angereist war.
Zwei in Schlabberkleider gewandete, babyrosa geschminkte Damen kamen herangekeucht. Wo denn das Brautpaar bleibe, man habe doch für halb zwölf Uhr den Fototermin vereinbart, jetzt sei es schon drei viertel, und ihre Zeit hätten sie ja auch nicht gestohlen.
Also klemmte sich Steffi noch einmal hinters Steuer, die Braut musste zur Seite rücken, was ihrem sehr hübschen, aber auch sehr ausladenden Kleid gar nicht gut bekam, denn der Bräutigam sollte jetzt natürlich mit im Wagen sitzen, die beiden Mädchen quetschten sich auf den Beifahrersitz, dann rollte das voll gestopfte Gefährt im Schneckentempo wieder abwärts. Wir anderen schlappten hinterher.
»Setzt euch in den Burghof und bestellt euch, was ihr wollt!«, rief uns Sascha noch zu. »Die Knipserei kann ja nicht so lange dauern!«
Der Burghof war besetzt. Von einer anderen Hochzeitsgesellschaft. Zahlenmäßig war sie uns weit überlegen, was natürlich erhöhten Umsatz versprach, doch da wir im Gegensatz zu ihr auch noch die Kapelle gebucht und darüber hinaus Zimmer belegt hatten, wurde uns ebenfalls ein Aufenthaltsrecht unter den Schatten spendenden Bäumen zugestanden. Die anderen Gäste mussten so lange zusammenrücken, bis einer der langen rustikalen Holztische frei wurde, nur reichten die Stühle nicht aus, was aber nicht weiter schlimm war, denn mindestens einer von uns war immer auf dem Weg von oder zu den Toiletten.
Da saßen wir nun, tranken literweise überwiegend Alkoholfreies, hatten Hunger, weil in Erwartung kommender Genüsse niemand richtig gefrühstückt hatte, guckten alle fünf Minuten auf die Uhr (ab halb eins reklamierte Rolf sein Mittagsschläfchen, an das er sich seit Beginn seines offiziellen Rentnerdaseins gewöhnt hatte) und kamen zu dem Schluss, dass wir alle schon amüsantere Hochzeiten erlebt hatten.
Endlich tauchte die Vorhut auf, nämlich die beiden kleinen Brautjungfern, schon etwas zerrupft, dann kam Sascha, Hemdkragen offen und Jackett überm Arm, ein paar Minuten später aus der entgegengesetzten Richtung die frisch restaurierte Braut. Und dann fand mitten auf dem Burghof eine Begegnung statt, wie ich sie mir – o selige Pennälerzeiten! – immer wieder mal vorgestellt hatte, solange wir uns mit Schillers Maria Stuart herumplagen mussten. Sogar die Kulisse stimmte! In einer Szene begegnen sich nämlich Maria und Elisabeth von England zum ersten Mal, nicht gerade freundlich gesonnen, doch zumindest Haltung bewahrend. Noblesse oblige! Genauso musterten sich die beiden Bräute, als sie sich unverhofft gegenüberstanden, wobei Nastassja die besseren Karten hatte. Nicht nur, weil sie die Hübschere war, doch das war nicht ihr Verdienst, so was hat man ja in erster Linie den dafür zuständigen Genen zu verdanken, sondern hauptsächlich wegen ihres Kleides. Ein bisschen erinnerte es an ein Abendkleid im Trachtenlook, cremefarben mit darauf abgestimmten bordeauxroten Applikationen, enges Mieder, weiter bodenlanger Rock … Und als Pendant dazu die andere, schon in jungen Jahren übergewichtige Braut in einem Wust von weißen Rüschen, in denen sie aussah wie ein Sahnebaiser.
Der Triumph in Nastassjas Augen dauerte nur Sekunden, dann lächelte sie freundlich, nickte und kam zu uns an den Tisch. »Die Verkäuferin, die dem armen Mädchen diesen Albtraum angehängt hat, sollte man fristlos entlassen!«, meinte sie nur.
»Das ist nicht die Verkäuferin gewesen«, vermutete Katja – nicht umsonst hatte sie während der Studienzeit zweimal wöchentlich in der Modeabteilung eines Kaufhauses gejobbt und entsprechende Erfahrungen gesammelt. »Das war die geballte Macht von Mama, Oma, zwei Tanten und der Nachbarin, die immer auf den Hund aufpasst. – Kriegen wir jetzt endlich was zu essen, oder soll ich mir doch erst mal ’ne Bockwurst bestellen?«
Der gräfliche Rittersaal einschließlich der angrenzenden Terrasse wurde bereits von der anderen Hochzeitsgesellschaft bevölkert, und so wurden wir in die wesentlich kleinere ehemalige Waffenkammer beordert. Eine lange, festlich geschmückte Tafel füllte den größten Teil des Raumes aus, und wer genau in der Mitte und auf jener Seite saß, wo der ausladende Kamin ins Zimmer ragte, konnte nur dann aufstehen, wenn die Plätze neben ihm ebenfalls geräumt wurden. Also wurde die ursprüngliche Tischordnung so geändert, dass die drei artigen Knaben die strategisch so ungünstigen Stühle besetzten, denn ihnen war es noch zuzumuten, bei Bedarf unterm Tisch durchzukriechen.
Vielleicht sollte ich bei dieser Gelegenheit noch erwähnen, dass sie besonders gegen Ende des Festmahls unverhältnismäßig oft den Drang zur Toilette verspürten und sofort nach dem Dessert um die Erlaubnis baten, den Raum verlassen zu dürfen. Aus gutem Grund, wie sich wenig später herausstellte, denn als wir uns ebenfalls die Füße vertreten wollten, hatten speziell die Männer gewisse Schwierigkeiten – jedenfalls diejenigen mit Schnürsenkeln in den Schuhen. Entweder hatten sie keine mehr drin oder sie waren mit denen ihrer Nachbarn verknüpft.
So viel zum Einfluss nördlichen Reizklimas auf die vermeintlich exzellente Erziehung halbwüchsiger Jungen!
Die meisten Hochzeiten verlaufen alle nach dem gleichen Schema: Es wird viel zu viel gegessen, dito getrunken, Reden werden gehalten, Toasts ausgebracht, die Unterhaltung mit dem bis dahin unbekannten Tischnachbarn wird zunehmend anstrengend, weil man keine Ahnung hat von den verschiedenen Arten der Rohleder-Veredelung und es auch gar nicht wissen will, und hat man sich endlich absetzen können, läuft man dem nächsten Gast in die Arme, der aktives Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr ist und einem die Vorteile der modernen Dreh-Kipp-Leiter gegenüber den Standardmodellen erläutert. Zum Schluss tut es einem beinahe Leid, dass man nicht wenigstens mit einem zünftigen Zimmerbrand gegenhalten kann.
Kaum hatte der Verdauungsprozess des mehrgängigen Mittagessens eingesetzt, wurde das Kuchenbüfett hereingefahren, und pünktlich um acht, als noch immer kein Mensch Hunger hatte, kamen die Kalten Platten fürs Abendessen. Zwischendurch lustwandelten wir ein wenig auf dem Burghof oder zwischen den zur Besichtigung freigegebenen Mauerresten einschließlich des zu jeder anständigen Burg gehörenden Verlieses, und plötzlich hatte ich einen schon recht gut abgefüllten Mann an meiner Seite, der mir bis dahin noch gar nicht aufgefallen war. Er stellte sich als Franz aus Ludwigsburg vor, war der Schwager vom Onkel der Braut (oder so ähnlich) und hielt von dem »Säckl, der wo die Schanett heute g’heiert hat müssen«, offenbar gar nichts.
Er wollte auch nicht wahrhaben, dass er momentan auf der falschen Hochzeit war, und als er es endlich einsehen musste, fing er an zu jammern. Ich ließ ihn auf ein paar Quadratmetern Wiese inmitten von wilden Margeriten stehen in der Hoffnung, dass ihn über kurz oder lang jemand finden würde.
Irgendwann zwischen Kaffee und Abendessen scheuchte uns Sascha ins Freie, auf dass wir neben der Treppe ein Spalier bildeten, während am Fuße derselben die unverheirateten Mädchen und Jungfr … nein, die jungen Frauen Aufstellung nähmen zwecks Empfangnahme des Brautstraußes. Viele waren es ja nicht, zumal die kleinen Brautjungfern noch nicht zugelassen wurden, denn Kinderehen sind in Deutschland nun mal verboten. Doch als Nastassja oben an der Treppe stand, sich langsam umdrehte und über die Schulter den Strauß herabwarf, hatte sich nahezu die komplette Hochzeitsgesellschaft aus dem Rittersaal als Zuschauer eingefunden und johlte Beifall. Gefangen wurde das bordeaux- und cremefarbene Rosenbukett übrigens von Nastassjas Freundin, die bis heute noch nicht verheiratet ist, während die anderen Ledigen inzwischen alle verehelicht oder zumindest verlobt sind (wird ja wieder modern!) und zum Teil sogar schon Nachwuchs haben.
Die alten Hochzeitsbräuche sind eben auch nicht mehr das, was sie mal waren, und der Wahrheitsgehalt ihrer Prophezeiungen ist ähnlich zutreffend wie die bäuerlichen Wetterregeln. Aber damals hat es wohl El Niño noch nicht gegeben …
Die Rüschenbraut wurde nun auch aufgefordert, sich von ihrem Strauß zu trennen, weigerte sich jedoch, es quasi coram publico zu tun, denn inzwischen hatten sich alle abkömmlichen Kellner, Zimmermädchen und sonstigen Angestellten eingefunden. Also zog der gesamte Tross zurück auf die Terrasse, wo er sich frei von Feindeinsicht wähnte. Stimmte aber nicht, denn unsere Waffenkammer lag genau gegenüber und hatte niedliche kleine Fenster mit Butzenscheiben, die man alle öffnen konnte.
Braut Jeannette wurde auf einen herbeigeholten Stuhl gehievt, um 90 Grad gedreht, die als potenzielle Ehekandidatinnen in Betracht kommenden Damen mussten sich in gebührender Entfernung aufstellen, und dann wurde der Strauß mit solcher Vehemenz geworfen, dass er über die Brüstung segelte und dreißig Meter tiefer auf dem Parkplatz landete. Der Bräutigam stiebte los, doch ob noch ein zweiter Versuch stattgefunden hat und falls ja, mit welchem Erfolg, haben wir nicht mehr mitgekriegt, weil sich die ganze Hochzeitsgesellschaft in den Rittersaal zurückzog.
Nach der mitternächtlichen Gulaschsuppe hatte ich vom Feiern genug und sehnte mich nach meinem Bett. Das stand jenseits des Burghofes in einem der winzigen, jedoch sehr stilvoll mit Himmelbett und Bauerntruhe möblierten Zimmer. Ob es mal die Gesindekammern gewesen waren oder die Stallungen, wie Sascha vermutet hatte, weiß ich nicht, war mir auch egal, das Bett hatte jedenfalls eine Matratze und keinen Strohsack, es gab ein richtiges Bad mit Toilette statt des Porzellantopfes unterm Bett, und der in einschlägigen Büchern für mich immer besonders abschreckend klingende Krug mit klarem Brunnenwasser war durch eine moderne Dusche ersetzt worden.
Ich habe absolut nichts gegen Romantik, solange man sie nicht übertreibt. Ein knisterndes Kaminfeuer ist herrlich, aber nur, wenn es irgendwo im Rücken noch eine normale Heizung gibt. Drei Hände voll Brunnenwasser können durchaus erfrischend sein, doch sich damit morgens waschen oder gar darin baden müssen …? Nein, danke! Ein alter Nachttopf sieht heutzutage ulkig aus, wird, sofern aus Meißen, sogar schon als Antiquität gehandelt (Sven hatte mal einen vom Flohmarkt mitgebracht – nicht aus Meißen! – und Geranien reingepflanzt), doch nachts um drei pfeife ich auf Romantik und ziehe eine Toilette mit Wasserspülung vor!
Rolf lag schon im Bett und studierte die Preisliste von der Minibar. »Du hast doch hoffentlich keinen Durst mehr?«
»Nein, habe ich nicht.« Erleichtert öffnete ich die beiden Knöpfe am Rockbund – der Reißverschluss glitt sofort von allein auseinander! – und schälte mich aus dem engen Futteral. Das hatte ich heute garantiert zum letzten Mal getragen! Ein Wunder, dass es nicht schon vorhin geplatzt war! Keine Ahnung, wann und wie, doch auf rätselhafte Art hatte sich mein Gewicht umverteilt. Die letzte Messung hatten 3 cm mehr in der Taille und 4 cm weniger im weiter oben liegenden Bereich ergeben; wo der eine fehlende Zentimeter geblieben war, hatte ich noch nicht herausgekriegt, wahrscheinlich dort, wo man ihn auch nicht braucht!
»Weshalb hast du mir nicht gesagt, dass du dich in unsere Gemächer zurückziehst? Und wieso ist die rote Zahnbürste nass?« Ich hatte gerade danach gegriffen und festgestellt, dass sie tropfte. »Dir gehört doch die grüne!«
»Tatsächlich? Ich war mir da nicht sicher. Tut mir Leid.«
Mir auch! Ich war ja bereit gewesen, mein Leben mit ihm zu teilen, mein Bett und im Notfall auch meine letzte Zigarette, nicht aber die Zahnbürste!!! Zu Hause ist das ja kein Problem, Herr Alibert hat dafür gesorgt, dass jeder von uns seine eigenen Fächer im Spiegelschrank hat, und dort, wo Rasierschaum und Aftershave stehen, findet Rolf auch auf Anhieb seine Zahnbürste. Für unterwegs werde ich ihm wohl doch wieder einen mit Wäschetinte beschrifteten Leukoplaststreifen auf den Stiel kleben müssen!
Also gut, es wird auch mal ohne gehen, Mundausspülen muss heute genügen, ist vielleicht sogar gesünder, erst unlängst hatte ich in der Zeitung von einem Fünfundneunzigjährigen gelesen, der noch alle Zähne hat, in seinem ganzen Leben nicht ein einziges Mal beim Zahnarzt gewesen war und dem Reporter eine noch in brüchiges Seidenpapier gewickelte und mit blauem Bändchen verzierte Zahnbürste gezeigt haben soll, die ihm seine Frau zur Hochzeit geschenkt hatte. So weit ich mich erinnere, wohnt er irgendwo auf der Schwäbischen Alb. Wahrscheinlich wäscht er sich auch mit Brunnenwasser.
Weshalb Rolf sich ohne mich abgeseilt hatte, habe ich nicht mehr erfahren, denn als ich ins Zimmer zurückkam, schlief er schon. Ich nahm ihm die Preisliste aus der Hand, stellte fest, dass ein Minifläschchen Whisky hier genauso viel kostete wie im Bayerischen Hof in München, knipste die Nachttischlampe aus und kuschelte mich in mein Bett. Durch das geöffnete Fenster kamen Töne herein, die entfernt an Musik erinnerten; anscheinend war man jetzt, nachdem die Alten das Feld geräumt hatten, zu den moderneren Klängen übergegangen. Viel habe ich dafür nicht übrig, doch einen Vorteil hat die moderne Musik: Kein Mensch kann sie pfeifen!
Um neun Uhr wollten wir uns alle zum Frühstück treffen, um halb zehn waren wir die Ersten, die Letzten kamen, nachdem der allgemeine Aufbruch schon eingesetzt hatte. Fast alle Hochzeitsgäste hatten eine stundenlange Autofahrt vor sich, und auch Sascha, der ursprünglich einen Erholungstag bei uns eingeplant hatte, musste sich in das Unabänderliche fügen. Noch etwas ungeübt als neugebackener Stiefvater schulpflichtiger Töchter hatte er nicht daran gedacht, dass der kommende Tag ein ganz gewöhnlicher Montag war, zwei gleichzeitig erkrankte Schwestern jedoch wenig glaubhaft sein würden.
»Der Mensch wird frei geboren und dann eingeschult!«, hatte Sunny gemault, als Nastassja ihr eine nachträgliche Entschuldigung für versäumten Unterricht rundweg verweigerte, und Michelle hatte sie noch übertrumpft: »Ich kann morgen ruhig fehlen, weil wir bloß Sport haben, Geographie und zwei Stunden Englisch. Grammatik natürlich, aber die kann Sascha viel besser erklären als der blöde Heiermann.«
»Heißt der wirklich so?«, hatte ich wissen wollen.
»Nein!« Grinsend hatte sie mich angesehen. »Sein richtiger Name ist Klausen, aber weil er ein falscher Fünfziger hoch zehn ist, heißt er in der ganzen Schule bloß noch Heiermann. So wird bei uns nämlich ein Fünfmarkstück genannt«, hatte sie erläuternd hinzugefügt, immer noch unsicher, wie sie mich einzuschätzen hatte. Ihrer Vorstellung von der am Herd stehenden, Semmelknödel rollenden Großmutter hatte ich schon bei unserer ersten Begegnung nicht entsprochen, denn sie hatte mich am voll gepackten Schreibtisch vor dem Computer sitzend vorgefunden. Nachdem Sascha ihr erzählt hatte, dass ich Bücher schreibe, war ich für kurze Zeit sogar in ihrer Achtung gestiegen; nicht etwa wegen der Tatsache als solcher, sondern weil ich dann ja berühmt sein musste und vor allen Dingen reich. Dass beides nicht der Fall ist, nahm sie mir nicht ab, Astrid Lindgren und Enid Blyton täten ja auch nichts anderes, und die würde jedes Kind kennen.
Inzwischen ist eine ganze Menge Zeit vergangen, aus dem netten, lustigen Mädchen ist ein Teenager geworden, und zwar einer der nicht mal mehr erträglichen Sorte, doch da sich ihre Besuche immer nur auf zwei oder drei Tage beschränken, üben wir uns in gegenseitiger Toleranz. Ich entspreche ja auch nicht ihren Wünschen! Wir wohnen noch immer in einem simplen Reihenhaus, haben auch kein Dienstmädchen, das Logiergästen die Betten macht und ihnen die herumliegenden Klamotten hinterherräumt, also kann es mit meiner Berühmtheit wirklich nicht weit her sein. Und mit dem Reichtum schon gar nicht!
Sunny hat immerhin schon ein Buch von mir gelesen, es »na ja, ganz nett« gefunden, ihre früheren Pläne, bei mir »in die Lehre« zu gehen, allerdings aufgegeben, weil man dabei wohl doch nicht so richtig berühmt werden kann. Sie ist jetzt gerade sechzehn geworden, findet die Schule »echt ääätzend«, Abitur überflüssig, und überhaupt brauche man für eine Fernsehkarriere, etwa als Moderatorin bei VIVA oder MTV, ganz andere Qualitäten. Ich kann mich erinnern, dass Sascha in dem Alter haargenau die gleiche Einstellung hatte, nur wollte er nicht zum Fernsehen, sondern zum Film. Als Stuntman.
Ein Abgeordneter der gräflichen Geschäftsleitung trabte an und machte uns höflich darauf aufmerksam, dass nicht nur die Zimmer bis halb zwölf geräumt sein müssten, was dankenswerterweise geschehen sei, sondern auch der Parkplatz. Die ersten Mittagsgäste seien bereits eingetroffen, in Kürze sei mit einem Engpass zu rechnen, und ob wir nicht vielleicht die Parkmöglichkeiten ganz unten am Fuß des Berges …
Jetzt ging alles ganz schnell. Das Gepäck war ohnehin schon verladen, die Abschiedsformalitäten schnell erledigt, jeden hatte es gefreut, alle kennen zu lernen, natürlich würde man sich wieder sehen, irgendwann einmal, spätestens zur Taufe, hahaha … Türen klappten, Hupen tönten, dann rollten die Wagen abwärts. Nur Thomas war noch neben mir stehen geblieben. »Was moanst?«, sinnierte er, der Autokolonne hinterherwinkend. »Ob’s jetzt gut ausgeht? Oder treff’ ma uns am End’ bei der dritten Hochzeit vom Sascha wieder?« Entsetzt sah ich ihn an. »Kommt nicht in Frage! Jetzt sind erst mal seine Schwestern dran!«
Nun schien es wirklich so weit zu sein. Offiziell wusste ich noch gar nichts, inoffiziell hatte mich Steffi aber doch schon informiert, natürlich unter dem Siegel der Verschwiegenheit.
»Weshalb so plötzlich? Ist sie schwanger?« Ein nahe liegender Gedanke, denn Nicki und Jörg lebten seit bald zwei Jahren zusammen, liebten sich immer noch, hatten aber bis dato nie die Absicht geäußert, ihre Verbindung auch amtlich besiegeln zu lassen. »Wozu denn? Das ist irgendwie so endgültig«, hatte Nicki noch vor gar nicht langer Zeit geäußert, »und bringt ja nicht mal steuerliche Vorteile.«
»Ihr seid mir heute alle zu pragmatisch!« Rolf hatte nur mit dem Kopf geschüttelt. »Früher hat man aus Liebe geheiratet, manchmal auch wegen Geld, doch nur, wenn sich’s wirklich gelohnt hat, aber wann heiratet man heutzutage?«
»Wenn der Bausparvertrag reif ist!«, hatte Katja gesagt. »Oder habt ihr etwa keinen?«
»Sogar zwei!«
»Wieso denn das? Jörg ist doch gar kein Schwabe.«
»Der nicht, aber ich!«
Das allerdings hatte ich sofort bestritten! »Ein Pferd, das zufällig im Kuhstall geboren wird, gibt deshalb noch lange keine Milch, und ein von Preußen gezeugtes und aufgezogenes Kind ist allenfalls ein Papierschwabe, sofern es im Ländle zur Welt gekommen ist. Du beherrschst ja nicht mal den hiesigen Dialekt!«
»Das fehlte noch! Was die hier reden, ist kein Schwäbisch, sondern eine verbale Katastrophe.«
Hm. Na ja, irgendwie hatte sie Recht.
Schließlich hatte Rolf das Thema Heirat beendet mit der Bemerkung, heutzutage sei eben alles anders geworden, er brauche nur mal an die damals üblichen Gepflogenheiten zu denken. »Früher hat man seine Sekretärin auf die Reise mitgenommen und sie als seine Frau ausgegeben, aber jetzt, in der Epoche der Spesenabrechnungen, nimmt man seine Frau mit und gibt sie als seine Sekretärin aus.«
»Na und? Hast du doch auch gemacht! Oder wie war das damals mit Määm und der Geschäftsreise nach Brüssel?«
»Das ist vierzig Jahre her, und überhaupt geht euch das gar nichts an!«
Dieses Gespräch lag ungefähr ein halbes Jahr zurück. Dazwischen hatte jene feierliche Handlung mit Eidesformel und Urkunde stattgefunden, die in dem fürchterlichen Begriff »Verbeamtung auf Lebenszeit« gipfelt. Seit diesem Tag gehören die Zwillinge jener Gattung Arbeitnehmer an, die über besondere, jedoch keineswegs berufsbedingte Fähigkeiten zu verfügen scheinen. Ich gönne sie ihnen ja von Herzen, sehe aber trotzdem nicht ein, dass ein Beamter zum Beispiel besser Auto fahren soll als ein Normalbürger und deshalb sein Fahrzeug preiswerter versichern darf. Und wenn die Zwillinge nicht gerade die schuleigenen Computer klauen, einen Kollegen meucheln oder zum Islam übertreten und Kopftuch tragen, können sie bis zum gesetzlich geregelten Pensionsalter nie mehr aus dem Schuldienst entlassen werden.
Der neue Status muss wohl in Nicole den Wunsch nach einer Neuordnung ihres Privatlebens geweckt haben, und da Jörg ebenfalls festen Fuß gefasst und die untersten Sprossen der beruflichen Karriereleiter bereits überwunden hatte, sollten anscheinend die noch fehlenden Voraussetzungen zur Familiengründung geschaffen werden, nämlich die amtliche Sanktionierung eines eheähnlichen Verhältnisses. Letztendlich muss man auch an die Eltern der Schüler denken … in der Provinz sind die meisten noch heute viel konservativer als in der Großstadt … hier ist man als Lehrerin immer noch eine Art Vorbild … außerdem gibt es für Verheiratete mehr Geld, und der Ehemann darf dann ebenfalls zum Beamtentarif Auto fahren.
Aber noch war es nicht so weit. Wenn ich Steffi vorhin richtig verstanden hatte, war die Hochzeit erst für Juni geplant, jetzt hatten wir Anfang Januar, ich litt noch unter den Nachwehen des familienintensiven Weihnachtsfestes, und mein Sinn stand zur Zeit mehr nach Pinacolada unter Palmen als nach Hochzeitstorte unterm Fliederbusch. Und überhaupt durfte ich doch noch gar nichts davon wissen. Wahrscheinlich würden wir das ganz offiziell erst am kommenden Sonntag erfahren, oder weshalb sonst hätten uns Tochter und potenzieller Schwiegersohn zum Mittagessen eingeladen?