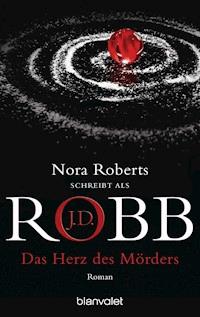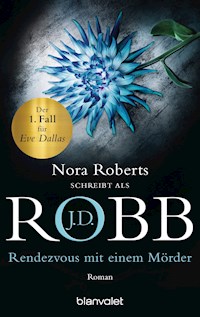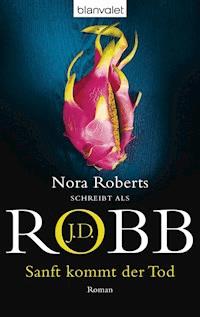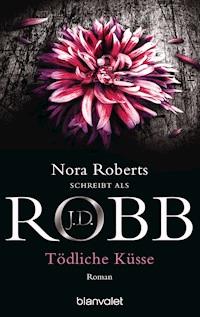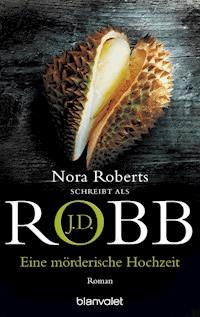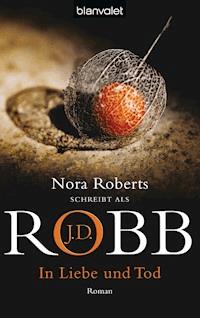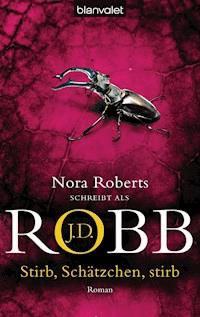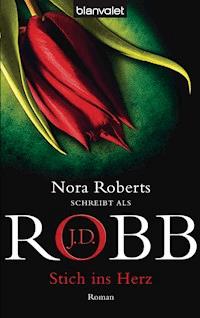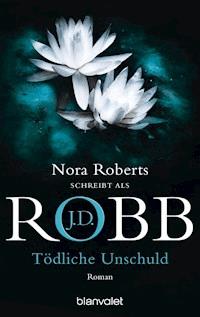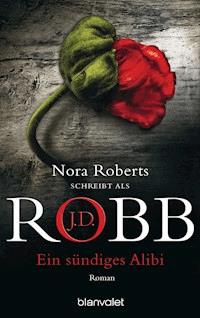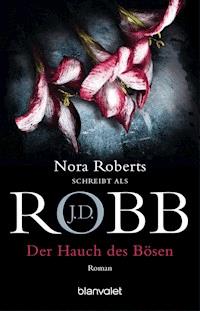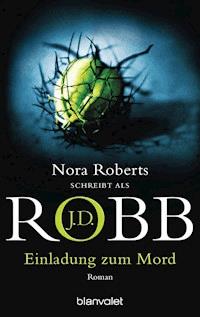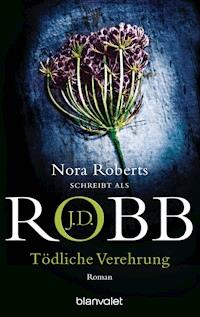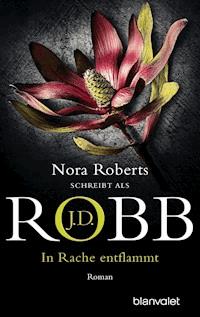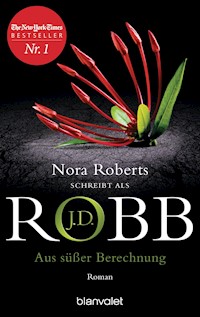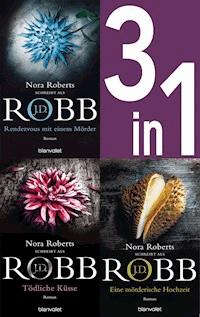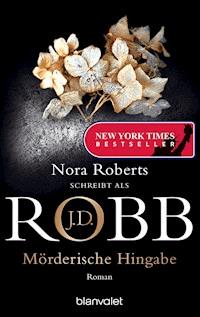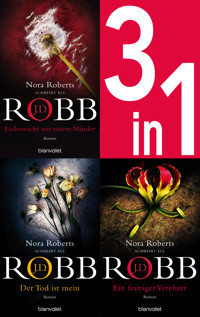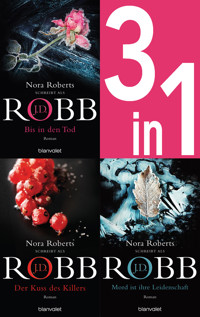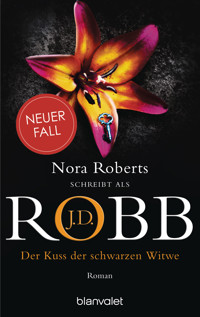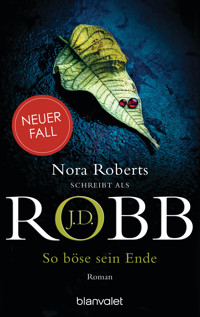Inhaltsverzeichnis
Buch
Autorin
Von J. D. Robb ist bereits erschienen:
Inschrift
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Copyright
Buch
Eine persönliche Nachricht, eine tote Prostituierte und ein Tatort, der kaum blutiger sein könnte: Lieutenant Eve Dallas verfolgt einen Killer durch die Straßen von New York, der die Handschrift der brutalsten Serienmörder der Geschichte kopiert, angefangen bei Jack the Ripper. Schnell wird klar, dass die Polizistin diesmal mehr als nur unbeteiligte Ermittlerin ist – sie steht direkt im Fadenkreuz des Täters. Eine atemlose Hetzjagd beginnt, die Eve bis in die höchsten Kreise der Reichen und Mächtigen führt. Eve und der Mörder sind beide Jäger und Gejagte zugleich. Und Eve weiß, nur wer schneller zuschlägt, wird überleben …
Autorin
J. D. Robb ist das Pseudonym der international höchst erfolgreichen Autorin Nora Roberts. Durch einen Blizzard entdeckte Nora Roberts ihre Leidenschaft fürs Schreiben: Tagelang fesselte 1979 ein eisiger Schneesturm sie in ihrer Heimat Maryland ans Haus. Um sich zu beschäftigen, schrieb sie ihren ersten Roman. Zum Glück – denn inzwischen zählt Nora Roberts zu den meistgelesenen Autorinnen der Welt. Unter dem Namen J. D. Robb veröffentlicht sie seit Jahren ebenso erfolgreich Kriminalromane. Auch in Deutschland sind ihre Bücher von den Bestsellerlisten nicht mehr wegzudenken.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.blanvalet.de und www.jdrobb.com
Von J. D. Robb ist bereits erschienen:
Rendezvous mit einem Mörder (1; 35450) · Tödliche Küsse (2; 35451) · Eine mörderische Hochzeit (3; 35452) · Bis in den Tod (4; 35632) ·Der Kuss des Killers (5; 35633) · Mord ist ihre Leidenschaft (6; 35634) ·Liebesnacht mit einem Mörder (7; 36026) · Der Tod ist mein (8; 36027) · Ein feuriger Verehrer (9, 36028) · Spiel mit dem Mörder (10; 36321) · Sündige Rache (11; 36332) · Symphonie des Todes (12; 36333) · Das Lächeln des Killers (13; 36334) · Einladung zum Mord (14; 36595) · Tödliche Unschuld (15, 36599) · Der Hauch des Bösen (17; 36693)
Mörderspiele. Drei Fälle für Eve Dallas (36753) Nora Roberts ist J. D. Robb Ein gefährliches Geschenk (36384)
Weitere Romane von Nora Roberts und J. D. Robb sind bei Blanvaletbereits in Vorbereitung.
Die Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel »Imitation in Death« bei Berkley Books, The Berkley Publishing Group, Penguin Group (US) Inc., New York.
No man ever yet became great by imitation. Niemand hat Größe je durch Nachahmung erreicht.
Samuel Johnson
»And the Devil said to Simon Legree: ›I like your style, so wicked and free.‹« »Und der Teufel sagte zu Simon Legree: ›Mir gefällt dein Stil, so gemein und frei.‹«
Vachel Lindsay
Prolog
Der Sommer des Jahres 2059 war wie eine bösartige, mörderische Bestie, die New York auch weiter gnadenlos in ihren Krallen hielt, nachdem der schweißtreibende August endlich vergangen war. Jetzt hüllte ein heißer, schwüler, stinkender September New York wie in eine nasse Decke in sich ein.
Der Sommer, dachte Jacie Wooton, war tödlich fürs Geschäft.
Es war kurz nach zwei, also eigentlich die beste Zeit. Die Bars spuckten die Gäste aus, und diese Gäste waren für gewöhnlich auf der Suche nach noch ein bisschen mehr Spaß. Im Herzen der Nacht, wie sie es gerne nannte, kamen diejenigen, die noch etwas Gesellschaft wollten und dafür bezahlen konnten, am häufigsten zu jemandem wie ihr.
Seit sie ein paar Mal wegen irgendwelcher Drogen hochgenommen worden war, war sie nur noch für die Arbeit auf der Straße lizenziert. Aber inzwischen war sie sauber, und sie hatte die Absicht, die Leiter der Prostitution wieder so weit zu erklimmen, dass sie sich eine schicke Wohnung leisten konnte, in der sie einsame, reiche Gönner empfing.
Erst einmal musste sie sich aber ihren gottverdammten Lebensunterhalt hier auf dem Straßenstrich verdienen, doch bei der Affenhitze hatte kaum jemand Interesse daran, für etwas zu bezahlen, bei dem er noch mehr in Schweiß geriet. Dass sie in den letzten beiden Stunden kaum Kolleginnen getroffen hatte, sagte ihr, dass in dem momentanen Klima auch kaum jemand bereit war, Sex zu haben, wenn er Geld dafür bekam.
Aber Jacie war ein Profi, und zwar schon seit der Nacht vor über zwanzig Jahren, in der sie in das Geschäft mit der bezahlten Liebe eingestiegen war. Auch wenn sie in der Hitze vielleicht schwitzte, welkte sie doch nicht. Ebenso, wie sie unter der Straßenlizenz auf Bewährung vielleicht hin und wieder leise stöhnte, daran aber nicht zerbrach.
Sie würde auf den Füßen bleiben – oder, je nach Wunsch des Kunden, auf den Knien, auf dem Rücken oder auf dem Bauch – und ihre Arbeit tun.
Sie würde ihre Arbeit tun, die Kohle auf die Seite legen und in ein paar Monaten wieder in ein Penthouse in der Park Avenue umziehen, denn dort gehörte sie hin.
Sie verdrängte den Gedanken, dass sie vielleicht etwas zu alt und weich für die Arbeit auf der Straße war, und konzentrierte sich ausschließlich darauf, noch einen Kunden aufzureißen. Einen letzten Kunden vor Ende dieser Schicht.
Ohne einen letzten Kunden bliebe ihr nach Zahlung ihrer Miete nicht genügend Geld für den Schönheitssalon. Und sie brauchte dringend eine Überholung.
Nicht, dass sie nicht noch immer gut aussehen würde, sagte sie sich, während sie an einer Straßenlaterne in dem drei Blocks umfassenden Gebiet, das sie in dieser düsteren Gegend der City für sich beansprucht hatte, vorüberschlenderte. Sie achtete auf sich. Vielleicht hatte sie die Drogen gegen eine tägliche Flasche Wodka eingetauscht – und, verdammt, sie könnte augenblicklich einen Schluck vertragen -, aber sie sah immer noch fantastisch aus.
Sie stellte das, was sie zu bieten hatte, in einem leuchtend roten, knappen Büstenhalter und einem kaum über die Pobacken reichenden Minirock in derselben Farbe vorteilhaft zur Schau. Bis sie in den Schönheitssalon käme, hielte der BH ihren Busen ersatzweise in Form. Das Beste an ihr waren aber immer noch die Beine. Sie waren lang und wohlgeformt und wirkten in den silbernen High Heels, deren kreuzweise gebundene Riemchen bis zu den Knien reichten, erotischer denn je.
Nur brachten sie sie beinahe um, als sie auf der Suche nach einem letzten Freier durch die Straßen streifte.
Um ihren Füßen eine kurze Pause zu verschaffen, lehnte sie sich an den nächsten Laternenpfosten, streckte ihre Hüfte vor und sah sich aus müden braunen Augen suchend in der beinahe menschenleeren Straße um. Sie hätte die lange Silberperücke aufsetzen sollen, überlegte sie. Auf lange Haare fuhren beinahe alle Kerle ab. Aber den Gedanken an das Gewicht einer Perücke hatte sie heute Abend nicht ertragen und sich deshalb einfach ihre eigenen rabenschwarzen Haare hochgesteckt und mit etwas silbernem Glitzerspray besprüht.
Ein paar Autos fuhren an ihr vorbei, doch obwohl sie sich nach vorne beugte und einladend mit den Hüften wackelte, hielt einfach niemand an.
Noch zehn Minuten, dann gäbe sie auf. Sie würde dem Vermieter einfach gratis einen blasen, wenn er wegen der Miete kam.
Sie stieß sich von dem Laternenpfosten ab und lief langsam mit schmerzenden Füßen in Richtung des winzig kleinen Zimmers, mit dem sie sich begnügen musste, seit sie aus der exklusiven Wohnung in der Upper West Side mit dem prall mit unzähligen wunderschönen Kleidern gefüllten Schrank, die sie sich dank ihres vollen Terminkalenders früher hatte leisten können, rausgeflogen war.
Drogen, hatte die Bewährungshelferin erklärt, schickten einen in eine abwärts verlaufende Spirale, und häufig endete diese Spirale mit einem elendigen Tod.
Sie hatte die Spirale überlebt, ging es Jacie durch den Kopf, nur dass eben jetzt ihr Leben elend war.
Noch ein halbes Jahr, versprach sie sich. Dann wäre sie wieder ganz oben.
Dann entdeckte sie den Typen, der ihr entgegenkam. Reich, exzentrisch und eindeutig am falschen Ort – in dieser Gegend lief kaum je ein Mann in einem teuren Smoking oder gar in einem eleganten, schwarzen Umhang, mit einem Zylinder auf dem Kopf und einer schwarzen Ledermappe in der Hand herum.
Jacie setzte ihr Arbeitsgesicht auf und strich mit einer Hand über ihren knappen Rock. »He, Baby. Du siehst so schick aus, warum feierst du nicht etwas mit mir?«
Als er sie mit einem schnellen, beifälligen Lächeln ansah, blitzten in seinem Mund zwei Reihen kerzengerader, strahlend weißer Zähne auf. »Was hast du dir denn vorgestellt?«
Seine Sprechweise passte zu seinem Aufzug. Er gehörte eindeutig zur Oberschicht, dachte sie halb wehmütig und halb erfreut. Stilvoll, kultiviert. »Was du willst. Du bist der Boss.«
»Dann vielleicht eine kleine Privatparty, irgendwo hier … in der Nähe.« Er sah sich suchend um und winkte dann in Richtung einer schmalen Gasse. »Ich habe leider nicht viel Zeit.«
Die Gasse verhieß einen Quickie, und der kam ihr gerade recht. Sie brächten die Sache innerhalb von wenigen Minuten hinter sich, und wenn sie geschickt vorging, strich sie neben der Gebühr vielleicht noch ein ordentliches Trinkgeld ein. Dann reichte ihre Kohle für die Miete und die Busenstraffung, dachte sie vergnügt.
»Du bist nicht hier aus der Gegend, oder?«
»Weshalb fragst du das?«
»Du klingst nicht so und siehst auch nicht so aus.« Sie zuckte mit den Schultern. Im Grunde ging es sie nicht das Geringste an. »Sag mir, was du möchtest, Baby, dann bringen wir den finanziellen Teil dieses Geschäfts sofort hinter uns.«
»Oh, ich will alles.«
Lachend legte sie die Hand in seinen Schritt. »Mmm. Das spüre ich. Dann sollst du auch alles kriegen.« Dann kann ich endlich diese Schuhe ausziehen und etwas trinken. Sie nannte einen hohen Preis, und als er einfach nickte, verfluchte sie sich stumm, weil sie nicht noch höher gegangen war.
»Ich will den Zaster vorher«, erklärte sie entschieden. »Erst das Geld, dann das Vergnügen.«
»Sicher. Als Erstes wird bezahlt.«
Immer noch lächelnd drückte er sie plötzlich mit dem Gesicht gegen die Wand, riss ihren Kopf an den Haaren nach hinten, zückte gleichzeitig ein Messer und schlitzte ihr, bevor sie auch nur schreien konnte, mit einem schnellen Schnitt die Kehle auf. Sie starrte ihn aus großen Augen an, öffnete den Mund, machte ein gurgelndes Geräusch und glitt dann an der Mauer in den Dreck hinunter.
»Und jetzt kommt das Vergnügen«, stellte er zufrieden fest und machte sich ans Werk.
1
Es gab einfach immer wieder Neues zu sehen. Egal, wie oft man schon durch das Blut und durch die Eingeweide Toter gestapft war, egal, wie häufig man das grausige Szenarium gewaltsamer Tötungen schon erlebt hatte, es gab doch immer wieder Neues.
Immer gab es etwas, das noch schlimmer, noch gemeiner, noch verrückter, noch bösartiger, noch grausamer war.
Als Lieutenant Eve Dallas über der Gestalt stand, die einmal eine Frau gewesen war, fragte sie sich, ob dies nicht vielleicht doch der Gipfel allen Grauens war.
Zwei der uniformierten Beamten, die zum Fundort gerufen worden waren, standen immer noch am Ausgang der schmalen, engen Gasse und kotzten sich die Seelen aus dem Leib. Sie selbst stand mit versiegelten Händen und Schuhen direkt neben der Toten und atmete, damit ihr eigener Magen sich beruhigte, ein paar Mal möglichst langsam aus und ein.
Hatte sie schon einmal so viel Blut gesehen? Sicher war es besser, wenn es ihr nicht mehr einfiele.
Sie ging in die Hocke, öffnete den Untersuchungsbeutel und zog den Identifizierungspad zur Überprüfung der Fingerabdrücke des Opfers daraus hervor. Da sich das überall verspritzte Blut nicht einfach abwischen ließ, dächte sie am besten nicht mehr darüber nach. Sie hob die schlaffe Hand der Toten und drückte ihren Daumen auf den Pad.
»Das Opfer ist eine weiße Frau. Die Leiche wurde gegen drei Uhr dreißig von zwei Beamten entdeckt, die auf einen anonymen Anruf hin hierhergekommen sind. Die Überprüfung der Fingerabdrücke hat ergeben, dass es sich bei der Toten um eine gewisse Jacie Wooton handelt, einundvierzig Jahre, lizenzierte Gesellschafterin, wohnhaft in der Doyers Street 375.«
Sie atmete zweimal nacheinander so flach wie möglich aus und ein. »Dem Opfer wurde die Kehle durchgeschnitten. Das Spritzmuster des Blutes lässt vermuten, dass ihr die Wunde zugefügt wurde, während sie mit dem Gesicht zu der nach Norden gehenden Mauer stand, und dass sie dann entweder von selber auf den Rücken gefallen oder von dem oder den Angreifern auf den Rücken gedreht worden ist, bevor …«
Gott. Oh Gott.
»Bevor man ihr den Uterus herausgeschnitten hat. Die Verletzungen an Hals und Unterleib deuten auf präzise Schnitte mit einem scharfen Messer hin.«
Trotz der Hitze strömte kalter, klammer Schweiß über ihren Rücken, als sie weiter Messungen durchführte und Informationen in den Rekorder sprach.
»Tut mir leid«, sagte ihre Assistentin Peabody in ihrem Rücken. Eve brauchte sich nicht umzusehen, um zu wissen, dass Peabodys Gesicht vom Schock und von der Übelkeit noch immer schweißglänzend und kreidig war. »Tut mir leid, Lieutenant; ich konnte mich einfach nicht zusammenreißen.«
»Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Sind Sie jetzt wieder okay?«
»Ich … ja, Madam.«
Eve nickte und fuhr mit ihrer Arbeit fort. Die robuste, ausgeglichene, zuverlässige Peabody hatte nur einen kurzen Blick auf das geworfen, was hier in der Gasse lag, war leichenblass geworden, und hatte auf Eves scharfe Bemerkung, dass sie gefälligst woanders kotzen sollte, auf der Stelle kehrtgemacht.
»Ich habe ihren Namen. Jacie Wooton. Gesellschafterin, wohnhaft in der Doyers. Überprüfen Sie sie bitte für mich.«
»So etwas habe ich noch nie gesehen. Noch nie in meinem …«
»Besorgen Sie mir Informationen über sie. Tun Sie es vorne an der Straße. Hier stehen Sie mir im Licht.«
Peabody wusste genau, dass das nicht stimmte. Ihr Lieutenant wollte ihr nur eine kurze Verschnaufpause verschaffen, da ihr schon wieder übel wurde, nahm sie das Angebot stumm an.
Ihr Hemd war nass vom Schweiß, die dunklen Haare unter ihrer Kappe klebten feucht an ihrem Kopf, ihre Kehle brannte, ihre Stimme piepste, doch während sie den Handcomputer aus der Tasche zog, verfolgte sie, wie ihre Chefin weiter ihre Arbeit tat.
Sie war gründlich, effizient und, wie manche vielleicht sagen würden, kalt. Peabody jedoch hatte den Schock, das Grauen und das Mitleid in ihrem Blick gesehen, bevor ihre eigene Sicht verschwommen war. Kalt war eindeutig das falsche Wort, getrieben passte eher.
Auch Eve war ziemlich blass, bemerkte Peabody, und es lag nicht nur an den grellen Lampen der Spurensicherung, dass jegliche Farbe aus ihrem schmalen Gesicht gewichen war. Ihre braunen Augen blickten völlig reglos und ihre Hände waren ruhig, als sie mit blutverschmierten Stiefeln neben der Toten hockte und gründlich untersuchte, welch grauenhafter Frevel an ihr begangen worden war.
Der Rücken ihres Hemdes wies eine dünne Schweißspur auf, doch sie war nicht davongestolpert, hatte nicht gewürgt. Nein, sie war geblieben und sie würde bleiben, bis ihr Job erledigt war.
Eve richtete sich wieder auf, und Peabody sah eine große, schlanke Frau in abgewetzten Jeans und einer wunderbaren Leinenjacke, mit einem fein gemeißelten Gesicht mit einem vollen Mund, großen goldbraunen Augen und kurzem, wirrem, ebenfalls goldbraunem Haar.
Vor allem aber sah sie eine Polizistin, die noch nie vor irgendwelchen Toten zurückgewichen war.
»Dallas -«
»Peabody, solange Sie keine Spuren dadurch verwischen, kotzen Sie meinetwegen die ganze Straße voll. Und jetzt sagen Sie mir, was Sie rausgefunden haben.«
»Das Opfer hat seit zweiundzwanzig Jahren in New York gelebt. Erst am Central Park West und seit achtzehn Monaten hier.«
»Ziemlich krasser Abstieg. Weshalb wurde sie hochgenommen?«
»Wegen Drogen. Insgesamt dreimal. Sie hat ihre Callgirl-Lizenz verloren, war dann aber sechs Monate in der Reha und in psychotherapeutischer Behandlung, wofür sie vor circa einem Jahr eine Straßenlizenz auf Bewährung ausgestellt bekommen hat.«
»Hat sie gegen ihren Dealer ausgesagt?«
»Nein, Madam.«
»Wir werden sehen, was die toxikologische Untersuchung bringt, aber ich glaube nicht, dass Jack ihr Dealer war.« Eve griff nach dem Umschlag, der auf der Brust der toten Frau gelegen hatte, und der jetzt in einem Plastikbeutel steckte, damit er keine Flecken abbekam.
LIEU TENAN T EVE DALLAS, POLIZEI NEW YORK
Die Worte waren, wie sie annahm, mit einem Computer in einer eleganten Schrift auf elegantes, cremefarbenes Papier gedruckt. Dick, schwer, teuer. Die Art von Papier, auf der man in der so genannten besseren Gesellschaft Einladungen schrieb. Sie kannte sich mit diesen Dingen aus, dachte sie ironisch, da schließlich ihr eigener Ehemann regelmäßig Einladungen zu exklusiven Veranstaltungen verschickte und bekam.
Dann zog sie einen zweiten Plastikbeutel aus der Tasche und las erneut den darin aufbewahrten Brief.
Hallo, Lieutenant Dallas,
ist es Ihnen heiß genug? Ich weiß, Sie hatten einen anstrengenden Sommer, denn ich habe Ihre Arbeit voller Bewunderung verfolgt. Mit keinem anderen Mitglied der New Yorker Polizei gehe ich deshalb lieber eine innige Beziehung ein.
Hier ist eine kleine Kostprobe von meiner Arbeit. Was halten Sie davon?
Ich freue mich bereits auf weitere Treffen.
Jack
»Ich werde dir sagen, was ich von dir halte, Jack. Du bist für mich ein krankes Arschloch, weiter nichts. Einpacken«, wies sie die Sanitäter mit einem letzten Blick auf Jacie Wooton an. »Schafft sie in die Pathologie.«
Wootons Wohnung lag im vierten Stock eines der Gebäude, die als vorübergehende Unterkünfte für die Flüchtlinge und Opfer der Innerstädtischen Revolten vor allem in den ärmeren Bezirken von New York errichtet worden und bereits seit Jahren zum Abriss vorgesehen waren.
Die städtischen Behörden zögerten den Rauswurf all der kleinen Nutten, Junkies, Dealer und Niedriglohnempfänger immer wieder hinaus, und während sie dies taten, verfielen die Gebäude immer weiter, ohne dass irgendjemand etwas dagegen unternahm.
Eve ging sicher davon aus, dass nichts geschehen würde, bis eine der Ruinen in sich zusammenbrach und die Bewohner unter sich begrub. Dann endlich würde den Verantwortlichen vielleicht eine Klage an den Hals gehängt.
Bis dahin aber wären derartige Häuser auch weiterhin die Orte, an denen man glücklose kleine Prostituierte wie Jacie Wooton fand.
Ihr Zimmer war ein kleiner, stickiger Verschlag mit einer kaum sichtbaren Küchenzeile und einem handtuchgroßen Bad, aus dem sich dem Bewohner die wunderbare Aussicht auf die Wand des identischen Nachbarhauses bot.
Durch die dünnen Wände drang das heldenhafte Schnarchen eines Nachbarn an Eves Ohr.
Trotz der dürftigen Umgebung hatte Jacie streng auf Sauberkeit geachtet und sich um so viel Schick wie möglich bemüht. Die Möbel waren billig, aber farbenfroh, und statt hinter teuren Jalousien hatte sie das Fenster einfach hinter gerüschten Vorhängen versteckt. Das Schlafsofa war ausgezogen, das Bett aber gemacht. Das teure Baumwolllaken stammte sicher noch aus besseren Zeiten, überlegte Eve.
Ein billiges Telefon stand auf einem kleinen Tischchen, und auf einer schäbigen Kommode waren Jacies Arbeitswerkzeuge verteilt: Kosmetika, Parfüms, Perücken, Modeschmuck, abwaschbare Tattoos. Schubladen und Schrank waren zum größten Teil mit Arbeitskleidung angefüllt, dazwischen aber hingen auch ein paar konservative Kleidungsstücke, in denen Jacie offenbar in ihren freien Stunden herumgelaufen war.
Eve fand einen Vorrat rezeptfreier Medikamente, darunter anderthalb Flaschen Ausnüchterungsmittel, was angesichts der beiden Flaschen Wodka und der Flasche selbstgebrannten Fusels in der Küche einen gewissen Sinn ergab.
Da sie keine Drogen in der Wohnung fand, ging sie davon aus, dass Jacie von den Chemikalien zu Alkohol gewechselt hatte, der zwar vielleicht nicht wirklich besser, aber zumindest nicht verboten war.
Sie trat vor das Telefon und spielte die Gespräche der vergangenen drei Tage ab. Eins mit ihrer Bewährungshelferin wegen der Erweiterung ihrer Lizenz, einen unbeantworteten Anruf des Vermieters wegen der ausstehenden Miete, und ein Telefonat mit einem exklusiven Schönheitssalon, bei dem es um die Tarife für diverse Behandlungen gegangen war.
Keine Plauderei mit irgendeiner Freundin.
Über ihre spärlichen Finanzen hatte Jacie penibel Buch geführt. Sie hatte auf ihr Geld geachtet, war regelmäßig ihrer Arbeit nachgegangen, hatte einen Teil der Kohle auf die Bank getragen, das meiste jedoch wieder in die Arbeit investiert. Die Ausgaben für Kleidung, Körper-, Haar-, Gesichtsbehandlungen waren erstaunlich hoch.
Ein seltsamer und trauriger Kreislauf, überlegte Eve.
»Sie hat sich ein hübsches Nest in einem sehr hässlichen Baum gebaut«, stellte sie Peabody gegenüber fest. »Ich habe keine Gespräche oder andere Nachrichten von irgendeinem Jack oder einem anderen Kerl entdeckt. Sie war nicht verheiratet und hatte auch keine eingetragene Partnerschaft?«
»Nein, Madam.«
»Am besten sprechen wir mit ihrer Bewährungshelferin. Sie kann uns sicher sagen, ob es einen Menschen gab, dem sie besonders nahe stand oder den sie vielleicht verlassen hat. Allerdings glaube ich kaum, dass wir ihn in dieser Ecke hier finden.«
»Dallas, ich habe den Eindruck, dass das, was er mit ihr gemacht hat … ich habe den Eindruck, dass das eine persönliche Geschichte war.«
»Den habe ich auch.« Eve sah sich noch einmal in dem Zimmer um. Ordentlich und mädchenhaft zeigte es das verzweifelte Bemühen um ein Mindestmaß an Eleganz und Stil. »Ich denke, dass es sogar sehr persönlich war, dass es aber nicht speziell um Jacie ging. Er hat eine Frau getötet, eine Frau, deren Beruf es war, ihren Körper zu verkaufen. Er hat sie nicht nur umgebracht, sondern ihr obendrein den Teil herausgeschnitten, der symbolisch für ihre Arbeit stand. Es ist nicht besonders schwer, um diese Zeit in dieser Gegend eine Prostituierte aufzutreiben. Er hat also den Ort und auch den Zeitpunkt mit Bedacht gewählt. Eine Kostprobe von seiner Arbeit«, murmelte sie leise. »Das ist alles, was sie für ihn war.«
Sie trat mit zusammengekniffenen Augen vor das Fenster und stellte sich die Straße, die Gasse, das Gebäude vor, wo sie Jacie gefunden hatten. »Vielleicht hat er sie gekannt oder vorher schon einmal gesehen. Vielleicht war es auch reiner Zufall, dass er gerade sie genommen hat. Aber er war auf jeden Fall bereit. Er hatte die Waffe und das Schreiben sowie irgendetwas – eine Tasche, eine Tüte, einen Koffer – bei sich, worin er frische Kleider hatte, weil er sich nämlich sicher umgezogen hat. Schließlich muss er nach der Tat über und über mit Blut bedeckt gewesen sein.
Sie ist mit ihm in die Gasse gegangen«, fuhr Eve nachdenklich fort. »Es war heiß, es war spät, die Geschäfte liefen nicht besonders gut. Aber plötzlich bot sich eine letzte Chance, vielleicht ein letzter Job, bevor sie endlich Feierabend machen konnte. Sie war durchaus erfahren, schließlich hat sie diesen Job zwanzig Jahre lang gemacht, aber sie sah ihm nicht an, dass er gefährlich war. Vielleicht war sie betrunken, oder vielleicht hat er einfach okay auf sie gewirkt. Außerdem war sie die Arbeit auf der Straße nicht gewohnt und hatte deshalb sicher nicht die notwendigen Instinkte.«
Sie war eher das gute Leben gewohnt, dachte Eve, die sexuellen Launen der diskreten Mitglieder der so genannten Oberschicht. Chinatown war ihr bestimmt wie ein völlig fremder Planet erschienen.
»Sie stand mit dem Rücken an der Wand.« Eve konnte es deutlich vor sich sehen. Das aufgetürmte, schwarze, silbrig schimmernde Haar, das grelle Komm-schongroßer-Junge-Rot ihres BHs. »Sie dachte, sie bräuchte die Kohle für die Miete, oder hoffte, er würde sich beeilen, denn ihr taten bestimmt die Füße weh – Himmel, diese Schuhe, die sie anhatte, haben sie sicher beinahe umgebracht. Sie war hundemüde, aber sie wollte noch diesen einen Job durchziehen, bevor sie Feierabend machte.
Als er ihr plötzlich die Gurgel durchgeschnitten hat, war sie vor allem überrascht. Es muss schnell und sauber abgelaufen sein. Ein schneller Schnitt von links nach rechts, quer über die Drosselvene. Das Blut hat wahrscheinlich wie wahnsinnig gespritzt. Bevor ihr Hirn auch nur begriff, was mit ihr passierte, war sie auch schon tot. Für ihn jedoch fing damit alles erst richtig an.«
Sie wandte sich erneut dem Zimmer zu und blickte auf die Kommode mit dem billigen Schmuck, den teuren Lippenstiften, den Parfüms – Imitationen teurer Nobelmarken, um sie daran zu erinnern, dass es eine Zeit gegeben hatte, in der sie in dem echten Duft gebadet hatte, und dass diese Zeit, verdammt noch mal, bald wieder kommen würde, überlegte sie.
»Er hat sie auf den Rücken gedreht und die Frau aus ihr herausgeschnitten. Er hatte eine Tasche oder so dabei, um das zu transportieren, was er ihr genommen hat. Dann hat er sich die Hände abgewischt.«
Auch ihn konnte sie deutlich vor sich sehen, wie er in der schmutzigen Gasse kauerte und mit bluttriefenden Händen Ordnung schuf.
»Wahrscheinlich hat er auch sein Werkzeug abgewischt, die Hände aber ganz bestimmt. Dann hat er den Brief hervorgezogen und ihr ordentlich auf die Brust gelegt. Außerdem muss er das Hemd gewechselt oder eine Jacke drübergezogen haben, damit man das Blut nicht sieht. Und dann?«
Peabody blinzelte verwirrt. »Ah, dann ist er gegangen. Seine Arbeit war erledigt, und er hat sich auf den Heimweg gemacht.«
»Wie?«
»Hm, wenn er in der Nähe wohnt, wahrscheinlich zu Fuß.« Sie atmete tief durch und versuchte statt mit ihren eigenen Augen mit denen ihres Lieutenants oder besser noch des Killers selbst zu sehen. »Er ist derart euphorisch, dass er sich keine Gedanken wegen eines möglichen Überfalles macht. Wenn er nicht in der Nähe wohnt, ist er wahrscheinlich mit seinem eigenen Wagen da, denn selbst wenn er sich umgezogen oder eine Jacke übergeworfen hat, klebt noch immer so viel Blut an ihm, dass man es sicher riecht. Taxi oder U-Bahn wären deshalb einfach zu riskant.«
»Gut. Wir werden überprüfen, ob vielleicht ein Taxi einen Verdächtigen dort in der Gegend aufgelesen hat, aber dabei kommt wahrscheinlich nichts heraus. Jetzt versiegeln wir die Wohnung und hören uns erst mal bei den Nachbarn um.«
Wie in einem solchen Haus nicht anders zu erwarten, hatten die netten Nachbarn nichts gesehen und nichts gehört.
Der Vermieter hatte sein Büro in Chinatown zwischen einer auf Entenfüße spezialisierten Schlachterei und einem Laden für alternative Medizin, der einem Gesundheit, Wohlbefinden und spirituelle Ausgeglichenheit oder das Geld zurück versprach.
Eve kannte Typen wie Piers Chan. Er war ein hemdsärmliger Kerl mit dicken Oberarmen und einem bleistiftdünnen Schnurrbart über einem ebenso schmalen Mund, der trotz der bescheidenen Umgebung einen Ring mit einem dicken Diamanten am kleinen Finger trug.
Der gemischtrassige Mann hatte gerade genug vom Asiaten an sich, dass er seinen Laden in dem geschäftigen Chinatown hatte einrichten können, doch der Letzte seiner Vorfahren, der Peking noch gesehen hatte, hatte seine besten Jahre wahrscheinlich während des Boxeraufstandes gehabt.
Während er beruflich über einen Teil der Slums der Lower East Side herrschte, lebte er privat mit seiner Familie sicher in irgendeinem schicken Vorort in New Jersey, stellte Eve verächtlich fest.
»Wooton, Wooton.« Während sich zwei von seinen Angestellten stumm im Hintergrund beschäftigten, blätterte Chan die Mieterliste durch. »Ja, sie hat eins der De-luxe-Apartments in der Doyers.«
»De luxe?«, wiederholte Eve mit ungläubiger Stimme. »Wodurch, bitte, wird dieses Loch de luxe?«
»Es hat eine Küchenzeile mit eingebautem Kühlschrank und integriertem AutoChef. Alles inklusive. Allerdings ist sie mit der Miete wieder mal im Rückstand. Die Zahlung war bereits vor über einer Woche fällig. Sie hat vor ein paar Tagen den Standarderinnerungsanruf von mir bekommen. Heute rufe ich sie noch mal an, und wenn dann nichts passiert, flattert ihr nächste Woche automatisch die Kündigung ins Haus.«
»Das wird nicht mehr nötig sein, weil sie nämlich heute früh ins Leichenschauhaus umgezogen ist. Sie wurde letzte Nacht ermordet.«
»Ermordet.« Sein Stirnrunzeln drückte wahrscheinlich eher Verärgerung als Mitgefühl oder Entsetzen aus. »Gottverdammt. Heißt das, dass die Wohnung jetzt versiegelt ist?«
Eve legte ihren Kopf ein wenig schräg. »Weshalb wollen Sie das wissen?«
»Hören Sie, mir gehören sechs Gebäude mit insgesamt zweiundsiebzig Apartments. Wenn man so viele Mieter hat, kratzt immer wieder einmal einer davon ab. Es gibt ganz normale Todesfälle, verdächtige Todesfälle, Unfälle, Selbstmord und eben auch Mord«, zählte er die Möglichkeiten an seinen fetten Fingern ab. »In einem Mordfall kommt eben ihr Bullen, versiegelt die Wohnung und verständigt die nächsten Angehörigen. Bevor ich auch nur blinzeln kann, kommt irgendein Onkel oder so und räumt die Bude aus, ehe ich zum Ausgleich für die noch ausstehende Miete irgendetwas sicherstellen kann.«
Jetzt spreizte er die Hände und bedachte Eve mit einem unglücklichen Blick. »Aber von irgendetwas muss ich schließlich leben.«
»Das musste sie auch, und während sie versucht hat, etwas zu verdienen, wurde sie von jemandem aufgeschlitzt.«
Er blies die Backen auf. »Wenn man einen solchen Job hat, muss man eben manchmal ein paar Kröten schlucken.«
»Ihr Mitgefühl ist einfach überwältigend. Vielleicht bleiben wir also besser bei unserem eigentlichen Thema. Kannten Sie Jacie Wooton?«
»Ich kannte ihre Referenzen, ihren Mietvertrag und die Termine, zu denen sie die Miete überwiesen hat. Gesehen habe ich sie nie. Ich habe keine Zeit, um mich mit meinen Mietern anzufreunden. Dafür sind es einfach zu viele.«
»Uh-huh. Aber falls jemand nicht pünktlich zahlt und sich auch nicht einfach auf die Straße setzen lässt, statten Sie ihm doch sicher einen kurzen Besuch ab und versuchen ihn dazu zu bringen, dass er sich wieder an die Spielregeln hält.«
Er strich mit einer Fingerspitze über seinen Schnäuzer. »Ich halte mich bei diesen Dingen streng an die Vorschriften. Kostet mich jährlich jede Menge an Gerichtsgebühren, die Schmarotzer rauszukriegen, aber das gehört zu den Betriebskosten, das ist Teil des Geschäfts. Ich würde diese Wooton wahrscheinlich nicht mal dann erkennen, wenn sie mir mal einen runtergeholt hätte. Und letzte Nacht war ich zuhause, in Bloomfield, bei meiner Frau und meinen Kindern. Ich war auch noch zum Frühstück dort, dann bin ich mit dem Sieben-Uhr-fünfzehn-Shuttle in die Stadt gekommen wie an jedem anderen Tag. Wenn Sie sonst noch etwas von mir wollen, sprechen Sie mit meinen Anwälten.«
»Schwein«, stellte Peabody draußen auf der Straße fest.
»Oh ja, und ich gehe jede Wette ein, dass er einen Teil der Miete in Form von Naturalien kassiert. Sexuelle Dienstleistungen, kleine Mengen Drogen, Hehlerware, lauter Dinge in der Art. Dafür könnten wir ihn drankriegen, nur fehlen uns leider die nötige Zeit und die Selbstgerechtigkeit.« Mit schräg gelegtem Kopf studierte sie die vor dem Nachbarladen aufgehängten nackten Hühner, die derart mager waren, dass sie den Tod wahrscheinlich als Erleichterung empfunden hatten, und die abgehackten Füße, die es separat zu kaufen gab. »Wie isst man diese Dinger?«, überlegte sie. »Fängt man bei den Zehen an und arbeitet sich dann nach oben, oder fängt man an den Knöcheln an und knabbert sich nach vorn? Haben Hühner und Enten überhaupt Knöchel?«
»Diese Frage hat mich bereits in unzähligen Nächten um den Schlaf gebracht.«
Obwohl Eve ihre Assistentin mit einem bösen Blick bedachte, war sie froh, dass diese offenbar inzwischen wieder völlig auf der Höhe war. »Einen Teil der Schlachtungen führen sie doch wahrscheinlich direkt hier im Laden aus. Auf jeden Fall werden die Tiere wohl hier zerlegt. Diejenigen, die das machen, besitzen sicher scharfe Messer, haben kein Problem mit Blut und verfügen über ein paar grundlegende Kenntnisse in Anatomie.«
»Ich gehe davon aus, dass das Zerlegen eines Huhns deutlich einfacher als das Zerteilen eines Menschen ist.«
»Ich weiß nicht.« Eve stemmte nachdenklich die Hände in die Hüften. »Rein praktisch gesehen, haben Sie sicher recht. Ein Mensch hat viel mehr Masse, man braucht für ihn bestimmt mehr Zeit, und vielleicht auch andere Fähigkeiten als für das Rupfen eines Huhns. Aber wenn man die Masse nicht als Menschen sieht, ist es vielleicht gar kein so großer Unterschied. Vielleicht hat unser Täter ja an Tieren geübt. Aber vielleicht ist er auch ein übergeschnappter Arzt oder Veterinär. Ein Schlachter, ein Doktor, ein talentierter Amateur, aber auf alle Fälle jemand, der seine Technik weit genug perfektioniert hat, um seinem Idol ebenbürtig zu sein.«
»Seinem Idol?«
»Jack«, antwortete Eve und wandte sich zum Gehen. »Jack the Ripper.«
»Jack the Ripper?« Peabody klappte die Kinnlade herunter, doch eilig trottete sie ihrer Vorgesetzten hinterher. »Sie meinen den Kerl drüben in London vor … wann war das noch einmal?«
»Ende des neunzehnten Jahrhunderts in Whitechapel. Das war während der viktorianischen Zeit eine der ärmeren Gegenden der Stadt, in der es jede Menge Prostituierte gab. Innerhalb von einem Jahr hat er zwischen fünf und acht, vielleicht sogar noch mehr Frauen im Umkreis von einer Meile umgebracht.«
Sie stieg in ihren Wagen und merkte, dass Peabodys Mund immer noch sperrangelweit offen stand. »Was?«, wollte sie von ihr wissen. »Darf ich nicht auch mal etwas wissen?«
»Doch, Madam. Sie wissen sogar eine ganze Menge, nur ist Geschichte für gewöhnlich nicht gerade Ihre Stärke.«
Aber mit Mord und Mördern kannte sie sich aus, dachte Eve und ließ den Motor an. Dafür hatte sie sich schon immer interessiert. »Während andere kleine Mädchen Geschichten von flauschigen, aber ansonsten noch wenig hübschen Entlein gelesen haben, habe ich mich eben mit Jack und anderen Serienmördern befasst.«
»Sie haben solche Sachen gelesen, als Sie noch ein Kind waren?«
»Na und?«
»Tja …« Sie wusste nicht, wie sie es formulieren sollte. Ihr war bekannt, dass Eve in einer Reihe Kinderheime aufgewachsen war. »Hat denn keiner der Erwachsenen Ihre Lektüre überwacht? Was ich damit sagen will, ist, meine Eltern – und sie waren alles andere als streng – hätten uns als Kinder so etwas untersagt. Sie wissen schon, schließlich werden Menschen in diesen Jahren geprägt, und sie könnten von solchen Dingen Alpträume bekommen, emotionale Schäden oder so.«
Sie hatte bereits lange, bevor sie hatte lesen können, jede Menge emotionaler Schäden abbekommen, dachte Eve. Und was die Alpträume betraf – sie konnte sich an keine Zeit erinnern, in der sie nicht von Alpträumen gepeinigt worden war.
»Wenn ich im Internet Informationen über den Ripper oder John Wayne Gacy gesucht habe, war ich wenigstens beschäftigt und habe keine Schwierigkeiten gemacht. Das war das Wichtigste für sie.«
»Wahrscheinlich haben Sie Recht. Dann wussten Sie also schon immer, dass Sie Polizistin werden wollten.«
Erst hatte sie nur gewusst, dass sie etwas anderes werden wollte als ein Opfer. Dann hatte sie gewusst, dass sie für die Opfer eintreten wollte. Weshalb sie zur Polizei gegangen war. »Mehr oder weniger. Der Ripper hat der Polizei Nachrichten geschickt, aber erst nach einer Weile. Nicht sofort beim ersten Mal wie unser Typ. Dieser Typ hier möchte, dass wir sofort erkennen, was er will. Es geht ihm um das Spiel.«
»Es geht ihm um Sie«, korrigierte ihre Assistentin, und Eve nickte mit dem Kopf.
»Ich habe gerade einen Fall abgeschlossen, um den es einen richtiggehenden Medienrummel gab. Auch um den Fall der Reinheitssucher Anfang dieses Sommers gab es jede Menge Wirbel. Wahrscheinlich hat er die Berichte im Fernsehen gesehen. Und jetzt will er selbst Schlagzeilen machen. Das hat Jack damals auf jeden Fall geschafft.«
»Er will Sie also in diese Sache reinziehen, damit sich die Medien auf ihn konzentrieren. Die Leute sollen von ihm und seiner Tat fasziniert sein.«
»Davon gehe ich zumindest aus.«
»Dann wird er also weiter Jagd auf Prostituierte in derselben Gegend machen.«
»Das entspräche auf jeden Fall dem vorgegebenen Muster.« Doch nach einer Pause fügte Eve hinzu: »Und das ist es, was er uns suggerieren will.«
Als Nächstes fuhren sie zu Jacies Bewährungshelferin, deren Büro am Rande des East Village lag. Auf ihrem großen, überladenen Schreibtisch stand eine Schale mit farbenfrohen Bonbons, und sie selbst strahlte in ihrem schlichten, grauen Kostüm eine warme Mütterlichkeit aus.
Eve schätzte sie auf Ende fünfzig. Sie hatte ein freundliches Gesicht, ihre wachen, haselnussbraunen Augen aber zeigten, dass sie sich sicher nicht für dumm verkaufen ließ.
»Tressa Palank.« Sie stand auf, begrüßte Eve mit einem festen Händedruck und wies in Richtung eines Stuhls. »Ich nehme an, es geht um einen meiner Klienten. Ich habe bis zu meiner nächsten Sitzung zehn Minuten Zeit. Was kann ich für Sie tun?«
»Erzählen Sie mir von Jacie Wooton.«
»Jacie?« Tressa zog die Brauen hoch und verzog den Mund zu einem leichten Lächeln, ihre Augen aber drückten eine gewisse Sorge aus. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Ihnen irgendwelche Schwierigkeiten macht. Sie ist fest entschlossen, ihre alte Lizenz zurückzukriegen, und ist dabei auf einem guten Weg.«
»Jacie Wooton wurde heute früh ermordet.«
Tressa schloss die Augen und atmete ein paar Sekunden langsam ein und aus. »Ich wusste, dass es eine meiner Klientinnen sein musste.« Sie schlug die Augen wieder auf und sah Eve reglos ins Gesicht. »Als die Nachricht von dem Mord in Chinatown im Fernsehen kam, habe ich es instinktiv gewusst. Ich hatte es einfach im Gefühl. Jacie.« Sie faltete die Hände auf der Schreibtischplatte und senkte ihren Blick. »Was ist passiert?«
»Ich darf Ihnen keine Einzelheiten nennen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ihr die Kehle durchgeschnitten worden ist.«
»Verstümmelt. In den Nachrichten hieß es, dass in den frühen Morgenstunden in Chinatown eine lizenzierte Gesellschafterin verstümmelt worden ist.«
Einer der uniformierten Beamten, dachte Eve. Wenn sie den Kerl fände, der geplaudert hatte, drehte sie ihm die Gurgel um. »Mehr kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Ich stehe mit meinen Ermittlungen noch ganz am Anfang.«
»Ich kenne die Vorschriften. Ich war selbst fünf Jahre bei der Truppe.«
»Sie waren Polizistin?«
»Fünf Jahre und in der Zeit habe ich mich hauptsächlich mit Sexualstraftaten befasst. Dann bin ich zur Bewährungshilfe. Mit der Arbeit auf der Straße, mit dem, was ich dort gesehen habe, kam ich auf Dauer einfach nicht zurecht. Hier kann ich etwas tun, um anderen zu helfen, ohne dass ich diese Dinge täglich mit eigenen Augen sehen muss. Auch diese Arbeit ist nicht gerade ein Spaziergang, aber sie ist das, was ich am besten kann. Ich werde Ihnen alles sagen, was ich weiß, und hoffe, dass es Ihnen hilft.«
»Sie hat vor kurzem mit Ihnen wegen der Erweiterung ihrer Lizenz telefoniert.«
»Ihr Antrag wurde abgelehnt. Sie hat – hatte – noch ein Jahr Bewährung. Daran führte nach ihren Verhaftungen und nach ihrer Drogenabhängigkeit kein Weg vorbei. Der Entzug ist gut verlaufen, obwohl ich den Verdacht habe, dass sie einen Ersatz für die Drogen gefunden hat.«
»Wodka. Ich habe zwei Flaschen in ihrer Wohnung entdeckt.«
»Tja. Das ist zwar legal, aber trotzdem ist es ein Verstoß gegen die Bewährungsauflagen. Obwohl das jetzt natürlich nicht mehr von Bedeutung ist.«
Tressa fuhr sich mit den Händen durchs Gesicht und seufzte leise auf. »Auch wenn das ebenfalls jetzt nicht mehr von Bedeutung ist, hatte sie die ganze Zeit das Ziel, es beruflich wieder bis ganz nach oben zu schaffen. Sie hat es gehasst, auf der Straße zu arbeiten, hat aber trotzdem nie auch nur darüber nachgedacht, sich vielleicht einen anderen Job zu suchen, etwas, das weniger anstrengend und gefährlich ist.«
»Hatte sie irgendwelche regelmäßigen Freier, von denen Sie was wissen?«
»Nein. Früher hatte sie eine ziemlich lange, exklusive Kundenliste. Männer und auch Frauen. Sie war für beides lizenziert. Aber meines Wissens ist keiner dieser Leute ihr nach Chinatown gefolgt. Wenn es so wäre, hätte sie mir das bestimmt erzählt. Es hätte ihrem Selbstbewusstsein gutgetan.«
»Wer hat ihr früher den Stoff besorgt?«
»Das hat sie niemandem verraten, nicht mal mir. Aber sie hat mir geschworen, dass sie seit ihrer Entlassung keinen Kontakt mehr zu ihm hatte. Und ich habe ihr geglaubt.«
»Hat sie den Namen Ihrer Meinung nach vielleicht aus Angst zurückgehalten?«
»Meiner Meinung nach war es für sie eine Frage der Ehre, dass sie ihren Lieferanten nicht verraten hat. Sie hat sich über zwanzig Jahre ihren Lebensunterhalt als lizenzierte Gesellschafterin verdient. Und wer gut in diesem Job ist, ist diskret, für den ist die Privatsphäre seiner Klienten heilig, ähnlich wie für einen Priester oder einen Arzt. Und selbst die Drogensache hat sie so gesehen. Ich nehme deshalb an, dass ihr Lieferant vielleicht gleichzeitig ein Kunde von ihr war, aber sicher weiß ich das nicht.«
»Sie hat Ihnen gegenüber bei den letzten Treffen nicht geäußert, dass sie sich Sorgen machte oder dass sie Angst hatte vor irgendetwas oder irgendwem?«
»Nein. Sie war nur versessen darauf, endlich wieder in ihr altes Leben zurückkehren zu können.«
»Wie oft kam sie hierher?«
»Alle zwei Wochen, wie es vorgeschrieben war. Sie hat keinen einzigen Termin verpasst. Sie hat sich regelmäßig ärztlich untersuchen lassen und stand auch für spontane Tests immer zur Verfügung. Sie war in jeder Hinsicht äußerst kooperativ. Lieutenant, sie war eine ganz normale Frau, nur etwas verloren und nicht ganz in ihrem Element. Sie hatte keine Ahnung von der Arbeit auf der Straße, denn sie war eine erlesenere Kundschaft und Routine gewohnt. Sie hatte Spaß an hübschen Dingen, hat sich Sorgen um ihr Aussehen gemacht, hat sich über die Gebührenbeschränkungen, die mit der Straßenlizenz einhergehen, beschwert. Sie hat keine ihrer alten Freundinnen und Freunde mehr getroffen, weil sie sich für ihre Lebensumstände geschämt hat, und auf die Frauen und die Männer, die sich in ihrem neuen Umfeld bewegten, hat sie ihrerseits herabgesehen.«
Tressa presste einen Augenblick die Finger an die Lippen. »Tut mir leid. Ich versuche, diese Sache nicht persönlich zu nehmen, aber das gelingt mir einfach nicht. Das war einer der Gründe, weshalb ich als Polizistin auf der Straße nicht wirklich zu gebrauchen war. Ich habe sie gemocht, und ich wollte ihr helfen. Ich weiß nicht, wer ihr so etwas angetan haben könnte. Vielleicht war es einfach ein willkürlicher Akt, mit dem jemand seine Macht über einen Menschen demonstriert hat, der schwächer war als er. Schließlich war sie nur eine kleine Hure, weiter nichts.«
Als ihre Stimme zu brechen drohte, räusperte sie sich und atmete langsam durch die Nase ein. »Es gibt noch immer jede Menge Leute, die so denken, das wissen Sie, und das weiß ich. Diese Frauen werden geschlagen, erniedrigt, misshandelt und missbraucht. Ein paar von ihnen geben deshalb auf, andere reißen sich zusammen, ein paar machen Karriere und führen ein beinahe königliches Leben. Und ein paar von ihnen gehen dabei drauf. Es ist ein gefährlicher Beruf. Polizisten, Rettungssanitäter, Sozialarbeiter und Prostituierte haben alle einen gefährlichen Beruf, bei dem die Sterblichkeitsrate deutlich über dem Durchschnitt liegt.
Sie wollte ihr altes Leben wiederhaben«, stellte Tressa abschließend fest. »Und das hat sie umgebracht.«
2
Auf dem Rückweg zum Revier fuhren sie an der Pathologie vorbei. Hier hatte das Opfer, wie Eve dachte, noch eine letzte Möglichkeit, ihnen etwas zu verraten. Ohne echte Freunde, namentlich bekannte Feinde, Kollegen und Verwandte bot Jacie Wooton das Bild einer einsamen Frau, für die der mit ihrer Arbeit verbundene Körperkontakt die einzige Form der Annäherung an andere gewesen war. Eine Frau, die ihren Leib als ihren größten Vorzug angesehen und ihn deshalb dafür verwendet hatte, ein luxuriöses Leben zu erreichen, was offenbar allzeit ihr Traum gewesen war.
Vielleicht verriet ihr Leib ja irgendetwas über ihren Mörder.
Auf halbem Weg den Korridor hinunter blieb Eve plötzlich stehen. »Setzen Sie sich irgendwo in eine Ecke«, wies sie ihre Assistentin an, »rufen Sie im Labor an und machen dort ein bisschen Druck. Betteln Sie, jammern, drohen, was auch immer. Ich muss einfach möglichst noch heute wissen, was er für ein Briefpapier verwendet hat.«
»Ich komme schon damit zurecht, wenn ich mit Ihnen reingehe. Ich falle ganz bestimmt nicht noch mal um.«
Aber sie war jetzt schon kreidebleich, bemerkte Eve. Jetzt schon stieg erneut das Bild der Gasse, des verspritzten Bluts, der heraushängenden Eingeweide vor ihrem inneren Augen auf. Sie fiele ganz bestimmt nicht um, da war sich Eve ganz sicher, doch der Preis für diese Tapferkeit wäre eindeutig zu hoch.
»Ich habe nicht gesagt, dass Sie es nicht packen; ich habe lediglich gesagt, dass ich wissen muss, woher der Killer diesen Briefbogen bezogen hat. Wenn er schon etwas für uns zurückgelassen hat, ist es ja wohl ganz normal, wenn wir die Spur verfolgen. Also suchen Sie sich was zum Sitzen und führen den Auftrag aus.«
Ohne Peabody die Chance zum Widerspruch zu geben, marschierte Eve entschlossen weiter den Korridor hinab und durch die breite Flügeltür in den Raum, in dem die Tote lag.
Sie hatte erwartet, dass der Chefpathologe Moris sich der Sache annehmen würde, und wurde nicht enttäuscht. Wie so häufig arbeitete er auch jetzt allein.
Unter seinem durchsichtigen Schutzanzug trug er eine blaue Tunika und Leggins, die langen Haare hatte er zu einem schimmernden Pferdeschwanz gebunden und, um den Leichnam zu schützen, unter einer Plastikhaube versteckt. Um den Hals trug er eine Art silbernes Medaillon mit einem leuchtend roten Stein. Seine Hände waren blutig und sein attraktives, exotisches Gesicht wirkte so kalt und reglos, als wäre es aus Stein.
Er hörte bei der Arbeit oft Musik, heute allerdings herrschte abgesehen vom leisen Summen der Geräte und dem unheimlichen Surren des Laserskalpells vollkommene Stille in dem kühlen Raum.
»Hin und wieder«, meinte er, den Kopf immer noch über die tote Frau gesenkt, »sehe ich hier drinnen etwas, was über das Normalmaß weit hinausgeht. Was einfach nicht mehr menschlich ist. Und wir beide wissen, Dallas, dass der Mensch seinen eigenen Artgenossen gegenüber in Bezug auf Grausamkeiten wirklich findig ist. Aber ab und zu kommt mir hier etwas unter, das geht sogar noch einen Schritt über das Grässliche hinaus.«
»Die Halswunde hat sie doch sicher umgebracht.«
»Das ist ein kleiner Trost.« Als er sie endlich ansah, lag in seinen Augen weder das gewohnte Lächeln noch auch nur ein Funke der Faszination, mit der er für gewöhnlich bei der Arbeit war. »Das Übrige, was er ihr angetan hat, hat sie nicht mehr gespürt. Sie war eindeutig tot, bevor der Kerl sie ausgeschlachtet hat.«
»Er hat sie ausgeschlachtet?«
»Wollen Sie es etwa anders nennen?« Er warf das Skalpell auf ein Tablett und wies mit einer blutverschmierten Hand auf den verstümmelten Leib. »Wie zum Teufel wollen Sie das nennen?«
»Ich habe dafür keine Worte. Ich glaube, dass es dafür keine Worte gibt. Schlecht und böse reichen nicht. Aber ich kann es mir nicht leisten, philosophisch zu werden, Moris. Das würde ihr nicht helfen. Ich muss wissen, ob er wusste, was er tat, oder ob er einfach drauflosgeschnippelt hat.«
Er atmete zu schnell. Um sich zu beruhigen, riss Moris sich die Brille und die Schutzhaube herunter, marschierte Richtung Waschtisch und schrubbte dort das Versiegelungsspray und Blut von seinen Händen ab.
»Er wusste, was er tat. Die Schnitte waren sehr präzise. Er hat nicht gezögert und keine unnötigen Bewegungen gemacht.« Er nahm zwei Flaschen Wasser aus dem Kühlschrank, warf Eve eine zu und hob die andere an seinen Mund. »Unser Killer kann eindeutig innerhalb der Linien malen.«
»Wie bitte?«
»Es ist einfach immer wieder faszinierend, was Ihnen in Ihrer Kindheit offenbar alles entgangen ist. Ich muss mich einen Moment setzen.« Er warf sich auf einen Stuhl und fuhr sich mit dem Handballen erst über die Brauen und dann über die Stirn. »Diese Sache geht mir wirklich an die Nieren. Man weiß nie, wann das passiert. Bei allem, was hier täglich durchgeht, hat mich ausgerechnet diese einundvierzigjährige Frau mit den bemalten Zehennägeln und dem entzündeten linken Fußballen eiskalt erwischt.«
Sie hatte keine Ahnung, wie sie mit ihm umgehen sollte, wenn er in dieser Stimmung war. Also folgte sie ihrem Instinkt, zog sich einen Stuhl heran und nahm neben ihm Platz. Während sie einen Schluck von ihrem Wasser trank, bemerkte sie, dass der Rekorder noch nicht ausgeschaltet war. Aber die Entscheidung, ob er ihre Unterhaltung später vielleicht löschen wollte, lag allein bei ihm.
»Sie brauchen Urlaub, Moris.«
»Das brauchen Sie mir nicht zu sagen.« Er lachte leise auf. »Eigentlich hätte ich morgen fliegen sollen. Zwei Wochen Aruba. Meer, Sonne, nackte Frauen – die Sorte, die noch atmet – und jede Menge Alkohol, den man aus Kokosnüssen trinkt.«
»Fliegen Sie.«
Er schüttelte den Kopf. »Ich habe die Reise schon verschoben. Erst will ich diese Sache hier zu Ende bringen.« Jetzt blickte er sie an. »Manchmal gibt es Dinge, die man selbst zu Ende bringen muss. Als ich sie vorhin sah, als ich sah, was dieser Kerl mit ihr gemacht hat, war mir sofort klar, dass aus dem faulen Strandleben in nächster Zeit nichts wird.«
»Ich könnte Ihnen sagen, dass Sie hier gute Leute haben. Leute, die sich gut um diese Frau und auch um alle anderen kümmern würden, die Ihr Laden in den nächsten beiden Wochen reinbekommt.«
Während sie von ihrem Wasser nippte, blickte sie auf Jacie Wootons Hülle, die nackt auf einem Rolltisch in dem kalten Zimmer lag. »Ich könnte Ihnen sagen, dass ich den Hurensohn, der ihr das angetan hat, finden und dafür sorgen werde, dass er für diese Tat bezahlt. All das könnte ich Ihnen sagen und es wäre sogar wahr. Aber ich an Ihrer Stelle bliebe ebenfalls vorläufig hier.«
Genau wie sie lehnte er den Kopf gegen die Wand, streckte die Beine aus und starrte auf den kaum einen Meter vor ihm aufgebahrten ausgeschlachteten Leib.
Nach einem Augenblick des Schweigens fragte Moris leise: »Was zum Teufel ist bloß mit uns los, Dallas?«
»Ich habe keine Ahnung.«
Er schloss kurz die Augen, bis er allmählich die Balance wiederfand. »Wir sind eben nekrophil.« Als sie verächtlich schnaubte, verzog er, ohne deshalb die Augen wieder aufzuschlagen, den Mund zu einem Grinsen. »Aber nicht auf eine kranke, fick-die-Leiche Art. Was haben Sie bloß für eine schmutzige Fantasie? Trotz allem, was diese Toten vielleicht zu Lebzeiten gewesen sind, lieben wir sie, weil jemand sie betrogen und missbraucht hat. Sie sind die ultimativen Underdogs.«
»Jetzt werden wir anscheinend doch noch philosophisch.«
»Sieht so aus.« Dann tat er etwas, was er nur sehr selten tat. Er berührte sie. Tätschelte ihr lediglich kurz den Rücken, was jedoch, wie Eve erkannte, eine beinahe intime Geste war. Ein freundschaftlicher Kontakt zwischen Kameraden, deutlich persönlicher als alles, was je zwischen dem Opfer und ihren Klienten stattgefunden hatte, dachte sie.
»Von den Babys bis hin zu den tatterigen Greisen«, fuhr Moris schließlich fort, »kommen sie alle hierher zu uns. Egal, wer sie zu ihren Lebzeiten geliebt hat, sind wir ihre intimsten Gefährten nach dem Tod. Manchmal dringt diese Intimität in unsere Seelen ein und bringt sie vorübergehend aus dem Gleichgewicht. Tja, nun.«
»Sie scheint in ihrem Leben niemanden gehabt zu haben. So, wie ihre Wohnung aussah, dem Fehlen jeden sentimentalen Schnickschnacks nach hat sie niemanden in ihrem Leben gewollt. Deshalb hat sie auch jetzt nur Sie und mich.«
»Okay.« Er trank noch einen Schluck von seinem Wasser und stand dann wieder auf. »Okay.« Er stellte seine Flasche fort, sprühte sich erneut die Hände ein und setzte seine Brille wieder auf. »Auch wenn es sicher nicht viel bringt, habe ich darauf gedrängt, dass der toxikologische Bericht noch heute fertig wird. Die Leber wirkt ein bisschen angegriffen, Alkoholmissbrauch. Aber davon abgesehen habe ich keine größeren Schäden oder schlimmeren Krankheiten entdeckt. Ihre letzte Mahlzeit, bestehend aus Spaghetti, hat sie circa sechs Stunden vor dem Tod zu sich genommen. Sie hatte sich die Brüste, die Lider und den Hintern straffen und am Kinn ein wenig Fett absaugen lassen. Alles wirklich gut gemacht.«
»Wie lange ist das her?«
»Die Hinternstraffung scheint der letzte Eingriff gewesen zu sein, und auch die ist bereits ein paar Jahre her.«
»Passt. Sie hat in den letzten Jahren ziemlich Pech gehabt und hatte sicher nicht das Geld für Operationen dieser Art.«
»Womit wir zu dem letzten Eingriff kommen, der an ihr vorgenommen worden ist: der Killer hat ein schmales Messer mit einer glatten Klinge, wahrscheinlich ein Skalpell benutzt. Er hat ihr die Kehle mit einem schnellen Schnitt von links oben nach rechts unten aufgeschlitzt. Dem Schnittwinkel zufolge hatte sie in dem Moment den Kopf zurückgelegt und das Kinn gereckt. Er hat eindeutig hinter ihr gestanden, ihren Kopf wahrscheinlich mit der linken Hand zurückgezogen und das Messer mit der rechten Hand geführt.« Moris demonstrierte dieses Vorgehen an einer unsichtbaren Person. »Er hat mit einem geraden Schnitt die Drosselvene durchtrennt.«
»Dabei muss sie jede Menge Blut verloren haben.« Eve blickte noch immer auf den Leichnam und stellte sich Jacie Wooton lebend, auf den Beinen, das Gesicht an der schmutzigen Mauer in der dunklen Gasse vor. Dann den plötzlich ruckartig zurückgerissenen Kopf, den Schock, den grellen Schmerz und die Verwirrung. »Es hat doch sicher fürchterlich gespritzt.«
»Allerdings. Selbst wenn er hinter ihr gestanden hat, hat er wahrscheinlich jede Menge abgekriegt. Was die zweite Wunde angeht, auch hier hat er einen einzigen, langen Schnitt gemacht.« Moris zeichnete den Schnitt mit einem Finger in die Luft. »Ich würde sagen, dass er schnell, ja sogar sparsam mit dem Messer umgegangen ist. Wenn er auch nicht wirklich sauber oder gar wie ein Chirurg an ihr herumgeschnitten hat, war es für ihn eindeutig nicht das erste Mal. Er hat vorher schon mit Fleisch zu tun gehabt. Und zwar nicht nur im Rahmen bloßer Simulationen. Er hat auch schon vor dem Überfall auf diese arme Frau mit Fleisch und Blut zu tun gehabt.«
»Sie sagen, nicht wie ein Chirurg. Er ist also kein Arzt?«
»Völlig auszuschließen ist das nicht. Schließlich hatte er es eilig, das Licht war schlecht, er hatte Furcht vor einer möglichen Entdeckung und war vielleicht sogar erregt.« Auf Moris’ exotischem Gesicht zeichneten sich Ekel und Abscheu ab. »Was auch immer diesen, diesen … tja, mir fehlen die Worte … was auch immer ihn getrieben hat, hat ihn vielleicht ein wenig ungeschickt gemacht. Er scheint bei der Entfernung der weiblichen Organe ziemlich hastig vorgegangen zu sein. Ich kann nicht sagen, ob es vorher noch zu einem sexuellen Kontakt gekommen ist. Aber da der Todeszeitpunkt und der Zeitpunkt der Verstümmelung nur wenige Minuten auseinanderlagen, hat er meiner Meinung nach nicht viel Zeit für irgendwelche Sex-Spielchen gehabt.«
»Würden Sie sagen, er kommt aus dem medizinischen Bereich? Sanitäter, Tierarzt, Pfleger?« Sie machte eine Pause, legte den Kopf ein wenig auf die Seite und sah ihn fragend an: »Pathologe?«
Er bedachte Eve mit einem schmalen Grinsen. »Das ist natürlich möglich. Unter den gegebenen Umständen hat es schon gewisser Fertigkeiten auf diesem Gebiet bedurft. Aber auf der anderen Seite brauchte er sich keine Gedanken über die Überlebenschancen seiner Patientin mehr zu machen. Er brauchte ein paar Kenntnisse in Anatomie und musste wissen, welche Instrumente er am besten nimmt. Ich würde sagen, er hat sich gründlich mit der Materie befasst und auf jeden Fall geübt, aber er brauchte dafür keine Zulassung als Arzt, denn vielleicht hat er ja bereits beim Üben nicht das Ziel gehabt, dass der Patient den Eingriff überlebt. Ich habe gehört, dass er eine Nachricht hinterlassen hat.«
»Ja. An mich persönlich adressiert, weshalb man die Ermittlungen mir übertragen hat.«
»Dann hat er das Ganze also zu einer persönlichen Angelegenheit gemacht.«
»Man könnte sogar sagen, zu einer intimen Angelegenheit.«
»Ich schicke Ihnen die Ergebnisse und den Bericht so schnell wie möglich zu. Ich will noch ein paar Tests durchführen, um zu sehen, ob ich nicht das Messer genauer definieren kann.«
»Gut. Und nehmen Sie sich diese Sache nicht zu sehr zu Herzen.«
»Ich nehme diese Dinge, wie sie kommen«, antwortete er, als sie sich zum Gehen wandte, und rief ihr leise hinterher: »Dallas? Vielen Dank.«
Sie warf einen Blick über die Schulter, meinte: »Nichts zu danken« und trat durch die Tür.
Während sie den Flur wieder hinaufging, winkte sie Peabody hinter sich her. »Erzählen Sie mir etwas, was ich hören will.«
»Auf erheblichen Druck von Ihrer treu ergebenen Assistentin haben die Leute im Labor den Umschlag und den Briefbogen analysiert und dabei herausgefunden, dass das verwendete Papier nicht nur besonders hochwertig, sondern noch nicht einmal recycelt ist. Das trifft nicht nur mein grünes Herz, sondern bedeutet obendrein, dass das Papier außerhalb des Hoheitsgebiets der Vereinigten Staaten hergestellt und verkauft worden sein muss. Hier gibt es nämlich zum Glück Gesetze, denen zufolge so etwas verboten ist.«
Eve zog die Brauen in die Höhe, als sie wieder in die Hitze auf der Straße trat. »Ich dachte, Hippies hielten nichts davon, wenn die Regierung der Gesellschaft ihre Wünsche per Gesetz aufzwingt.«
»Wenn die Gesetze unseren Zwecken nützen, schon.« Peabody schwang sich in den Wagen. »Aber zurück zu dem Papier. Es wurde in Großbritannien hergestellt und wird nur in einer Hand voll Läden in Europa verkauft.«
»In New York kriegt man es also nicht.«
»Nein, Madam. Es ist sogar schwierig, es über das Internet oder auf dem Postweg zu bestellen, weil nämlich selbst die Einfuhr von Produkten aus nicht recyceltem Papier in diesem Land verboten ist.«
»Mmm-hmm.« Eve dachte bereits weiter, da Peabody jedoch für die Detective-Prüfung lernte und die Frage, die ihr durch den Kopf ging, ihr vielleicht die Gelegenheit zum Üben bot, formulierte sie sie laut. »Und wie ist das Papier dann aus Europa in eine Gasse in Chinatown gelangt?«
»Tja, die Menschen schmuggeln alle möglichen verbotenen Produkte durch den Zoll. Sie kaufen solche Dinge auf dem Schwarzmarkt, wenn sie als Diplomaten oder als Gäste hier im Land sind, ist es ihnen sogar erlaubt, eine beschränkte Zahl an persönlichen Gegenständen mitzubringen, die genau genommen nicht ganz koscher sind. Aber wie dem auch sei, muss man einen ziemlich hohen Preis für dieses Zeug bezahlen. Ein Blatt dieses Papiers kostet zwanzig Euro, ein Umschlag zwölf.«
»Und das haben Ihnen alles die Jungs aus dem Labor erzählt?«
»Nein, Madam. Da ich nichts zu tun hatte, als ich dort draußen saß, habe ich diese Dinge selber recherchiert.«
»Gut gemacht. Haben Sie auch eine Liste der Geschäfte, in denen dieses Zeug zu haben ist?«
»Zumindest der Geschäfte, in denen das Papier offiziell gehandelt wird. Obwohl genau dieses Papier ausschließlich in Großbritannien hergestellt wird, wird es europaweit in sechzehn Einzelhandelsgeschäften und von zwei Großhändlern verkauft. Zwei dieser Geschäfte sind in London.«
»Und was soll mir das sagen?«
»Ich dachte, da er einen Londoner Mörder nachahmt, hat er das Papier vielleicht auch dort gekauft.«
»Dann fangen Sie dort an. Wir hören uns auch in den anderen Läden um, richten aber unser besonderes Augenmerk auf die beiden Geschäfte dort. Gucken Sie, ob Sie eine Liste der Käufer dieses Briefpapiers bekommen.«
»Zu Befehl, Madam. Lieutenant, wegen heute Morgen. Ich weiß, ich habe meine Arbeit nicht ordentlich gemacht -«
»Peabody«, fiel ihr Eve ins Wort. »Habe ich gesagt, Sie hätten Ihre Arbeit nicht ordentlich gemacht?«
»Nein, aber -«
»Gab es, seit Sie unter meinem Kommando stehen, je eine Situation, in der ich gezögert hätte, Ihnen deutlich zu verstehen zu geben, wenn Sie meiner Meinung nach Ihre Arbeit nicht ordentlich verrichtet haben oder Ihnen auch nur der geringste Fehler unterlaufen ist?«
»Tja, nun, nein, Madam.« Peabody blies die Backen auf und atmete dann hörbar aus. »Nun, da Sie es erwähnen …«
»Dann vergessen Sie die Angelegenheit und besorgen mir die Liste der Käufer von diesem Papier.«
Auf der Wache wurde sie von den Kollegen mit Fragen, Gerüchten, Spekulationen über den Wooton-Mord bestürmt. Wenn schon die Cops über einen Fall in Aufregung gerieten, wäre die Öffentlichkeit völlig außer sich.
Sie flüchtete in ihr Büro, bestellte sich als Erstes einen Becher Kaffee und hörte dann die Nachrichten ab, die an diesem Morgen für sie eingegangen waren.
Bei zwanzig hörte sie mit dem Zählen der Anrufe von Journalisten auf. Allein Nadine Furst vom Channel 75 hatte bisher sechsmal ihr Glück versucht.
Den Kaffeebecher in der Hand, nahm Eve an ihrem Schreibtisch Platz und trommelte mit ihren Fingern auf das verkratzte Holz. Früher oder später müsste sie sich den Reportern stellen.
Lieber später, möglichst irgendwann nach der Jahrtausendwende, dachte sie. Um eine Stellungnahme käme sie wahrscheinlich nicht herum. Doch sie würde nur ein paar knappe, offizielle Sätze sagen, irgendwelche markigen Sprüche oder gar Einzelinterviews gäbe es auf keinen Fall.
Genau das wünschte er sich nämlich. Er wollte, dass sie zu den Medien ging, ausführlich über ihn sprach und er dadurch, dass man im Fernsehen und auch in der Presse über ihn berichtete, ein möglichst großes Maß an Aufmerksamkeit geschenkt bekam.
Das wünschten sich viele, überlegte sie. Das wünschten sich sogar die meisten. Er aber wollte die Sensation des Herbstes sein. Er wollte, dass es hieß:
NEUER JACK THE RIPPER SCHLACHTET IN NEW YORK
In Fettdruck auf den ersten Seiten. Ja, das entspräche seinem Stil.
Jack the Ripper, überlegte sie, schaltete ihren Computer ein und machte sich ein paar Notizen.
Vorgänger der modernen Serienkiller.
Wurde nie erwischt, wurde nie eindeutig identifiziert.
Seit beinahe zweihundert Jahren zentrale Figur unzähliger Studien, Geschichten, Theorien.
Gegenstand der Faszination und Abscheu.
Durch den damaligen Medienrummel wurde nicht nur Panik, sondern gleichzeitig dauerhaftes Interesse an dem Kerl geschürt.
Nachahmungstäter geht davon aus, dass er ebenfalls unentdeckt bleiben wird. Will Angst verbreiten und Faszination auslösen, indem er sich mit uns misst. Hat sich sicher eingehend mit dem Original-Ripper befasst. Hat wahrscheinlich offiziell oder nebenher Medizin studiert, damit er das Verbrechen überhaupt begehen konnte. Klassisch elegantes Briefpapier, vielleicht Symbol für Reichtum oder Geschmack.
Im ursprünglichen Ripper-Fall hatten einige der Hauptverdächtigen der Oberschicht oder gar dem Adel angehört. Hatten über dem Gesetz gestanden. Waren davon ausgegangen, dass niemand sie belangen kann.
Manche waren davon ausgegangen, dass der Ripper vielleicht ein in London lebender Amerikaner war. Sie hatte das immer für Quatsch gehalten, aber … war es vielleicht möglich, dass ihr Killer ein in Amerika lebender Brite war?
Oder war er vielleicht einfach – wie sagte man noch einmal? – anglophil? Jemand, der alles Britische bewunderte? Der dorthin gereist und durch die Straßen von Whitechapel gewandert war? Hatte er dort die Taten in Gedanken noch einmal begangen? Hatte er sich vorgestellt, dass er der Ripper war?
Sie fing an, einen Bericht zu tippen, brach dann aber wieder ab, rief in Dr. Miras Praxis an und erkämpfte einen sofortigen Termin.