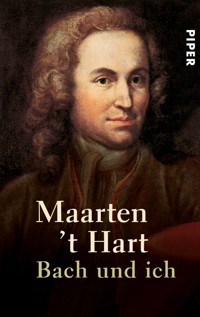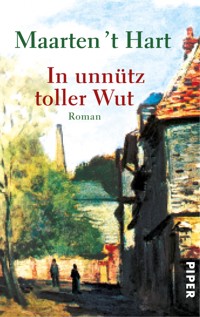9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Seine Nichteinmaligkeit ist ihm früh bewusst geworden. Nicht weniger als sechs Namensvettern fanden sich allein im engsten Familienkreis, und gleich um die Ecke seines Elternhauses lebte ein Milchkannenlieferant, der ebenfalls Maarten 't Hart hieß. Ausgestattet mit einem dementsprechend schwach ausgeprägten Selbstbewusstsein wuchs Maarten 't Hart, der Schriftsteller, in einer Familie aus Handwerkern, Bauern und Totengräbern auf. Allen Hindernissen zum Trotz setzte sich sein Bildungshunger durch und ermöglichte ihm einen Schulabschluss, ein Studium und eine Karriere als Romancier, die ihm zu Weltruhm verhalf. In seiner erstmals auf Deutsch vorliegenden Autobiografie erzählt er auf charmante, höchst selbstironische Weise von seinen Anfängen als Metzgereiausfahrer, als Verhaltensforscher, als Journalist und Autor sowie von seiner alles überstrahlenden Leidenschaft für die Musik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Niederländischen von Gregor Seferens
Die niederländische Originalausgabe erschien 1984 unter dem Titel »Het roer kan nog zesmaal om« im Verlag De Arbeiderspers, Amsterdam.
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe 1. Auflage 2014
ISBN 978-3-492-96733-4
© 1984 Maarten ’t Hart
Deutschsprachige Ausgabe:
© Piper Verlag GmbH, München 2014
Covergestaltung: Cornelia Niere, München
Covermotiv: Privat
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Man muss also gewissen Menschen ihr Alleinsein gönnen und nicht so albern sein, wie es häufig geschieht, sie deswegen zu bedauern.
Friedrich Nietzsche
Jedermann
Für die meisten Menschen ist es ganz selbstverständlich, dass sie einzigartig sind. Ihre Eltern haben ihnen möglicherweise einen Namen gegeben, der häufig vorkommt, wie zum Beispiel Jan oder Maria, der aber in Verbindung mit ihrem Nachnamen sofort einmalig klingt. Auf der ganzen Welt gibt es bestimmt keinen anderen Menschen, der wie meine Frau Hanneke van den Muyzenberg heißt. Doch als ich geboren wurde und den Namen Maarten erhielt, gab es allein in meiner Verwandtschaft bereits sechs weitere Personen mit demselben Vor- und Nachnamen. Seitdem sind in der nächsten Generation noch ein Dutzend Maartens dazugekommen; mein Bruder hat einen Sohn, der ebenfalls Maarten ’t Hart heißt.
Auch außerhalb meiner Verwandtschaft wimmelte es in Maassluis von Männern, die Maarten ’t Hart hießen. Zwei Straßen von unserem Haus entfernt wohnte ein hinkender Milchmann gleichen Namens. Im Katechismusunterricht war ich, zum Entsetzen des Pastors, einer von dreien, die so hießen. Und die beiden anderen Jungen waren nicht einmal mit mir verwandt. Auf dem Weg zur Schule kam ich jeden Tag an einer Metzgerei vorbei, an der mein Name wie folgt prangte: »Maarten – großer Schweinekopf mit Gruselzähnen – ’t Hart«. Als ich anfing, Bücher zu veröffentlichen, gab es sehr bald Verwirrung, weil ein niederländischer Maler, der vor allem für seine Kircheninterieurs bekannt ist, auch Maarten ’t Hart heißt.
Wenn in Anbetracht dessen doch wenigstens mein Äußeres einmalig wäre! Aber auch das scheint nicht der Fall zu sein. Vor Jahren verbrachten Hanneke und ich einen Urlaub im Kiental in der Schweiz, wo zwei Damen mittleren Alters uns so inständig beobachteten, dass wir uns belästigt fühlten. Am vierten Tag wurde es uns zu viel, und wir fragten, was das Problem sei. »Ja«, sagten sie, fröhlich lachend, »wir erkennen dich sehr wohl, auch wenn du so tust, als würdest du uns nicht kennen. Du machst hier fein mit deiner Freundin Urlaub, während deine Frau nichtsahnend zu Hause sitzt.«
Ein andermal identifizierte man mich neben der Post in Warmond als einen aus der psychiatrischen Anstalt Sancta Maria in Noordwijkerhout entflohenen Irren. In Edinburgh sprach mich auf der Straße eine junge Frau an und nannte mich Geoff. Sie zeigte mir sogar ein Foto von diesem Geoff. Ich sah mich selbst.
Vor einiger Zeit dann war ich in Schweden, und als meine schwedische Übersetzerin mir ihren Mann vorstellte, da starrte dieser mich erstaunt an. Sie berichtete mir später, ihr Mann habe abends im Bett zu ihr gesagt: »Er sieht genauso aus wie ein Infanteriehauptmann, der bei uns arbeitet. Es ist wirklich unglaublich, er hat exakt dieselbe Stimme.«
Auf dem Rückflug von Schweden saß ich neben einem Astronomen aus Leiden, der mir erzählte: »Diesen Sommer ist uns in den Appalachen vielleicht etwas Merkwürdiges passiert. Wir haben dort eine Wanderung unternommen, und auf einmal kamst du uns entgegen. ›Hallo, Maarten, was machst du denn hier?‹, fragte meine Frau. Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich um jemand vollkommen anderes handelte, einen Jagdaufseher. Wir haben ihm erzählt, dass es in den Niederlanden einen Schriftsteller gibt, der ihm verblüffend ähnlich sieht, und haben ihn gefragt, ob wir ein Foto von ihm machen dürften. Im Gegenzug haben wir versprochen, ihm ein Foto von dir zu schicken. Moment, ich glaube, ich habe einen Abzug eingesteckt, für den Fall, dass ich dich irgendwo treffe.« Er griff in seine Innentasche, und da war er wieder: der Mann, den ich in Edinburgh schon aus einer Damenhandtasche hatte auftauchen sehen und den ich jeden Morgen beim Rasieren im Spiegel erblicke.
Mich scheint es überall zu geben. Mindestens zweihundert Niederländer tragen denselben Namen wie ich. Selbst in den Appalachen laufen Doppelgänger von mir herum. Notgedrungen bin ich daher ein ausgesprochener Individualist. Zum Glück hat keiner der Doppelgänger und auch kein anderer Maarten ’t Hart dieselben Vorfahren wie ich. In Biografien und Autobiografien (etwa in Nabokovs Erinnerung, sprich) werden diese Vorfahren in der Regel ausführlich beschrieben. Nicht selten geht man dabei viele Generationen weit zurück, fast immer der männlichen Linie folgend. Das erscheint wenig sinnvoll, wenn man bedenkt, dass wir von jedem Großelternteil nur fünfundzwanzig Prozent der Gene erben. Dennoch kann es erhellend sein, jemanden durch die Beschreibung seiner Großeltern zu charakterisieren. Erbliche Eigenschaften überspringen schließlich häufig eine Generation; beim Enkel kommt die Kleptomanie des Großvaters wieder zum Vorschein. Da Großeltern oft keinen Einfluss auf die Erziehung haben, liegt es nahe, hier an Vererbung zu denken. Von den Urgroßeltern stammt dann allerdings nur noch ein Achtel unserer Gene. Ist es sinnvoll, noch weiter zurückzugehen? Auf jeden Fall ist es unsinnig, bei der Ahnenforschung nur die männliche Linie zu verfolgen.
Daher beginne ich auch lieber mit meiner Ururgroßmutter Hester van der Kooij, die natürlich mit einem Maarten ’t Hart verheiratet war und gemeinsam mit diesem im Westgaag in Maasland eine Gärtnerei bewirtschaftete. Unzufrieden über die leichtsinnige Verkündigung des Evangeliums in der Niederländisch-Reformierten Kirche in Maasland unternahm sie sonntags stundenlange Fußmärsche, um anderenorts das Wort des Herrn unverschnitten zu hören. Als sie vierzig Jahre alt war, starb sie an Tuberkulose. Am 8. Juli 1859 standen ihre zutiefst betrübten Familienangehörigen an ihrem Bett, sie jedoch sagte: »Trauert nicht, sondern singt:
›Im Festtagskleid steigt sie zum Thron,
erscheint vor Gott und seinem Sohn.‹«
Über die anderen sieben Ururgroßmütter und acht Ururgroßväter weiß ich nichts; das stört allerdings nicht weiter, ich bin stolz auf diese eine Ururgroßmutter. Von einigen meiner acht Urgroßeltern kann ich etwas mehr erzählen. Einer von ihnen hieß Hendrik ’t Hart; ein Foto zeigt einen früh gealterten Mann, der sich auf eine Schaufel stützt. Auch er war Gärtner. Des Weiteren habe ich den Großvater meiner Mutter, Leen van der Giessen, einmal leibhaftig gesehen. Seine Kinder und Enkel haben ihn nie besucht, weil er, so berichtete mir meine Mutter, ein Ungeheuer war. Das konnte und wollte ich als achtjähriges Kind nicht glauben. Er war schließlich mein Urgroßvater. Ich beschloss also, ihn zu besuchen. Ganz beiläufig horchte ich meine Onkel und Tanten aus und erfuhr so, wo er wohnte. An einem freien Mittwochnachmittag begab ich mich auf die Fähre nach Rozenburg. Fahrgeld hatte ich nicht, doch ich wusste, dass erst mitten auf dem Strom kassiert werden würde. Ich ging zum Heck und sagte zu dem Kassierer: »Mein Vater steht da vorne.«
»Wer ist denn dein Vater?«
»Der Mann da«, erwiderte ich und deutete möglichst vage auf eine kleine Gruppe von Rozenburger Hühnerbauern. Der Kassierer grummelte etwas, ging zunächst weiter und packte mich dann am Arm, als wir auf Rozenburg anlegten.
»Für dich hat keiner bezahlt«, sagte er.
»Nein«, sagte ich und riss mich los, »dafür bezahl ich nachher doppelt, wenn ich zurückfahre. Mein Urgroßvater gibt mir Geld.«
Ich war nämlich überzeugt, dass mein Urgroßvater sich sehr darüber freuen würde, seinen Urenkel zu sehen, er würde mich bestimmt mit Münzen überhäufen. Eltern waren in aller Regel nett zu ihren Kindern, hatte mich die Erfahrung gelehrt, und Großeltern waren noch viel netter zu ihren Enkeln und neigten sogar dazu, sie zu verwöhnen. Wie unvorstellbar nett mussten dann Urgroßeltern sein! Frohgemut marschierte ich über die sonnige, wunderschöne, idyllische Insel. Immer wenn ich auf Rozenburg unterwegs war, wähnte ich mich in einem fernen Land, wo die Dinge anders dufteten, wo die Menschen einen mit dem Rad gemächlicher überholten, wo immer die Sonne schien, wo sich die Vögel in einer verständlichen Sprache miteinander unterhielten. Oh, welch eine herrliche Insel! Der vollkommen stille Pfad am Fuße des winzigen Deichs, mit dem Naturgebiet De Beer an der Spitze – wie gern würde ich dort noch einmal spazieren gehen! Doch Rozenburg gibt es nicht mehr, die Insel wurde, mitten in Friedenszeiten und ganz ohne Atombombe, vollkommen ausgelöscht. Und so bekommt man heute das Gefühl, die Erinnerung an dieses Paradies beruhe auf einer Welt, die niemals existiert haben könne.
Ich ging weiter auf dem schmalen Weg, der am nach Gras duftenden Deich entlangführte. Über mir balgte sich der Westwind verspielt mit den Rozenburger Wolken. Nach einer guten Stunde erreichte ich das Häuschen, von dem ich aufgrund der mir gegebenen Beschreibungen annahm, dass es sich dabei um das Heim meines Vorfahren handelte. Es war ganz still dort; ein paar Hühner schoben bei jedem Schritt den Körper unter dem Kopf durch, eine Katze döste auf einem Zaun, ein Hahn hielt seinen Kopf schief und schaute misstrauisch, eine weiß-braune Taube mengte sich unter die Hühner, tat gerade so, als gehörte sie dazu, und pickte rasch ein paar Getreidekörner auf. Zielstrebig betrat ich den Hof. Augenblicklich erschien durch das, was ich als Kind immer als »kaputte Tür« bezeichnete, ein uraltes, ganz in Schwarz gekleidetes Männlein, das kaum größer war als ich. Der kleine Kerl brüllte. Um ihn zu beschwichtigen, rief ich aus der Ferne: »Ich bin ein Sohn von Lena van der Giessen!« Das war erst recht Öl ins Feuer; der alte Mann packte eine Bohnenstange und fing an zu tanzen. Eine Frau tauchte auf, seine Tochter, die Stiefschwester meines Großvaters, die ihn zu beruhigen versuchte. Vergeblich. Der Alte wedelte seine Bohnenstange wie eine Wünschelrute hin und her und kam drohend auf mich zu.
»Ich bin dein Urenkel!«, rief ich noch, doch es nützte nichts.
Zweimal schlug er mich mit der Stange und brüllte: »Verschwinde von meinem Hof, du Rotznase!«
Dann schleuderte er seine Waffe zwischen die erschrocken gackernden Hühner und wollte sich auf mich stürzen. Doch darauf wartete ich nicht, sondern rannte schluchzend davon. Ich war so durcheinander, dass ich mich nicht noch einmal traute, die Fähre dreist ohne Fahrgeld zu betreten. Deshalb ging ich zu einer Tante meines Vaters, die zusammen mit ihrem Cousin seit etwa vierzig Jahren auf Rozenburg in einem Deichhäuschen wohnte. Alle auf der Insel glaubten, Huibje und Klaas seien miteinander verheiratet. Die beiden waren, vielleicht weil sie nicht verheiratet waren, das liebste Menschenpaar, dem ich je begegnet bin. Innig zufrieden und glücklich saßen sie auch an jenem Nachmittag bei einem flackernden Teelicht zusammen, als ich weinend durch die Hintertür eintrat. Während ich erschüttert meine Geschichte erzählte, nickten sie weise: Oh ja, ich war an der richtigen Adresse gewesen, so war der Leen, ganz zweifellos, in diesem Teil der Familie tickten sie alle nicht ganz sauber, gab es nicht auch zwei Tanten, die im Irrenhaus gelandet waren, weil sie meinten, sie seien Martha und Maria?
Ich bekam erst einmal eine Tasse Tee, und dann sagte Tante Huibje: »Oben auf dem Dachboden habe ich noch eine ganze Menge alter Bibeln. Davon darfst du dir eine aussuchen. Zum Trost. Weil du so traurig bist.«
Mithilfe einer wackligen Leiter kletterte ich auf den dunklen Dachboden. Als ich den Kopf durch die Bodenluke steckte, sah ich im Dämmerlicht den Goldschnitt der prähistorischen Bibeln. Ich kroch näher heran und bemerkte, dass einige der Bibeln leider schon in Puderform übergegangen waren. Als ich eine in die Hand nahm, verließen, zornig mit den Flügeln brummend, allerlei Käfer und Deckflügler ihre religiöse Speisekammer. Jedes Mal, wenn ich heute im protestantischen Sender sagen höre, jetzt werde »das lebendige Wort des Herrn« verkündet, sehe ich die alten Bibeln vor mir.
Mit einem halbwegs erhaltenen Exemplar kletterte ich wieder hinunter. Außerdem bekam ich noch zehn Cent für die Fähre. Oh, was für liebe Menschen! Ihr Leben lang predigte ihnen am Sonntag ihr stotternder Pastor Mantz, dass sie sündig seien, ja, dass sie, wie es im Heidelberger Katechismus so herzlich heißt, geneigt zu allem Bösen und ganz und gar untüchtig zu einigem Guten seien. Wenn sie dann aus der Kirche kamen und beim Kaffee saßen, sagten sie zueinander: »Da hat uns der Pastor wieder ordentlich die Leviten gelesen, wir sind durch und durch wurmstichig vor Sünde.« Dennoch bin ich mir vollkommen sicher, dass weder Tante Huibje noch Onkel Klaas jemals einem Wesen, ob Mensch oder Tier, etwas Böses zugefügt haben. »Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein«, sagt Jesus. Nun, die beiden waren in jeder Hinsicht dazu befugt, den ersten Stein zu werfen.
Tante Huibjes Schwester, die Mutter meines Vaters, war ebenfalls so eine kleine herzensgute Frau. Die einzige kritische Bemerkung aus ihrem Mund, festgehalten nach der Geburt ihres achten Kindes, lautete: »Lieber krieche ich auf den Knien nach Delft, als dass ich noch eins kriege.« Trotzdem wurde mein Vater noch geboren, und kurze Zeit später kam sogar das zehnte Kind hinzu. Meine andere Großmutter gebar nur neun Kinder, beklagte sich darüber aber nie. Wohl aber gab sie jedem Neugeborenen so lange wie möglich die Brust, weil eine Frau, wie man damals meinte, nicht wieder schwanger wurde, solange sie stillt.
Mit dem rabenschwarzen Haar und der krummen Nase sah meine Großmutter sehr jüdisch aus. Zudem war sie überaus gesprächig. Laut meinem Vater war sie, vonseiten der Bodegoms, tatsächlich von jüdischer Herkunft. Sie hatte etwas Munteres und Unverletzbares. Sie schien immer fröhlich zu sein, unerschütterlich. Sie redete ständig, auch als sie dement wurde und ihre Kinder nicht mehr erkannte. Als sie schon weit in den Achtzigern war und immer mehr körperliche Leiden sie plagten, amputierte man ihr dies und jenes. Denn was steinalt, dement und des Lebens müde ist, muss man, koste es, was es wolle, am Leben erhalten. Bevor man dazu kam, ihr den Kopf zu amputieren, starb meine Großmutter. Sie war, fand ich als Kind, eine erstaunliche Frau. Man hatte den Eindruck, sie mache sich über nichts Sorgen, als halte sie alles Leid und Ungemach weit von sich, indem sie ständig redete. Wenn in unserer Familie das Phänomen Sünde zur Sprache kam, bat ich meine Mutter, die meiner Ansicht nach ebenfalls befugt war, den ersten Stein zu werfen, oft: »Wenn wir so sündig sind, dann sag mir doch, was du jemals an Bösem getan hast.« Daraufhin dachte meine Mutter lange nach, zählte einige Kleinigkeiten auf, die auf die Bezeichnung Sünde keinerlei Anspruch erheben konnten, und sagte schließlich mit gerunzelter Stirn: »Ich bin zu meiner Mutter nicht artig genug gewesen.« Das ist erstens nicht wahr, und zweitens hätte meine Großmutter, wenn es denn wahr gewesen wäre, keine Notiz davon genommen. Es wundert mich immer wieder, dass sie meine Großmutter war – denn allem Anschein nach habe ich nichts mit ihr gemein oder von ihr geerbt.
Was man in Bezug auf meinen Großvater, nach dem ich benannt worden bin, nicht behaupten kann. Ursprünglich war er Käsehändler, doch im Prinzip verkaufte er alles, womit man eine paar schnelle Cent verdienen konnte. Er war nicht gerade befugt, den ersten Stein zu werfen. Dass er beim Anpreisen von Wischtüchern auf der Straße rief: »Ein Wischtuch acht Cent, drei Wischtücher im Angebot für fünfundzwanzig Cent!«, kann man ihm noch verzeihen, im Gegensatz zu seiner Reaktion auf den Tod seines ältesten Sohnes Hendrik. Der arbeitete bei den Vereinigten Seilfabriken und verdiente dort acht Gulden in der Woche. Diese Summe gab er, wie es damals noch üblich war, bei seinem Vater ab. Hendrik kam bei einem Arbeitsunfall ums Leben. Man brachte ihn in sein Elternhaus. Als mein Großvater seinen toten Sohn sah, sagte er: »Mann, das kostet mich acht Gulden die Woche.« Gesprächig war er übrigens nie gewesen. Sein bevorzugtes Ausdrucksmittel war sein Spazierstock. Hörten wir dessen Ticken wie das Klopfen eines Spechts über die Straße schallen, dann wussten wir, dass er beim Damespiel verloren hatte. Wenn er den Spazierstock an dem Ende festhielt, das normalerweise dazu gedacht ist, die Straße zu berühren, und mit dem Griff durch die Luft fuhr, war klar, dass er ein Mädchen im Visier hatte, das er am liebsten mit dem Griff an sich herangezogen hätte. Zweimal habe ich beobachtet, wie er tatsächlich eine junge Dame auf diese Weise enterte. Beide Male legte er den Frauen den Griff um den Nacken und zog. Einmal enterte er auch eine ohne Spazierstock: Als mein Onkel Maarten, sein sechster Sohn, zum ersten Mal seine Freundin mit nach Hause brachte, meinte sein Vater, ihm stünden aufgrund der Tatsache, dass er denselben Namen trug, auch dieselben Privilegien zu. Er umarmte seine zukünftige Schwiegertochter so innig, dass mein Onkel augenblicklich ein Messer aus der Küche holte und es in seine Richtung warf. Er verfehlte sein Ziel nur um Haaresbreite, das Messer blieb zitternd neben seinem Vater im Schrank stecken.
Nachdem mein Großvater vierzig geworden war, zog er sich aus seinem Lebensmittelgeschäft zurück. Die ganze Arbeit überließ er fortan seiner Frau und widmete sich selbst nur noch seinem geliebten Damespiel. Überall in Maassluis kannte er Leute, zu denen er zum Spielen ging; bei meinem Vater war er immer montag- und mittwochabends. Bei den anderen Söhnen und Schwiegersöhnen hatte er ebenfalls feste Termine. Auch wenn er seine älteste Tochter für ein paar Tage besuchte, traf er sich in Leiderdorp mit Bekannten zum Spielen. Er hatte sich dort rasch ein enges Netzwerk von Spielern aufgebaut. Das Einzige, was allen bei der Sache Verdruss bereitete, war, dass er absolut nicht verlieren konnte.
Eine meiner ersten Erinnerungen an ihn ist, wie er an einem dieser Montagabende mit meinem Vater Dame spielte und, als mein Vater einen Moment nicht hinsah, einen von dessen Steinen verschwinden ließ. Ich holte tief Luft und wollte etwas sagen, doch er sah mich an wie ein Marder kurz vor dem Sprung. Ich schluckte, woraufhin er mir ein Pfefferminzbonbon gab, das in seiner Westentasche kohlrabenschwarz geworden war.
Als ich sechs wurde, bekam ich von ihm, weil ich wie er Maarten hieß, einen Meccano-Baukasten. Alle früheren Maartens hatten größere Geschenke bekommen, doch ich war vorerst der Letzte in der Reihe. Enkel mit anderen Namen bekamen überhaupt nichts geschenkt, und zwar aus dem einfachen Grund, dass mein Großvater geizig war. Das ist ein typisches Familienleiden, etwas, das hartnäckig in den Genen verankert ist, denn auch die uralt gewordene Schwester meines Großvaters ließ noch mit neunundneunzig Jahren, wenn Besuch kam, von ihrer gut siebzigjährigen Tochter den Teppich aufrollen, damit dieser nicht abgenutzt wurde. Teekannen durften nur mit Wasser aus der Regentonne ausgespült werden, und das Haus hatte sie, mit Ausnahme des Zimmerchens, in dem sie mit ihrer Tochter wohnte, an Dritte vermietet.
Mein Großvater nahm nie ein Bad oder eine Dusche. Auf diese Weise sparte er Wasser und Seife. Dass er fünf Straßen weit zu riechen war, kümmerte ihn nicht. Obwohl er nie ein Wort mit mir sprach, liebte ich ihn sehr. Immer wenn er, was alle sechs Wochen geschah, am Sonntagmittag bei uns aß (an den anderen Sonntagen aß er bei seinen anderen Söhnen und Töchtern), wartete ich auf den denkwürdigen Augenblick, wenn wir uns ins Tischgebet vertieften und er seine schwarze Mütze, die er nie absetzte, kurz ein wenig nach vorn schob. Während des Gebets hielt ich dann die Augen geöffnet und sah einen kleinen Teil seines glänzenden Schädels. Nach dem Gebet gab es immer Vermicelli-Suppe, und jedes Mal fiel ihm beim Essen eine der dünnen hellgelben Nudeln in seinen grauen Bart. Meistens blieb das fadenartige Ding darin hängen, und manchmal konnte man es, wenn mein Großvater am Montagabend zum Damespielen kam, dort noch, leicht verschrumpelt, entdecken. Mitunter wurde eine solche Nudel als fester Bestandteil in den Bart mitaufgenommen.
Jedes Jahr am 2. Februar ging ich zu ihm, um ihm zum Geburtstag zu gratulieren. Bei meiner letzten Geburtstagsvisite spielte er mit einem uralten Männlein aus Maasland Dame. Er unterbrach das Spiel, ich reichte ihm die Hand, bekam ein pechschwarzes Pfefferminzbonbon hineingelegt und sagte: »Ich hoffe, du wirst noch sehr lange bei uns sein.« Bestürzt sah er mich an, dann brach er in Tränen aus. Vor Schreck begann auch ich zu weinen, und sehr bald schon fügte das alte Männlein aus Maasland sein krampfartiges Schluchzen unserem Jammern hinzu. Kurz danach ist mein Großvater gestorben. Oft denke ich, ihm wurde, als ich in meiner Unschuld den klischeehaften Wunsch aussprach, erstmals bewusst, dass dies sein letzter Geburtstag sein könnte.
Er starb, wie er gelebt hatte, ohne Schmerz, ohne Trauer, ohne wirkliche Krankheit. Allerdings war den Angehörigen klar, dass es bald so weit sein würde. Seine Söhne hielten abwechselnd Wache an seinem Bett. In der Nacht, als er starb, war mein Vater an der Reihe. Morgens um fünf bat mein Großvater um den Nachttopf, er wollte sich aufrichten und kippte um. Als mein Vater um sieben nach Hause kam, hatte er dicke Tränen in den Augen.
Erstaunt sagte ich: »Aber du hast ihn doch gar nicht gemocht, und zu dir hat er ständig gesagt, du seist ein grober Klotz.«
»Trotzdem war er mein Vater«, erwiderte er.
Von frühester Kindheit an habe ich nie jemanden etwas Anerkennendes über meinen Großvater sagen hören. Und gleichzeitig habe ich von Kindesbeinen an ständig von meinem eigenen Vater, meinen Onkeln und Tanten (nie aber von meiner Mutter) zu hören bekommen, ich gliche ihm aufs Haar. Als ich das erste Mal bei meiner Tante Anna war – die er oft für ein paar Tage besucht hatte – und ich mich in der Diele kurz mit ihr unterhielt, um anschließend das Wohnzimmer zu betreten, da starrte mich der leichenblasse Schwiegersohn meiner Tante an, der mich bis dahin noch nie getroffen hatte.
»Gütiger Gott«, sagte er, »ich habe mich zu Tode erschreckt. Ich habe auf einmal die Stimme von Opa ’t Hart gehört, obwohl der doch schon lange tot ist.«
»Nein«, sagte meine Tante, »das war die Stimme von unserem Maarten hier. Er hat genau, aber auch wirklich genau dieselbe Stimme wie sein Großvater.«
»Sag noch mal etwas«, bat mich der angeheiratete Cousin.
»In einem Eisbär bleibt das Fleisch herrlich kühl«, sagte ich.
Der Mann meiner Cousine holte tief Luft: »Wie ist es bloß möglich.«
Es ist ein merkwürdiger Fluch, zu wissen, dass man jemandem aufs Haar gleicht. Mein einziger Trost ist, dass mein Großvater, wie ich bis heute, nie ernsthaft krank war und vierundachtzig Jahre alt geworden ist. Seinen Hang zu Frauen, seinen außergewöhnlichen Geiz, die Scheu vor Wasser und das Nicht-verlieren-Können, das habe ich von ihm. Und natürlich die Stimme, wobei ich mich in diesem Punkt grob benachteiligt fühle. Denn schließlich hätte ich ebenso gut die Stimme meines anderen Großvaters erben können. Und dessen Stimme ist die zweitschönste Sprechstimme, die ich je gehört habe. Nur die von Kathleen Ferrier finde ich noch schöner, von ihrer Singstimme ganz zu schweigen. Vor allem, wenn mein Großvater mit seiner wunderbaren Stimme demutsvoll aus der Bibel vorlas oder ein Gebet sprach, war ich zutiefst gerührt. Hin und wieder kommt mir sein Ton noch mal zu Ohren, etwa wenn ein christlich-reformierter Pastor im Radio predigt.
Mein anderer Großvater war nicht auf die gleiche selbstverständliche Art gläubig wie meine übrigen Verwandten. »Vater Arie macht es sich selbst so schwer«, sagte mein Vater immer. »Mein Vater ringt ganz schrecklich mit seinem Glauben«, sagte meine Mutter, »das solltest du selbst später nicht tun, auch wenn du ihm in vielem ähnlich bist.« Es war dieser Großvater, der zwei Presbyter zur Tür hinauswarf, so wie ich es in Ein Schwarm Regenbrachvögel beschrieben habe. Er war Gärtner, wollte der beste von ganz Maasland sein, und das war er auch; er züchtete Exportqualität. Wenn er seine Tomaten für den Export nicht gut genug fand, verkaufte er sie nicht, auch wenn man ihm hoch und heilig versicherte, sie könnten problemlos auf das Schiff nach England verladen werden. Er war grundehrlich; während des Krieges beteiligte er sich nicht am Schwarzhandel, obwohl ihm das ein Vermögen eingebracht hätte. Da fast alle Gärtner in Westland diesbezüglich weniger große Bedenken hatten, kam das damals bereits raublustige Finanzamt auf den Gedanken, den Gärtnern nach dem Krieg einen Steuerbescheid über die geschätzten Einkünfte auf dem Schwarzmarkt zu schicken. Auch mein Großvater bekam einen solchen Bescheid. Dieser Zweifel an seiner Integrität hatte schreckliche Folgen. Nachdem er alle seine Kinder (sechs Söhne und drei Töchter) und deren Verlobte aus dem Haus geschickt hatte, schloss er sich im nach vorn gelegenen Schlafzimmer ein. Wann immer jemand an das Fenster klopfte, drohte er, dass er jeden, der ins Haus komme, umbringen werde. Daraufhin versuchten einige seiner Söhne vor dem Haus, ihn, so gut es ging, abzulenken, während mein Vater sich mit den anderen durch die Hintertür hineinschlich. Es gelang der Gruppe, ihn zu überwältigen. Mein Vater erzählte später des Öfteren: »Wir waren zu sechst, aber wir konnten ihn kaum halten. Nur gut, dass wir einen Arzt gerufen hatten, der ihm dann eine Spritze gegeben hat.« Anschließend wurde mein Großvater in das psychiatrische Krankenhaus St. Joris in Delft gebracht, dasselbe Krankenhaus, wo heute der Bruder meines Freundes und Kollegen Maarten Biesheuvel von wiederum meinem Bruder gepflegt wird.
Im St. Joris ist mein Großvater nicht lange gewesen, trotzdem hat er auch danach noch oft derartige Anfälle von unbeherrschter Wut gehabt. Einmal durfte ich einen miterleben. Mein Großvater hatte seine Gärtnerei an zwei seiner Söhne übergeben, war in eine Altenwohnung in Maasland gezogen und arbeitete unentgeltlich bei der dortigen Gemüseauktion. Eines Nachmittags gingen einige Klassenkameraden und ich nach der Schule zur Auktionshalle, um dort, wie wir das öfter taten, beim Auf- und Abladen der Auktionssteigen zu helfen. Nachdem wir dies eine Weile getan hatten, liefen wir zur großen Waage im vorderen Bereich der Halle und wogen uns selbst. Mein Großvater tauchte auf, sah, was wir taten, nahm eine Fahrradpumpe und schlug einen meiner Klassenkameraden zu Boden. Die anderen Jungen rannten weg. Ich blieb stehen. Er packte mich beim Jackenkragen, drehte ihn zu einem Knebel und herrschte mich an: »Du auch hier?« Dann verpasste er mir mit seiner freien Hand eine schallende Ohrfeige. Anschließend lief er zu seinem Fahrrad, sprang auf und machte sich an die Verfolgungsjagd. Ein Stück entfernt, bei einem Tunnel, holte er zwei meiner Mitschüler ein. Noch heute sehe ich genau vor mir, wie er im schattenreichen Wintersonnenlicht des ausgehenden Tages in unbändiger Wut auf einen der beiden einschlägt. Als dieser zu Boden sank, sprang er wieder aufs Rad und verfolgte den anderen. In der stillen Winterdämmerung ging ich langsam zu Daan Coumou. Vorsichtig half ich ihm auf die Beine. Er blutete heftig. »Der wird noch von mir hören«, sagte er, »ich sorge dafür, dass mein Vater Anzeige bei der Polizei erstattet.« In der Ferne hatte mein Großvater inzwischen den anderen Klassenkameraden eingeholt. Wieder sah ich die Fahrradpumpe durch die Luft sausen. Und immer noch war mein Großvater nicht zufrieden. Er saß bereits wieder auf dem Rad und versuchte, auch den Letzten noch zu fassen zu kriegen. Auch der kam am nächsten Tag mit Prellungen, Blutergüssen und aufgeplatzter Augenbraue in die Schule.
Einige Jahre später bekam mein Großvater Magenkrebs. Ich habe ihn nach der Diagnose noch einmal gesehen. Eines Mittwochnachmittags schickte meine Mutter mich nach Maasland, um »für immer Abschied zu nehmen«. Ich glaube nicht, dass ich jemals einen schwereren Gang gemacht habe. Ich fuhr an der Auktionshalle vorbei, wo man den schwierigen Mann vor die Tür gesetzt hatte. Am Gartentor der Altenwohnung wartete bereits meine muntere Großmutter auf mich. Sie ging nicht mit hinein, sie ließ mich allein das Wohnzimmer betreten, wo er auf einem Campingbett unter dem größeren Fenster lag. Ich erkannte ihn kaum wieder, er war zu einem Kind mit dem Gesicht eines Greises zusammengeschrumpft. Immer wieder zog er die Decke über seinen imaginären Körper. Wir haben dann, ich war fünfzehn Jahre alt, über die Sünde gesprochen. »Weißt du«, sagte er zu mir, »das mit der Erbsünde ist bestimmt nicht wahr. Einem Kind wie dem meiner Tochter Bep, das gerade geboren wurde, muss man nur in die Äuglein schauen, um zu wissen, dass es nicht sündig ist. Das kommt erst später. Und manchmal kommt die Sünde überhaupt nicht. Es gibt Menschen, die gerecht sind, bestimmt. Pastor Potjer sagt zwar, dem sei nicht so, aber der sollte lieber seine Bibel mal genau lesen. Jesus sagt schließlich, dass er nicht für die Gerechten gekommen sei, und daraus folgt, dass es Gerechte gibt. Nein, ich spreche nicht von mir selbst, ich war nicht ohne Sünde, und du auch nicht, du warst bereits ein Taugenichts, als du noch ganz klein warst. Aber das spielt keine Rolle, ich werde aus alldem sowieso nicht mehr schlau, wie kann der Sohn Gottes ganz allein all unsere Sünden auf sich nehmen? Ich habe jeden Halt verloren, ich kann mir auf all das keinen Reim mehr machen.«
Er gab mir die Hand und sagte ruhig: »So, Maarten, das ist nun das letzte Mal, dass ich dir die Hand gebe, sei gut zu deiner Mutter.« Danach schloss er die Augen, drehte sich zum Fenster und zog die Decke über sich. Sein ganzer Körper passte problemlos darunter. Es dauerte aber noch Wochen, ehe er starb. Während der ganzen Zeit besuchten mein Vater und meine Mutter ihn jeden Samstagabend, und jedes Mal sagte mein Vater, wenn sie nach Hause kamen: »Wie klein Vater Arie geworden ist, man kann ihn auf einem Teelöffel forttragen.« Meine Mutter sagte nichts, sie weinte nur, und sie weinte so lange, bis wir zu Bett gingen.
»Und du hast immer gesagt, dass er ein schrecklicher Tyrann sei und du ihn gar nicht magst«, sagte ich.
»Er ist mein Vater«, erwiderte sie.
In den letzten Wochen sagte mein Großvater, er wolle gern bei vollem Bewusstsein sterben. »Um zu wissen, was das ist: Sterben.« Aber er starb im Schlummer, an einem Sonntagnachmittag, am Tag des Herrn. Den Seinen gibt der Herr im Schlaf.
Die Hälfte des Lebens
Meine erste Erinnerung: ein bezaubernder warmer, sonnendurchfluteter, vom beiläufigen sommerlichen Summen der Insekten erfüllter Sommertag des schrecklichen Kriegsjahres 1944. Wobei das eigentlich gar nicht sein kann, damals war ich noch nicht geboren. Dennoch sehe ich meine schwangere Mutter und meinen Vater dort im breiten, sandigen Grasstreifen sitzen, der neben dem Nieuwe Waterweg in Maassluis und hinter einem Spalier aus blühendem, duftendem Raps entlangführt. Ich höre ihre murmelnden Stimmen. In der Ferne leuchten geblähte weiße Segel. Alles ist so, wie es sein soll.
Später sehe ich den Grasstreifen wieder. Jetzt gehe ich selbst dort spazieren. Bis zum Horizont blühen roter Mohn und gelbe Löwenmäulchen. Der Weg, den ich zurückgelegt habe, bleibt eine Weile als dunkelgrüner Streifen sichtbar.
Ich war in den ersten Jahren meines Lebens so glücklich, dass ich mich an nichts mehr erinnere. Wenn ich angestrengt nachdenke, sehe ich lediglich schlammige Gräben, in denen ich Deiche baue. Ansonsten scheint das, was damals geschah, hinter einem herbstfarbenen, diffusen Sonnenlicht verborgen zu sein. Der Schleier hebt sich jedoch, sobald ich in den Kindergarten komme. Am ersten Tag weigere ich mich, hingebracht zu werden.
»Ich weiß doch, wo der Kindergarten ist«, sage ich zu meiner Mutter.
»Ja, aber ich muss kurz mitgehen, um der Kindergärtnerin zu sagen: Das ist Maarten, er ist heute zum ersten Mal hier.«
»Das kann ich ihr auch selbst sagen.«
»Aber dann glaubt man dir möglicherweise nicht. Es ist noch nie vorgekommen, dass ein Kind am ersten Tag ohne seine Mutter zum Kindergarten gegangen ist.«
»Ich gehe allein. Du brauchst mich nicht zu bringen.«
Und so kam es, dass ich allein zum Kindergarten ging. Jahre später hatte meine Mutter mir erzählt, sie sei mir in einiger Entfernung nachgegangen. »Wie beherzt du damals in den Kindergarten hinein bist in deinem braunen Anzüglein mit dem weißen Kragen«, erinnerte sie sich. Ich aber weiß nur, dass ich zögernd und ängstlich mitten auf der Straße vor der Tür stand, weil ich hinten im Flur »große Jungs« entdeckt hatte. Erst dann nahm ich all meinen Mut zusammen und marschierte auf Fräulein Lub zu: »Ich bin heute zum ersten Mal hier.«
Noch heute höre ich das fröhliche Lachen der drei Kindergärtnerinnen in dem dunklen, hohl schallenden Flur. Eine von ihnen fragt mich: »Wo ist deine Mutter?«
»Ich bin allein gekommen«, erwidere ich spitz.
»Wie heißt du?«
»Maarten.«
»Und kommt da noch was danach?«
»Lenie.«
»Lenie? Das glaub ich nicht.«
»Doch, meine jüngere Schwester heißt Lenie.«
Sie zuckt mit den Achseln und führt mich in einen dunklen Raum. Eine andere Kindergärtnerin, Fräulein Dekwaaisteniet, erzählt eine Geschichte aus der Bibel, die ich längst kenne. Nach der Bibelgeschichte müssen wir prickeln, und ab dieser ersten Bastelarbeit versagt meine Erinnerung an den ersten Tag. Stattdessen sehe ich eine schier unendliche Reihe von Tagen, an denen ich prickeln, kleben, schneiden und modellieren muss. All diese Aktivitäten hasse ich aus tiefster Seele, und ich versuche, die mir aufgetragenen Arbeiten so schnell wie möglich hinter mich zu bringen; oder ich weigere mich einfach zu basteln. Von Anfang an habe ich eine derartige Abneigung gegen das Malen, dass ich jedes Mal, wenn ich aufgefordert werde, einen Baum oder einen Schlepper zu malen, das weiße Papier wütend in Stücke reiße. Aus dem Modellierton mache ich Kugeln, die ich durch die Klasse schieße, und wenn ich etwas »ordentlich« (oh, wie ich dieses Wort hasse!) ausschneiden soll, lasse ich meine Schere kreuz und quer durch den Karton wüten, während ich mich gleichzeitig nach dem Tag sehne, an dem man mir das Lesen beibringen wird. Oft schwänze ich, und noch öfter stehe ich in der Ecke, wenn ich wieder einmal ein Blatt Zeichenpapier zerfetzt habe oder, ohne zum Sprechen aufgefordert worden zu sein, etwas durch den Klassenraum gerufen oder gar meine Pricknadel in den Rücken von Carla, der Tochter von Pastor Dercksen, gestochen habe. Das Einzige, was mir im Kindergarten gefällt, sind die gereimten Psalmen. Schon in der »ersten Klasse« des Kindergartens müssen wir am Wochenende einen solchen Vers lernen und am Montagmorgen aufsagen. Ich sehe die anderen Kinder stammeln und stottern und meist auf halber Strecke verstummen oder in Tränen ausbrechen. Mich selbst höre ich stolz den ganzen Vers mühelos vortragen, damals schon den für meine weitere Entwicklung wenig förderlichen Hochmut kultivierend, dass ich zu mehr in der Lage bin als andere.
Als ich am 1. April 1951 in die Grundschule kam, fühlte ich mich meinen Altersgenossen derart überlegen, dass ich mich noch viel heftiger dagegen wehrte, von meiner Mutter zur Schule gebracht zu werden. Mir kam es so vor, als würde ich meinen Vorsprung wieder verlieren, wenn ich in Begleitung meiner Mutter auf dem Schulhof der Dr.-Abraham Kuyper-Schule erschien. Sie sagte jedoch, ich würde ohne sie nicht zugelassen, und diesem Argument beugte ich mich, weil ich nichts lieber wollte, als lesen zu lernen.
»Heute Abend kann ich die Zeitung lesen«, sagte ich am Morgen des 1. April 1951 stolz zu meinem Vater.
»Das kannst du vergessen«, sagte er, »das lernst du nicht an einem einzigen Tag.«
Es zeigte sich, dass er recht hatte. Bei einer merkwürdig sanftmütigen Dame, Fräulein van der Meulen, lernte ich am ersten Tag nur den Buchstaben A, den ich dann am Abend in sämtlichen Artikeln des Rotterdamers (»eine unterhaltsame Zeitung«) eifrig mit Bleistift unterstrich. Gewiss, auch der Unterricht in der Grundschule enttäuschte mich zutiefst – es ging mir nicht schnell genug –, zumindest fand ich es aber sehr angenehm, dass so nutzlose Aktivitäten wie Zeichnen, Prickeln, Kleben, Malen und Modellieren – im Stundenplan als Handarbeit bezeichnet – nur noch in der letzten Stunde am Dienstagnachmittag praktiziert wurden. Zudem erlaubte mir Fräulein van der Meulen, leise etwas anderes zu machen. Während der ersten drei Wochen ergab sich dabei allerdings ein Problem: Was sollte ich anderes tun? Als ich nach Ablauf dieser Zeit endlich lesen konnte, zauberte ich hinten aus dem Schrank ein braunes Buch (Willem Gerrit van de Hulst, So ein merkwürdiger Junge) hervor, das ich mir langsam vorbuchstabierte. Ab diesem Augenblick schienen all meine Probleme gelöst, wenn man einmal von der schrecklichen Ungeduld und der zügellosen Verärgerung absieht, die mich täglich überkamen, weil die anderen Kinder so langsam und begriffsstutzig waren. Trotzdem kam die alte Jungfer, die vor der Klasse stand und sich selbst einmal die Woche Blumen unter einem fiktiven Männernamen schicken ließ, hervorragend mit mir zurecht. »Du kleiner Wildfang«, sagte sie immer, »wenn du ein wenig langsamer arbeiten würdest, dann sähe dein Heft vielleicht ordentlich aus. Deine Rechenaufgaben wären immer noch richtig, aber ohne dieses Geschmiere.«
Im zweiten Schuljahr, bei Fräulein Kievit, änderte sich alles. Wenn ich als Erster mit dem Rechnen fertig war, schaute sie sich die Aufgaben nicht einmal an, nein, ihr fiel nur eine einzige Methode ein, mich weiter zu beschäftigen: Sie zerriss alles, und ich musste noch einmal von vorn anfangen, obwohl ich genau wusste, dass ich keinen Fehler gemacht hatte. Damals konnte ich noch nicht wissen, dass man im Leben entweder die anderen beschäftigt oder von den anderen beschäftigt wird und dass die Aufgabe des Beschäftigers sehr viel schwerer ist. Es ist immer besser, sich auf der anderen Seite der Linie aufzuhalten und beschäftigt zu werden. Dann kann man tatenlos abwarten und muss sich nicht den Kopf darüber zerbrechen, womit die Zeit des Abwartenden gefüllt werden kann, damit dieser nicht mürrisch wird. Daher gerät der Beschäftiger, wie Fräulein Kievit, dann oftmals auch in Panik, wenn er feststellt, dass die Arbeit, die er aufgetragen hat, nicht ausreicht, um die Zeit zu füllen. Wenn man beschäftigt wird, kann man so tun, als amüsierte man sich, hätte zu tun und nutzte seine Zeit sinnvoll. Aber das wusste ich im zweiten Schuljahr noch nicht. Wütend weigerte ich mich, die Aufgaben erneut zu rechnen. Wenn ich dann, die Fäuste unter dem Kinn und die Ellbogen wütend auf dem Tisch, vor mich hinstarrte, kam ein langes, viereckiges Lineal zum Einsatz, mit dem Fräulein Kievit mir vor versammelter Klasse gnadenlos den entblößten Hintern versohlte. Acht Monate lang schlug sie mich fast jeden Tag. Am Ende dieser Zeit hatte sie mich eines Nachmittags wieder so unbarmherzig bearbeitet, dass ich, noch leise schluchzend, meinem Nachbarn Daan Coumou zuflüsterte: »Ich finde, sie ist ein gemeine Scheißlehrerin.« Woraufhin er augenblicklich die Hand hob und ihr, nach einem ermunternden Nicken, mitteilte: »Maarten sagt, Sie seien eine gemeine Scheißlehrerin.«
Danach explodierte die Bombe erst so richtig. Überall trafen mich die Schläge mit dem braunen Lineal, und anschließend sollte ich auf dem Flur stehen und mein Schluchzen zwischen den Mänteln unterdrücken, was ich aber nicht sonderlich lange aushielt. Durch den sauberen, kühlen, hellen Flur rannte ich zur Eingangstür. Keiner hielt mich auf. Draußen auf der Straße angekommen, drohte mir keine Gefahr mehr. Nicht weit entfernt, genau vor der Polizeiwache, stand mein Vater zusammen mit dem Straßenpflasterer Piet Verbrugge und ruhte sich von seinen Handlangertätigkeiten aus. Im Telegrammstil berichtete ich ihm, was mir widerfahren war: »Rechenaufgaben fertig, zerrissen, sollte alles noch einmal machen, wollte ich nicht, mit dem Lineal verprügelt, zu Daan gesagt, was für eine gemeine Scheißlehrerin, der hat mich verpetzt, und da hat sie mich mit dem Lineal auf Rücken, Arme, Beine, Kopf und überallhin geschlagen.«
»Bleib ruhig hier«, sagte mein Vater, »wenn die Schule nachher aus ist, kommt sie auf dem Weg zum Bahnhof hier vorbei, und dann werde ich mal kurz mit ihr reden.«
Eine halbe Stunde später kam sie, stramm im Gleichschritt humpelnd, über die Brücke gelaufen. Als sie auf Höhe der Polizeiwache war, tauchte mein Vater überraschend hinter einem Haufen Pflastersteine auf. Mit eiserner Faust umklammerte er ihr linkes Handgelenk und sagte, während er ein blitzendes Brecheisen vor ihrer gedrungenen Gestalt rotieren ließ: »Wenn du meinen Sohn noch ein einziges Mal mit dem Lineal schlägst, dann verprügle ich dich mit diesem Stemmeisen.« Das wirkte. Von diesem Tag an ignorierte sie mich, und ich habe keine weiteren Erinnerungen an sie. Ich weiß nur noch, dass sie nicht bis zum Ende des Schuljahrs unsere Lehrerin blieb, sondern von einer anderen gedrungenen Gestalt abgelöst wurde: Herrn Mollema.
Mein Lehrer Andries Mollema kam geradewegs aus dem Fernen Osten, als er Fräulein Kievits Nachfolger wurde. Schon als der Direktor, Herr Cordia, ihn uns als unseren neuen Lehrer vorstellte, der nicht nur die wenigen verbleibenden Monate des zweiten Schuljahrs unser Klassenlehrer sein, sondern uns auch im nächsten Schuljahr begleiten sollte, wusste ich, dass ich – um mit Simon Vestdijk zu sprechen – »ihn liebte, wie ich noch nie zuvor jemanden geliebt hatte«. Augenblicklich lernte ich auch ein mir damals noch rätselhaftes Phänomen kennen: dass ich nämlich meine Liebe zu ihm nur äußern konnte, indem ich ihn quälte. Dass wahre Liebe gehässig ist und zum Quälen neigt, wurde mir erst viel später bewusst. Auch dass man zum Beispiel heiratet, um das exklusive Recht zum Quälen zu haben, war mir als Kind natürlich unbekannt. Aber ich versuchte sehr wohl, ihm das Leben so sauer wie möglich zu machen, obwohl ich genau wusste, dass er mich ebenso mochte wie ich ihn. Vom ersten Tag an nahm er mich vor meinen rachsüchtigen Klassenkameraden in Schutz. Um vier Uhr durfte ich noch ein wenig in der Schule bleiben, damit die schlimmsten Quälgeister schon weg waren, wenn ich mich auf den Heimweg machte. Als das sehr bald nicht mehr half, weil die Plagegeister warteten, bis ich herauskam, durfte ich den Klassenraum um fünf vor vier verlassen, sodass ich einen Vorsprung hatte. Ich bedauerte es übrigens, früher gehen zu dürfen. Anfangs, als ich länger bleiben durfte, hatte ich für Herrn Mollema die Tafel geputzt und den Ofen nachgefüllt, während er Rechenarbeiten und Diktate nachsah. Währenddessen erzählte er mir von Indonesien. Von allem, was er tat und konnte, ist mir dies am deutlichsten in Erinnerung geblieben: dass er erzählen konnte wie kein anderer – obwohl doch nach Ansicht von J. B. Charles die Friesen jede Geschichte verderben – und dass dieses wunderbare Erzähltalent sich gleichwohl eignete für eine unvergessliche Geschichte, in der es nur darum ging, wie er einmal auf Java an einem glühend heißen Nachmittag auf den Bus gewartet hatte (und immer noch bricht mir, wenn ich daran zurückdenke, der Schweiß aus), als auch für die Darstellung der niederländischen Geschichte, die Erzählungen der Bibel, für den Erdkundeunterricht – die zu behandelnden Themen präsentierte er immer in Form einer Erzählung über eine Expedition durch unbekanntes Gebiet (ungefähr so wie Jules Verne es in Die Kinder des Kapitän Grant macht), für das Schreiben eines Diktats – stets eine kurze, abgeschlossene Geschichte – und sogar fürs Rechnen, wobei er die Zahlen und Brüche als lebende Personen auftreten ließ. In den zweieinhalb Jahren, die er mein Lehrer war, ist er in Geschichte nicht weiter gekommen als bis zum Tod von Wilhelm III. von Oranien. Über den weiß ich wirklich alles – durch die Augen meines Lehrers betrachtet. Herr Mollema war fasziniert, besessen, gefesselt von den Ketzerverbrennungen. Immer, wenn am Dienstag- oder Donnerstagnachmittag die Geschichtsstunde näher rückte und ihn eine gewisse Unruhe erfasste, die er am Harmonium zu besänftigen versuchte, war mir bereits klar, dass er wieder über einen Ketzer erzählen würde, den die Katholiken verbrannt hatten. Er wusste von Verbrennungen, über die ich später nie wieder etwas gehört oder gelesen habe. Er berichtete über einen Mann in Gorcum, der übers Eis floh. Hinter ihm stürzten seine Verfolger, die Papisten, in das dunkle Wasser einer Wake. Der Fliehende kehrte zurück, um seine Häscher zu retten. Sie nahmen ihn erneut gefangen, und ungeachtet seines Edelmuts wurde er zum Scheiterhaufen verurteilt. Diesen bestieg er an einem Tag, an dem ein derart starker Nordostwind blies, dass die Flammen zur Seite geweht wurden und der Mann – seine Schmerzensschreie waren noch auf Schloss Loevestein zu hören – langsam in seiner eigenen Asche versank. Herr Mollema erzählte über Arminius und Gomarus, über die Ermordung der Brüder de Wit, über das strenge, kränkliche, stille Bürschchen, das später Wilhelm III. werden sollte; doch am meisten fesselten ihn die Ketzerverbrennungen, was, im Nachhinein betrachtet, so unheilverkündend prophetisch erscheint. Andries Mollema ist bei einem Hotelbrand ums Leben gekommen.
Und nicht nur mit den Bränden in der Vergangenheit beschäftigte er sich fortwährend, nein, auch Brände in der Zukunft faszinierten ihn. Regelmäßig entwarf er nachmittags, kurz vor Ende der Schule, folgendes Szenario: »Tja, liebe Kinder, wenn die Atombombe fällt, wird Maassluis bis auf das letzte Haus niederbrennen. Und Maasland auch. Wenn ihr dann auf Rozenburg seid, werdet ihr ein einziges riesiges Feuer sehen, das von Dirkzwager bis jenseits des Wasserturms reicht. Alle Einwohner von Maassluis werden dabei umkommen. Und wenn die Wasserstoffbombe fällt, und die fällt auf Den Haag, weil dort der Regierungssitz ist, dann brennt alles zwischen Haarlem, Amsterdam, Gouda, Rotterdam und Hoek van Holland ab. Wenn ihr bei einer Wasserstoffbombe auf Rozenburg steht, werdet ihr ein unglaubliches Flammenmeer sehen, ihr werdet Explosionen hören, und die großen Öltanks bei Pernis werden in die Luft fliegen, ja, gewaltige Feuersäulen werden in den Himmel steigen, aber all das ist nicht das Schlimmste. Oh nein, am schlimmsten wird es sein« (an dieser Stelle stand er immer von seinem Stuhl auf, ging zwischen den Tischen hindurch und blieb vor meiner Bank stehen), »am schlimmsten wird es sein, wenn die Kobaltbombe fällt.« Seine Stimme verebbte zu einem heiseren Flüstern, und wir, atemlos lauschend, hörten ihn dann wispern: »Dann bricht die Welt in zwei Teile. Und wenn ihr dann auf Rozenburg seid, werdet ihr plötzlich das Wasser aus dem Nieuwe Waterweg fortfließen sehen, ein großer Riss wird sich auftun, der immer breiter und tiefer werden wird, bis die Erde aus zwei losen Hälften besteht, und diese Hälften werden hinab ins Weltall stürzen.«
Meistens läutete Direktor Cordia gleich danach die Schulglocke, sodass es den Anschein hatte, als wäre die Dramaturgie der Unterrichtsstunde genau getimed. Wenn ich später nach Hause rannte, dachte ich immer: »Hoffentlich warten sie noch kurz mit der Kobaltbombe. Was, wenn der Riss genau durch unsere Straße geht und mein Vater und meine Mutter auf der einen Seite stehen und ich auf der anderen?« Höre oder lese ich heute etwas über Atombomben, so ist immer mein erster Gedanke: »Wie schade für Herrn Mollema, dass er niemals wirklich ein so gewaltiges Feuer hat sehen dürfen.«
Während der langen Sommerferien vermisste ich ihn schmerzlich. Oft ging ich an stillen Sommerabenden gleich nach dem Essen aus dem Haus und begab mich zum Hintereingang des Möbelgeschäfts, über dem er sein Zimmer hatte. Meist musste ich nicht lange warten. In der blinden Mauer, die den Garten umgab, öffnete sich langsam eine unscheinbare Pforte, und dort erschien Herr Mollema. Wenn ich ihm vorsichtig folgte, schaute er sich nicht einmal um. Zunächst spazierte er, scheinbar ziellos, durch Maassluis, doch ich hatte schon bald, fast wie mit der Intuition des eifersüchtigen Liebhabers, erkannt, was der Sinn des Ganzen war. Er hoffte, der Nachfolgerin von Fräulein van der Meulen zu begegnen. Das war eine erstaunlich schöne, sehr blasse, fast durchscheinende junge Frau mit kupferfarbenem Haar, die etwas Zerbrechliches, etwas Porzellanhaftes hatte und tatsächlich, nicht lange nachdem Herr Mollema weggezogen war, genau vor der Mühle Den Hoop vom Fahrrad fiel und so viel Blut spuckte, dass nicht mehr genug übrig blieb, um ihr Herz schlagen zu lassen.
Ende der Leseprobe