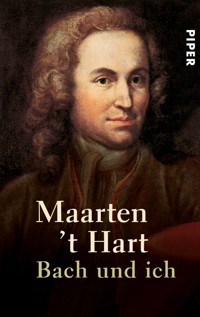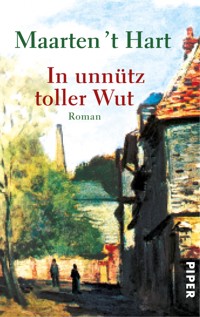9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In »Unter dem Deich« erinnert sich Maarten 't Hart an sein Maassluis der 50er Jahre, an ein Kindheitsparadies, wie es nicht mehr lange existieren würde: Die alten Häuser unter dem Deich sollen abgerissen werden, viele Menschen drohen ihr Zuhause zu verlieren. In diesem Viertel wohnt auch die begabte junge Clazien, die aus ärmlichen Verhältnissen stammt und keine höhere Schule besuchen kann. Als Aushilfe in einem kleinen Lebensmittelladen lernt sie den stillen Piet Hummelmann kennen und beschließt, bei ihm zu bleiben. Die beiden heiraten, doch Claziens Sehnsucht nach gesellschaftlichem Aufstieg lässt sich nicht für immer unterdrücken. Als sie Jan begegnet, einem Lehrer, der neu in die Stadt kommt, sieht sie in ihm einen Geliebten und Seelenverwandten. Sie verlässt Piet und glaubt, es endlich geschafft zu haben. »Unter dem Deich«, der in den Niederlanden erstmals 1988 erschien und dort neu aufgelegt große Aufmerksamkeit genießt, entführt uns in eine längst ungegangene Welt und erzählt die tragische Geschichte der amourösen Irrungen und Wirrungen einer rastlosen Frau.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Niederländischen von Gregor Seferens
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2013
ISBN 978-3-492-96182-0
© 1988 Maarten ’t Hart
Deutschsprachige Ausgabe:
© 2013 Piper Verlag GmbH, München
Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München
Umschlagmotiv: Monet/Carmen Thyssen-Bornemisza Collection – Museo Thyssen-Bornemisza/Scala, Florence
Datenkonvertierung E-Book: Kösel, Krugzell
Topografischer Prolog
Lassen Sie uns ein Paradies besuchen. Wir gelangen über einen Grünstreifen hinein, der doppelt so breit wirkt wie der Weg, an dem er entlangführt. Wir weichen dem Klatschmohn aus, den goldgelben Löwenmäulchen und dem Raps. Der betörende Duft der letzten Pflanze begleitet uns auf unserem Weg. In der Ferne, dort, wo der Weg zum Deich ansteigt, erblicken wir die schlanke Gestalt der Galeriekornmühle De Hoop. Schräg dahinter erstreckt sich ein Viertel, das namenlos geblieben ist. Es besteht aus vier Straßen und zwei Querstraßen, die unmerklich in eine Grünfläche übergehen, die Julianapark genannt wird, obwohl sich dort nicht mal ein Pferd umdrehen kann. Hinter dem Park versteckt liegt der 1887 angelegte Städtische Friedhof, auf dem pro Woche durchschnittlich anderthalb Beerdigungen stattfinden. Es ist der einzige dicht belaubte Ort in der Stadt, weshalb sich die gesamte Vogelpopulation dort niedergelassen hat. In jedem Frühling übertrifft die Zahl der Geburten die Zahl der Todesfälle bei Weitem. Den ganzen Tag lang ertönt das Gurren der Ringeltauben, und im hohen Schilf, das den Graben zwischen Friedhof und Bahnlinie vollständig den Blicken entzieht, erklingen der schrille Ruf des kleinen Schilfrohrsängers und das Murmeln des Teichrohrsängers.
Ungeachtet der Tatsache, dass der Julianapark mit seinem verwitterten, auf einer kleinen Säule ruhenden Blumenkasten im Grunde nicht mehr ist als ein paar Grasstreifen mit ein paar Bänken, verfügt die Stadt doch über einen Grünflächendienst. Dieser wiederum besteht aus zwei Männern in von der Gemeinde gestellten braunen Cordanzügen, die beide Onderwater heißen. Im Volksmund werden sie die Brüder Onderwater genannt, obwohl sie nicht miteinander verwandt sind. Über den jüngeren Onderwater wird berichtet, sein Vater habe ihm an seinem Hochzeitstag den Rat gegeben: »Schlafe nie morgens mit deiner Frau, im Laufe des Tages kann dir immer noch etwas Besseres begegnen.«
Weil die beiden Onderwater sich den Park höchstens einmal im Monat vornehmen müssen, verbringen sie im Sommer ihre Zeit damit, die steile Böschung des hohen Seedeichs zu mähen, der die Stadt in zwei Teile trennt: einen außerhalb und einen innerhalb des Deichs. Beide benutzen zum Mähen eine Sense, und sie stehen den ganzen Tag mit den Füßen schräg am Hang, sodass sie sich anschließend, wenn sie ganz normal über die Straße gehen, weit nach hinten lehnen. Der ältere Onderwater schleift seine Sense auffallend oft und singt dabei das folgende Lied:
»Die Sense wetzen,
da darf man nicht hetzen.
Man wird dadurch fit
und verbessert den Schnitt.«
Manchmal fügt der jüngere Onderwater noch eine Strophe hinzu:
»Die Hand fest am Schaft
mäh’n wir mit wenig Kraft.
Und bei gemächlichem Schwung
fühl’n wir uns abends noch jung.«
An schönen Sommertagen folgt dann gelegentlich noch ein zweistimmig gesungener Refrain:
»Ja, wir mähen den Deich,
unten arm, oben reich.«
Zweimal pro Jahr haben die beiden Onderwater den Auftrag, auch das Gras am Graben entlang der Gleise zu mähen. Jenseits des Grabens donnert einmal am Tag der Rheingold-Express vorbei. Am Bahnhof, der auch als Wohnhaus dient, halten pro Stunde vier Züge. Die Fahrgäste rennen hier nicht, um den Zug noch zu kriegen, sondern sie laufen los, sobald sie aus dem Zug ausgestiegen sind. Sie versuchen, den Bahnhof zu verlassen und die Gleise zu überqueren, bevor der Zug zwischen den heruntergelassenen Schlagbäumen hindurch in Richtung Westen weiterfährt. Meistens schaffen es nur die Allerschnellsten, auf die Stadtseite zu gelangen, ehe die Schranke sich schließt. Immer wieder kommt es vor, dass Evangelisten auf die ankommenden Züge warten, um den Aussteigenden die Zeitschrift Die frohe Botschaft in die Hand zu drücken. Wer nach dem Verlassen des Zuges sofort losrennt, hat umgehend einen trabenden Glaubensverkünder an seiner Seite, der ihm im Dauerlauf Die frohe Botschaft überreicht. Die Reisenden, die zu langsam sind und sich folglich vor der geschlossenen Schranke versammeln, erhalten dort ihr Exemplar der Frohen Botschaft ausgehändigt, und meistens ist vor den rot-weiß gestreiften Schlagbäumen dann auch noch Zeit für einen kurzen Vortrag des Missionars. Noch ehe man die Stadt erreicht, ist man schon bekehrt worden.
Hinter dem Bahnhof erstreckt sich das Firmengelände von Key & Kramer. Von dort werden Röhren in alle Teile der Erde verschickt. Bevor das geschieht, müssen die Röhren geteert und pyramidenförmig aufgestapelt werden. Diese Röhrenpyramiden bilden an der Ostseite von Key & Kramer die Grenze zur Müllverbrennungsanlage, die schlauerweise hinter dem strengen Dieselpumpwerk versteckt worden ist. An diesem Pumpwerk vorbei verläuft ein im Zickzackmuster gepflasterter Weg über den breiten Deich. Da aller Sand zwischen den Steinen weggeschwemmt worden ist, ertönt ein lautes Holpern und Klappern, wenn ein Fahrrad die Stadt verlässt. Im Chor rufen die Klinker: »Geh nicht weg, verlasse nicht die Stadt, woanders herrscht nur Elend.«
Auf der Südseite wird das Firmengelände von der Scheur begrenzt, einem kleinen Fluss, der in der Stadt einfach nur Maas genannt wird, während sich auf der Westseite ein Viertel anschließt, das Hoofd heißt und in dem Wasserheizer de Vries seine Kunden empfängt. Insgesamt umfasst das Hoofd zehn nach lokalen Widerstandskämpfern aus der französischen Zeit und nach Helden aus den Burenkriegen benannte Straßen. Da aber vier der zehn Straßen nur die Verlängerung anderer Straßen sind, gibt es eigentlich nur acht. Geht man näher heran, entpuppt sich ein massives Bauwerk mit echten Zinnen als Wasserturm, und dahinter, auf der Grenze zwischen dem Hoofd und der Scheur, liegt das dreieckige Schwimmbad, das durch einen Basalthang von der Maas abgetrennt wird und durch eine Rohrleitung sein Badewasser kurzerhand aus dieser bezieht.
Im Sommer ist das Schwimmbad bereits um sechs Uhr am Morgen geöffnet. Dabei gilt zu beachten, dass an dem einen Tag die Jungen von sechs bis acht schwimmen dürfen und am nächsten Tag die Mädchen, wobei anschließend von acht bis zehn dann das jeweils andere Geschlecht im brackigen Wasser Brustschwimmen oder Schmetterling übt. Von zehn bis zwölf steht Schulschwimmen auf dem Programm. Von zwölf bis drei ist das Schwimmbad geschlossen. Dann kommen die beliebtesten Zeiten: von drei bis halb fünf, von halb fünf bis sechs und von sechs bis halb acht. Und immer wechseln die Geschlechter einander ab. Von halb acht bis neun ist es dann meist recht ruhig.
Das Schwimmbad verfügt über sechzig Kabinen. Gibt es mehr als sechzig Schwimmer, müssen sich die Übriggebliebenen hinten auf dem dreieckigen Rasen umziehen. Weil jeder eine Kabine haben möchte, drängeln sich bereits eine halbe Stunde vor dem Geschlechterwechsel Dutzende Jungen oder Mädchen vor dem Eingang. Sobald die Tür sich öffnet, stürmt die Menge hinein. Bademeister Jacobs wird rücksichtslos über den Haufen gerannt, und innerhalb von einer Minute sind alle Kabinen besetzt. Gute Freunde oder Freundinnen gehen zusammen in eine Kabine. Selbst Senioren sagen von einem Bekannten nicht: »Das ist mein Freund«, sondern: »Ich durfte früher zu ihm in die Kabine.«
In den Kabinen betrachten Elfjährige die Geschlechtsorgane des anderen und entdecken so die erstaunliche Formenvielfalt von Kinderpimmeln. Es gibt gerade nach vorn zeigende schmale Stöckchen, kommaförmige Anhängsel, Schrumpelpimmel, die sich in der Falte zwischen den Hoden verstecken – alles scheint möglich zu sein. In den sechzig Kabinen werden Freundschaften fürs Leben geschlossen. Mancher ist so glücklich über seine Kabine, dass er anderthalb Stunden darin hocken bleibt.
Am Tag des Herrn ist das Schwimmbad geschlossen. Schon seit Jahren bemüht sich der sozialdemokratische Ratsherr Smit darum, dass Schwimmbad auch sonntags zu öffnen. Regelmäßig veröffentlicht er in der Lokalzeitung De Schakel ein Umfrageformular. Jedes Mal, wenn die Zeitung ein solches Formular abdruckt, steigen dreitausend Reformierte die Deichtreppen hinauf, werfen ihr Formular mit NEIN in den Briefkasten des Ratsherrn, und das Schwimmbad bleibt am Sonntag weiter geschlossen.
Schräg vor dem Schwimmbad liegen auf acht unterschiedlichen Höhen die acht Anlegestellen der Fähre. Ob Ebbe oder Flut, die Fähre kann immer anlegen. Soweit man weiß, besteht hier seit 1365 die Möglichkeit, den Fluss zu überqueren, und das, obwohl 1365 weder von der Stadt noch von der gegenüberliegenden Insel etwas zu sehen war! Von einer Stadt konnte man selbst im Jahr 1498 noch kaum sprechen. Dennoch kamen in ebendiesem Jahr zehn Boote und vier Tjalken den Fluss herab, aus denen dreihundert Mann hier an Land gingen, um zu plündern.
Das Hoofd wird durch den Hafen und die Bahnlinie abgegrenzt, die miteinander einen rechten Winkel bilden. Auf der anderen Seite des Hafens liegt das Schanshoofd, kein Viertel, sondern ein Reihenbau entlang des Wassers. Hinter dem Reihenbau erstreckt sich die Maaskant, ein Gebiet voller Schilf und Ranken. Der Begriff Maaskant hat in der Stadt eine merkwürdige Nebenbedeutung bekommen. »Mit dir würd ich gerne zur Maaskant gehen« bedeutet: »Ich finde dich nett.« Und: »Sie gehen zusammen zur Maaskant« heißt: »Die beiden sind ein Paar.« Was anderswo eine »Stichprobe« genannt wird, nennt man hier ein »Maaskantje«, was gemeinhin mit »Kantje« abgekürzt wird, und das Resultat von so einem Maaskantje wird »Kantertje« genannt. Wie die normalen Kinder auch werden die Kantertjes beim Standesamt in der Roten Villa angemeldet, die nicht weit vom Bahnübergang des Schanshoofds entfernt liegt.
Beim Schanshoofd liegt ein Motorboot von Dirkzwagers Schiffsagentur im Hafen, das ausläuft, wenn ein großes Schiff vorbeikommt. Von den Ozeanriesen werden Flaschen oder Köcher mit Angaben über Schiff und Zielhafen in das längsseits fahrende Boot hinuntergelassen. Offenbar ist das Abholen dieser Informationen ein so lukratives Geschäft, dass Dirkzwager in den Fünfzigerjahren gleich neben dem Schanshoofd ein beeindruckendes, aus beigefarbenen Steinen gebautes, halbrundes Büro errichten lassen konnte. Ob dies wohl das Gebäude ist, von dem K. Norel in seinem Buch Auf großer Fahrt sagt: »Der Pfefferstreuer ist weiß im hellen Licht«?
Zwischen den Gleisen und dem Deich liegen, abgesehen von dem Viertel neben dem Friedhof, das wir schon früher besucht haben, noch zwei Viertel und eine Insel. Von der Mühle De Hoop aus erstreckt sich bis zum Hafen ein Wohngebiet, das aus einer Hauptstraße, der Fenacoliuslaan, und sieben kurzen Nebenstraßen besteht, die alle am Gelände der Kistenfabrik De Neef & Co. enden. Der schrille, durchdringende Pfiff der mit Dampf angeblasenen Fabrikspfeife sorgt dafür, dass alle Bewohner der Stadt um sieben Uhr morgens senkrecht aus den Betten hochschrecken. Sobald der Pfiff verklungen ist, sind alle hellwach. Auch der Beginn und das Ende der Mittagspause wird durch die Pfeife markiert.
Rings um das Fabrikgelände von De Neef & Co. verläuft ein Wassergraben, der unglaubliche Reichtümer birgt. Wenn man seinen Kescher nur ganz beiläufig durchs Wasser zieht, fängt man sofort etwa zwanzig kleine Teichmolche, zwei Wasserskorpione, eine Wassernadel, Dutzende Süßwassergarnelen, Wasserspinnen, Eintagsfliegen, Wasserasseln, zwei oder drei Larven des Gelbrandkäfers, einen ausgewachsenen Gelbrandkäfer, einen Großen Kolbenwasserkäfer (aufpassen, der beißt) und unzählige wimmelnde Rückenschwimmer.
Zwischen der Fenacoliuslaan und dem Hafen liegen der Wijde Slop und die Taanstraat, die beide über Schlitze im Pflaster verfügen, in die bei Hochwasser Flutplanken gesteckt werden können. Und parallel zur Fenacoliuslaan verläuft noch der Zandpad, der durch den Zure Vissteg mit dem Hafen verbunden ist. Auch diese Gasse kann durch Flutplanken gesichert werden.
Auf der anderen Seite des Hafens liegt hinter den Lagerhäusern ein Viertel, das Stort genannt wird. Dabei handelt es sich um einen ehemaligen Polder, den man zugeschüttet und anschließend bebaut hat. Zwischen dem Stort, dem Deich und dem Hafen liegt eine Insel, die Schans heißt. Von 1629 bis 1639 wurde auf Schans die Grote Kerk errichtet, an die 1649 noch ein Turm angebaut wurde. Die Insel wird daher auch Kerkeiland genannt. 1732 wurde die Kirche mit der nicht genug zu bewundernden Garrels-Orgel ausgestattet, ein Ereignis, das merkwürdigerweise, obwohl die Stadt nie einen Autor oder Dichter von Bedeutung hervorgebracht hat, eine kurzfristige literarische Explosion nach sich zog. Pieter Schim dichtete »Die Orgel mit Davids Harfe vermählt«, und auch seine beiden Söhne, Hendrik und Jacob Schim, veröffentlichten Gedichte, die in dem Band Gesänge anlässlich der Einweihung der Maassluiser Orgel zu finden sind. Das Instrument inspirierte auch den Dichter Rijkje Bubbezon zu einem Vers.
Am 1. Januar des Jahres 1835 erschien Huiberdina Quack ein Engel und teilte ihr mit, dass die Orgel am großen und erlauchten Tag der Wiederkunft nicht durch das Feuer vernichtet, sondern Pfeife für Pfeife, in Stroh verpackt und von Engelflügeln in den Himmel gebracht werden würde. Dort werde sie vorerst eingelagert, um später in einer Replik der Grote Kerk auf der Neuen Erde wieder aufgebaut zu werden. Und in dieser Kirche dürften dann die Organisten, kraft ihres Amtes allesamt in die Ewigkeit eingegangen, abwechselnd spielen, in Anbetracht der großen Anzahl von Kandidaten allerdings lediglich alle zweitausend Jahre einmal.
In der Nähe der Schans befindet sich die Mündung des Noordvliet, die durch ein Siel vom Hafenbecken getrennt ist. Hier scheint der Ursprung der Stadt zu liegen. Dieses Siel, die Monsterse Sluis, wird 1367 in einem Brief erwähnt, aus dem hervorgeht, dass bereits vor diesem Zeitpunkt das bei der Trockenlegung des Dorfes Maasland anfallende Wasser an dieser Stelle in die Maas geleitet wurde. Zwei Hütten aus Lehm und Schilf, in denen die Sielwärter wohnten, haben angeblich die erste Bebauung des Ortes gebildet. Zwei Jahrhunderte später ging dort, davon sind alle Einwohner überzeugt, Jan Koppelstock in seinem Haus ein und aus. Das Haus steht heute noch, obwohl Koppelstock allem Anschein nach in Den Briel gewohnt hat. Er war derjenige, der um 1572 zwischen Den Briel und der damals noch nicht existierenden Stadt einen Fährdienst betrieb. So wurde an jenem denkwürdigen Dienstag, dem 1. April, als mit der Eroberung von Den Briel der Aufstand gegen die Spanier begann, eine entstehende Stadt aus der Anonymität geholt und für kurze Zeit mit dem großen Weltgeschehen in Verbindung gebracht.
An der Monsterse Sluis landete 1597 ein Schiff. »Am 29. Oktober gelangten wir mit ostnordöstlichem Wind in die Maas und gingen dort in der Nähe der Maaslandschleuse an Land.« Es liegt nahe, dass die Seeleute ihr Schiff an den Anlegestellen festgemacht haben, die damals aus dem Deich ragten. Und dann? Hat der Sielwärter sie an Land gehen sehen? Oder haben die Männer, die den Winter im Nordpolarmeer auf der Insel Nowaja Semlja überlebt hatten, unbemerkt ihren Fuß an Land setzen können, nachdem sie am 14. Juni desselben Jahres in zwei offenen Booten in See gestochen waren?
Der Seedeich, an dem das Schiff damals vertäut wurde, teilt die Stadt in einen höher und einen niedriger gelegenen Teil. Der tiefer gelegene Teil, innerhalb des Deichs, beherbergte früher in dem Gebiet um die Vliete herum diejenigen, die man die »kleinen Leute« nannte und später die »Unterprivilegierten« nennen sollte. Die besser Situierten – man denke dabei nicht an reiche Leute, die gibt es dort nicht – wohnen in dieser Stadt vier Meter höher als die Armen. So ist der Standesunterschied sehr genau messbar. Natürlich hat sich der ein oder andere Reiche »unter dem Deich« niedergelassen, und umgekehrt wohnen im Hoofd und im Stort viele Unterprivilegierte, aber allein schon die Tatsache, dass man »über dem Deich« wohnt, verschafft einem einen Vorsprung, hebt einen vier Meter über die anderen Bewohner empor.
An einigen Stellen kann man mithilfe einer Treppe auf den Deich steigen. Zu beiden Seiten der Monsterse Sluis verläuft die älteste Treppe der Stadt, die Steenen Trappen aus dem Jahr 1732. Sie wird auch Breede Trappen genannt, obwohl ihre Stufen gar nicht breit und eher für kleine Füße berechnet sind.
Drei andere Deichaufgänge tragen die Namen Wedde, Afrol und Wip. Anders als Wedde und Afrol, die parallel zum Deich hinaufführen, ist die Wip im Neunzig-Grad-Winkel zum Deich angelegt. Sie ist dadurch steiler als die beiden anderen Treppen. Im Träumen und Denken der Sluiser – wie sich die Bewohner der Stadt selbst nennen – spielt die Wip eine wichtige Rolle. Wenn ein Sluiser stirbt, hört man die Leute zueinander sagen: »Hast du schon gehört? Lagrauw ist tot.«
»Mensch, wie ist es möglich! Vorigen Samstag habe ich ihn noch auf der Wip Richtung Seemannshaus gehen sehen.«
Oder sie sagen: »Van Vuuren ist ziemlich krank, wie man hört.«
»So was, erst gestern ist er die Wip hochgeflitzt.«
Wenn man sich in der Stadt begegnet, dann geschieht dies grundsätzlich auf der Wip. Es muss nicht wirklich dort passieren, doch einfachheitshalber verlegt man jede Begegnung, wenn man später von ihr erzählt, auf die Wip. Wenn man wissen will, ob man von einer Krankheit vollkommen genesen ist, dann schaut man, ob man die Wip wieder hochrennen kann. Die Wip ist lange Zeit der erste und einzige Weg gewesen, der elektrisch beleuchtet wurde. Oben an der Wip, dort, wo das Rathaus steht, beginnt Leen van Buren seinen Gang durch die Stadt, wenn er als Ausrufer eine Nachricht der Gemeindeverwaltung verkündet. Dort auf der Wip wird später einmal Heleentje Lub von einem Lastwagen der Vereinigten Seilfabriken überfahren werden. Sie wird unverletzt bleiben, obwohl die Reifenspuren noch monatelang auf ihrem Gesicht zu sehen sind.
Auf der Wip lassen die Gäule von Gemüsehändlern, Milchhändlern, Scherenschleifern und Petroleumhändlern aus Angst vor dem steilen Abhang ihre Pferdeäpfel fallen. Deshalb leben auf den Dächern der umliegenden Häuser konkurrierende Spatzenpopulationen. Hinaufgehende Pferde schaffen es manchmal nicht bis oben, hinabgehende Pferde werden auf der Wip des Öfteren kopfscheu, und ebendiese Wip, das eigentliche Zentrum der Stadt, wird sich später als uneinnehmbare Barriere für diejenigen Händler erweisen, die sich den Luxus eines kleinen einachsigen Schleppers geleistet haben.
Neben der Wip liegt die Mündung des Zuidvliet, die Wateringersluis. Noordvliet und Zuidvliet verlaufen parallel zueinander in nordöstlicher Richtung. Wer oben auf der Wip oder den Steenen Trappen steht, kann die Vliete bis zum Horizont sehen. Von beiden Stellen aus erblickt man einen langen geraden Wasserstreifen, der zuerst von Häuserreihen gesäumt und von zwei Brücken überspannt wird. Weiter weg fehlen die Häuser, weshalb der Wasserstreifen dort viel mehr Licht fängt. Tatsächlich wirkt der vom grünen Polderland umgebene helle Wasserstreifen näher am Betrachter als der dunkle Teil zwischen den Häusern. Gleichzeitig sieht es so aus, als steige der Streifen in Richtung Himmel, und das verschafft dem Auge und der Seele ein Gefühl des Friedens und der Geborgenheit. Es gibt auf der ganzen Welt kaum einen schöneren Anblick. Trotzdem hat die Gemeindeverwaltung beschlossen, das ganze Viertel unterhalb des Deichs rund um die Vliete zu sanieren.
Das Paradies
Das Sanierungsgebiet
Wir wohnten unter dem Deich, doch wir wussten nicht, dass man uns schon von der Landkarte gestrichen hatte. Wir liebten unser verfallenes Viertel. Ich fand, kein Viertel konnte sich messen mit unserem Zuhause rund um die Vliete. Obwohl es weder Gärten noch Blumen gab, hießen die Straßen hier Tuinstraat oder Bloemhof. Und mehr noch, sie hatten außerdem Beinamen, etwas, das es, soweit ich wusste, in keiner anderen Stadt gab. Nie hatte ich in einem Buch von Straßen gelesen, die Beinamen gehabt hätten. »Vielleicht«, dachte ich als etwa achtjähriger Junge stolz, »gibt es auf der ganzen Welt nur eine Stadt, in der die Straßen Beinamen haben, und das ist die Stadt, in der ich geboren bin.« Dies ging mir durch den Sinn, wenn ich durch die Hoekerdwarsstraat stiefelte, die von allen nur Stronikaadje genannt wurde. Es fiel mir wieder ein, wenn ich in der Lijnstraat zum Friseur ging; die Lijnstraat war so lang gestreckt, dass sie unter dem Namen Langestraat firmierte, und dass, obwohl auch die Bewohner der Sandelijnstraat behaupteten, ihre Straße heiße Langestraat. Beide Straßen mündeten in die St. Aagtenstraat, die aber niemand so nannte. Diese Gasse mit ihren fensterlosen Mauern hieß ’t Peerd z’n Bek, dem Pferd sein Maul. Und allein dieser Beiname sorgte dafür, dass ich anschließend in gestrecktem Galopp über das Kopfsteinpflaster der Straße rannte. Auf diese Weise war ich nie lange genug dort, um mich zu fürchten. »Vielleicht«, überlegte ich, »heißt die St. Aagtenstraat ja ’t Peerd z’n Bek, weil dort gleich um die Ecke die katholische Kirche ist.« Die katholische Kirche war, das wusste ich, aufgrund einer Verordnung aus dem Jahr 1787 außerhalb des bebauten Gebiets errichtet worden. Die Kirche durfte nicht wie eine Kirche aussehen, und sie durfte auch keine direkte Verbindung zu den öffentlichen Wegen haben. Deshalb lag sie, jenseits einer freien Fläche und hinter einigen hohen Gebäuden versteckt, auf der Grenze zum Nachbarort Maasland. Das hatte mir der Vater eines Klassenkameraden erzählt, der bei sich im Wohnzimmer einen Stadtplan an der Wand hängen hatte. Auf diesem Plan waren mit Fähnchen die Häuser der zweihundertvierzig katholischen Familien markiert, die es in der Stadt gab.
»Wenn Notzeiten kommen«, sagte er, »und wenn der Herzog von Alba das Land wieder bedroht, weiß ich, wo sie wohnen, und wir können sie umgehend aus der Stadt vertreiben.« Dann schwieg er einen Moment und sagte: »Zurzeit verhalten sie sich ruhig, aber wenn sich ihnen die Gelegenheit bietet, sind wir alle dran. In ihren Hintergärten sammeln sie schon das Bruchholz für neue Scheiterhaufen.«
Und wenn er ausgesprochen hatte, schaute er zu seiner Frau und fragte: »Und weißt du, wer Vorsitzender des Blutrats wird?«
»Jan de Quay«, erwiderte seine Frau.
Da ich Willem Wijcherts von Willem Gerrit van de Hulst gelesen hatte und Schele Ebbe kannte, der in diesem Buch mit den Spaniern gemeinsame Sache machte, wusste ich, wozu Katholiken fähig waren. Ich verstand nicht, weshalb man sie nicht gleich alle umbrachte. Ich wagte mich selten in die Nähe der katholischen Kirche, obwohl der Pfad entlang des Vliet, mit der Wippersmühle in der Ferne, zu einem Gang zur Auktion in Maasland regelrecht einlud. In der Nähe der St. Aagtenstraat hatte ich mich einmal mit Jan Zwaard unterhalten, der katholisch war.
»Wenn wir wieder Oberwasser haben, kommen alle Protestanten auf den Scheiterhaufen«, sagte Jan.
»Ich auch?«, fragte ich ihn.
»Ich werde ein gutes Wort beim Herrn Pastor für dich einlegen«, sagte er. »Ich werde ihn bitten, dich zu enthaupten, bevor du verbrannt wirst.«
»Nein, nicht«, sagte ich.
»Dann werde ich darum bitten, dass man dich mit Schießpulver füttert, ehe du auf den Scheiterhaufen kommst. Dann explodierst du, sobald das erste Streichholz angezündet wird, und musst so nicht leiden.«
Mit schwerem Herzen ging ich nach diesem Gespräch durch den Lijndraaierssteeg, der Baanslop genannt wurde, zur Schule. Später habe ich nachgesehen, ob das Haus der Familie Zwaard auf dem Plan im Wohnzimmer meines Klassenkameraden auch mit einem Fähnchen markiert war. Zum Glück war das der Fall, und ich atmete erleichtert auf.
Mit ebendiesem Klassenkameraden habe ich den Plan dann vorsichtig von der Wand genommen und mithilfe von zwei Fäden ermittelt, wo sich der Mittelpunkt unserer Stadt befindet. Was ich immer schon vermutet hatte, erwies sich als richtig. Das Pumpwerk – und Stolz erfüllte mein Herz –, in dessen Nähe ich wohnte, lag auf dem Schnittpunkt der beiden Fäden, die wir über den Plan gespannt hatten.
Als ich wieder zu Hause war, schlug ich im Schulatlas die Karte von Südholland auf. Aber die Silhouette von Südholland – die eher so aussieht wie ein Mann mit einer großen Nase, der bei Woerden die Faust ballt und in einem Ruderboot mit einer große Welle kämpft (daher die Beule bei Vijfheerenlanden) – hatte so wenig Ähnlichkeit mit einem Viereck, dass man unmöglich den Mittelpunkt bestimmen konnte. Allein schon der Rucksack des Mannes im Ruderboot bei Hillegom und Lisse!
Auf Durchschlagpapier zeichnete ich die Niederlande ab. Ich zog eine Linie von Sluis zum Dollard und von Vaals zum Leuchtturm auf Terschellingerbank. Unsere Stadt lag nicht auf der Schnittlinie. Dann faltete ich meine Karte einmal der Länge nach und zog zwei Linien über die westliche Hälfte der Niederlande. Mein Herz pochte ergriffen: Unsere Stadt lag genau auf dem Schnittpunkt. Nun schlug ich im Atlas die Abbildung der Erde auf. Ich legte Durchschlagpapier auf Karte 4B und zog zwei Linien darüber. Nein, die Niederlande lagen nicht auf dem Schnittpunkt. Lange betrachtete ich die Karten 4B und 4C. Und plötzlich sah ich es: Wenn man jeweils eine Linie vom Äquator in die Ecke der Karte zog, dann lagen die Niederlande sehr wohl auf dem Schnittpunkt.
»Das Pumpwerk am Anfang unserer Straße«, so formulierte ich meine Entdeckung, »ist der Mittelpunkt der Stadt, und unsere Stadt ist der Mittelpunkt der einen Hälfte der Niederlande, und die Niederlande sind der Mittelpunkt der nördlichen Halbkugel.« Ich bedauerte zwar, dass die Niederlande nachweislich nicht der Mittelpunkt der Welt waren, doch unser Pumpwerk war in jedem Fall der Mittelpunkt der nördlichen Erdhalbkugel.
Daher waren wir auch vollkommen bestürzt, als mein Vater, der damals seit einiger Zeit bei der Gemeinde arbeitete, mit der Nachricht heimkam, er habe im Büro des Bauamtsleiters einen Standplan gesehen, auf dem unser ganzes Viertel unter dem Deich bereits durchgestrichen war.
»Wir werden saniert«, sagte mein Vater. »Bald fangen sie auf dem Damplein mit den Abrissarbeiten an.«
In der dunkelsten Zeit, um Weihnachten herum, hatte der Damplein, der gleich bei uns um die Ecke lag, etwas von einem Geisterreich. Ich liebte es, bei Nieselregen an der Ecke zu stehen und den für mein Gefühl riesigen Platz zu betrachten. Den Platz zu betreten traute ich mich nicht, denn in der angrenzenden Damstraat wohnte Piet Sluys, der gedroht hatte, mir ein Ohr abzureißen, und noch ein Stück weiter, dort, wo der Damplein in Viehweiden überging, wohnten zwei grobknöchige katholische Burschen, die schon aus der Ferne so bedrohlich wirkten, dass es nicht einmal mehr eines Scheiterhaufens bedurfte, um in Todesangst zu geraten.
Trotz all dieser Gefahren übte der Damplein eine große Anziehungskraft auf mich aus. Links an der Damstraat und auf der anderen Seite an einer fensterlosen Mauer brannten zwei Gaslaternen, und vor allem, wenn es neblig war, schien es, als sei das Gaslicht flüssig. Der ganze Platz löste sich in ein perlgraues, dunstiges Zwielicht auf, und alle Konturen verschwammen. Dann hatten nicht einmal die Schatten mehr klar umrissene Ränder. Die beiden Glaskugeln einer der beiden Gaslaternen dort gaben zischende Geräusche von sich, und wenn ich genug Mut gefasst hatte, um mich kurz darunterzustellen, kam es mir so vor, als spräche jemand in einer unverständlichen himmlischen Sprache zu mir. Nichts ist, wie ich heute weiß, schöner als ein in Gaslaternenlicht getauchtes Sanierungsgebiet bei Nieselregen. Der riesige Raum des Damplein mit den beiden Laternen, deren Schatten sich in der Mitte des Platzes überlappten, war abends fast wie das Totenreich selbst. Allein hätte ich mich nach dem Abendessen niemals dorthin gewagt, doch mit dem Mädchen von nebenan, Toos Koek, die sich niemals fürchtete, rannte ich manchmal blitzschnell über den Platz und kam erst in der Damstraat wieder zu Atem.
Der Damplein war ein fast quadratisches Viereck, in das vier Straßen mündeten und auf dem es, von unserer Straße aus gesehen, nur fensterlose Mauern gab. Links stand noch eine Häuserreihe, und auf der Ostseite fing ganz unvermittelt das Weideland an. Um die Sanierung unseres Viertels vorzubereiten, hatte man dort bereits ein neues Wohngebiet errichtet, mit einer idiotisch weißen Kirche des Niederländischen Protestantenbundes, in der – wie mein Vater immer sagte – die Gottheit Christi geleugnet wurde.
An einer der blinden Mauern stand ein grünes Verteilerhäuschen, auf dem, passend zum Charakter des Damplein, fürchterliche Drohungen angebracht waren. Auf der gegenüberliegenden Seite gab es zwei Geschäfte. Das eine war eine Metzgerei, wo das Fleisch – obwohl der Metzger unserer Kirche angehörte – weniger gut war als das des reformierten Metzgers in unserer Straße. In dem anderen Damplein-Laden wurde nur ein einziger Artikel verkauft: Schiffszwieback. Obwohl die Schiffe, die den Hafen verließen, dieses Produkt kistenweise einschlugen, konnte man auch für fünf Cent einen einzigen Schiffszwieback kaufen. Ein solcher Zwieback war erst genießbar, nachdem man ihn einen ganzen Nachmittag lang in kaltem Tee aufgeweicht hatte. Manchmal gab es unerfahrene Kinder, die vom Hoofd herüberkamen, einen Zwieback kauften und sofort hineinbissen. Die spuckten dann in der Regel anschließend ihr halbes Milchgebiss auf die Straße.
Im Haus Damplein Nummer 1 – es gab keine Nummer 3 oder 5, wohl aber ein paar gerade Hausnummern auf der anderen Seite – wohnte mein Großvater. In Anbetracht der Tatsache, dass er eine große Leidenschaft hatte, nämlich Dame zu spielen, fand ich es logisch, dass er dort wohnte. Die Welt war übersichtlich und gut geordnet. Schade nur, dass auch Piet Sluys dort um die Ecke wohnte. In ebendieser Straße wohnte auch mein Onkel Klaas, ebenfalls ein leidenschaftlicher Damespieler. Daher der Name – Damstraat.
Der Damplein war kein Platz, auf dem Menschen stehen blieben, um ein Schwätzchen zu halten. Man stellte dort kein Fahrrad ab. Man überquerte ihn einfach und verschwand in den angrenzenden Straßen. Darum wunderte es mich, als irgendwann im Jahr 1952 auf einmal ein Auto auf dem Platz anhielt. Ein Auto war damals noch etwas ganz Außergewöhnliches. Niemand sprach von einem Auto, sondern alle sagte nur »Luxusauto«. Normale Autos waren Lastwagen wie der Kohlenlaster von van Heyst. Dieses Luxusauto, in meinen Augen ein mögliches Vorzeichen der bevorstehenden Sanierung, war also eine unglaubliche Sehenswürdigkeit. In null Komma nichts drängelten sich Dutzende Jungen in meinem Alter um den Wagen, die den Mann, der daraus ausstieg, anstarrten, als wäre er der wiedergekehrte Christus. Noch heute sehe ich vor mir, wie er sich aus dem Wagen zwängt. Endlich steht er auf der Straße, er betrachtet die vielen Jungen und richtet dann plötzlich den ausgestreckten Zeigefinger auf mich und sagt: »Du wirst später auch einmal genug Geld haben, um ein Auto zu fahren.« Ich hatte kaum genug Zeit, die unglaubliche Bedeutung dieser Worte zu mir durchdringen zu lassen, da stürzte sich auch schon Piet Sluys auf mich und fing an, mein rechtes Ohr umzudrehen.
Einmal im Jahr, am Königinnentag, wurde der Platz in einen Ort verwandelt, an dem man sich tatsächlich eine Weile aufhalten konnte. Wiederholt habe ich an diesem Feiertag beim Sackhüpfen mitgemacht, ein Spiel, bei dem ich immer als Letzter loshüpfte und nie ins Ziel kam. Ein Aushilfsbäcker spielte, auf einem Anglerschemel sitzend, Akkordeon, und abends wurde gelegentlich ein Laternenzug veranstaltet, an dem wir wegen der Brandgefahr nie teilnehmen durften. Auch wenn ich hätte mitgehen dürfen, ich hätte niemals mit so einem brennenden Ding durch die Stadt gehen wollen. So eine Laterne hatte, wie ich fand, etwas Katholisches an sich.
Hatte man in der Damstraat einmal das Haus von Piet Sluys hinter sich gelassen, dann konnte man entweder zur Nassaustraat weitergehen oder in die Oranjestraat abbiegen. Entschied man sich nicht für eine dieser zwei eher hässlichen Straßen, dann stand man am Ende der Damstraat plötzlich vor einer Wand und musste wohl oder übel in die Emmastraat abbiegen. In der Emmastraat wohnte einer meiner Onkel. Mit seiner Familie hatten wir die Rotterdamer (»eine unterhaltsame Zeitung«) abonniert, die dort vor dem Abendessen in der Emmastraat ausgeliefert wurde, wo wir sie nach dem Abendessen dann abholen mussten. Das war meine Aufgabe. Weil ich mich wegen Piet Sluys nicht durch die Damstraat traute, lief ich unsere Straße entlang, bog in die Tuinstraat ein und kam zur Lijnstraat, von wo ich über die Lijndwarsstraat und die Landstraat – in die die Nassaustraat, die Oranjestraat und die Emmastraat mündeten – schließlich doch noch zum Haus meines Onkels gelangte. Unterwegs begegnete ich etlichen meist älteren und oft schon erwachsenen Schicksalsgenossen, die ebenfalls mit einer Zeitung durchs Viertel gingen. Unter dem Deich lasen manchmal drei oder vier Familien eine Zeitung. Mit all den Leuten, die gerade ihre Zeitung holten oder brachten, war daher auf den Straßen immer gut was los. Auch als ich etwas älter war und mich am Haus meines Widersachers vorübertraute, traf ich in den ansonsten stillen, gaslaternenbeleuchteten Straßen immer Burschen, die wie ich mit einer Zeitung in Richtung einer Wohnstube unterwegs waren, in der grundsätzlich mitten im Raum, über dem Esstisch, nur eine einzige Lampe brannte.
Lijnstraat, Sandelijnstraat und Hoekerdwarsstraat verliefen parallel zum Zuidvliet. Die Lijnstraat gehörte noch nicht wirklich zum total heruntergekommenen Gebiet, grenzte jedoch daran. Die Sandelijnstraat und die Hoekerwarsstraat waren das eigentliche Elendsviertel, und ich fand, dass diese beiden Straßen zuerst abgerissen und anschließend saniert werden sollen, zumal dort ein reformierter Kommunist wohnte. Zunächst wurde er in der Kirche toleriert. Nachdem aber die nordkoreanische Armee am Sonntag, den 25. Juni 1950, den 38. Breitengrad überschritten hatte, wurde er, nach vielen Ermahnungen, Schritt für Schritt aus der Gemeinde verbannt.
Als der Sanierungsplan immer mehr Form annahm, war die Sandelijnstraat die erste, in der man an jedem Haus die Fenster mit Brettern vernagelte, sobald die Bewohner ausgezogen waren, und über oder neben der Tür ein Schild anbrachte, auf dem folgende ominösen Worte standen: ›Für unbewohnbar erklärt.‹ Es dauerte nicht lange, da musste ein Haus nicht einmal leer stehen. Es reichte, wenn ein Dachziegel herunterflog, und schon erschien ein solches Schild. Im Laufe der Jahre wuchs die Zahl der für unbewohnbar erklärten und der ungeachtet dessen noch bewohnten Häuser. Man hätte meinen können, es handele sich um eine, zunächst auf die Gegend zwischen Sluyspolder und Zuidvliet beschränkte, ansteckende Krankheit, die dann später auch auf das Gebiet unter dem Deich, westlich vom Noordvliet, übersprang. Es hatte etwas Unheimliches, in einem derart verfluchten Viertel zu wohnen. Oft stellte ich mir vor, morgens aufzuwachen und zu entdecken, dass alle Häuser unter dem Deich mit einem solchen Schild versehen worden waren. Weil das ganze Viertel immer mehr verdammt zu sein schien, war man von einer zunehmenden Beklemmung erfüllt, man hatte das Gefühl, als würde man selbst bald weggebracht.
Trotzdem lebten die Menschen in all den von der Karte gestrichenen Straßen, Wegen und Gassen einfach weiter. Und in den winzigen Höfen der Häuser (Gärten gab es keine) florierte eine regelrechte Bioindustrie. Nicht umsonst hieß die Gegend um die Emmastraat »Kaninchenviertel«. Dort wurden in übereinandergestapelten Ställen Dutzende, manchmal sogar Hunderte von Kaninchen gehalten, und abends zogen die Leute dann zum Deichhang entlang dem Nieuwe Weg, um dort Gras oder noch besser Löwenzahn für ihre Belgischen Riesen, Lothringer oder Holländer zu schneiden, die zur Weihnachtszeit an die Außendeicher verkauft werden sollten.
In all den Jahren des Kalten Kriegs blieb der Beschluss, das gesamte Gebiet wegzusanieren, in Kraft, doch es passierte nichts. Wobei das Schicksal der in den für unbewohnbar erklärten Häusern aufwachsenden Kinder der Gemeindeverwaltung nicht vollkommen gleichgültig zu sein schien, denn einmal im Jahr wurden sie, vorausgesetzt, sie waren nicht älter als zehn, kostenlos zu einer Bootsfahrt eingeladen. Unsere Mütter brachten uns dann in die Veerstraat, wo wir in einen Prahm der Brüder van Baalen stiegen, mit dem sonst Sand transportiert wurde und in dessen Frachtraum niedrige Bänke standen, auf denen wir hin und her schaukelten. Da es keine Bullaugen gab, konnten wir nur den blauen Himmel über uns sehen, doch wir spürten, dass wir durch die Schilfgebiete fuhren, und eine Betreuerin, die an Deck saß, berichtete uns von den Schilfhalmen, Weiden und Reihern, die zu sehen waren.
Weil das Viertel sowieso von der Landkarte verschwinden würde, wurde es von der Gemeinde vernachlässigt. Während anderswo in der Stadt die Gasbeleuchtung durch elektrische Lampen ersetzt wurde, brannten unter dem Deich die Gaslaternen einfach weiter. Noch 1963 gab es in dem Viertel sechzehn Gaslaternen. Um diese anzünden und wieder löschen zu können, musste dreimal am Tag der Gasdruck im gesamten Leitungssystem für drei Minuten von zweiundzwanzig mbar auf vierundvierzig mbar erhöht werden. Hatte man während dieser Zeit den Gasherd an, dann konnte man beobachten, wie die Flammen unter den Töpfen plötzlich aufbrausten. Und dann dachte man immer: Noch etwas mehr Druck, und die Gemeinde jagt das komplette Viertel mit einem Schlag in die Luft. 1963 wurden Pläne gemacht, die Gaslaternen durch elektrische Lampen zu ersetzen. Und es war beinahe so, als wären diese Pläne ein Zeichen: Keine Gefahr, wir können endlich aufatmen, unser Viertel wird nicht abgerissen.
Warum wurde das Viertel in den Fünfzigerjahren nicht dem Erdboden gleichgemacht? Wartete die Gemeinde auf den Atomkrieg, der die Gegend schneller und sehr viel kostengünstiger niederreißen würde, als sie selbst es jemals bewerkstelligen könnte? Wir in unseren für unbewohnbar erklärten Häusern hatten jedenfalls nicht mehr sonderlich viel Angst vor der Atombombe. Was auch passieren würde, wir würden verschwinden. Krieg oder kein Krieg, wir waren so oder so gezeichnet. Mit dem Bleistift hatte man unsere Häuser auf der Karte bereits abgerissen. Unser Leben war nur ein Nachleben.
Die Tage
Im Sanierungsgebiet roch der Montag nach Waschblau, einem stark riechenden Zeug, das in allen Häusern beim Spülen der weißen Wäsche verwendet wurde. Waschblau roch, wie ich später herausfand, wie Sperma, und von dem Zeitpunkt an, als mir dies bewusst wurde, blieben mir nur zwei Jahre, in denen ich den Geruch sowohl von Waschblau als auch von Sperma überhaupt noch identfizieren konnte. Wenn irgendwann einmal der Augenblick kommt, in dem meine Nase, für kurze Zeit befreit von den mit zunehmendem Alter größer werdenden Einschränkungen, den Geruch von Sperma wieder wahrnehmen kann, dann wird für mich auch der Waschtag in seiner ganzen Glorie wieder lebendig werden. Manchmal kommt es mir so vor, als hätte sich im Laufe meines Lebens nichts so sehr verändert wie das Wäschewaschen. Als fünfjähriger Junge musste ich, und dies war ein Teil des Jochs, das jeder Mensch in seiner Kindheit zu tragen hatte, beim Wasserheizer unter dem Deich, im Bloemhof 1, zwei Eimer warmes Wasser holen. Um dort nicht anstehen zu müssen, trug man mir auf, schon vor sieben Uhr am Morgen hinzugehen. Weil ich nur einen Eimer tragen konnte, musste ich zweimal hin- und hergehen. Zum Glück war der Weg nicht lang. Allerdings kostete ein Eimer bei Wasserheizer Pieterse zwei Cent, während einer seiner Konkurrenten, der sein Bruchholz über eine angeheiratete Cousine der Kistenfabrik De Neef & Co. bezog, zwei Eimer für drei Cent verkaufte. Holte man aber das billigere Wasser, dann war es, wenn man zu Hause ankam, schon für einen Cent abgekühlt. Ob es wohl irgendwo auf der Welt noch so eine Wasserheizerei gibt, komplett vollgestapelt mit Waschmitteln und ausgerüstet mit einem riesigen, zentral stehenden zylinderförmigen Kessel? Wie gern würde ich dort warten, zwischen Hausfrauen in langärmeligen Kitteln, die am Montagmorgen schon vor sieben Uhr Krankheit, Unglück und Seitensprung ihrer Stadtgenossen besprechen. Es herrschte jedes Mal ein Höllenlärm, vor allem, wenn einem der Anwesenden ein Spritzer glühend heißen Wassers aus einem der zu wild hin und her schaukelnden Eimer traf. Ständig hörte man das Zischen des Dampfes, und der Dampf selbst nahm, jedes Mal wenn ein Eimer gefüllt wurde, alle in der Wasserheizerei hängenden Gerüche in sich auf, die man dann in konzentrierter Form in der Dampfwolke über dem Eimer mit auf den Heimweg nahm. Ohne zu kleckern, musste man den Eimer nach Hause tragen, was meist beim zweiten Gang besser gelang.
Als der große Tag kam, an dem ich alt genug war, um zwei Eimer gleichzeitig zu tragen, wurde die erste Waschmaschine unter dem Deich aufgestellt. Zuvor hatten dort alle Frauen in einem Bottich gewaschen, aus dem die Wäsche stückweise herausgeholt und auf einem Waschbrett eingeseift und geschrubbt werden musste.
Bevor allerdings die Waschmaschine wie ein Geschenk aus dem Kaufhaus des Himmels Einzug hielt, war die Schwerstarbeit meiner Mutter bereits durch einen Wringer erleichtert worden. Dass die Wäsche nicht mehr mit der Hand ausgewrungen werden musste, machte den Montag, seit Alters her der schlimmste Tag der Woche, etwas erträglicher. Dennoch blieb auch nach der Einführung des Wringers der Montag der einzige Wochentag, an dem meine Mutter keine Psalmen sang: Im Haus herrschte eine bedrückte, schicksalsergebene Stimmung. Waschtag!
Ende der Leseprobe