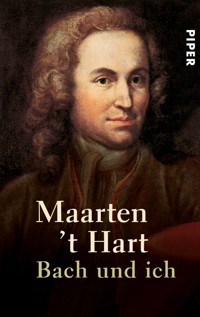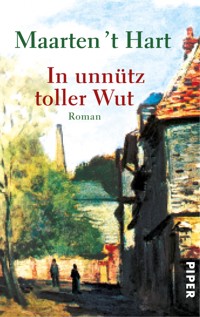9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als gewissenhafter protestantischer Grabmacher hat man es schwer: Erst soll man dieses lächerliche Kreuz aufstellen, dann wird man von den »Katholen« gebeten, 1000 Tote umzubetten, und obendrein bekommt man den bauernschlauen Ginus zur Seite gestellt, der sich nichts als Feinde macht. Ebenso schwierig aber ist es, der Sohn dieses höchst eigensinnigen Totengräbers zu sein – vor allem wenn man unerwidert in ein Mädchen aus der Nachbarschaft verliebt ist …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Niederländischen von Gregor Seferens
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
2. Auflage 2011
ISBN 978-3-492-95658-1
© Maarten 't Hart 1998 Titel der niederländischen Originalausgabe: »De vlieger«, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam 1998 Deutschsprachige Ausgabe: © Piper Verlag GmbH, München, 2008 Umschlaggestaltung: semper smile, München Umschlagfoto: Peter Griffith / Masterfile
1
Mein Vater war Totengräber. Sein Arbeitstag fing um halb acht an. Von halb eins bis halb zwei durfte er Pause machen. Er machte Feierabend, »wenn von der Turmuhr der erste der Fünf-Uhr-Schläge ertönt. Dann hör ich sofort auf. Als ob ich mich bis dahin nicht schon genug abgerackert hätte!«
Fünf Minuten später knallte er sein Fahrrad gegen das Fallrohr unserer Regenrinne. Er sang. »Ach Väterchen, ach Väterchen, kommst du wieder heim.« Nach der letzten Note hörten wir seine Holzschuhe über den Granitfußboden unseres Flurs poltern.
Meistens war ich um die Zeit mit meinen Hausaufgaben fertig und las in meinem Zimmer. Sobald ich das Klappern des Fallrohrs hörte, stellte sich mir die Frage: »Bleibe ich hier, oder gehe ich runter?«
Bis meine Mutter anfing, den Tisch für das Abendbrot zu decken, erzählte mein Vater von seinen Erlebnissen inmitten der Toten. Vor allem im Winter, wenn es bereits dämmerte und das Zimmer vom Teelicht im Stövchen und der sanften roten Glut der Anthrazitkohlen beleuchtet wurde, fiel die Entscheidung nicht schwer. Zwar las ich damals begierig Antoon Coolen, Herman de Man, Felix Timmermans, Maurits Sabbe, Stijn Streuvels und Theodor Storm, aber ihre Bücher konnte ich ja hinlegen und zu jedem beliebigen Zeitpunkt weiterlesen. Das galt für die Geschichten meines Vaters nicht.
Übrigens hatte es beinahe allabendlich den Anschein, als hätte mein Vater, nachdem er es sich im Lehnstuhl beim Ofen bequem gemacht hatte, überhaupt keine Lust, uns etwas zu erzählen. Beleidigt, mürrisch vor sich hinstarrend, trommelte er mit den Knöcheln auf der Armlehne. Meine Mutter rief: »Dein Kaffee kommt sofort.«
Mein Vater tastete nach dem Päckchen Zware Van Nelle. Gemächlich machte er sich daran, eine Zigarette zu drehen. Er drapierte ein Mascotte-Zigarettenpapier auf der Lehne und strich es sorgfältig glatt. Anschließend deponierte er darauf einen dunkelbraunen Tabakbausch. Er zog den Tabak auseinander und presste die Krümel in die scharfe, schnurgerade Falte des Zigarettenpapiers. Dann wurde der Tabak angedrückt und das Zigarettenpapier mit größtmöglicher Präzision gefaltet. Anschließend wurde es so lange gerollt, bis an den Enden nur noch zwei kleine Büschel Tabak herausragten. Lange bevor mein Vater den gummierten Rand befeuchtete, erschien bereits seine erstaunlich lange Zunge, deren Spitze jedes Mal kurz in einem Nasenloch verschwand. Man hätte meinen können, er besorge sich dort eine kleine Portion Leim.
Meistens drehte er das Zigarettenpapier dreimal herum, ehe er dazu überging, es zu befeuchten. Wenn die Zigarette endlich zugeklebt war, betrachtete mein Vater sie andächtig. Anschließend wurde der Tabak, der links und rechts herausragte, mit zwei subtilen Drehbewegungen von Daumen und Zeigefinger entfernt und zurück in die dunkelblaue Tabakpackung befördert. Jetzt erst war der große Augenblick gekommen, in dem er die Säkerhets Tändstickor aus seiner Tasche zauberte. In der Zwischenzeit hatte meine Mutter den dampfenden Kaffee auf den Tischrand gestellt. Jeden Tag musste mein Vater sich entscheiden, ob er zuerst einen Zug oder einen Schluck nahm. Griff er zuerst zu seiner Tasse, wusste ich, dass ich mich wieder in mein Mansardenzimmer zurückziehen konnte. Er hatte dann selten etwas Besonderes zu erzählen. Nahm er zuerst einen Zug, musste ich zusehen, dass mir kein Wort entging.
Doch auch wenn er zuerst an seiner Zigarette zog, mussten wir ihn jedes Mal ein wenig aus der Reserve locken. Normalerweise brauchten wir dazu nach der ersten Rauchwolke nur eine einzige Frage zu stellen: »Ist Herr Rampenne heute noch vorbeigekommen?«
»Rampenne? Es ist wirklich kaum zu glauben! Der kommt jeden Tag kurz vorbei. Als wollte er sich schon mal ein bisschen dran gewöhnen, dass er bald den ganzen Tag bei mir liegen wird. Heute Morgen tauchte er tatsächlich schon vor acht am Grab auf! Wieso? Was macht so ein uralter Mann so früh auf dem Friedhof? Der Leiter des Altersheims hat ihn natürlich, weil man dort schon die Nase von ihm voll hat, einfach vor die Tür gesetzt. Und dann muss so ein Mann eben zusehen, wie er, halbwegs christlich auch noch, den Tag herumkriegt. Er denkt dann: Erst mal zum Friedhof, da kann ich um diese Zeit hin. Vor acht hängt der dann schon bei mir rum! Was soll ich so früh mit einem Taubstummen machen, der nichts lieber will, als ein Schwätzchen halten? Eine schöne Bescherung!«
Mein Vater zog kräftig an seiner Zigarette.
»Es ist verdammt schwierig, sich mit einem Taubstummen zu unterhalten. Jedes Mal hält er einem diesen kleinen verflixten Notizblock unter die Nase. Und dann holt er diesen schmutzigen Bleistiftstummel hervor, der einem beim ersten Wort, das man damit zu schreiben versucht, aus der Hand rutscht. Plumps, fällt er in ein Beet. Es dauert eine halbe Stunde, bis man das Ding zwischen den verdammt dornigen Rosen wiedergefunden hat. Wenn man den Stumpf wieder in der Hand hat, sind alle Finger blutverschmiert. Manchmal schreibt er tatsächlich zuerst was. Ein, zwei Wörter. Kannste raten, was er meint. Wenn man nicht schnell genug reagiert, reißt er den Zettel aus dem Block und wirft ihn dir einfach ins Gesicht. Wenn man eine Weile so mit ihm geschwatzt hat, fliegen überall weiße Blätter herum. Manchmal kann man nicht mal mehr lesen, was auf einem liegenden Grabstein steht, so viele Mistzettel kleben darauf fest. Und irgendwie tut er einem ja auch schrecklich leid, aber trotzdem mache ich einen Luftsprung, wenn ich ihn irgendwann ordentlich in ein Reihengrab hinablassen kann, denn es ist wahrlich ein Elend mit diesem kleinen, wütenden Kerl, der mit den Armen wedelt, wenn man nicht schnell genug auf einen dieser Zweiwörterzettel antwortet, den er dir unter die Nase gehalten hat. Und wenn er dann weg ist, muss man immer das ganze Gespräch von einem liegenden Grabstein aufsammeln oder es zwischen den Kieselsteinen hervorklauben. Und jedes Mal, wenn man sich mit ihm unterhält und endlich zu wissen meint, worauf er hinaus will, dann schreibt er plötzlich ein paar Wörter auf so einen mickrigen Zettel, mit denen man null Komma nichts anzufangen weiß. Heute Morgen auch wieder. Er kommt an, nimmt seinen Block, kramt den Bleistiftstummel hervor, leckt ihn an und schreibt: ›Heute Beerdigung?‹ Ich nehme ihm also den Block aus der Hand und schreibe: ›Ja, Frau Rabenvanger.‹ Er schreibt: ›Ist katholisch, wieso hier?‹ Ich schüttle den Kopf und bedeute ihm, dass ich keine Ahnung habe, ich rufe – denn auch wenn er taubstumm ist, man spricht doch, schließlich redet man auch mit einem Pferd, obwohl man genau weiß, dass so ein Tier kein Wort versteht –, ich rufe also: ›Ich weiß es nicht, keine Ahnung!‹ Du schaust ihn an und denkst: Das versteht er, und dann nimmt er seinen Block und schreibt: ›Dort vielleicht der Boden zu heiß unter den Füßen?‹ Tja, darauf wusste ich absolut nichts mehr zu erwidern. Was sollte schon mit dem katholischen Friedhof sein? Boden zu heiß unter den Füßen? Soweit ich weiß, hat man nicht vor, dort ein Krematorium zu bauen. Wenn man katholisch ist, darf man sich nach dem Tod nicht mal verbrennen lassen. Ist man aber protestantisch, dann darf man sogar vor dem Tod verbrannt werden. Wie nett, dass sie uns schon vor dem Tod gönnen, was sie ihren eigenen Leuten nicht mal danach zugestehen.«
2
Mein Vater zog an seiner Zigarette und sagte: »Kommt heute Morgen gleich nach der Pause Ai van Leeuwen aufs Grab. ›Junge‹, sagt er, ›mach mal das große Tor auf, ich habe eine hübsche Lieferung für dich.‹
›Einen Grabstein?‹, frage ich.
›Nein, soweit ich weiß, ist es kein Grabstein.‹
›Was ist es denn?‹
›Keine Ahnung. Es ist eingepackt, als wäre es aus Porzellan, aber es ist nicht besonders schwer. Es ist für das Grab von Frau Rabenvanger, und das ist auch schon alles, was ich weiß.‹
Ich gehe also mit ihm an den Gräbern der ersten Klasse entlang, mache das große Tor für ihn auf, und da kommt er auch schon mit seinem Schlitten und dem Anhänger. Und darauf liegt ein riesiges Ding. Schön eingepackt, mit hellbraunem Papier. Als wir das abgewickelt haben – sehr feines, leichtes Papier, schön dünn und geschmeidig, wie die Haut eines frisch geschlachteten Kaninchens –, kommt ein Gitter aus Brettern und dünnen Eschenholzlatten zum Vorschein. Und darin, perfekt aufgebahrt zwischen weißen Holzwollebäuschen, liegt ein riesiges Kreuz.
›Soll das auf dem Grab von Frau Rabenvanger stehen?‹, frage ich.
›Offenbar. Ich versteh nur nicht, wieso man sich dafür an mich gewandt hat. Es ist komplett aus Holz. Bin ich dafür etwa Steinmetz geworden?‹
Wir heben das Kreuz aus der Holzwolle, und es ist doch schwerer, als wir gedacht hatten: tropisches Hartholz, schätze ich. Ai sagt zu mir: ›Mann, Mann, was für ein Ding, da könnte man ja einen groß gewachsenen Burschen drannageln.‹ Ich erwidere nichts, denn ich habe schon gesehen, dass …«
Mein Vater trommelte mit den Fingern auf der Armlehne seines Stuhls, zog gierig an seiner Zigarette, sodass sie zwischen seinen Lippen feuerrot aufglühte, und zischte zwischen seinen Zähnen und der im Mundwinkel hängenden Zigarette hindurch: »Da hing … da hing … ratet mal, was da an dem Kreuz hing.«
»Eine Plakette mit dem Namen und den Daten von Frau Rabenvanger«, sagte meine Schwester.
»Von wegen«, erwiderte mein Vater, »nein, das wäre nicht so ein Problem gewesen, nein, die Plakette muss noch montiert werden, hat Ai mir gesagt, nein, da hing … da hing zum Kuckuck noch mal ein Jesus dran.«
»Unglaublich«, sagte meine Mutter.
»›Ai‹, sage ich zu van Leeuwen, ›bist du dir sicher, dass das Kreuz hier stehen soll? Hättest du damit nicht zum katholischen Friedhof fahren müssen?‹
›Nein, es ist wirklich für das Grab von Frau Rabenvanger bestimmt, ich kann es dir zeigen, ich hab die Papiere.‹
›Ai‹, sage ich zu ihm, ›jetzt hör mir mal gut zu. Das hier ist ein ordentlicher, anständiger Friedhof, du kannst dir hier alle Klassen anschauen, die Erbgräber der ersten Klasse, die Familiengräber und die normalen Reihengräber der zweiten Klasse, die Reihengräber der dritten Klasse und meinetwegen auch die Armengräber der vierten Klasse, und nirgendwo, aber auch wirklich nirgendwo wirst du ein Kreuz entdecken mit so einem jämmerlichen Jesus dran. Haben unsere Vorfahren vielleicht dafür achtzig Jahre lang gekämpft? So eine Missgestalt gehört hier nicht hin, die ist noch katholischer als der Papst selbst, und so was wollen wir hier nicht haben.‹
›Nun mach mal nicht gleich eine Staatsaffäre draus‹, sagt er, ›lass uns erst mal nachsehen, wie dieser Jesus befestigt ist.‹
Er schaut sich das Kreuz also genau an und sagt dann: ›Schrauben oder Nägel kann ich nirgends entdecken, ich wette zehn zu eins, dass man billigen Holzleim benutzt hat, um den Wicht zu kreuzigen. Wenn du also mal zufällig mit dem Rasenmäher dagegen fährst oder mit der Harke dran stößt …‹
Nun ja, da hab ich ihm eben geholfen, das Kreuz aufzustellen. Das war ganz schön viel Arbeit. Es musste ziemlich tief eingegraben werden, damit es aufrecht stehen blieb. Wie hat man das damals auf Golgatha nur gemacht? Dieses Kreuz reicht mir bis zum Kinn. Ein echtes Kreuz ist also noch viel größer und schwerer, wie stellt man das bloß auf? Was ich nicht verstehe, ist, dass die an ein so irre großes Kreuz einen so winzigen Jesus hängen … jeder Frosch ist größer. Wer hängt denn ein so mageres Männlein an ein so großes Kreuz? Und wie er da hängt! Als hätte er sein letztes Hemd ins Pfandhaus gebracht! Dafür dann aber mit einem hölzernen Tuch um den Unterleib, das fünfmal so groß wie der ganze Jesus ist. Und auf dem Kopf eine riesige Dornenkrone mit herausgearbeiteten hochstehenden Rändern! Ai van Leeuwen hat gemeint: ›Du wirst sehen, in null Komma nichts hat eine Meise ihr Nest in die Krone gebaut.‹
Wie recht er hat. Und ich habe dann wieder die Arbeit damit! Jeden Tag muss ich die Krone kurz kontrollieren, um nachzusehen, ob vielleicht schon ein paar trockene Halme darin liegen. Die kann man zwar wegpusten, aber wenn man am Montag wiederkommt, wird man feststellen, dass die Bauarbeiter am Sonntag ein komplettes Nest gebaut haben, und mit etwas Glück liegen auch schon zwei dieser kleinen himmelblauen Eier drin. Und was macht man dann? Nein, dieser Jesus muss so schnell wie möglich weg. Ich locke Rampenne zu dem Kreuz, und wenn er wieder mal wütend mit seinen Armen rudert, ist er ruck, zuck ab.«
»Dann bekommst du aber Ärger mit der Familie Rabenvanger«, meinte meine Mutter.
»Soweit ich weiß, sind die einzigen Hinterbliebenen eine gefleckte Katze und ein roter Kater.«
»Wer hat denn das Kreuz aufstellen lassen?«
»Darum hat sie sich selbst noch gekümmert.«
Mein Vater trommelte wieder kurz auf der Armlehne und murmelte grimmig: »Als Ai weggegangen ist, habe ich zu ihm gesagt: ›Du wirst sehen, wenn ich in der Mittagspause zum Essen nach Hause gehe, wird der Jesus gleich vollgeschissen.‹ Und tatsächlich, als ich kurz vor fünf noch mal vorbeigeschlendert bin, stand da nicht nur mein zahmer Grabreiher und hat ihn sich aus zwei Meter Entfernung regungslos angeschaut, sondern es tropfte ihm auch schon ordentlich Taubenscheiße vom Holzschurz. Die Tiere denken auch: He, was soll das? Ich verstehe die Katholen nicht. Was man sich damit auf den Hals holt, mit so einem Jesus … so einem Wicht … so einem Frosch … Gott sei es wahrhaft geklagt.«
Eine Weile saß er da und starrte mit fest aufeinandergepressten Lippen vor sich hin. Und dann verschwand auf einmal sein grimmiger Gesichtsausdruck. Seine sämtlichen Falten gerieten in Bewegung. Fröhlich lächelnd sah er mich an und sagte: »Das schöne, dünne, glatte, geschmeidige Packpapier und die Lättchen aus Eschenholz, weißt du, was wir damit machen?«
»Hast du das alles aufbewahrt?«, wollte meine Mutter wissen.
»Natürlich! Ich habe den ganzen Krempel ordentlich im Bahrhäuschen verstaut, ich habe ja gleich gesehen … Wir werden ihn mal von seinen Büchern wegzerren. Ich weiß, wo im Lager der Gemeinde eine hübsche Rolle dünnes Tau liegt, für das niemand Verwendung hat, und zu dem werde ich einfach sagen: Gehst du freiwillig, oder muss ich dich mitnehmen … Ja, morgen machen wir uns gleich an die Arbeit.«
Vergnügt rieb er sich die Hände. »Morgen basteln wir einen Flieger.«
»Einen Flieger?«, fragte meine Schwester.
»Ja, einen Drachen! Für deinen Bruder! Damit er endlich mal seine Lesebücher beiseite legt. Wenn das Wetter einigermaßen ist, kann er dann seinen Flieger steigen lassen.«
3
»Glaub ja nicht«, sagte mein Vater, »man könnte einfach so, mir nichts dir nichts, einen Flieger zusammenbauen. Man muss sehr genau arbeiten.«
Er sah mich an, als hätte ich die kleinen Latten aus Eschenholz schon falsch gesägt und das weiche Packpapier zerschnitten.
»Auf deiner Stirn habe ich gesehen, was du gedacht hast: Ich mache aus zwei Latten ein Kreuz, spanne zwischen die vier Enden eine Schnur, schneide das Papier zurecht, falte es um die Schnur und leime es mit Tapetenkleister fest.«
»Das habe ich überhaupt nicht gedacht«, protestierte ich.
»Darauf lief es aber hinaus«, sagte er, »aber das Kreuz …«
Er rieb über die Narbe an seinem Kinn, die nach einem Sturz aufs Eis zurückgeblieben war.
»Du kannst die Latten zusammenbinden«, sagte er, »oder mit ein paar kleinen Nägeln befestigen, aber am besten ist es, mit einem kleinen Stecheisen in der Mitte eine Kreuzverbindung zu schneiden, sodass du die Längsstrebe und die Querstrebe ineinander verschränken kannst. Wenn du es wirklich gut machst, brauchst du weder Schnur noch Nägel, sondern klemmst sie einfach fest aneinander … eventuell noch mit ein wenig Holzleim … vielleicht ein kleines Schräubchen … na, Latten hast du genug, du kannst also anfangen …«
Er schwieg, fuhr mit dem Zeigefinger über die Narbe und murmelte: »Wie sie wohl auf Golgatha das Kreuz gemacht haben? Haben sie den Querbalken einfach auf den senkrechten Balken genagelt? Oder haben sie vorher auch in der Mitte eine Kreuzverbindung gemacht? Das wäre viel fachmännischer.«
Jemand klopfte kräftig an die Tür des Bahrhäuschens.
»Wer kommt denn da jetzt auf den bescheuerten Gedanken, uns hier zu stören?«, rief mein Vater entrüstet. Er ging zur Tür, öffnete sie vorsichtig und sagte: »Ach, du schon wieder. Was willst du? Was soll das?«
Auf dem weißen Kies stand bewegungslos ein großer blaugrauer Vogel.
Mein Vater sagte: »Wenn ich ab und zu auf einem Geburtstagsfest erzähle, dass hier bei mir auf dem Grab ein zahmer Reiher herumläuft, der dann und wann mit dem Schnabel an die Tür des Bahrhäuschens klopft, wenn er sich nach Unterhaltung sehnt, weil er kränkelt, dann sieht man sie denken: Schwager, du bist auch nicht an deiner ersten Lüge erstickt. Tja, du weißt ja, wie das ist: Du kannst lügen, dass sich die Balken biegen, und die Menschen glauben dir nicht nur, sondern sie fühlen auch mit dir mit, aber sag die Wahrheit, und sie zischen hinter deinem Rücken: Schwindler.«
Er wandte sich an den Reiher und sagte gutmütig: »Such dir doch ein handfestes Weibchen … es gibt genug … du kannst hier ein Nest bauen, wo du willst, Bäume im Überfluss, keiner stört dich, denn außer mir sind ja alle tot, tja, was willst du noch mehr … ja, ja, gut, ich weiß … Rampenne … der kann dich nicht ausstehen … aber der hat auch nicht das ewige Leben, hat heute oder morgen seinen letzten Satz gesagt … der wird bald ins Himmelreich berufen.«
Der Reiher hob seinen rechten Fuß und stellte ihn wieder auf den Boden. Dann hob er seinen linken Fuß und stellte auch den wieder auf den Boden.
»Ich mache mich gleich an die Arbeit«, sagte mein Vater, »gedulde dich noch einen Moment, ich wollte noch kurz mit meinem Sohn über seinen Flieger sprechen … ich muss ihm doch beibringen, wie man so ein Ding bastelt, das ist auch in deinem Interesse … bald steht hier ein Kamerad für dich am Himmel.«
Der Reiher schüttelte den Kopf, mein Vater sagte: »Oder setz dich doch einfach zu uns … nein, das willst du nicht, was … wie du meinst, ich lass einfach die Tür offen, dann kannst du hören, was wir sagen. Wir werden zuerst über die Bespannung sprechen.«
Er gab dem Reiher einen freundschaftlichen Klaps auf die linke Schulter und wandte sich dann wieder an mich.
»Glaub nicht, du könntest für die Bespannung das schöne Packpapier einfach mal schnell zurechtschneiden. Drachenpapier … am besten wäre es, wenn du das Papier erst einmal zerknüllen und dann wieder glattstreichen würdest. Aber es täte mir in der Seele weh, derart schönes Papier zu zerknüllen. Nun ja, was auch ganz gut funktioniert, ist, das Papier über Nacht zwischen zwei feuchte Handtücher zu legen. Das Problem ist nur: Ich habe hier keine feuchten Handtücher.«
Wieder fuhr er vorsichtig mit dem Finger über die Narbe.
»Ich glaube, wir kriegen schlechteres Wetter, mein Zierstreifen macht sich unangenehm bemerkbar … Handtücher … warte mal, ich hatte hier doch noch ein großes, altes Bahrtuch herumliegen. Wenn ich das kurz in den Friedhofsgraben tauche und auswringe, dann können wir es doppelt falten und das Papier darin übernachten lassen.«
Er öffnete einen hellblauen Schrank und nahm ein schwarzes Tuch vom untersten Brett. Obwohl er dabei behutsam zu Werke ging, wurde so viel Staub aufgewirbelt, dass er heftig zu husten begann. Der Reiher richtete sich auf, öffnete den Schnabel, schloss ihn wieder und trampelte ein paarmal mit den Füßen auf den Kies. Mein Vater ging an dem Vogel vorbei zu dem Graben, der an den Gleisen entlang führte. Er tauchte das Tuch ins Wasser, wrang es wieder aus und kam zurück ins Bahrhaus. Seine Augen tränten noch von dem Hustenanfall.
»Als ich das Tuch eingetaucht habe«, sagte mein Vater, »musste ich auf einmal an König Benhadad denken.«
»König Benhadad?«, fragte ich erstaunt.
»Ja, aus 2 Könige, Vers 8. Elisa verkündet ihm, dass er König von Syrien sein wird. Und was folgt dann? ›Des anderen Tages aber nahm er die Bettdecke und tauchte sie in Wasser und breitete sie über sein Angesicht; da starb er.‹ Er erfährt, dass er König werden wird, und bringt sich anschließend um! Verstehst du das? Und welch eine seltsame Methode, sich um die Ecke zu bringen. Ob man wirklich stirbt, wenn man sich eine nasse Decke übers Gesicht zieht? Und wie war das mit dem Propheten Elisa? Sagt was voraus, das am nächsten Tag schon nicht mehr stimmt. Was für eine verrückte Geschichte!«
Während seines Monologs hielt ich die eine Hälfte des Tuchs in die Höhe. Mein Vater drapierte das Papier auf der anderen Hälfte, die auf dem Boden des Bahrhäuschens lag. Dann deckte ich meine Hälfte darüber. Mein Vater sagte: »So, das hätten wir, und nun zuerst die beiden Latten. Wie groß sollen sie deiner Ansicht nach sein? Einen Meter zwanzig die senkrechte Strebe und die waagerechte neunzig Zentimeter? Ist das in Ordnung?«
»Ja, prima«, sagte ich auf gut Glück.
»Na, na, ein bisschen groß für dich, aber gut, es ist dein Flieger, und wenn du ihn so groß haben willst …«
»Er kann ruhig auch kleiner sein.«
»Nein, nein, wir haben hier eine perfekte Latte von einem Meter zwanzig Länge; es wäre Sünde, davon ein Stück abzusägen.«
Er nahm eine der Latten und bog vorsichtig das Holz.
»Schau nur«, sagte er, »wir haben es hier mit der allerbesten französischen Esche zu tun, die ist fast so geschmeidig wie eine Kranzschleife. Sollen wir die Querstrebe mit einer kräftigen Spannschnur etwas biegen? Dann steht der Flieger gleich ein wenig stabiler.«
»Meinetwegen«, erwiderte ich.
»Wenn ich schon mal schnell mit meinem Stecheisen für dich einen Anfang an der mittigen Kreuzverbindung mache, dann kannst du inzwischen zum großen Tor laufen und nachsehen, ob Rampenne zufällig angestiefelt kommt. Ich will nicht, dass er uns hier überrascht. Selbst wenn er dich mit eigenen Augen mit einem Stecheisen hantieren sieht, weiß morgen die ganze Stadt, dass der Grabmacher während der Arbeitszeit im Bahrhäuschen sitzt und Flieger bastelt.«
Als ich von meinem Gang zurückkam und berichten konnte, dass Rampenne weit und breit nicht zu sehen war, zeigte sich, dass die Arbeit an der Kreuzverbindung schon ziemlich weit fortgeschritten war.
»Mensch«, sagte ich, »du bist schon fast fertig.«
»Ja, ja, das könnte man meinen, aber worauf es ankommt, ist, dass die linke und die rechte Seite genau im Gleichgewicht sind. Wenn die Querstrebe auf der einen Seite auch nur ein bisschen schwerer ist als auf der anderen, dann steht der Flieger nicht gut in der Luft. Wie finden wir heraus, ob er links ebenso schwer ist wie rechts? … Am besten wäre es, wenn wir die Enden der Querstrebe irgendwo so auflegen könnten, dass sich das Kreuz um diese Achse drehen kann … dann würden wir sehen, ob die Querstrebe an einer Seite nach unten sinkt … wie machen wir das? … Warte … wenn ich den Deckel von dem Reihengrab in der zweiten Klasse abnehme und zwei Schnüre darüber spanne … ja, das ist eine Bombenidee.«
Mit dem Kreuz schlenderten wir über den stillen Friedhof zu den Reihengräbern der zweiten Klasse. Zusammen hoben wir den Deckel von dem halb gefüllten Grab. Mithilfe von vier Stöckchen spannte mein Vater zwei Schnüre über die tiefe Grube. Währenddessen kam der zahme Reiher angeflogen und landete auf einer schwarzen Marmorplatte. Ganz langsam, immer wieder kleine Schritte machend, kam er näher, bis er das offene Grab erreicht hatte. Andächtig schaute er in die Tiefe.
»Das ist seine ganze Lust und Seligkeit«, sagte mein Vater, »wie ein Standbild am Rande eines Grabes zu stehen und hineinzuschauen. Das kann er stundenlang. Er denkt dann: Ach, wenn ich doch später auch so ein schönes Menschengrab bekommen könnte.«
Mein Vater nickte dem Vogel zu.
»Sei unbesorgt, Reiher, wenn du stirbst, sorge ich dafür, dass du dein Grab kriegst. Mit etwas Glück gelingt es mir, dich in ein Familiengrab erster Klasse zu schmuggeln, das verspreche ich dir.«
Mein Vater legte das Lattenkreuz so auf die straff gespannten Schnüre, dass die Querstrebe sich frei bewegen konnte. Nachdem das Kreuz eine Weile friedlich auf den Schnüren hin und her geschaukelt hatte, kam es zum Stillstand.
»Siehst du«, sagte mein Vater, »auf der rechten Seite hängt es etwas herab. Die beiden Hälften sind nicht genau gleich schwer, auch wenn der Unterschied nur winzig ist. Du musst die rechte Seite ein wenig nacharbeiten. Manchmal muss man nur eine Kleinigkeit abschmirgeln. Ich wäre dir allerdings sehr dankbar, wenn du zuerst noch mal zum Tor gehen würdest, weil ich Bammel vor Rampenne habe … es ist Viertel vor neun … er ist immer noch nicht hiergewesen … es kommt zwar gelegentlich vor, dass er seinen Besuch ausfallen lässt, aber nur wenn er ernsthaft krank ist, nein, der kommt bestimmt noch vorbei.«
Zwischen den Gräbern der dritten Klasse hindurch ging ich zum Tor. Ich warf einen Blick in die Straßen und Wege, die zum Friedhof führten. Kein Lüftchen regte sich. Totenstill standen die Bäume unter den regungslosen Wolken. Es war keine Menschenseele zu sehen, und es schien fast, als würde nie wieder jemand auf diesen Straßen und Wegen gehen. Nichts deutete darauf hin, dass jenseits dieser Straßen die übrige Welt lag.
Als ich wieder zurückkam, hatte mein Vater schon mit dem Schmirgeln begonnen. Kurz darauf hing das Lattenkreuz in vollkommenem Gleichgewicht auf den beiden Schnüren.
»Denk dran«, sagte mein Vater, »wenn du die Bespannung befestigt hast, musst du noch mal kontrollieren, ob beide Hälften genau gleich schwer sind. Du hast jetzt gesehen, wie du das machen musst. Zwei Schnüre und …«
»Wenn er dann aber auf einer Seite zu schwer ist, was soll ich dann tun? Ich kann doch nicht einfach ein Stück von dem Papier abschneiden?«
»Nein, da hast du recht, nein, du musst ihn dann auf der anderen Seite ein klein wenig schwerer machen, mit ein bisschen Fensterkitt zum Beispiel. Oder du streichst auf der einen Seite ein wenig Kleister auf das Papier. Wichtig ist, dass die linke und die rechte Seite bis aufs Milligramm gleich schwer sind. Glaub mir, es ist sehr viel einfacher, ein Kreuz zu machen, um jemanden festzunageln. Wie dem auch sei, wir kriegen das bestimmt hin … Gütiger Himmel, wenn das nicht Rampenne ist, der da kommt, schleich mit dem Kreuz hinter den Rhododendren entlang, dann halte ich ihn so lange in der vierten Klasse beim Grab von Frau Poot auf.«
4
Eine Woche lang ging ich jeden Tag nach der Schule zum Friedhof, um dort an meinem Drachen zu arbeiten. Sobald ich kam, holte mein Vater die Sachen aus dem Leichenhäuschen. Er sagte mir, was zu tun war, und schickte mich dann los, um nachzusehen, »ob keine Topfgucker im Anmarsch sind«. Während ich unterwegs war, bastelte er im Bahrhäuschen schon mal gemütlich weiter. Hin und wieder streckte ich meine Hand nach dem Papier oder der Spannschnur aus, doch dann fragte er besorgt: »Was hast du vor? Viel ist jetzt nicht mehr zu tun, überlass deinem alten Vater ruhig den Rest, du hast schon genug gemacht.«
Eines Freitagnachmittags lehnte er den großen braunen Drachen an die Kinderbahre und sagte: »Das sieht doch schon sehr gut aus, ich glaube, du bist jetzt wirklich fertig, sogar eine Kielschnur und eine bewegliche Lenköse hat er schon. Jetzt nur noch der Schwanz. Denn einen Schwanz muss er haben, sonst wird er, auch wenn du die Querstrebe sehr schön gebogen hast, nur mit Mühe in der Luft stehen.«
Er sah sich im Bahrhäuschen um.
»Wie wäre es, wenn du von dem alten Bahrtuch die Fransen abschneiden und sie säuberlich aneinanderknoten würdest …«
Er nahm das alte Tuch, musterte die Fransen und sagte dann: »Nein, die taugen nicht.«
Er sah mich an.
»Was könnten wir für den Schwanz nehmen?«
»Wir haben zu Hause noch so lange Strickschnüre … von früher …«, sagte ich.
»Als ihr noch mit der Strickliesel gespielt habt, meinst du, ja, das … das ist gar kein so schlechter Gedanke. Vielleicht muss man alle zwanzig Zentimeter einen Knoten hineinmachen, oder man muss, um ihn am Ende schwerer zu machen, ein paar Glieder von einer Grabsteinkette anhängen. Das könnten wir ausprobieren.«
Noch am selben Abend sagte er gleich nach dem Abendessen: »Und? Was meinst du? Sollen wir mal ausprobieren, ob er auch fliegen will?«
»Ich lese gerade so ein schönes Buch, Scheepswerf de Kroonprinses von Herman de Man«, sagte ich.
»Schönes Buch«, sagte er höhnisch, »nun, das läuft dir ja nicht weg. Warum willst du nicht mal probieren, ob du ihn steigen lassen kannst? Ich schlendre hinter dir her, damit ich dir, sollte es nötig sein, helfen kann.«
Als wir den Sluispolder erreichten, sagte er: »Ich glaube nicht, dass wir genug Wind haben, um deinen Flieger steigen zu lassen.«
Wir konnten überall hingehen, weil der Polder mit einer Schicht aus aschgrauem Sand bedeckt war, um ihn bebaubar zu machen, bis weit jenseits der Ecke, wo mein Vater früher einmal einen Schrebergarten besessen hatte. Wochenlang waren riesige Lastwagen durch die engen Straßen gepoltert. Der Polder war in eine Miniwüste mit feinem hellgrauem Sand, die wie gebleicht aussah, verwandelt worden. Hier und da ragten kleine schiefergraue Muscheln heraus. Manchmal hörte man, wie eine dieser Muscheln unter der Schuhsohle zersplitterte, und dann sagte mein Vater entschuldigend: »Das verwüstete Land soll wieder gepflügt werden, dafür dass es verheert war, dass es sehen sollen alle, die dadurch gehen, und sagen: Dies Land war verheert, und jetzt ist’s wie der Garten Eden.«
Er blieb immer wieder stehen, schnüffelte wie ein Windhund und sagte: »Du brauchst allerdings eine ordentliche Brise, und ich bin mir nicht sicher, ob wir es mit diesem sanften Abendlüftchen schaffen werden … na ja, versuchen können wir es ja mal, vielleicht gibt’s weiter oben noch einen tüchtigen Luftzug.«
Wir setzten unseren Weg über den leichenblassen Sand fort und gelangten zur Rückseite der katholischen Enklave, die vom Zuidvliet aus mit einem Kirchlein, einem Pastorat, einem ummauerten Garten und einem Friedhof tief in den Polder hineinragte. Im siebzehnten Jahrhundert hatte man den Katholiken das Grundstück, das möglichst weit vom Dorfkern entfernt lag, widerwillig zugewiesen.
»Wenn hier jetzt gebaut wird«, sagte mein Vater, »dann können sie den ganzen verdammten katholischen Plunder in einem Mal mit aufräumen. Wie sähe das denn aus, wenn hier eine ganz neue Wohnsiedlung aus dem Boden gestampft wird, und mittendrin steht noch so eine heruntergekommene katholische Schrottkirche. Das darf nicht sein.«
Gleich hinter dem katholischen Friedhof unternahmen wir unseren ersten Versuch, den Drachen steigen zu lassen. Ich entfernte mich mit dem braunen Ding ein Stück von meinem Vater. Er rief: »Los!« und fing an zu rennen. Der Drachen stieg zunächst gravitätisch in die Höhe, taumelte dann zweimal um seine Achse und schlug anschließend kopfüber im schiefergrauen Sand auf. Ich lief hin, zog ihn heraus, drehte ihn um, und wieder rief mein Vater: »Los!« Er rannte rückwärts über den glitzernden Sand auf den katholischen Friedhof zu.
Schon bald wurde deutlich, dass es uns an diesem Tag nicht gelingen würde, den Drachen steigen zu lassen.
»Das hatte ich bereits befürchtet«, sagte mein Vater. »Eine tüchtige Brise, das ist das Mindeste, was du brauchst. Komm, lass uns nach Hause gehen.«
Er schaute zu dem katholischen Friedhof hinüber. Im Licht der tiefstehenden Abendsonne ähnelte der von einem tiefen Wassergraben umgebene hoch gelegene Kirchhof eher einem unzugänglichen Garten als einem Gottesacker. Pappeln, die so dicht nebeneinander am Rand des Wassergrabens standen, dass ihre Äste ineinander griffen, entzogen die Gräber fast vollständig dem Blick. Mein Vater starrte auf all das Grün und sagte: »Was hindert mich eigentlich dran, mich dort drüben mal umzusehen und mich zu informieren. Ich wette, da hinten stehen Dutzende von Kreuzen aus Hartholz mit so einem mickrigen Jesus dran. Ich würde zu gern wissen, wie sie die bloß sauber halten. Oder sind die auch ganz voller Taubendreck? Die Frage ist nur: Wie komme ich über den Wassergraben? Moment, habe ich nicht vorhin, als wir herkamen, ein hübsches Brett aus dem Sand ragen sehen? Wenn wir das jetzt kurz …«
Und er ging schon los, während ich sagte: »Darf man denn einfach so auf den Friedhof gehen?«
»Danach fragen wir nicht«, erwiderte er, »wir tun es einfach. Man rennt da höchstens dem Herrn Pastor über den Weg, und den kenne ich. Der war erst vor Kurzem mit seinem Weihwassersprenkler bei mir und hat geurbit und georbit, als Frau Rabenvanger beerdigt wurde … tja, warum die wohl hier nicht liegen wollte oder nicht liegen durfte oder nicht liegen konnte …?«
Er zog die Planke aus dem Sand. Zusammen gingen wir damit zurück, und er legte das Brett über den breiten Graben.
»Ich geh schnell allein«, sagte er. »Bleib du einen Moment hier und warte mit unserem Flieger.«
Mein Vater ging über das Brett. Es war ein kleines bisschen zu kurz, um den ganzen Graben zu überbrücken, sodass er einen Sprung machen musste. Er kletterte hinauf in das unstetige Zittergras, das auf dem hohen, steilen Ufer wuchs. In aller Seelenruhe schlenderte er anschließend über den Friedhof, wobei seine Holzschuhe laut auf den Kieselsteinen knirschten; die Hände hatte er lässig in die Taschen seiner Arbeitscordhose gesteckt. Ab und zu tauchte er zwischen den Pappeln auf, doch die meiste Zeit konnte ich ihn nicht sehen. Regelmäßig, wenn er stehenblieb, um sich ein Grabdenkmal näher anzusehen, erstarb in der kühlen Abendluft das Geräusch der knirschenden Kieselsteine. Nach etwa zwanzig Minuten überquerte er wieder den Wassergraben und sagte feierlich: »Ja, ja, der Herr stellte mich auf ein weites Feld, das voller Totengebeine lag. Und er führte mich allenthalben dadurch. Und siehe, des Gebeins lag sehr viel auf dem Feld; und siehe, sie waren sehr verdorrt.«
Und als wir eine Weile später genau auf die tief stehende Sonne zu nach Hause gingen, sagte er: »Was für ein Sauladen. Da steht überall Unkraut. Mehr als mannshohe Brennnesseln. Und genug Glaskraut, um eine Pferdezucht damit zu betreiben. Sogar zwischen den Kieselsteinen auf den Wegen wächst Unkraut. Sie lassen alles aus dem Boden schießen, wie es Gott gefällt. Und erst die Grabsteine! Von Pflege haben die offenbar noch nie was gehört. Und wie ich es mir schon gedacht habe: All die Jesusse an den hölzernen und steinernen Kreuzen sehen schrecklich schmuddelig aus. Dass sie alle voller Taubendreck sind, ist nicht das Schlimmste; ein ordentlicher Regenschauer, und die Scheiße wird wieder abgespült; aber die ganze Vogelkacke ist sauer wie verdorbene Milch, die ätzt alles weg. Die Jesusse werden also … ach, wie sie nur alle aussehen. Manchmal sind sie bis auf die Knochen weggefressen, es ist wirklich schrecklich, man kann die Rippen zählen.«
5
Als der Wind im Frühjahr kräftiger wehte, sagte mein Vater gleich nach dem Dankgebet, mit dem er das Abendessen zu beenden pflegte: »Los, komm, wir versuchen es noch mal.«
Wir gingen über den jungfräulichen Sand, der immer wieder die Farbe des Himmels darüber annahm. Mal war er bleigrau, dann leuchtete er weiß auf, als wollte er die Wolken widerspiegeln, die in der Höhe trieben. Schritt der Abend voran und die Sonne sank, sah es so aus, als würde der schiefergraue Himmel mit der Erde verschmelzen. Wäre der Sand nicht so locker gewesen, hätte man meinen können, man liefe über Eis.
Wir gingen immer bis zum katholischen Friedhof. Ich hielt den Drachen hoch, und mein Vater rollte ein Dutzend Meter Gemeindeschnur ab, rief »los« und rannte rückwärts über den chamäleonartigen Sand. Ganz gleich, wie stark der Wind war, man konnte nie vorhersagen, ob der Drachen auch tatsächlich fliegen würde. Manchmal traf ihn in etwa zehn Meter Höhe ein tückischer Fallwind, der ihn wild torkelnd in den Sand stürzen ließ.
Meistens schien am Boden jedoch kaum ein Lüftchen zu wehen. Erst wenn der Drachen einmal über die Pappeln des katholischen Friedhofs hinausgeklettert war, konnte er stetig, ohne sich auch nur einmal um die eigene Achse zu drehen, in die höheren Luftschichten aufsteigen, wo – wenn die Gemeindeschnur es zuließ – stetigere Winde ihn trugen. Schließlich verschmolz er, nahezu unbeweglich, mit dem immer dunkler werdenden Abendhimmel. Dann hielten mein Vater und ich ihn abwechselnd fest und spürten, wie er ab und zu neckisch an der Schnur zog. Um uns einen Schrecken einzujagen, drehte er sich gelegentlich um die eigene Achse oder schwenkte schwungvoll nach links oder rechts. Aber je höher er stieg, desto weniger grillenhaft verhielt er sich. Wenn er sich fast regungslos vom tiefblauen Himmel abhob, kam der Moment, in dem mein Vater ihm an der Leine entlang Nachrichten hinaufschicken wollte.
Ehe es so weit war, überfiel mich immer, nachdem wir den Drachen bereits zwanzig Minuten lang abwechselnd gehalten hatten, ein Gefühl der Unzufriedenheit. Und was jetzt? Einfach nur herumstehen und zum Drachen hochschauen, der inzwischen kaum noch zu erkennen war? Der Gang über den heimtückischen Sand war beklemmend, das Steigenlassen des Drachens entnervend, aber wenn er einmal hoch am Himmel stand, ja, dann stand er da, dann passierte eigentlich nichts mehr, man konnte höchstens noch den Drachen in der Luft lassen, bis es so dunkel war, dass man ihn nicht mehr sehen konnte. Das war dann wieder spannend: Würde er zum Vorschein kommen, wenn wir die Schnur aufrollten?
Mein Vater litt offenbar nicht unter dieser seltsamen Unzufriedenheit. Er hätte, glaube ich, bis zum Morgengrauen den Drachen halten können. Oder bekämpfte er dieses Gefühl vielleicht, indem er Nachrichten schrieb? Man hätte fast meinen können, er glaubte wirklich, damit etwas erreichen oder sogar jemanden – Gott? – mürbe machen zu können. Auf die Rückseiten von gebrauchten Briefumschlägen schrieb er seine Schnurgebete. Anschließend hängte er die Umschläge an die Schnur, gab ihnen einen Schubs und sah, meist erst nach mehreren erfolglosen Versuchen, vergnügt zu, wie der Umschlag zaghaft und zögernd die Schnur hinaufknisterte. »Gib, dass ich meinen Bruder Klaas beim Damespiel schlage«, schrieb er auf einen. »Sorge dafür, dass Rampenne mich endlich in Frieden lässt, zur Not, indem du machst, dass ich ihn anständig begraben darf«, kritzelte er auf einen anderen. »Lass Herrn Alders, Chef des Grünflächenamtes und damit mein direkter Vorgesetzter, bitte bis zum Hals in der Scheiße versinken.« »Sorge dafür, dass mein zahmer Reiher ein Weibchen findet.« Seine kürzeste Bitte passte auf die Rückseite eines Kalenderblatts: »Gib mir hunderttausend Gulden.«
Wenn er fünf Nachrichten verschickt hatte, drängte er auch mich, eine in die Höhe zu senden. Ich schreckte aber davor zurück, meine Wünsche auf der Rückseite eines Umschlags preiszugeben, ganz zu schweigen davon, dass ich gewillt gewesen wäre, sie an einer Schnur gen Himmel zu schicken. Um meinem Vater entgegenzukommen, notierte ich hin und wieder eine harmlose Bitte: »Gib, dass ich De vrouw met de zes slapers von Antoon Coolen in die Finger bekomme.« Und selbst dann rief ich, wenn mein Vater Anstalten machte, meine Bitte in die Höhe zu senden: »Nicht lesen, was ich geschrieben habe.« Aber er las es dennoch und meinte anschließend: »Fällt dir nichts anderes ein? Warum muss es immer um Bücher gehen?«
»Das schadet doch niemandem.«
»Nein, und ich finde es auch gar nicht schlimm, dass du gern liest, aber du machst nichts anderes mehr, du verliest dein ganzes Leben, und du liest so merkwürdige Bücher. Lies doch mal Moeder Geerte oder Huis van licht en schaduw von Nijnatten-Doffegnies. Oder Lydia en de erven Neuteboom von Ooms, das sind prächtige Bücher. Aber dieser Coolen und dieser Timmermans, das sind schreckliche Papisten, versteh das doch endlich.«
Wenn man den Drachen einholte, stellte sich oft heraus, dass die Nachrichten unterwegs gestrandet waren. Auf halber Strecke hingen sie an einem Knoten in der Schnur. Manchmal waren sie auch ganz verschwunden, oder man fand nur noch ein Stück des Umschlags. Nur selten waren sie tatsächlich an der Kielschnur des Drachens angekommen. Wenn dem allerdings so war, vollführte mein Vater einen Freudentanz, denn dann hatte er das Gefühl, dass seine Bitte erhört werden würde.
Allabendlich, wenn es beinahe dunkel war, legte er die Planke über den Graben beim katholischen Friedhof und machte einen Kontrollgang an den Gräbern entlang. Jedes Mal kam er vergnügt murrend wieder und sagte: »Tja, wenn die Leute zuerst hier waren und dann bei mir vorbeischauen, wissen sie nicht, wie ihnen geschieht. Nicht auszudenken, wenn man hier katholisch begraben wird. Allmählich verstehe ich auch, warum Frau Rabenvanger bei mir liegen wollte.«
6
In jenen Jahren fuhr ich jede Woche zwölf Kilometer weit mit dem Fahrrad zur öffentlichen Bibliothek am Lange Haven, um Bücher zurückzugeben und neue auszuleihen. Manchmal machte ich dabei einen kleinen Umweg durch die in Hafennähe gelegene Hoogstraat, weil man sagte, dass dort immer besonders hübsche Mädchen unterwegs seien. Auffällige Schönheiten hatte ich dort noch nie gesehen, wohl aber erstaunt festgestellt, dass es in der Hoogstraat, in der Nähe des öffentlichen Lesesaals zudem, noch eine zweite Bibliothek gab. Jedes Mal, wenn ich daran vorbeifuhr, dachte ich: Es wäre doch sehr praktisch, wenn ich dort auch Mitglied würde. Dann muss ich nur eine lange Fahrt mit dem Rad machen und kann zwei Bibliotheken besuchen. Und bestimmt gibt es in dieser katholischen Bibliothek Bücher von Autoren, die man sonst nirgendwo findet. Dennoch traute ich mich zunächst nicht, die katholische Bücherei zu betreten; zum einen, weil man mich von frühester Kindheit an vor der »Hure von Babylon«, die man auch katholische Kirche nennt, gewarnt hatte, zum anderen, weil ich damals schon so viel über die Inquisition, über Hexenverbrennungen, über die gnadenlose Verfolgung von Waldensern, Albigensern, Hussiten, Hugenotten und nicht zuletzt Juden gelesen hatte, dass es mich bereits schauderte, wenn mir irgendwas unter die Augen kam, dass an den Katholizismus erinnerte. Andererseits faszinierte die Welt des Weihrauchs und der Priester mich. Und so unvorstellbar verbrecherisch die katholische Kirche auch war, sie hatte den Dichter hervorgebracht, der Als de ziele luistert und Ego Flos geschaffen hatte. Dennoch erschien es mir unmöglich, jemals einen Blick in die katholische Bibliothek in der Hoogstraat zu werfen.
Als aber auf dem Friedhof, wo mein Vater arbeitete, ein Kreuz mit einem geschmacklosen Jesus daran auftauchte und er es, obwohl er großspurig verkündet hatte, dass es demnächst einen Unfall mit einer Harke oder einem Rasenmäher geben würde, vorerst verschonte und zudem noch jedes Mal, wenn wir den Drachen steigen ließen, seelenruhig den Graben überquerte, um den katholischen Friedhof kurz zu inspizieren, da erschien es mir immer weniger undenkbar, die Schwelle der katholischen Bibliothek zu überschreiten.
An einem warmen, hellen Sommerabend im August fuhr ich zu der Bibliothek am Lange Haven. Anschließend schob ich, bereits mit fünf neuen Büchern ausgestattet, mein Fahrrad über die Brücke zum Deichaufgang. An der Handelsbörse vorbei ging ich zur Hoogstraat hinauf. Vorsichtig stellte ich mein Rad an die Fassade der katholischen Bücherei. Ich schluckte ein paarmal, nahm meinen ganzen Mut zusammen und öffnete so behutsam wie möglich die Tür. Als ich eintrat, befand ich mich in einem kleinen Vorraum, der ungeachtet des schönen Wetters mit dicken Zugvorhängen von der eigentlichen Bibliothek abgetrennt war. Vorsichtig unternahm ich den Versuch, einen der Vorhänge zur Seite zu bewegen, aber wohin ich den Stoff auch schob, immer wieder hinderten riesige Falten mich am Eintritt. Es war, als würde ich nie weiterkommen, als würde ich dort für immer im Fegefeuer der widerspenstigen Falten versuchen müssen, zum Heiligtum vorzudringen, in dem die Bücher aufbewahrt wurden. Tastend, schiebend, drückend bemühte ich mich weiter, einen Durchgang zu schaffen. Schließlich bemerkte ich aus dem Augenwinkel, dass ich mich gleich beim Reinkommen scharf nach rechts hätte wenden müssen, wo ein schwacher Lichtstreifen schimmerte. Und tatsächlich konnte ich dort den Vorhang problemlos zur Seite schlagen, woraufhin es mir endlich vergönnt war, durch den engen Spalt das Heiligtum zu betreten. Ich erschrak ob der Dunkelheit in dem Raum. Alles Licht schien von einer einzigen flackernden Kerze auszugehen, die vor einer Marienfigur brannte. Eine Mädchenstimme rief: »Vorhang zu, sonst wird die Kerze ausgeweht!«
Hastig zog ich den Vorhang hinter mir zu. Die Kerzenflamme wurde von einem Windstoß erfasst, der sie beinahe erlöschen ließ. In ihrem Licht, das von dem bläulichen Schimmer, der durch die hohen Fenster ins Innere fiel, verstärkt wurde, entdeckte ich am Schalter die Erscheinung, die zu mir gesprochen hatte. Ansonsten schien sich auf den ersten Blick niemand in dem Raum aufzuhalten, kein Leser, kein Ausleiher, niemand, der ziellos herumstöberte. Ich hoffte nur, dass die Besucher hinter den Regalen hockten.
Ich ging auf die Erscheinung zu, wollte den Satz aufsagen, den ich auf dem Weg zur Hoogstraat auswendig gelernt hatte – »Darf ich mich ein wenig umschauen, um festzustellen, ob es hier genug zu lesen gibt und sich eine Mitgliedschaft lohnt« –, aber die Erscheinung hinter dem Schalter raubte mir den Atem.
Dort saß ein Mädchen meines Alters. Vielleicht ein wenig älter. Ihr sehr üppiges blondes Haar hatte sie erschreckend hoch aufgesteckt, und es schimmerte etwas Glänzendes daraus hervor, das große Ähnlichkeit mit einem Stück Hühnerdraht hatte. Unter dem Haar, das offenbar dank des Hühnerdrahts der Schwerkraft widerstand, spähten zwei schwarz umrandete Augen zu mir herüber. Sowohl über als auch unter dem breiten schwarzen Rand, der beide Augen vollständig umgab, war auf verschwenderische Weise lila-blauer Lidschatten aufgetragen. Darunter glänzten feuchte, feuerrot angemalte, fast negroide Lippen. Aber die ganze Erscheinung hätte mich eher erstaunt als bestürzt, wenn ihre kräftigen Hände nicht mit den längsten Fingernägeln ausgestattet gewesen wären, die ich je gesehen hatte. Auch die Fingernägel waren feuerrot.
»Wenn ich mich nicht irre, bist du noch nie hiergewesen«, lispelte die Erscheinung.
»Nein«, erwiderte ich.
»Willst du Mitglied werden?«
»Wenn es genug Bücher gibt, die ich noch nicht gelesen habe. Darf ich mich kurz umsehen?«
»Nur zu«, sagte sie.
»Hier ist sonst niemand«, sagte ich heiser.
»Du bist doch hier«, sagte sie, »wir sind doch hier.«
Mit pochendem Herzen ging ich durch die Regalreihen. Überall entdeckte ich Bücher, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Und in der Reihe der Bücher von Antoon Coolen stand tatsächlich – mein Drachengebet wurde erhört – De vrouw met de zes slapers.
Ich ging zum Schalter zurück. Dahinter sah ich nur den Rücken von jemandem, der sich bückte. Ich holte tief Luft und sagte: »Ich möchte gern Mitglied werden.«
Ende der Leseprobe