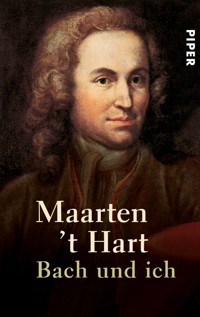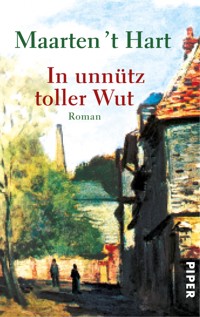9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alexander Goudveyl blickt als Pianist auf eine ansehnliche Karriere zurück. Eines Abends wird der verheiratete Musiker nach einem Konzert von einer jungen Frau angesprochen. Sie interessiert sich für eines seiner Konzerte. Wenig später schon besucht sie ihn zu Hause, um diese Aufnahme persönlich bei ihm abzuholen. Unüberlegt und voller Leidenschaft stürzt sich Alexander in eine Affäre mit ihr. Doch während seine Liebe wächst, immer intensiver und unbedingter wird, kühlt die seiner Geliebten nur allzu rasch ab. Verzweifelt versucht er, die Kluft zwischen ihnen zu schließen. Immer weniger weiß Alexander, mit wem er es überhaupt zu tun hat – mit einem zaghaften Mädchen oder einem weiblichen Don Juan, deren Liebe so schnell erlischt, wie sie entflammt ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Niederländischenvon Gregor Seferens
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2011
ISBN 978-3-492-95258-3
© 1991 Maarten ’t Hart
Deutschsprachige Ausgabe:
© Piper Verlag GmbH, München 2011
Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München
Umschlagabbildung: Monet / Houses on Zaan River at Zaandam / akg-images
1
September. Hester und ich traten beim Voorhoutfestival auf. Nach unserem letzten Stück sagte sie: »Ich kann dich nicht nach Hause bringen, ich muss noch weiter nach Schiedam.«
»Das macht nichts«, sagte ich, »es fahren Straßenbahnen, Züge und Busse.«
»Doch, das macht was«, sagte sie, »das Mindeste, was ich für dich tun kann, ist, dich wieder nach Hause zu bringen, du trittst mit mir auf, damit ich mir etwas dazuverdienen kann. Du selbst brauchst das Geld überhaupt nicht.«
»Nebenverdienste brauche ich nicht, aber deine Gesellschaft ist unbezahlbar«, sagte ich.
»Ja, darum bin ich so arm.«
Sie küsste mich auf die linke Wange. Eilig ging sie zum Parkhaus.
Das strahlende Spätsommerwetter hatte etwas Trügerisches. Es schien, als wäre Frühling. Der Himmel war hellblau. Im Westen, in weiter Ferne, schwebte ein Wölkchen, das aussah wie eine Männerhand.
Die Sonne schien auf mein Gesicht; ich schloss die Augen. Einen Moment lang war mir, als wäre ich noch jung. Dann dachte ich: Ich bin jetzt genauso alt wie Schumann, als er in Endenich eingewiesen wurde.
In der Nähe erklangen Mädchenstimmen. Fast widerwillig öffnete ich die Augen. Nicht weit entfernt von der improvisierten Terrasse, auf der ich saß, standen zwei junge Frauen.
»Sind Sie Alexander Goudveyl?«, fragte die kleinere der beiden.
»Leugnen hat keinen Zweck«, sagte ich, »aber sagen Sie es nicht weiter.«
War ich witzig? Die kleine Frau lachte lauthals, die größere lächelte. Vorsichtig schaute ich sie an, vorsichtig schaute sie zurück. Sie war ein eher dunkler Typ mit vielen widerspenstigen Locken. Unerschrocken sah ich sie weiter an. Was mich eigentlich bezaubert, ist klein, hat langes, glattes Haar und trägt einen Rock. Diese mädchenhafte Frau war groß. Sie trug eine Hose, eine blassgrüne Windjacke, und sie hatte Locken. Sie hatte ein hübsches ovales Gesicht mit fast feuerroten Wangen. Ihre Lippen waren kräftig. Unter ihrem Mund ragte ein kleines, aber unbeugsames Kinn hervor. Sie hatte eine zierliche kerzengerade Nase. Sie war bildschön, wobei Hester allerdings sagen würde: »Schöne Frauen? Ach, davon gibt es so viele.«
In ihrem Gesicht gab es etwas, das nicht zu ihrem Liebreiz passte. Die ein klein wenig zu schräg stehenden Augen? Oder die allzu roten Wangen? Oder der kräftige, fleischige Kiefer? Ganz gleich, was es war – erst diese Kleinigkeit machte sie unwiderstehlich. Es war, als gäbe ihr Gesicht ein Rätsel auf.
Sie nahm sich zusammen, wollte etwas sagen, doch mehr als ein Lächeln bekam sie nicht zustande. Ihre Verlegenheit übertrug sich auf mich. Auch ich wollte etwas sagen, mit zwei Scherzen beruhigen. Doch auch ich schaffte nicht mehr als ein Lächeln.
Sie gingen. Die Sonne schien noch immer auf mein Gesicht. Erneut schloss ich die Augen. Feurige Streifen und Kreise erschienen auf der Leinwand meiner Augenlider. Warum war mir plötzlich so schwindlig? Ich zitterte, als hätte ich Parkinson. Hastig öffnete ich die Augen; die Sonne war schuld, die viel zu warme Herbstsonne. Ich stand auf. Ich zitterte am ganzen Körper. Rasch setzte ich mich wieder hin. Ich hatte ein Gefühl, als machten sich unter meinem Zwerchfell Zahnschmerzen breit. Es war, als wäre ich in mir selbst gefangen. Vorsichtig versuchte ich aufzustehen. Es ging, aber es schien, als wären meine Arme und Beine eingeschlafen. In allen Gliedern spürte ich ein Prickeln. Als ich den Plein überquerte, bekam ich unvorstellbare Bauchschmerzen. Mir war, als hätte ein Schornsteinfeger einen Stoßbesen in meinen Magen geschoben, den er jetzt hin und her bewegte.
Das Gesicht der anderen Frau, die über mich gelacht hatte und die ich kaum angesehen hatte, konnte ich mir mühelos ins Gedächtnis rufen, doch das Gesicht der großen Frau schien radikal aus meiner Erinnerung gelöscht zu sein.
Was ich zu tun hatte, war klar. Ich musste sie wiederfinden. Einmal noch musste ich sie anschauen. Dann würde ich mir ihr Gesicht mit der zierlichen Nase, den erstaunlich roten Wangen, dem kräftigen Kinn einprägen. Um es mir zu jedem gewünschten Zeitpunkt wieder vorstellen zu können. Und dann wäre alles in Ordnung.
Stundenlang schlenderte ich an den Marktständen vorbei. Es war Ende September, und es herrschte strahlendes Spätsommerwetter. Trotzdem kommt es mir, wenn ich an diesen Samstagnachmittag zurückdenke, so vor, als wäre es, als ich meine vergebliche Suche begann, bereits Winter gewesen. Mühelos kann ich mir das Bild des Mannes, der im gleichen Alter wie der zu Unrecht in Endenich eingewiesene Schumann war, in Erinnerung rufen, wie er dort an den Ständen entlanggeht. Ich sehe mich selbst gehen, den Rücken noch ein wenig stärker gebeugt als sonst, die Hände noch ein wenig tiefer in den Hosentaschen. Das stimmt zweifellos. Was nicht stimmt, was nicht stimmen kann, ist, dass meine Erinnerung behauptet, dass es von dem Moment an, in dem ich mich auf die Suche nach ihr begab, bitterkalt war. Außerdem behauptet meine Erinnerung, dass es bereits dämmerte. Auch das kann so nicht gewesen sein. So lange bin ich doch nicht an den Ständen auf dem Plein, auf dem Lange und Korte Voorhout sowie am Rande des Hofvijvers entlanggegangen? Was ebenso wenig stimmen kann, was meine Erinnerung aber hartnäckig behauptet, ist, dass in allen Ständen flackernde Petroleumlampen hingen. Es war doch windstill? Dennoch sehe ich mich dort schlendern, und es ist eiskalt und schon dunkel, die Straßenlampen leuchten überschwänglich, die Petroleumlampen flackern ungeduldig, Pferde scharren mit den Hufen. An einer der Buden bleibe ich stehen. Eine Frau, von runden Stoffballen verdeckt, sagt zu einem Mann, dessen eine Gesichtshälfte von einer Petroleumlampe erhellt wird: »Zwischen uns ist es nun endgültig aus.«
»Nur gut«, sagt der Mann verbittert, »dann muss ich auch nicht länger unter all den Spannungen leiden.«
»Es ist aus«, schnaubt die Frau.
»Zum Glück«, ruft der Mann, »endlich!«
»Zwischen uns ist es absolut, endgültig, vollkommen und unwiderruflich aus. Schluss. Aus. Ende.«
Mit einem braunen Zollstock schlägt sie wütend auf die Stoffballen. Dabei wirbelt so viel Staub auf, dass das Licht der Petroleumlampe gedämpft wird.
»Schluss!«, schreit sie. »Es ist aus.«
»Wenn du wüsstest, wie glücklich du mich machst mit dem, was du sagst«, ruft der Mann.
Wütend geißelt die Frau ihre Ballen. Sie packt einen zweiten Zollstock und trommelt damit auf den Stoff. Sie sieht aus wie eine begeisterte Schlagzeugerin. Während ich sie beobachte und das kräftige Niesen höre, das der von ihr aufgewirbelte Staub ihr entlockt, überkommt mich ein Gefühl vollkommener Vergeblichkeit.
Was mich stört, ist meine unzureichende Formulierung. Man kann das Wort »Vergeblichkeit« verwenden. Es kommt dem Ganzen am nächsten. Aber das Wort bringt nicht die bodenlose Hoffnungslosigkeit des Gefühls zum Ausdruck, das mich dort überkam, dort an dem Stand am Hofvijver, mit der niesenden Frau, die zwischen dem Niesen ständig jammerte: »Es ist vorbei, es ist aus zwischen uns«, und dem Mann, dessen Gesicht im Dunkeln blieb und der regungslos dastand und kein Wort mehr sagte. Es war, als würde unter meinem Zwerchfell die Sechste Sinfonie von Schostakowitsch gespielt. Es war, als hätte ich versagt, als hätte ich mein Leben lang versagt und würde es nie wiedergutmachen können.
2
Wenn nichts passiert, vergeht die Zeit wie im Flug. Gut ein Jahr später rief Hester mich an: »Ein Freund von mir hat einen Roman geschrieben, und das Buch wird in der Buchhandlung Maria Heiden in Rotterdam vorgestellt. Er hat mich gebeten, bei der Gelegenheit zu singen. Würdest du mich begleiten?«
»Natürlich, gibt es denn ein Klavier?«
»Das wird organisiert.«
Hester holte mich mit ihrem schmutzigen Audi ab. Wir fuhren in einem langen Stau nach Rotterdam. Unter dem bleigrauen Novemberhimmel kam uns auf der anderen Fahrbahn ein zweiter Stau entgegen. Viele Fahrer hatten bereits das Licht eingeschaltet. Dadurch schien es noch nebliger zu sein, und in dem Nebel kamen die blendenden Scheinwerfer auf uns zu.
»Ich tu das für dich, nicht für den Autor«, sagte ich.
»Ach, aber Job ist wirklich ein netter Kerl.«
»Jeder ist nett, solange es ihm gut geht.«
»Er ist wirklich nett.«
»Ein Schriftsteller?«
»Sind Schriftsteller denn nicht nett?«
»Nein, die hängen alle an der Flasche. Das sind lauter Nachteulen. Die geben sich alle einen Hauch von: ›Sieh nur, wie feinfühlig ich bin.‹ Alle haben sie einen Hang zu hochtrabenden Formulierungen, wo eine einfache Aussage gereicht hätte. Meine Klavierlehrerin hat immer gesagt: »Literatur? Das ist nichts anderes, als mit teuren Wörtern schönes Wetter spielen.«
»Job hat aber ein schönes Buch geschrieben.«
»Worüber?«
»Über die eheliche Liebe.«
»Eheliche Liebe? Die gibt’s überhaupt nicht.«
»Er denkt schon.«
»Hat er Händel in seinem Buch verarbeitet?«
»Was faselst du jetzt?«
»Na ja, Händel! Wenn ich über die Ehe schreiben würde, dann müsste ich doch auf jeden Fall etwas über das kurze Duett ›Who calls my parting soul from death‹ aus Esther von Händel sagen. In wenigen Takten wird da mehr zum Ausdruck gebracht, als man in einem Buch über die Ehe je sagen könnte. Alles, was ein Autor kann, kann ein Komponist besser. Du glaubst doch nicht, ein Schriftsteller könnte uns mit Barbarina um eine verlorene Nadel trauern lassen, ein paar Takte in f-Moll, damit kann sich nichts messen.«
»Schon, aber wenn du nicht wüsstest, dass Mozart an der Stelle ein Mädchen um eine verlorene Nadel trauern lässt, dann würdest du, wenn du die Musik hörst und kein Italienisch verstehst, meinen, dass sie mindestens ihren Liebsten verloren hat.«
»Um so viel Trauer hervorzurufen, braucht ein Schriftsteller ein ganzes Buch! Wirklich, was ein Schriftsteller kann, kann ein Komponist tausend Mal besser.«
»Du kannst mit Musik niemanden zum Lachen bringen.«
»Das wollen wir erst mal sehen, wobei ich zugebe, dass sich Humor und Musik schlecht vertragen. Wenn du vor Lachen brüllen willst, kannst du dir vermutlich besser einen lustigen Film ansehen, anstatt ein Buch zu lesen. Ich hasse Filme, aber bei Manche mögen’s heiß habe ich gelacht, bis ich Bauchschmerzen hatte. Kannst du mir ein Buch nennen, bei dem …«
»DiePickwickier von Dickens.«
»Das habe ich noch nicht gelesen.«
»Dann beneide ich dich, da hast du das schönste Buch, das es gibt, noch vor dir.«
In Rotterdam brauchten wir für die Parkplatzsuche mehr Zeit als für die ganze Hinfahrt. Hester sang zu spät, zu spät begleitete ich sie. Über das Klavier hinweg sah ich eine junge Frau den Laden betreten. Aus der Ferne sahen wir einander an. Sofort verschwand sie hinter einem Bücherregal.
Hester sang eine Schlussnote, ich improvisierte ein Nachspiel. Die junge Frau kam wie eine scheue Rohrdommel zum Vorschein. Sie trug einen karierten Blazer. Die hohen Buchstapel als Deckung nutzend, kam sie langsam näher. Sie schlug einen Bogen, war plötzlich wieder hinter einem Regal verschwunden, das links von mir stand, tauchte dann schräg neben mir auf und fragte: »Wissen Sie, ob die erste Platte, die Sie aufgenommen haben, noch lieferbar ist?«
»Ich glaube schon, aber hier werden Sie die nicht finden«, erwiderte ich.
Ich erhob mich langsam. Obwohl sie stattlich war, überragte ich sie. Wir begaben uns zu einem Fenster im hinteren Teil des Ladens.
»Möglicherweise hat Dankert noch ein Exemplar vorrätig«, sagte ich.
»Da war ich schon.«
Wir schauten zum Fenster hinaus. Mir kam es so vor, als bildeten wir beide zusammen einen Elektrisierapparat. Wir hätten einander nur die Köpfe zuzuneigen brauchen, und schon wären die Funken übergesprungen.
»Ich glaube, ich habe zu Hause noch ein Exemplar der Schallplatte«, sagte ich. »Das können Sie haben.«
»Vielen Dank!«
»Wenn Sie mir Ihre Adresse geben, schicke ich Ihnen die Platte, falls ich noch eine habe.«
»Oh, meine Adresse ist wertvoll. Rufen Sie mich doch an, wenn Sie noch eine finden.«
»In Ordnung«, sagte ich.
»Ich geben Ihnen die Nummer der Praxis. Wenn Sie noch eine Platte finden, können wir uns vielleicht treffen. Sind Sie gelegentlich in Den Haag?«
»Ja, wenn ich in die Musikbibliothek gehe.«
Sie wickelte die Bauchbinde von Jobs neuem Buch und schrieb ihren Namen darauf: Sylvia Hoogervorst. Darunter notierte sie eine Telefonnummer: 0 10-5 27 54 34. Sie gab mir den Papierstreifen.
KV 527, dachte ich, Don Giovanni von Mozart; ich sah sie an, sie erwiderte meinen Blick und verabschiedete sich dann. Mit zitternden Knien ging ich zum Klavier zurück.
»Na«, sagte Hester, »das war aber ein sehr intimes Gespräch, da am Fenster.«
»Wunderbare Frau«, sagte ich.
»Papperlapapp, schöne Frauen, davon gibt es viele, und von der Seite sah sie außerdem aus wie eine strenge Lehrerin.«
Hester musterte mich und sagte spitz: »Du wirst ja ganz blass.«
»Ich darf doch wohl auch mal blass werden«, erwiderte ich und rutschte näher ans Klavier. Mein Rücken sehnte sich nach einer Lehne, aber Klavierhocker haben nun mal keine Lehnen. Meine Finger legten sich schicksalsergeben auf die Tasten. Behutsam schlugen sie einen Akkord an. Neugierig wartete ich auf das, was erklingen würde. Ich hörte ein tiefes es, zwei as und ein g. »Mild und leise«, dachte ich. Vorsichtig bewegten sich meine Finger über die Tasten. Während ich so leise wie möglich weiterspielte, hob ich den Blick. Im schwarzglänzenden Holz des Instruments sah ich das Spiegelbild ihres Gesichts. Es machte den Eindruck, als wäre sie ganz klein und stünde sehr weit entfernt. Sie fragte mich: »Sie treten doch demnächst wieder in einer Kirche auf?«
»Ja«, sagte ich.
»Braucht man da eine Eintrittskarte?«
»Ich habe ein paar Karten dabei. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen eine geben.«
»Oh ja, gern«, erwiderte sie.
Einen kurzen Moment lang hielten wir beide die Karte fest. Sie ging. Hester sah mich leicht vorwurfsvoll an, und ich sagte: »Ich kann doch nichts dafür, dass sie noch einmal zurückgekommen ist.«
3
Ich hatte den Staub von der Plattenhülle gewischt. Die Bauchbinde hatte ich in das vordere Fach meines Portemonnaies gesteckt. Was hielt mich davon ab, sie anzurufen? Wovor fürchtete ich mich? Was war harmloser als ein kurzes Treffen in Den Haag, bei dem ich ihr die entstaubte Platte überreichen würde?
Trotzdem kam ich irgendwie nicht dazu, die Don-Giovanni-Nummer zu wählen.
Im November machte ich eine Radiosendung über Bearbeitungen von klassischer Musik durch Popmusiker. Zuerst spielte ich »A whiter shade of pale«. »Nun«, sagte ich, »hören Sie das Stück von Bach, das Keith Reid und Gary Brooker ihrem Lied zugrunde gelegt haben, die Kantate ›Ich steh’ mit einem Fuß im Grabe‹.«
»Mag sein, aber erst muss ich ein neues Tonband holen«, sagte der Techniker hinter der Glasscheibe.
Er ging los und ließ mich in meiner schalltoten Kabine allein. Es schien fast, als wollte er mir, ein Telefon des Rundfunks in Reichweite, absichtlich die Gelegenheit bieten, sie anzurufen. Trotzdem saß ich auch jetzt erst noch eine Weile mit dem Hörer in der Hand da, ehe ich ihre Nummer wählte. Es klingelte zwei Mal. Eine dezente, leicht schleppende Mädchenstimme sagte: »Sie sind mit dem automatischen Anrufbeantworter der tierärztlichen Praxis Westvest verbunden. Sie können …«
Erleichtert legte ich auf. Zum Glück, sie war nicht erreichbar. Offenbar arbeitete sie als Assistentin bei einem Tierarzt. Aber warum hatte sie mir ihre Privatnummer nicht gegeben? War sie etwa verheiratet? Oder lebte zumindest mit jemandem zusammen? Wollte sie verhindern, dass ich ihren Mann oder ihren Freund am Telefon hatte? Aber warum? Wie dem auch sein mochte: Ich hatte mich an unsere Verabredung gehalten, ich hatte angerufen. Jetzt war ich von weiteren Verpflichtungen befreit. Ich durfte die Bauchbinde wegwerfen. Ich drehte mich auf meinem Bürostuhl im Kreis und sah mich nach einem Papierkorb um. Es gab keinen. Also konnte ich die Bauchbinde ebenso gut aufheben. Die Nummer kannte ich sowieso auswendig: Vorwahl von Rotterdam, dann Don Giovanni, dann Kantate 54 von Bach, »Widerstehe doch der Sünde«, und zum Schluss Kantate 34 von Bach, »O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe«.
Jedes Mal, wenn ich in den darauffolgenden Wochen etwas von Bach oder Mozart hörte, dachte ich mit einem vagen Schuldgefühl an die Telefonnummer. Trotzdem hätte ich sie wahrscheinlich nicht noch einmal gewählt, wenn ich mich nicht mit meinem Freund Frank unterhalten hätte. Er ist Psychiater, was nicht für ihn spricht, er mag Mozart nicht, was unverzeihlich ist, und dennoch kann ich mich, wenn wir im Sommer in seinem Garten sitzen und der Abend dämmert, mit ihm so angenehm unterhalten wie mit niemandem sonst.
Diesmal saßen wir allerdings in seinem Wohnzimmer am offenen Kamin.
»Joanna hat demnächst wieder eine Reihe von Auftritten im Ausland und ist ein paar Wochen unterwegs.«
»Wenn das schlimm für dich ist«, erwiderte er, »dann nimm dir doch so lange eine Freundin.«
»Als ob mich noch eine Frau haben wollte.«
»Du musst nur in deinen Garten gehen und in die Hände klatschen«, sagte er, »dann kommen sie aus allen Richtungen angelaufen. Wenn du die Frauen abwehren wolltest, die etwas von dir wollen, dann müsstest du eine Frauenwehr bauen.«
Später am Abend stand ich in meinem Garten. Ich klatschte in die Hände. Aus der Wiese am Wassergraben, der meinen Garten begrenzt, erhob sich ein alter Reiher. Mit einem heiseren Schrei flog er durch die kalte Luft.
»Eine Frauenwehr«, rief ich dem Reiher hinterher, »wie kommt er darauf? Eine Frauenwehr!«
Mitte Dezember machte ich eine Sendung über die Streichquartette von Janáček. Wieder musste ich warten, weil das Tonband gewechselt wurde. Eine Digitaluhr zeigte 15:27. Eine Weile betrachtete ich die Ziffern. Sie kamen mir vor wie ein Code für das Wort Frauenwehr. »Mal sehen, ob du recht hast, Frank«, murmelte ich. Erneut wählte ich die Nummer. Es klingelte fünf Mal. Ich wollte schon auflegen, als sich dieselbe schleppende Mädchenstimme meldete: »Tierarztpraxis Westvest.«
»Könnte ich vielleicht Sylvia Hoogervorst sprechen?«, fragte ich.
»Einen kleinen Moment, bitte«, sagte die Stimme.
Die Leitung rauschte wie ein altes Radio.
»Bis 15: 30 warte ich«, nahm ich mir vor. »Danach lege ich auf und lösche die Nummer aus meinem Gedächtnis. Frauenwehr, ist das zu fassen!«
Drei Sekunden vor 15:30 Uhr erklang ihre Stimme.
»Hier Sylvia Hoogervorst.«
»Hier Alexander Goudveyl. Ich habe auf dem Speicher noch ein verstaubtes Exemplar der Platte gefunden. Deshalb wollte ich nun gern einen Termin mit Ihnen ausmachen. Sie wohnen doch in Den Haag?«
»Nein, ich wohne in Breukelen.«
»Ach, aber … sind Sie denn öfter in Den Haag?«
»Das eigentlich nicht. Ich habe nur Den Haag gesagt, weil ich dachte, dass Sie öfter dort sind, und weil es für mich kein Problem ist, kurz hinzufahren.«
»Aber wenn Sie in Breukelen wohnen und ich einmal in der Gegend bin, dann können wir uns doch dort verabreden?«
»Ich denke, dass es einfacher ist, wenn wir uns in Den Haag …«
»Ja, aber das ist gar nicht nötig. Dann müssen Sie extra nach Den Haag …«
»Ich dachte, das wäre für Sie das Einfachste.«
»Ich bin öfter in der Gegend von Breukelen als in Den Haag.«
»Tja, dann … dann gut. Wann sind Sie …?«
»Kommenden Freitag.«
»Da kann ich nicht, da muss ich arbeiten.«
»Weiter … nächste Woche vielleicht, aber das steht noch nicht fest. Soll ich, wenn ich weiß, wann ich in Breukelen sein werde, noch einmal anrufen?«
»In Ordnung«, sagte sie.
»Abgemacht«, stimmte ich zu, »bis bald dann.«
Brav legte ich den Hörer auf die Gabel. Ich starrte eine Weile durch die Glasscheibe in den leeren Raum auf der anderen Seite. Warum hatte sie kein Treffen in Breukelen vereinbaren wollen? Lebte sie dort mit einem schäbigen rothaarigen Tierarzt zusammen, der in Wut geriet, wenn er einen Mann roch? Und warum klang ihre Stimme am Telefon so frostig und sachlich? Frostig? War das der richtige Ausdruck? Oder klang sie kühl, effizient? Oder nur unpersönlich? Mir war, als hörte ich ihre Stimme noch, eine Stimme ohne Wärme, ohne Geschmeidigkeit, ohne Modulation. Das ist natürlich ihre Praxisstimme, dachte ich, da kannst du ihr nicht verübeln, dass sie so kurz angebunden ist und frostig klingt. Den ganzen Tag lang muss sie das Bellen von Bernhardinern übertönen.
Dennoch wog der beinahe mürrische Klang der Stimme den verlockenden Ausdruck »Frauenwehr« mühelos auf, der mir beim Anblick eines Telefons in den Sinn kam. Zum Anrufen kam ich nicht mehr. Vielleicht vergaß ich sie sogar.
Nach dem Ende unseres »Kirchenkonzerts«, wie Hester und ich unseren Auftritt nannten, schlenderte ich im schattenreichen Kreuzgang über die Grabplatten. Oben im Gewölbe flatterte eine Fledermaus: »Du solltest Winterschlaf machen«, murmelte ich. Ein Stück weiter standen Konzertbesucher und unterhielten sich noch. Musste ich mich zu ihnen gesellen? Mir Komplimente über meine routinierte Begleitung anhören? Es war, als sähe ich mich selbst durch die Augen der Fledermaus über die Grabplatten wandeln. Aus großer Höhe schaute ich auf meinen kahlen Schädel hinab. Wie unbedeutend ich aussah. Da stand ich, ein fünftklassiger Komponist. Aber warum sollte ich mich selbst so disqualifizieren? Schließlich konnte es mir genauso ergehen wie Bohuslav Martinů, der sein Leben lang veredelte Nähmaschinenmusik komponiert hatte, bis ihm kurz vor seinem Tod ganz unerwartet eine paar unvergängliche Meisterwerke wie die Fantaisies symphoniques und die Fresques de Piero della Francesca gelungen.
Würde es mir auch einmal vergönnt sein, mich selbst zu übertreffen? Oder würde ich immer zu den Stümpern und Pfuschern gehören? Und würde ich immer nur wegen meiner Bearbeitungen und semiklassischen Kantilenen berühmt bleiben, die Hester mit so viel Flair und Überzeugung vorzutragen verstand, für die sich Joanna aber stellvertretend schämte, obwohl diese Bearbeitungen ihr und mir ein komfortables Leben verschafften. Schon seit Jahren stand mein Leben im Zeichen des fortwährenden Versuchs zu akzeptieren, dass ich nur ein winziges Talent hatte. Trotzdem wurde ich ständig eingeladen. Und um Hester einen Gefallen zu tun, schlug ich nur selten eine Einladung aus, weshalb ich immer wieder mit meinen eigenen armseligen harmonischen Einfällen, meinen glatten, ausgetüftelten, banalen melodischen Formeln und meiner eingängigen Rhythmik konfrontiert wurde. Es war ein Elend, nur ein Talent zu haben, nämlich das Talent zur Einsicht, dass man kein Talent hat.
Ich schaute zu der Fledermaus hinauf und erschauderte. Nicht vor Kälte, ich friere nie. Dann sah ich sie näher kommen. Sie trug ein Band im lockigen Haar. Wenn eine Frau ein solches Band trägt, ist sie bei mir unten durch. Sie ging über die Grabplatten an mir vorüber, ich sagte: »Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich die Schallplatte für dich mitgebracht! Aber ich werde dich anrufen!«
»Ich warte einfach ab«, erwiderte sie, und schon war sie vorüber, auf den Grabsteinen, die unter ihren Absätzen so hohl klangen. Am Ausgang zögerte sie kurz, schaute sich aber nicht um. Sie hatte keinen Mantel an und trug nur den Rotterdamer Blazer; offenbar war sie mit dem Wagen gekommen.
Sobald sie die Kirche verlassen hatte, folgte ich ihr. Draußen herrschte ein weißer Dezembernebel. Das Licht der Straßenlaternen triefte herab. Ihr Schein reichte nicht weit. Rasch ging ich um die Kirche herum. Ich schaute in alle Straßen, die auf den Kirchplatz mündeten. Sie war weg. Wahrscheinlich war sie in ihr Auto gestiegen und gleich weggefahren.
4
Obwohl mir die Worte »Frauenwehr« und »Ich warte einfach ab« weiterhin durch den Kopf gingen, kam ich wieder nicht dazu, in der Praxis anzurufen. Ich wartete selbst ab. Allerdings verspürte ich jedes Mal um 15:27 ein kurzes Zucken, die Versuchung, den Hörer vom Telefon zu nehmen. Und jedes Mal dachte ich dann: Lass es, das bringt nur Schwierigkeiten.
Joanna wurde gebeten, in Köln einzuspringen. Sie fuhr am Dienstagmorgen ab. Am Sonntag würde sie wiederkommen. Nachmittags um 15:27 griff ich zum Telefon. Erneut erklang die schleppende Mädchenstimme.
»Könnte ich vielleicht Sylvia Hoogervorst sprechen?«, fragte ich.
»Sie operiert gerade«, antwortete die schleppende Stimme. »Ich glaube nicht, dass ich sie jetzt stören kann.«
»Oh, das macht nichts«, erwiderte ich.
»Vielleicht kann ich ihr den Hörer ans Ohr halten.«
»Das ist nicht nötig !, so dringend ist es nicht.«
»Sie signalisiert mir, dass ich das tun soll. Einen Moment bitte, ich muss nur kurz den Apparat woanders hinstellen.«
»Nicht nötig!«, rief ich, doch am anderen Ende der Leitung war nur undeutliches Poltern zu hören. Dann erklang ihre Stimme: »Hier Sylvia.«
»Alexander hier, ich glaube, ich störe gerade sehr.«
»Nein, kein Problem, ich kann beim Sprechen einfach weiterarbeiten.«
»Handelt es sich um einen Hund oder eine Katze?«
»Es ist ein altes Meerschweinchen«, antwortete sie. »Manchmal weiß man nicht, was das soll. Für siebenfünfzig kriegt man in der Zoohandlung ein neues Meerschweinchen, und ich muss hier ein altes Tier operieren, das sowieso bald stirbt, und so eine Operation kostet fünfzig Gulden.«
»Was hat das Meerschweinchen denn?«
»Einen Tumor in der Blase.«
»Das hört sich an, als würde ich Sie bei einer sehr kniffeligen Arbeit stören. Soll ich später noch mal anrufen?«
»Nein, ich muss anschließend noch eine Penisamputation machen.«
»Dann sollten wir rasch versuchen, einen Termin auszumachen. Vielleicht würden Sie … warum sage ich eigentlich Sie? … würdest du, wenn du schon bereit bist, von Breukelen nach Den Haag zu fahren, um die Platte zu holen, auch von Breukelen aus zu mir nach Hause kommen, um …«
»Ja, das wäre vielleicht möglich.«
»Von Breukelen zu mir nach Hause ist kürzer als von Breukelen nach Den Haag. Hast du ein Auto?«
»Ja.«
»Oh, dann ist es ganz einfach. Weißt du, wo ich wohne?«
»Ich habe schon mal den Namen eines Dorfs fallen hören.«
»Sobald du das Dorf erreichst, musst du nach einer katholischen Kirche Ausschau halten. An der Kirche biegst du rechts ab. Dann ist es das zweite Haus am Wasser.«
»Das finde ich schon. Wann soll ich kommen?«
»Wann hast du Zeit? Heute? Morgen? Übermorgen?«
»Übermorgen ist Donnerstag. Da arbeite ich abends nicht. Soll ich dann kommen? So gegen neun?«
»Ist gut«, sagte ich.
Zwei Tage lang widerstand ich der Versuchung, sie erneut anzurufen und die Verabredung abzusagen. Da hatte ich endlich Zeit zum Komponieren, und ich vereinbarte ein solches Treffen! Warum konnte ich an nichts anderes denken? Warum war ich vor dieser Begegnung aufgeregt wie vor einem Besuch beim Zahnarzt? Was hinderte mich daran, die Haustür nur einen Spalt zu öffnen, ihr die Platte zu geben, ihr gute Nacht zu wünschen und die Tür wieder zu schließen?
Letztendlich spaltete ich am Donnerstag dann doch Buchenholzklötze für den Kamin. Um halb acht stellte ich eine Flasche Chablis kalt. Bei allem, was ich tat, war mir, als schaute die Fledermaus zu. Hoch über mir flatterte sie herum. Sie sah, wie ich ruhelos über den Hof irrte. Sie hörte, wie ich Joanna zitierte: »Hast du wieder Hummeln im Hintern?« Sie beobachtete mich, als ich, um mich zu beruhigen, die b-Moll-Fuge aus dem zweiten Teil des Wohltemperierten Klaviers spielte. Ob eine Fledermaus irgendwas mit Musik anfangen konnte? Ihr Gehör ist zehntausend Mal besser als unseres. Deshalb kann eine Fledermaus auch nur die allerbesten Kompositionen wertschätzen. Und daraus auch nur die allerbesten Takte, zum Beispiel die Takte 85 und 86 aus der b-Moll-Fuge. Wenn es Gott gibt, ist dort Seine Stimme zu hören.
Ehe ich Takt 85 erreichte, klingelte es. Als ich in der Diele das Licht einschaltete, sah ich sie mit halb abgewandtem Gesicht vor der Tür stehen. Sie trug den Blazer mit den kleinen Karos. Das Haarband fehlte. Über der Schulter lag der braune Riemen ihrer Tasche. Wieso rührte mich das? Was mich nicht rührte, war ihre blaue Jeans. Ich hasse Denim.
Sobald ich die Haustür geöffnet hatte, trat sie ganz selbstverständlich ein.
»Es war ganz leicht zu finden«, sagte sie. »Ich glaube, ich bin sogar ein wenig zu früh.«
»Ich hatte später mit dir gerechnet, der Kamin ist noch nicht an.«
Sie folgte mir ins Wohnzimmer.
»Setz dich so nah wie möglich an den Kamin«, riet ich ihr, »ich zünde jetzt das Feuer an.«
Sie legte ihre Tasche auf die Couch und blieb stehen.
»Was möchtest du trinken?«, fragte ich sie.
»Ein Bier«, antwortete sie.
Verdutzt lauschte ich all den einfachen Sätzen. Es war, als würde gar nichts Unalltägliches passieren. Im Kamin knisterte das Holz einer Apfelsinenkiste, das ich zum Anfeuern benutzte. Von Hochspannung wie in der Rotterdamer Buchhandlung konnte keine Rede sein. Sie schien eine ganz normale Frau zu sein.
Von neun Uhr abends bis zwei Uhr nachts saßen wir vorm Kamin, einer links und einer rechts vom Feuer. Immer wieder gab es Momente des Schweigens, und ich dachte: Mein Gott, mit der Frau kann man sich ja kaum unterhalten.
Sie trank vier Bier, ich trank vier Bier. Im Laufe des Abends verfeuerte ich eine Kiste Pappelholz, eine Kiste Holunderholz und den Kasten mit den gespaltenen Buchenblöcken.
»Alle Holzsorten brennen unterschiedlich«, sagte ich, um irgendwas zu sagen. Wir betrachteten die schwefelgelben Flammen des Holunders, das solide, ruhige Feuer der Buchenscheite. Wir lauschten dem Pappelholz. Pappelholz produziert mehr Lärm als Wärme. Funken fliegen ins Zimmer. Pappelholz kann man gut verfeuern, wenn nicht geredet wird. Es hört sich dann so an, als würde doch gesprochen. Außerdem muss man wegen der Funken ständig aufpassen, dass es keinen Zimmerbrand gibt.
»Du müsstest ein Funkenschutzgitter haben«, sagte sie.
»Ja«, antwortete ich und fragte mich dabei, wann sie wohl gehen würde.
Sie ging nicht. Ich stellte ihr Fragen. Wie alt sie sei. »Dreißig.« Wo sie studiert habe. »In Utrecht, Tiermedizin.« Sie berichtete, als ich sie danach fragte, über Hunde und Katzen, über Glanzsittiche und Papageien, über Meerschweinchen und Wüstenmäuse. Dann fragte sie mich etwas: »Weißt du, wie Akazienblätter aussehen?«
»Wieso willst du das wissen?«
»Ich lese gerade Paustowski, und es ist ständig von Akazien die Rede. Ich habe mich gefragt, wie die wohl aussehen.«
»Ich glaube, ich habe irgendwo ein Buch über Bäume«, sagte ich.
Mit dem Buch setzte ich mich neben sie auf die Couch und dachte: Ich lege einfach einen Arm um ihre Schulter, dann erschreckt sie und geht bestimmt. Oder sie erschreckt nicht, und das ist auch in Ordnung, denn dann müssen wir jedenfalls nicht mehr mühsam ein Gespräch in Gang halten.
Sie blätterte. »Hier«, sagte ich, »eine Akazie.«
»Das ist ein Akazie? Was für saukleine Blätter! Ist das alles?«
Entrüstet schaute sie mich an. Mein Arm bekam einen Schreck. Hastig nahm ich wieder auf meinem eigenen Stuhl Platz. Dann herrschte Schweigen. Ein Buchenscheit kokelte vor sich hin. Wie sich zeigte, war mein Arm allerdings durchaus in der Lage, einen knorrigen Holunderstumpf in den Kamin zu werfen. Sogleich loderten schmutziggelbe Flammen auf.
»Schon damals in Den Haag hatte ich dich nach der Platte fragen wollen«, sagte sie.
»Damals in Den Haag?«, fragte ich erstaunt.
»Ja, beim Voorhoutfestival.«
»Warst du …«
»Ich war mit meiner Freundin Petra dort.«
»Warst du auch … nein, warst du … wie ist das nur möglich … warst du auch, unglaublich.«
»Hast du mich in der Buchhandlung nicht erkannt?«
»Nein.«
»Aber wir waren uns in Den Haag schon begegnet.«
»Vielleicht habe ich mich nicht getraut, dich wiederzuerkennen.«
Es hatte den Anschein, als würde die Enthüllung, dass ich sie bereits zwei Mal gesehen hatte, die Möglichkeit, sich leichthin und scherzend miteinander zu unterhalten, endgültig zunichtemachen. Erstaunt betrachtete ich die schmutziggelben Holunderflammen. Ich kam nicht auf die Idee, für sie etwas auf dem Klavier zu spielen. Ebenso wenig dachte ich daran, eine CD aufzulegen. Wir saßen einfach nur da und folterten einander geduldig mit einem Gespräch, das immer wieder stockte. Das Kaminfeuer tauchte ihre Wangen in ein immer tieferes Rot. Konnte sie nachher überhaupt noch fahren mit all dem Bier intus? Sollte ich vielleicht etwas zu essen machen?
Das Holz war alle, im Kamin war nur noch Glut. Warum blieb sie bloß sitzen? Sie trank noch ein Bier. Wir schwiegen. Eine Turmuhr schlug. Ein Uhr. Wir schwiegen. Die Turmuhr schlug erneut. Halb zwei. Niemand musste befürchten, dass der Abend allzu geschwätzig wurde. Die Uhr schlug. Es war zwei.
»Ich mach mich dann mal auf den Heimweg«, sagte sie.
»Ich hol schnell die Platte, dafür bist du schließlich gekommen.«
Draußen im Hof überreichte ich ihr die Platte. Sie sagte: »Vielen Dank, ich werde mich dafür erkenntlich zeigen, du bekommst ein Geschenk, und ich weiß auch schon, was, ja, ich weiß auch schon, was.« Wir standen im Hof, und es war recht kalt, obwohl es nicht fror.
»Ja«, sagte sie erneut, »ich weiß auch schon, was.«
Sie sah mich nicht wirklich an. Dennoch entdeckte ich in ihren Augen etwas, das beinahe wie Spott aussah. Warum? Es kam mir so vor, als wollte sie mich auslachen, traute sich aber nicht so recht. Ich sah den Blick, der möglicherweise gar nicht spöttisch gemeint war, ich sah das Funkeln in ihren Augen, und es schien, als würde nur eine Geste dazu passen. Vorsichtig legte ich meinen Arm um sie. Sie reagierte sofort, schloss die Augen und drückte sich an mich. So standen wir eine Weile. Es war ziemlich kalt, obwohl es nicht fror, und ich sagte: »Du wirst dich noch erkälten in diesem Blazer. Lass uns lieber hineingehen.«
Wir gingen ins Haus und standen in der Diele. Ich schlang beide Arme um sie, sie schlang einen Arm um mich. Sie hatte nur einen Arm frei, da sie in der Rechten die Schallplatte hielt.
»Komm«, sagte ich, »leg die Platte hin und nimm die Tasche von der Schulter.«
Sie legte die Platte hin, nahm die Tasche ab und schlang beide Arme um mich. Es sah so aus, als gäbe es nur eine Möglichkeit zu verbergen, dass wir offenbar nicht imstande waren, ein lebendiges Gespräch zu führen. Vorsichtig drückte ich meine Lippen auf ihren schweigsamen Mund. Was ist ein Kuss? Vier Lippen berühren einander paarweise. Trotzdem wusste ich nach diesem ersten Kuss mehr über sie als nach vier Stunden Schweigen am offenen Kamin. Nach diesem ersten Kuss kannte ich – ich bin schließlich Musiker – Tonart, Takt und Tempo. Wir küssten einander, und ich, der ich ebenso alt wie Schumann war, als er in »geistiger Umnachtung« versank, wusste, dass ich niemals zuvor so ruhig, so hilflos geküsst hatte. Darum also redet sie nicht, ging es mir durch den Kopf, der Kuss ist ihr bevorzugtes Ausdrucksmittel, der Kuss ist ihre Geheimwaffe. Sie küsste beherrscht, geduldig, lang anhaltend. Ihr Kuss wirkte keusch. Von Begierde oder Launenhaftigkeit konnte keine Rede sein. Sie küsste, wie Bruckner komponierte.
Sie nahm ihre Lippen von meinen und sagte: »Du hast sehr schöne Zähne.«
Ich wollte auch etwas sagen, bekam aber kein Wort heraus. Also summte ich eine einfache Notenfolge, ein langes g, a, ais, b, b, a.
Wie lange wir uns geküsst haben? Eine halbe Stunde? Eine Dreiviertelstunde? Jedenfalls gingen wir zurück zum noch glühenden Kamin. Wir saßen eine Weile auf der Couch und küssten einander. Anschließend lagen wir eine Zeit lang auf der Couch, einander immer noch küssend. Erst jetzt, als wir ganz dicht aneinander auf der schmalen Couch lagen, roch ich sie. Der Augenblick, in dem ich ihren Duft einatmete – nie werde ich ihn vergessen. Alles, was davor geschehen war, schien nur eine Vorbereitung auf diesen Moment gewesen zu sein. Wie sie roch, lässt sich nicht sagen. Geruch ist ungreifbar. Die Sprache hat, anders als für Töne und Farben, keine Namen für Gerüche. Man kann nur sagen: »Sie roch wie …«, und dann muss man etwas nennen, dessen Geruch bekannt ist. Man kann sagen: »Es roch wie Kalmus«, doch hilft einem das weiter? Weiß man dann mehr? Wie sie roch, lässt sich, auch wenn sich in den Duft ihres Körpers ein Hauch Chanel No 5 mischte, nicht in Worte fassen. Der Duft, ihr Duft, dieser kräftige, atemberaubende und doch leichte Duft, gab mir das Gefühl, als wären alle vergangenen Jahre meines Lebens verschwendet gewesen, weil ich in all dieser Zeit – ein halbes Menschenleben! – diesen Duft nicht gerochen hatte. Elsa hatte recht, wenn sie sang: »Es gibt ein Glück«, und ich summte das lange g und dann a, ais, b, b, a, und es schien fast, als passte zu dieser Melodie der Text: »Es ist sehr hart, es erst zu entdecken, wenn man schon Mitte vierzig ist.«
5
Die Turmuhr schlug vier. Sie sagte: »Jetzt gehe ich wirklich nach Hause.«
Sie erhob sich von der Couch und meinte dann: »Darf ich vielleicht hier auf der Couch schlafen?«
»Natürlich, ich werde dir ein paar Decken holen.«
Mit drei Decken ließ ich sie im Wohnzimmer zurück. Der Kamin glimmte vor sich hin.
Ich lag im Bett und konnte nicht einschlafen. Wenn ich kurz eindöste, wurde ich wieder zur Fledermaus. Sie sah, wie ich an den Marktständen entlanggegangen war, den Rücken gebeugt, die Hände tief in den Hosentaschen. Sie hörte der Frau und dem Mann bei den Stoffballen zu. Jedes Mal ließ mich der Trommelwirbel des Zollstocks aus dem Schlummer fahren. Was mir geblieben war von dieser Erinnerung, die nur noch die Erinnerung an einen Traum zu sein schien, war das hoffnungslose Gefühl der Vergeblichkeit, des Scheiterns, der Unzulänglichkeit.
Morgens um halb zehn öffnete ich vorsichtig die Wohnzimmertür. Sie schlief. Auf dem Kaminsims lag ihr goldenes Armband. Ihre goldenen Ohrringe lagen auf der Fensterbank. Diverse Kleidungsstücke lagen über ein paar Stühle verteilt. Ihre Schuhe standen vor dem offenen Kamin. Sie lag mit dem Gesicht zur Rückenlehne der Couch. Obwohl es kalt war, hatte sie die Decken halb heruntergeschoben. Ihre Schultern und ein Teil des Rückens waren unbedeckt. Eine Weile betrachtete ich die nackten braunen Schultern. Sie waren der Mittelpunkt eines Stilllebens aus Schmuck, Jeans, Schuhen und Blazer. Es sah aus, als wären ihre Sachen in einem Halbkreis um sie herum verstreut. Um die stille Pracht ihres Rückens zu betonen, hatte der Maler ihre Locken wie zufällig über die Schultern drapiert. Andächtig betrachtete ich das Stillleben. Diese Szene musste ich mir einprägen. Hierauf hatte ich die ganzen Jahre gewartet.
Regungslos lag sie da. Nichts bewegte sich. Man konnte nicht einmal sehen, dass sie atmete. Die Vorhänge waren zugezogen. Draußen schien eine blasse Januarsonne. Sie lag da, die Schultern nackt, Locken darüber, und am liebsten hätte ich alles vermessen und mit Kreide markiert, wie es die Polizei nach einem Unfall macht.
Wie lange stand ich so da? Bis zu dem Augenblick, als mir einfiel: Wenn sie jetzt aufwacht, sich umdreht und mich sieht, bekommt sie bestimmt einen Schreck. Lautlos verließ ich das Zimmer. Was sollte ich machen? Sie schlafen lassen? Sie wecken? Undeutlich erinnerte ich mich an eine Bemerkung, der zufolge sie erst um halb eins in der Praxis sein musste. Bis halb elf konnte ich sie auf jeden Fall schlafen lassen.
Um Viertel nach zehn wachte sie auf. Um halb elf hatten Schmuck und Kleidungsstücke ihren ursprünglichen Platz wieder eingenommen. Sie trank eine Tasse Kaffee, und ich fragte sie: »Was für eine Wohnung hast du in Breukelen?«
»Ich habe eine winzige Wohnung. Aber demnächst ziehe ich nach Utrecht. Ich kann dort für einige Zeit ein Apartment in einem besetzten Gutshaus kriegen.«
»Wie bist du in Breukelen gelandet?«
»Nachdem ich aus Rijkswijk weggezogen … ach, das kannst du natürlich nicht wissen, ich habe dort anderthalb Jahre mit meinem Freund zusammengewohnt. Im vorigen Sommer war es dann aus und vorbei. Während unseres Urlaubs in Portugal haben wir den Entschluss gefasst, uns zu trennen. Wir haben vereinbart, dass er in der Wohnung bleiben durfte, während ich den Wagen bekam. Zuerst habe ich bei einer Freundin gewohnt. In einer Lokalzeitung stand dann eine Annonce, in der eine Mansardenwohnung auf einem Bauernhof in Breukelen angeboten wurde.
»Du hast anderthalb Jahre mit jemandem zusammengewohnt?«
»Ja«, erwiderte sie kurz.
Gern hätte ich sie gefragt: »Mit wem?« Und gern auch: »Warum habt ihr euch getrennt?«, aber ich hörte, wie Elsa in Lohengrin aufgetragen wurde: »Nie sollst du mich befragen«, und ich hielt den Mund.
Um halb zwei sagte sie: »Jetzt muss ich wirklich gehen.«
»Die Meerschweinchen warten«, sagte ich.
»Ja«, sagte sie. Wir standen in der Diele, küssten uns, und sie fragte: »Du bist verheiratet. Wie passt das hiermit zusammen?«
»Das passt überhaupt nicht zusammen.«
»Das hier ist also eigentlich unmöglich.«
»So vieles ist unmöglich, und es geschieht doch.«
»Vieles, was möglich ist, geschieht nicht«, erwiderte sie. »Und wie geht es nun weiter?«
»Du hast in der nächsten Zeit bestimmt viel zu tun, Umziehen ist kein Pappenstiel. Wie wäre es, wenn ich dich nach deinem Umzug anrufen würde? Sagen wir, so in drei Wochen?«
»Gut«, sagte sie, »ruf mich nach meinem Umzug an.«
Sie stieg in ihren silbernen Wagen. Schon seit Jahren fragte ich mich, warum Frauen am Steuer attraktiver zu sein scheinen, als sie in Wirklichkeit sind. Sogar sie, deren Liebreiz seit dem vergangenen Abend von Minute zu Minute zugenommen hatte, war am Steuer so atemberaubend, dass mir das Herz im Hals schlug, als sie winkend von meinem Hof fuhr.
Wenn ich durchs Haus ging, wollte ich in den Garten. Irrte ich durch den Garten, dann fiel mir ein: Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, ich sollte mich eine Weile aufs Bett legen. Wenn ich es mir auf dem Bett bequem gemacht hatte, überlegte ich: Gestern habe ich sämtliche Buchenscheite verheizt, ich sollte vielleicht ein wenig Holz spalten. Wenn ich das Beil zweimal gehoben und wieder hatte herabsausen lassen, dachte ich: Warum bin ich nur so unruhig? Es ist wohl besser, ich spiele erst mal ein bisschen Bach. Am Klavier rief ich mich selbst zur Ordnung: »Ruhe, ruhe, meine Seele«, murmelte ich. Dabei schaute ich zum Telefon hinüber und dachte: Idiot, wenn du ihr wenigstens deine Geheimnummer gegeben hättest, dann könnte sie dich anrufen. Aber war das so schlimm? Schließlich konnte ja ich sie anrufen. Laut sagte ich über das Klavier hinweg: »Nein! Wir haben vereinbart, dass ich sie erst in drei Wochen anrufe.« Wütend stand ich auf. Erneut ging ich in den Garten, um Holz zu spalten, und während ich das Beil durch die Luft schwang, versuchte ich, mir ihr Gesicht vorzustellen. Das gelang mir nicht. Viel weiter als bis zu den goldenen Ohrringen und den Locken kam ich nicht. Ihr Gesicht entglitt mir jedes Mal.
Ich muss sie wiedersehen, dachte ich, nur ganz kurz. Dann präge ich mir ihr Gesicht möglichst genau ein. Dann weiß ich für immer, wie sie aussieht. Dann kann ich sie mir jederzeit vorstellen.
Ende der Leseprobe