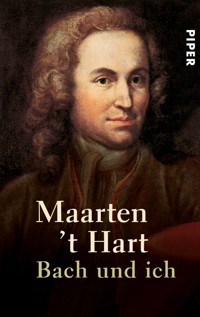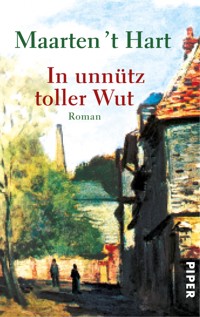9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Maarten 't Hart gehört zu den herausragenden niederländischen Schriftstellern unserer Zeit. Sein Erzählungsband »So viele Hähne, so nah beim Haus« bringt seine Kunst des pointiert Anekdotischen zum Leuchten: Da ist die Studentin Letitia, die schamlos ihre Reize einsetzt, um gleichzeitig promovieren und ihr Haus renovieren zu können; da ist der sture Bäckergehilfe im Warmond der Fünfzigerjahre, den auch das Bestechungsgeld von 1000 Gulden bei der für seinen Bäcker unangenehmen Wahrheit bleiben lässt, oder die musikalische Rate-Runde, deren Abende empfindlich durch den aufdringlichen Hund eines ihrer Mitglieder gestört wird. Maarten 't Harts Kosmos bevölkern skurrile Figuren, die uns mit ihren allzu menschlichen Schwächen entgegentreten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de/literatur
Übersetzung aus dem Niederländischen von Gregor Seferens
Die Übersetzung dieses Buches wurde von der niederländischen Stiftung für Literatur gefördert.
Die Zitate im Kapitel Der Liegestuhl über Djurgården und das Zitat im Kapitel Der Wiegestuhl über den Einzelgänger stammen aus: Hjalmar Söderberg, Doktor GlasDie Rechte an der deutschen Übersetzung von Verena Reichel liegen beim Manesse Verlag, Zürich, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
© 2016 Maarten ’t HartTitel der niederländischen Originalausgabe :» De moeder van Ikabod « bei De Arbeiderspers, Amsterdam, 2016© Piper Verlag GmbH, München 2019Covergestaltung: Cornelia NiereCovermotiv: AKG, PIETER BRUEGEL
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Die Stieftöchter von Stoof
1
2
3
4
5
Die Knochengrube
Survival of the fittest
Der Kompass
Hundemusik
Wie Gott erschien in Warmond
Die Mutter Ikabods
Der junge Amadeus
Der Hauptpreis
Die Ladentür
Maartens Hanfplantage
Scheißprotestanten
Der Speckpfannkuchen
So viele Hähne, so nah beim Haus
Wohnbootbotschafter
Eine sehr kurze Geschichte über Musik
Im Kasino
Der Wiegestuhl
Die Stieftöchter von Stoof
1
Wieder einmal besuchte ich das Städtchen, in dem ich geboren wurde. Ich stieg die steile Deichtreppe hinauf, ging an der Mühle »De Hoop« vorüber, ließ das Haus des Doktors hinter mir und kam am Pumpwerk vorbei. Mein Weg führte mich zu jener Bäckerei, in der ich seinerzeit reformiertes Graubrot gekauft hatte. Die Bäckerei sah jetzt vollkommen anders aus. Der schmale Laden hatte sich in eine Backwarenboutique verwandelt. Als ich daran vorbeiging, schob sich geräuschlos eine Glastür in Richtung Mühle, und es entstand eine Öffnung, durch die man einfach so den Laden betreten konnte. Bevor ich jedoch der Einladung der Glasscheibe folgte, schaute ich zuerst kurz nach oben, um zu sehen, ob das große Schild Hoflieferant dort noch hing. Dem war so. Schelvischvanger, Bäcker und Konditor, seit 1517.
Ich ging hinein. Hinter der Ladentheke tummelten sich drei junge Frauen, die drei identische braungelbe Latzhosen trugen. Sie hatten drei identische braungelbe Baseballkappen auf dem Kopf, unter denen drei identische Pferdeschwänze hervorschauten.
»Womit kann ich dienen?«, fragte mich eine der jungen Frauen.
»Eigentlich mit nichts«, erwiderte ich, »ich wollte nur mal schauen, ob ich hier noch jemanden treffe, den ich von früher kenne.«
»Ich sag der Chefin kurz Bescheid«, sagte die junge Frau.
Sie ging zur Gegensprechanlage und drückte auf einen Knopf: »Chefin, hier möchte Sie jemand sprechen, ein Vertreter oder so.«
Sogleich kam sie zu mir zurück und sagte: »Die Chefin kommt sofort.«
Ich schaute mich um, und mir war nicht gleich klar, wie der Laden so groß hatte werden können. Doch dann dachte ich: Man hat nicht nur das ehemals hinter dem Verkaufsraum gelegene Wohnzimmer hinzugenommen, sondern offenbar auch das Nachbarhaus gekauft, um in der Breite wachsen zu können.
Auf einer Wendeltreppe stieg aus der Tiefe (befand sich dort immer noch die Backstube?) eine kräftige, große Frau herauf. Auch sie trug die recht plumpe, braungelbe Latzhosenuniform. Zum Glück fehlten die Kappe und der Pferdeschwanz. Während sie langsam nach oben kam, bewegte ich mich auf der Kundenseite des Verkaufstresens zu der Stelle, wo sie den Laden betreten würde. Als wir auf gleicher Höhe waren, rief ich: »Nein, tatsächlich, Dina, du bist es! Ist das denn die Möglichkeit!«
Sie sah mich misstrauisch an, dann lächelte sie plötzlich und erwiderte: »Jetzt weiß ich, wen ich vor mir habe. Mensch, hast du dich verändert, all deine schönen Locken sind verschwunden.«
»Du hast dich überhaupt nicht verändert«, sagte ich, »kein bisschen. Du siehst immer noch toll aus, hätte ich dich damals doch bloß in den Zure Vischsteeg gezogen, um dich zu küssen.«
»Hätte ist ein armer Mann«, erwiderte sie. »Haben ist für den, der’s kriegen kann.«
»Der Laden ist ja wirklich riesig geworden.«
»Ja, ja, Schelvischvanger, Bäcker und Konditor, seit 1517.«
»Du bist keine Schelvischvanger.«
»Ich nicht, aber meine drei Stiefschwestern.«
»Sind sie die Eigentümerinnen?«
»In gewisser Weise, aber ich bin auch Teilhaberin, oder wie du es auch immer nennen willst. Ach, wenn du wüsstest, wie das alles gelaufen ist … wie wir haben kämpfen müssen … Aber ich habe dir damals schon gesagt: Wir haben zwei Trümpfe in der Hand, wir sind wunderschön und wir sind viele … All meine Schwestern und Stiefschwestern haben sich anständige Kerle geangelt, und mit ihrer Hilfe … ach, jetzt finde ich es auf einmal schade, dass wir das Wohnzimmer für den Laden geopfert haben, dort würde ich jetzt gern noch eine Weile mit dir sitzen, du auf der Zwiebacktonne mit einem Windbeutel in der Hand und einer Tasse Kaffee … wie du die Windbeutel verputzt hast … zwischen zwei Schlägen der Turmuhr, drei große Bissen und weg.«
2
Die gute alte Zeit! Man musste das Haus nicht verlassen. Alles wurde geliefert. Um halb acht klingelte der Milchmann. Um zehn fuhr mit Pferd und Wagen der Gemüsehändler vor. Kurz nach elf erklang die dissonante Schalmei des Petroleumhändlers. Außer Petroleum verkaufte er auch Waschmittel, Briketts, Streichhölzer und Sunlight-Seife. In unerwarteten Momenten vernahm man auch das Knattern des Einachsschleppers, mit dem der Scherenschleifer umherfuhr. Aus allen Wohnungen tauchten sogleich Hausfrauen mit nicht mehr gut schneidenden Brotmessern und stumpfen Kartoffelschälmessern auf, nicht selten gefolgt von ihren Ehemännern, die ramponierte Putzspachtel und verschlissene Meißel in den Händen hielten. Und exakt um eine Minute nach halb drei bog unser Bäcker Stoof Schelvischvanger psalmensingend in unsere Straße ein. Er gehörte zu unserer Kirche. Allen Reformierten brachte er Brot und Konditoreiwaren ins Haus. In unserer Straße belieferte er noch eine andere reformierte Familie. Bei uns klingelte er zuerst, schlurfte dann summend zu seinem Karren zurück und holte einen Milchwecken und ein Graubrot heraus. Die brachte er uns (»am Samstag bezahlen«), und danach fuhr er weiter zur Familie Marchand, die jedes Mal acht Weißbrote bekam.
War es gesund, immer nur dieses gräuliche Weißbrot zu essen? Wir stellten uns diese Frage nicht. Auch in der Familie Marchand wurde diese Frage nicht gestellt, obwohl Vater Marchand nach seinem fünfundfünfzigsten Geburtstag Probleme beim Schlucken bekam. Er klagte über Schmerzen in der Brust, machte sich Sorgen wegen des Herzens und begab sich zu unserem reformierten Hausarzt Dr. Collet. Der sagte ihm, es sei nicht unklug, einmal die Speiseröhre untersuchen zu lassen. Dazu musste Marchand ins Holy-Krankenhaus. Der Zustand seiner Speiseröhre veranlasste die Internisten dort dazu, ihn gleich dazubehalten.
Unser Bäcker hatte Mitleid mit der bekümmerten Ehefrau. Er drehte die Lieferreihenfolge um. Zuerst brachte er sieben Weißbrote zur Familie Marchand (offenbar verputzte Vater Marchand jeden Tag ein ganzes Weißbrot!), und erst danach bekamen wir unser Graubrot und unseren Milchwecken.
Weil Stoof zwar stets um genau eine Minute nach halb drei in unsere Straße einbog, der Zeitpunkt, an dem er an unserer Tür klingelte, jedoch immer weiter in den Nachmittag hineinwanderte, wurden wir mit der Nase auf die Tatsache gestoßen, dass er sich immer länger bei der Familie Marchand aufhielt.
»Seit Neuestem geht er zu ihnen hinein, wenn er seine Weißbrote abliefert«, sagte meine Mutter.
»Ach, was ist er doch für ein guter Kerl«, erwiderte mein Vater. »Er trägt die schweren Brote für Clazien in die Küche.«
»Ich glaube, er setzt sich auch jedes Mal kurz hin und trinkt eine Tasse Tee mit ihr«, meinte meine Mutter. »Er bleibt nämlich oft sehr lange dort.«
»Ach«, sagte mein Vater, »Stoof hat ein Herz aus Gold, ich denke, er schneidet ihr das Weißbrot gleich in der Küche auf. Demnächst wird das nicht mehr notwendig sein. Ich habe neulich in der Zeitung gelesen, dass sich ein Bäcker nach dem anderen so eine wahnsinnig teure Schneidemaschine zulegt. Dann können sie ihren Kunden das Brot geschnitten verkaufen.«
»Oh, wie schrecklich«, erwiderte meine Mutter, »vorgeschnittenes Brot, wozu soll das gut sein? Dann vertrocknet es im Handumdrehen. Das schmeckt doch schon am nächsten Tag nicht mehr.«
»Ist aber bequem«, sagte mein Vater, »und für Stoof wäre es auch nicht schlecht, denn dann müsste er das Brot nicht mehr bei Clazien in der Küche schneiden.«
»Ob das am Schneiden liegt, dass er immer mit hochroten Wangen wieder aus dem Nachbarhaus kommt?«, fragte sich meine Mutter.
»Vielleicht nimmt er sich auch gleich ihre Kartoffeln vor«, sagte mein Vater, »und verpasst hin und wieder einer der Töchter einen Klaps. Man hat’s nicht leicht, wenn man als quasi alleinstehende Frau eine solche Bande von lauter ungestümen Mädchen im Zaum halten soll.«
An einem warmen Sommertag, es war schon fast halb fünf, brachte Stoof in Hemdsärmeln unsere Brote ins Haus. Ich kam gerade aus der Schule und sah, wie er zu seinem Karren zurückging und einen Milchwecken und ein Graubrot herausnahm. Als meine Mutter die Brote in Empfang nahm, sagte sie: »Du kommst aber spät, Stoof. Und darf ich dich vielleicht darauf aufmerksam machen, dass hinten ein Hosenträgerknopf los ist?«
»Oh«, sagte er, »damit lauf ich dann wohl schon den ganzen Tag herum und mach mich zum Narren. Ich habe nichts bemerkt, und bisher hat mich auch niemand darauf angesprochen. Selbst komme ich da nicht ran. Würdest du mir vielleicht den Knopf kurz zumachen?«
Meine Mutter knöpfte die Hosenträger fest. Am nächsten Tag war wieder ein Knopf seiner Hosenträger los, und wieder half ihm meine Mutter.
»Warum sind Stoofs Hosenträger neuerdings immer lose?«, fragte ich eines Abends meinen Vater.
»Wenn er in Frau Marchands Küche all die Weißbrote schneidet, beugt er sich weit vor, und dann rutscht der Knopf heraus«, erwiderte mein Vater.
»Weißbrote«, sagte mein Mutter, »wer’s glaubt. In letzter Zeit hat er immer öfter keinen Milchwecken mehr, wenn er an unserer Tür klingelt. Und weißt du, wieso? Weil er ihr all seine Milchwecken gibt anstatt der einfachen Weißbrote. Und ich glaube, sie bezahlt dafür nur den Weißbrotpreis.«
»Vielleicht muss sie überhaupt nicht mehr bezahlen«, gab mein Vater zu bedenken.
»Könnte durchaus sein«, meinte meine Mutter.
Ich wunderte mich über die Hosenträger und die kostenlosen Milchwecken.
Dann verstarb an einem sonnigen, warmen Septembertag unser Nachbar Marchand im Krankenhaus.
»Ich könnte schwören«, sagte mein Vater, als meine Eltern vom Begräbnis nach Hause kamen, »dass sie wieder schwanger ist.«
»Meinst du?«, sagte meine Mutter. »Vielleicht ist ihr Bauch vor Kummer so geschwollen.«
»Wir werden das Ganze im Auge behalten«, erwiderte mein Vater. »Wenn sie wieder schwanger ist, stehen wir vor einem Rätsel. Ihr Mann hat rund zehn Monate im Krankenhaus gelegen, und da stellt sich die Frage: Woher also kommt der kleine Wurm?«
»Sei still«, sagte meine Mutter, »denk an Jesaja 32, Vers 3.«
»Allmählich wird mir klar, warum die Hosenträger immer halb lose waren.«
»Als wäre dir das nicht schon länger klar gewesen«, sagte meine Mutter.
Im darauffolgenden Frühjahr bemerkte Stoof, während er einen Milchwecken und ein Graubrot aus seinem Karren nahm, beiläufig meiner Mutter gegenüber: »Clazien und ich werden uns bald verloben.«
»Glückwunsch«, sagte meine Mutter.
Mein Vater erfuhr es natürlich, sobald er von der Arbeit kam.
»Was findet er nur an diesem verlebten Nervenbündel?«, meinte mein Vater. »Clazien hat fast ein halbes Dutzend Töchter zur Welt gebracht. Die stehen alle drum herum, wenn er seine Frau in der Backstube am Zwiebackofen aufwärmt. Außerdem ist die nächste Tochter bereits unterwegs.«
»Deswegen«, sagte meine Mutter.
»So einen Haufen Stieftöchter, das muss man mögen. Ich werde jedenfalls aus der ganzen Sache nicht schlau.«
»Stieftöchter? Ach was, kostenloses Ladenpersonal.«
»Kostenloses Personal?«
»Ja, kapierst du das nicht? Stoof sucht schon seit Jahren Verkäuferinnen für seinen Laden. Noch nie hat es eine länger als einen Monat bei ihm ausgehalten. Sie laufen ihm alle weg, weil sie keine Lust auf seine Handgreiflichkeiten haben. Wie man hört, kann er seine Finger nicht von ihnen lassen. Und in der Backstube … seine Angestellten … da gibt es eine ganze Reihe von Junggesellen, die ihre Hände ebenfalls nicht bei sich behalten können, und deshalb …«
»Und deshalb was?«
»Deshalb ist er jetzt mit einem Mal dieses Problem los. Fünf Stieftöchter. Die älteste kann sofort im Laden anfangen, und sobald sie etwas anderes machen will, ist die nächste alt genug.«
Meine Mutter hatte das richtig erkannt. Dank der Heirat mit der Witwe Marchand hatte sich Stoofs Verkäuferinnenproblem in Luft aufgelöst. Abwechselnd standen all die reizenden, kaum voneinander zu unterscheidenden Töchter hinter der Ladentheke. Außerdem gebar die Ex-Witwe eine zukünftige Verkäuferin.
Nicht lange nach Frau Schelvischvangers auffälliger Niederkunft machte ein merkwürdiges Gerücht in unserem Städtchen die Runde. Die Brotauslieferung sollte »saniert« werden.
»Sanierte Brotauslieferung?«, fragte mein Vater. »Was sich dahinter wohl verbergen mag?«
»Soweit ich es verstanden habe«, sagte meine Mutter, »ist gemeint, dass jeder Bäcker in Zukunft einen festen Bezirk zugeteilt bekommt, anstatt stundenlang mit seinem schweren Karren durch die ganze Stadt zu fahren und in jeder Straße nur zwei oder drei Kunden zu beliefern. Und in seinem Bezirk kann er dann von Tür zu Tür gehen.«
»Aber das bedeutet ja, dass die Menschen das Brot von Bäckern fressen müssen, die nicht zu ihrer Kirche gehören.«
»Und von schlechten Bäckern«, ergänzte meine Mutter.
»Wer denkt sich so was aus?«
»Keine Ahnung.«
»Und wer kommt dann zu uns an die Tür?«
»Bäcker de Geer.«
»Bäcker de Geer? Sind die jetzt total verrückt geworden? Der ist katholischer als der Papst. Und sein Brot … Wenn du das einem Hund gibst, dann spuckt er es nach dem ersten Bissen wieder aus und springt dir an die Kehle.«
»So schlimm ist es nicht, aber ich möchte kein Brot von de Geer haben.«
»Aber was sollen wir dann um Himmels willen machen?«
»Wir sind nicht verpflichtet, das Brot von de Geer zu kaufen«, sagte meine Mutter, »aber wenn wir weiterhin Schelvischvangerbrot essen wollen, dann müssen wir es selbst in Stoofs Laden holen.«
»Oh je, wie soll das bloß werden. Das ist doch schrecklich, selbst das Brot holen müssen! Es wird böse enden.«
»Das kannst du wohl sagen«, stimmte meine Mutter ihm bei.
Die Folge der Sanierung war, dass meine Schwester und ich abwechselnd die Deichtreppe hinaufstiegen, um einen Milchwecken und ein Graubrot bei Schelvischvanger zu holen. Und wir waren nicht die Einzigen. Fast alle reformierten Kunden blieben, dazu von den Kanzeln der Zuiderkerk und der Immanuelkerk herab angespornt, unserem vortrefflichen reformierten Bäcker treu. Es passte also gut, dass Stoof mit einem Mal über einen ganzen Trupp Verkäuferinnen verfügte.
Hinter der Ladentheke sah ich all die immer hübscher werdenden Mädchen wieder, die zunächst nur ein paar Häuser von uns entfernt gewohnt hatten. Vor allem die älteste, Dina, freute sich darüber, den ehemaligen Nachbarsjungen wiederzusehen. Oft lud sie mich in das winzig kleine Wohnzimmer hinter dem Laden ein und spendierte mir einen Windbeutel. Zwischen Laufstall und Wiege (in der Zwischenzeit waren bereits zwei Schelvischvanger geboren worden und ein dritter wurde erwartet) durfte ich auf der großen Zwiebacktonne Platz nehmen. Anschließend schwelgten die fünf Marchand-Mädchen und ich nicht nur in Erinnerungen an den Sandkasten im Kindergarten, sondern wir sprachen auch über die vielen schillernden Bewohner unserer Straße, von denen ich dann berichten musste, wie es ihnen in letzter Zeit ergangen war.
3
Als ich das letzte Schuljahr des Gymnasiums absolvierte und eigentlich schon zu lange Beine hatte, um noch auf der Zwiebacktonne sitzen zu können, wurde ich im Frühsommer ins Wohnzimmer hinter dem Laden gebeten. Kaum hatte ich auf der ächzenden Tonne Platz genommen, da erschien Stoof.
»Demnächst Ferien?«, fragte er.
»Nach dem Abitur«, erwiderte ich.
»Und was machst du dann?«
»Studieren.«
»Wann fängst du damit an?«
»Irgendwann im September, glaube ich.«
»Dann hast du ja etwa drei Monate frei.«
»Ja«, sagte ich.
»Und was machst du während der ganzen Zeit?«
»Lesen«, erwiderte ich.
»Lesen, jeden Tag nur lesen, Mann, davon wirst du doch rammdösig. Hast du nicht Lust, drei oder vier Wochen für mich zu arbeiten? Die Hälfte der Bäcker hier muss – das wurde von oben vorgeschrieben; wo soll das bloß enden! – von Anfang bis Ende Juli drei Wochen Urlaub machen, und die andere Hälfte ist verpflichtet, von Ende Juli bis Mitte August den Laden zu schließen. In den drei Wochen, in denen ich keinen Urlaub habe, muss ich etwa doppelt so viel backen wie sonst und auch doppelt so viel ausliefern. Tja, doppelt so viel backen, das werde ich wohl schaffen, aber wo nehme ich eine Elitetruppe her, um die doppelte Menge auszuliefern? Schon seit Wochen renne ich mir auf der Suche nach Personal die Hacken ab … tja, der Gnade Gottes habe ich es zu verdanken, dass mein Neffe drei Wochen herkommen will … Und das eigentlich auch nur, weil hier so viele knackige Mädchen herumlaufen … Aber Cor allein reicht nicht, ich brauche mindestens noch einen weiteren Ausfahrer zusätzlich. Wäre das nicht vielleicht was für dich? Du kannst doch nicht all die Monate nur rumsitzen und lesen? Von mir bekommst du fünfunddreißig Gulden die Woche schwarz auf die Hand. Du kannst Hoofd übernehmen. Nettes Viertel, frischer Seewind, freundliche Seeleute … das schaffst du am Vormittag, und anschließend kannst du noch den ganzen Nachmittag die Nase in deine Bücher stecken. Was sagst du dazu?«
»Oh, das könnte ich mir gut vorstellen«, erwiderte ich.
»Fantastisch«, sagte Stoof, »Montag, 5. Juli, geht’s los. Um sechs Uhr den Karren beladen, um halb acht ab ins Viertel.«
Und so sammelte ich am 5. Juli meine ersten Erfahrungen als Brotausfahrer. Sehr schnell wurde mir klar, dass man seinen Karren nie unbeaufsichtigt herumstehen lassen durfte. Nicht, weil jemals das Brot selbst gestohlen wurde. Aber wenn der Karren aus meinem Blickfeld geriet, etwa weil ich den Flur eines Hauses betrat, dann wurden sofort gefüllte Teilchen und Mandelhörnchen aus dem vorderen Kasten entwendet. Ziemlich katastrophal war auch, wenn das geschnittene Brot ausverkauft war. Manche Hausfrauen drohten mit Mord und Totschlag, wenn ich sagte: »Bedaure, das geschnittene Brot ist leider alle, ich habe nur noch ungeschnittenes.«
»Ungeschnittenes? Grundgütiger! Du glaubst doch nicht etwa, dass ich hingehe und mein Brot selbst schneide, du Rotznase! Ich besitze nicht einmal mehr ein Brotmesser, und das ist schade, denn wenn ich noch eins hätte, dann würde ich dich damit auf der Stelle aufspießen.«
Wenn ich am Ende meiner Tour wieder zurück zur Bäckerei kam, berichtete ich, dass ich nicht genug geschnittenes Brot dabeigehabt hatte.
»Es ist kaum zu glauben«, sagte Stoof, »früher war das ganz selbstverständlich, da hat man sein Brot selbst geschnitten. Und jetzt wollen alle Kunden nur noch geschnittene Grau- und Weißbrote. Immer wieder bekommt man zu hören, dass die Leute gar kein Brotmesser mehr im Haus haben. Wo sind in Gottes Namen die ganzen Messer bloß geblieben? Der Scherenschleifer sieht mich schon ganz vorwurfsvoll an, weil er nichts mehr zu tun hat. Wie dem auch sei, morgen also mehr geschnittenes Brot. Da müssen wir eben ein paar zusätzliche Laibe durch die Maschine jagen. Kein Problem.«
Am Freitagmittag verkündete Stoof: »Kriegsrat! Was machen wir morgen früh? Wie schaffen wir es, all die Brote rechtzeitig zu schneiden?«
»Hätten wir doch nur zwei Schneidemaschinen«, sagte die Ex-Witwe, die bei den logistischen Beratungen nicht nur grundsätzlich anwesend war, sondern auch sämtliche Diskussionen dominierte.
»Tja, Mensch«, wiederholte Stoof, »hätten wir doch nur zwei Schneidemaschinen.«
»Aber stehen nicht überall unbenutzte Maschinen herum?«, fragte Dina Marchand.
»Unbenutzte Maschinen?«
»Ja, all die Schneidemaschinen der Bäcker, die im Urlaub sind. Vielleicht dürfen wir ja eine dieser Maschinen benutzen. Wir fahren mit einem Karren voll Brot hin, schneiden es dort und fertig.«
»Was für eine brillante Idee«, jubelte Stoof, »ich rufe gleich den Kollegen van Lenteren an. Der hockt zu Hause und grämt sich saniert, weil man ihn gezwungen hat, drei Wochen Urlaub zu machen. Ich denke, er hat nichts dagegen, wenn wir seine Schneidemaschine in der Bäckerei auf dem Kerkeiland benutzen.«
Bäcker Schelvischvanger telefonierte mit Bäcker van Lenteren.
»Wir können den Schlüssel zur Bäckerei jetzt gleich abholen«, berichtete er kurze Zeit später und klang ganz aufgeweckt, »und morgen macht sich dann eine Schneidemannschaft auf den Weg dorthin.«
Er deutete mit einem mehligen Finger auf mich.
»Willst du mit schneiden gehen?«
»Meinetwegen«, erwiderte ich.
»Und du?« Er deutete auf seine hübsche Stieftochter Gezina.
»Nein«, stöhnte diese.
»Also ja«, sagte Stoof, »morgen früh um fünf rüber zum Kerkeiland.«
Sein Finger wanderte in Richtung seines Neffen Cor.
»Und du auch.«
An jenem sommerlich sonnigen Samstagmorgen beluden wir um halb fünf einen Karren mit Broten, die kurz zuvor mit einem hölzernen Schießer aus dem heißen Backofen geholt worden waren. Man konnte ein solches Brot nur einen kurzen Moment in der Hand halten.
»Davon bekommt man feuerfeste Finger«, meinte Stoof tröstend, als er mich bei der Arbeit sah.
Um fünf Uhr fuhren wir mit dem übervollen Karren zum Kerkeiland. Ich trat in die Pedale des Lastenfahrrads. Cor, der die ganze Zeit vor mir herfuhr, nahm Gezina auf dem Gepäckträger seines Rades mit. Stoofs Neffe war ein gedrungener, ziemlich mürrischer Bursche in meinem Alter, der einen immer anschaute, als würde er sich am liebsten sofort mit den Fäusten auf einen stürzen. Obwohl ich stets auf der Hut war, hatte ich keine Angst vor ihm. Man sah (und sieht) es mir nicht an, aber ich war (und bin) bärenstark. Das kann hin und wieder durchaus nützlich sein.
Dann und wann warf ich einen Blick auf Gezina, die verschlafen auf dem Gepäckträger hing. Im ersten Licht der aufgehenden Sonne sah sie märchenhaft aus. Ihr langes, leicht gewelltes Haar hatte die Farbe der Kruste von recht gut durchgebackenem Weißbrot. Sie trug ein kurzes weißes Sommerkleid und weiße Sandalen. Auf das Kleid war mit roter und grüner Seide eine riesige Tulpe gestickt. Bei jeder Bewegung, die Gezina machte, sah es so aus, als wiegte und neigte sich die Tulpe im Wind.
In der Bäckerei von van Lenteren kristallisierte sich sehr bald eine deutliche Aufgabenverteilung heraus. Ich transportierte die ungeschnittenen Brote zur Schneidemaschine. Gezina schnitt die Brote und tat sie anschließend in Tüten. Cor brachte die Brote zurück zum Karren. Daher begegneten wir einander ständig.
»Was für eine trübe Tasse«, flüsterte Cor mir zu, als wir wieder einmal aneinander vorübergingen.
»Trübe Tasse?«
»Ja, kein Lächeln, nicht einmal ein Wort hat sie für einen übrig. So ein hübsches Gesicht, aber sie schaut, als wollte man ihr an die Kehle. Sie steht nur da und schneidet missgelaunt die Brote. Was für eine Kratzbürste.«
»Ist vielleicht ein bisschen früh für sie.«
»Für uns etwa nicht?«
»Oh, ich find es schön, so früh.«
»Ich auch, aber nur wenn so ein Mädel, so ein heißer Feger ein wenig entgegenkommend ist. Hast du gesehen? Sie hat schon richtige Möpse, Mann, unglaublich.«
»Ja, hab ich«, bestätigte ich.
Wir gingen zusammen zurück, er mit leeren Händen, ich mit ungeschnittenen Broten.
»Ich muss kurz zum Klo«, sagte Gezina beleidigt.
»Nur zu«, sagte Cor, »und dann kommst du fröhlich wieder.«
»Fröhlich? Wenn man um vier Uhr aus dem Bett geworfen wird?«
»Morgen soll es schönes Wetter geben«, sagte Cor. »Hast du Lust, mit mir zum Strand zu gehen?«
»Mit dir?« fragte Gezina verdutzt und ungläubig.
»Ja, mit mir, warum nicht?«
»Mit dir? Am Sonntag?«, wiederholte sie, noch ablehnender.
Gezina ging auf ihren klappernden Sandalen davon. Die grünen Blätter ihrer roten Tulpe wogten herausfordernd.
»Was für eine Zimtzicke«, sagte Cor heiser, »was denkt die sich überhaupt, was bildet die sich ein?«
Wütend ging er ein Stück tiefer in die Bäckerei hinein.
»Ob es hier noch was zu futtern gibt?«, überlegte er.
»Bestimmt nicht«, erwiderte ich, »und wenn noch etwas herumliegt, dann ist es uralt.«
»Irgendwo wird doch wohl noch ein gefülltes Teilchen herumliegen? Oder ein Mandelhörnchen.«
Er schnüffelte in einem Regal zwischen den Backblechen herum und sagte: »Das kann ich überhaupt nicht ausstehen … gut … sie will morgen nicht mit mir zum Strand … aber dann muss sie doch nicht so tun, als wäre ich der letzte Dreck … irgendein Abschaum … was für ein verdammtes Miststück.«
»Sie will nicht, weil morgen Sonntag ist.«
»Sonntag? Ja und?«
»Der Tag des Herrn«, sagte ich.
»Da laust mich doch der Affe. Der Tag des Herrn.«
Gezina kam zurück, und wir nahmen unsere Arbeit wieder auf. Die Glocke der Großen Kirche schlug gemächlich sechs Uhr. Weil der Turm nicht weit entfernt war, dröhnten die Glockenschläge so nachdrücklich über den Karren und die Schneidemaschine hinweg, dass wir unsere Beschäftigung kurz unterbrachen.
»Sechs Uhr«, brummte Cor, »kommt, wir legen mal eine Pause ein, lasst uns einen kleinen Spaziergang über die Insel machen. Gehst du mit, Gezina?«
»Nein«, erwiderte sie schroff. »Ich werde Brottüten suchen. Die wir mitgebracht haben, sind nämlich alle.«
»Wie ich schon sagte«, meinte Cor wenig später, »jetzt hast du gesehen, was für ein Miststück sie ist. Wirklich, eine richtige Kratzbürste. Was für eine Schreckschraube.«
»Außer Dina sind sie alle ziemlich unfreundlich und abweisend«, sagte ich, »sämtliche Stieftöchter. Genau wie ihre Mutter, die ist auch immer launisch.«
»Stimmt, ich kann überhaupt nicht verstehen, warum mein Onkel sie geheiratet hat. Und mir ist auch ein Rätsel, warum sie alle so eingebildet sind. Was ist schon so Besonderes an ihnen?«
»Sie sind hübsch«, sagte ich.
»Von Dina einmal abgesehen … die alte Kneifzange.«
Wir gingen am Rasen vor dem Haupteingang der Kirche entlang. Um daran zu erinnern, dass unsere Stadt einst ein bedeutender Fischereihafen gewesen war, hatte man, sozusagen als Denkmal, einen besonders großen pechschwarzen Anker auf der Fläche aufgestellt. Tautropfen glitzerten im Gras.
»Komm, wir setzen uns ein Weilchen auf den Anker.«
»Wir müssen zurück.«
»Ach was, einen Moment hinsetzen, kurz ausruhen. Mal schnell schauen, wer von uns am stärksten ist. Los. Armdrücken.«
Er schob mich auf den Anker, nahm mir gegenüber Platz, stellte den rechten Ellenbogen auf das Eisen, nahm mit der Linken meine rechte Hand und legte sie in seine. Dann drückte er meinen Arm mit spielerischer Leichtigkeit nach unten.
»Das war aber eine schwache Vorstellung«, sagte er.
»Ich hab ja auch gar nichts gemacht«, erwiderte ich.
»Dann noch einmal«, sagte er.
Wieder positionierten wir unsere Ellenbogen auf dem Ankerstock. Wir legten unsere Rechte ineinander. Dann drückte er unangekündigt los. Ich gab kurz nach und erwiderte dann den Druck. Mit der Zeit guckte er immer erstaunter.
»Du bist stärker, als ich dachte«, sagte er.
Ich ging nicht auf seine Bemerkung ein, drückte jedoch noch ein wenig kräftiger.
»Himmelherrgottsakrament«, stöhnte er.
Und dann spürte ich, wusste ich, dass ich ihn besiegen konnte, und weil ich es wusste, beließ ich es dabei. Meine Muskeln erschlafften. Er drückte meine Hand auf das Eisen und sagte: »Nicht schlecht.«
Cor kletterte auf die Spitze des Ankers, richtete sich auf und setzte einen Fuß auf eine der Flunken und sagte: »Sollen wir ihr eine Lektion erteilen?«
»Wem?«
»Dieser Kratzbürste.«
»Ach, wieso?«
»Weil sie ein Miststück ist. Sollen wir ihr eine kleine Lektion erteilen … sollen wir … Du bist fast genauso stark wie ich … wenn wir jetzt einmal … Wenn du sie eine Weile gut festhältst … sie auf den Boden drückst … dann kann ich sie mir vornehmen.«
»Vornehmen?«
»Ja«, sagte er heiser, »ja, das machen wir … Du drückst sie zu Boden … und wenn sie zu kreischen anfängt, habe ich bestimmt noch eine Hand frei, um ihr den elenden Mund zuzuhalten …«
Er umarmte den Ankerstock und knurrte: »Oh wowowowowowow.«
Es hörte sich an, als wollte er die vielen Turteltauben nachahmen, die bereits in der Morgensonne saßen und eintönig gurrten.
»Bist du dabei?«, wollte er wissen.
»Aber was … was willst du machen, wenn ich sie auf den Boden presse?«
»Was ich tun will, mein Gott, du Trottel, das kannst du dir doch vorstellen. Ich werde es ihr ordentlich besorgen, wenn du sie nur gut festhältst. Und wenn ich es ihr besorgt habe, halte ich sie fest, und du kannst es ihr besorgen.«
»Nein … nein …«, sagte ich.
»Wieso nein? Da kann doch gar nichts schiefgehen?«
»Bestimmt rennt sie sofort nach Hause und sagt allen, was wir gemacht haben.«
»Und selbst wenn? Wir sind zu zweit. Zwei gegen einen. Wir können einander doch auf jeden Fall decken. Da kann sie sagen, was sie will.«
Ich schüttelte den Kopf.
»Warum denn nicht?«, fragte er beleidigt.
Ich sagte nichts, dachte nichts. Ich hoffte nur, dass im Licht der tief stehenden Sonne plötzlich jemand auftauchte, der mit seinem Hund Gassi ging.
»Zuerst knöpfe ich sie mir vor«, sagte er, »und dann bist du dran. Mann, stell dir doch nur vor … So ein Mädchen … so ein hübsches Ding … da will man doch … oh, wie gern würde ich da mal drüber … Na los, komm.«
Mein linker Fuß schaukelte über dem Ankerstock träge hin und her.
»Sie ist so ein gottverdammtes Miststück«, versuchte er es erneut. »Du hast vorhin selbst noch gesagt, dass sie alle Kratzbürsten sind, die ganze Mischpoke, na los, komm …«
Er sah mich an und sagte: »Was bist du für ein Schlappschwanz, was bist du für ein Riesenschlappschwanz … so eine Gelegenheit, und du lässt sie dir einfach entgehen … keiner sieht oder hört etwas … alle schlafen noch … nur mal schnell drüber … wir beide … mein Gott, du verdammter Schlappschwanz.«
»Ich mach nicht mit, vergiss es. Ich mach nicht mit«, sagte ich.
»Ich mach nicht mit«, höhnte er. »Na gut, du Hosenscheißer, dann lässt du es halt bleiben, dann mach ich es eben allein, als wenn ich dich dazu bräuchte … als wäre ich nicht Manns genug, sie allein … so eine Schlampe … so ein Miststück …«
Er sprang vom Anker in das glitzernde Gras und machte sich auf den Weg zum Hintereingang der Bäckerei. Ich schaute ihm nach, lauschte dem beruhigenden Gurren der Tauben. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, ich saß einfach nur da, auf dem schwarz geteerten und ziemlich merkwürdig riechenden Anker, ich schaute über das Wasser, welches das Kerkeiland umspülte, schaute zur Schiffswerft am gegenüberliegenden Ufer und hatte das Gefühl, schwerer zu sein als der Anker, auf dem ich saß. Cor erreichte die Bäckerei und betrat sie mit recht wüstem Schritt. Er traut sich nicht, dachte ich, das traut er sich bestimmt nicht.
Auf der Werft schlenderten ein paar Männer in blauen Overalls umher. Die sind viel zu weit weg, dachte ich, die hören nichts, wenn sie laut ruft.
Ich beobachtete die bläulich glitzernden Tautropfen, die unendlich langsam, aber gleichmäßig an den Grashalmen herunterliefen.
Ich spitzte die Ohren. Hörte ich bereits etwas? Dann dachte ich: Ich bin stärker als Cor. Er glaubt zwar, dem sei nicht so, doch er weiß nicht, dass ich ihn beim Armdrücken habe gewinnen lassen, ganz bestimmt, ich bin stärker. Dennoch rührte ich mich nicht. Dann knöpfte ich mich mir selbst vor: »Feigling«, murmelte ich, »Hosenscheißer, Angsthase«, und ich versuchte, mich zu erinnern, welche Ausdrücke es sonst noch mit dieser Bedeutung gab, und dabei wurde mir klar, dass ich das nur machte, um einen Vorwand zu haben, dort sitzen bleiben zu können. Erneut murmelte ich: »Feigling«, und während ich es murmelte, wurde mir bewusst, dass meine ganze Existenz auf dem Spiel stand, dass ich jede Selbstachtung für immer verlieren würde, wenn ich dort auf dem Anker sitzen blieb. Schweren Herzens glitt ich vom Anker herab, ging gemächlich in Richtung Bäckerei und dachte: Es wird schon nicht so schlimm sein, so etwas passiert doch nicht einfach so.
Als ich nach drinnen kam, sah ich Gezina mit irgendwie in die Luft ragenden Beinen auf einem Mehlsackstapel liegen. Cor hatte sich, weiß bestäubt, auf sie geworfen. Mit einer Hand versuchte er, sie auf die Säcke zu drücken, mit der anderen war er dabei, ihr Tulpenkleid hinaufzuschieben. Es sah so aus, als würde es dabei bleiben, denn sie wehrte sich heftig, und während sie sich wehrte, wirbelte immer mehr Mehlstaub auf, der anschließend auf die beiden herniedersank. Dadurch wurden sie immer weißer. Es war, als würden sie, in diesem seltsamen Zweikampf gefangen, für immer in einer Pattstellung verharren: Cor, der ständig eine Hand zu wenig hatte, um wirklich das tun zu können, was er vorhatte, und Gezina, die sich so lange wehren würde, bis sie unter einer Mehlschicht verschwunden war. Ich sah ihre weit aufgerissenen, leicht vorstehenden Augen. Es schien, als könnten sie vor lauter Panik einfach aus ihren Höhlen springen. Sie sah mich an, als wäre ich es, der sie bedrängte.
»Idiot, nun hilf mir doch … ich … ich … los hilf mir«, rief Cor.
Ich stand da wie angewurzelt, sah ihre Augen, hörte sein Keuchen, mehr noch, sein Fluchen, sein Wüten, hörte, wie all die Wörter auf mich einprasselten: Feigling, Idiot, Arschloch, Trampel, und plötzlich sah ich, mit wie viel Kraft er seine Hand auf ihren Mund drückte und zugleich mit der anderen an ihrem Kleid zerrte, auf dem inzwischen eine so dicke Mehlschicht lag, dass man die Tulpe kaum noch sehen konnte. Ich hörte sie ächzen, und wieder musste ich den ganzen Zyklus durchlaufen, den ich zuvor schon, auf dem Anker balancierend, durchlaufen hatte. Erneut stand meine Selbstachtung auf dem Spiel, doch diesmal kam mir ein Bäckereiwerkzeug zu Hilfe. Ein Brotschießer stand in Reichweite. Ich griff nach dem Ende des Stiels. Weil dieser so unglaublich lang war, brauchte ich keinen Schritt zu machen. Mit dem recht schweren Löffel am anderen Ende, der üblicherweise dazu diente, die glühend heißen Brote aus dem Ofen zu holen, wollte ich drohend über seinem Kopf herumfuchteln.
Ich hob den Brotschießer hoch. Ich dachte nicht daran, ihn wirklich als Waffe zu gebrauchen. Es erschien mir ausreichend, ihn über Cors Kopf kreisen zu lassen. Doch als ich den Brotschießer hochhob, überschätzte ich, weil er so lang war, meine Kraft. Dadurch fiel das schwere Ende, der Löffel, plötzlich herab. Ich versuchte noch, ihn zu lenken, aber das gelang mir nur mäßig. Entgegen meiner Absicht landete der Brotschießer mit einem dumpfen Knall auf Cors wüster Haarpracht.
»Verdammter Mistkerl«, brüllte er.
Erschrocken stemmte ich mit beiden Händen den Stiel in die Höhe. Wieder konnte ich ihn nicht richtig halten, sodass er erneut mit einem dumpf dröhnenden Geräusch Cor traf, diesmal seitlich am Kopf. Der Löffel schrammte an seinem Ohr entlang und knallte dann auf seine rechte Schulter. Wieder hob ich den Brotschießer ein wenig an und bewegte ihn zur Seite, woraufhin der Löffel gegen Cors Ohrmuschel stieß.
»Saukerl«, brüllte er.
Cor sprang auf, packte den Löffel des Brotschießers, riss mir den Stiel aus den Händen und bohrte ihn mir in den Bauch. Ich stolperte nach hinten. Gezina rappelte sich währenddessen auf, stürmte an mir vorüber, sah mich dabei voller Todesangst an, als fürchtete sie, ich könnte sie aufhalten, und floh nach draußen. Ich hörte, wie sie über das Kopfsteinpflaster der Ankerstraat davonlief.
Cor warf den Brotschießer auf die Mehlsäcke, stürzte sich auf mich und deckte mich mit primitiven Boxhieben ein, von denen manche zwar im Nichts landeten, andere mich aber ziemlich hart trafen. Ich ließ ihn zunächst machen; ich war noch nicht wütend, ich war nur erleichtert darüber, dass Gezina, auch wenn sie mich angesehen hatte, als wäre ich der Leibhaftige, hatte weglaufen können. Außerdem ging mir durch den Kopf: Ich habe mich noch nie geschlagen, ich will mich nicht schlagen. Doch Cor rückte mir immer heftiger zu Leibe, seine Hiebe nahmen mit der Zeit auch an Wirkung zu, und einer seiner Schläge traf mich so heftig in der Magengegend, dass ich endlich wütend wurde. Mit aller Kraft verpasste ich ihm einen Hieb auf die Milz. Er krümmte sich, sah mich dann so fürchterlich drohend an, dass mich kurz Angst überkam, und wollte sich dann wieder auf mich stürzen. Da ertönte hinter uns eine Stimme.
»Na, Jungs, was wird das? Was soll das Ganze? Seid ihr noch dabei zu schneiden? Oder seid ihr schon fertig?«
Ich wandte mich um, sah in das erstaunlich freundliche Gesicht des niederländisch-reformierten Bäckers van Lenteren.
»Wir sind so gut wie fertig«, sagte ich, »Ihre Maschine hat uns sehr geholfen.«
»Na, fein«, sagte der Bäcker, »das höre ich gern. Und zwischendurch noch ein wenig miteinander balgen … ach ja, das macht man, wenn man jung ist … ach ja, da rennt man hin und wieder einem Mädchen um den Tisch hinterher.«
4
Als ich ein paar Wochen danach im goldenen Spätsommerlicht am Hafen spazieren ging, vernahm ich schnelle Schritte hinter mir. Ehe ich mich umsehen konnte, hatte Stoof mich bereits eingeholt.
»Wenn du auch vorhattest, eine Runde zum Hoofd zu machen«, sagte er, »dann können wir zusammen gehen.«
»Ich wollte nicht zum Hoofd«, erwiderte ich.
»Ach, tu mir den Gefallen, geh doch kurz mit, begleite mich eine Meile, um mit Prediger zu sprechen.«
»Das steht nicht in Prediger«, sagte ich entrüstet, »das sagt Jesus der Herr selbst: Wer irgend dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh zwei. Matthäus 5.«
»Wenn du so genau weißt, wo es steht«, sagte Stoof, »dann hast du keine Entschuldigung mehr, mich nicht kurz zu begleiten. Nun ja, was spielt es für eine Rolle, wo es steht. Hauptsache, es wurde aufgeschrieben.«
»Bis zum Hoofd ist es keine Meile«, sagte ich, »und schon gar keine zwei.«
»Dann spazieren wir beide noch ein Meilchen am Waterweg entlang.«
Wir kamen an einem Schlepper von Smit & Co vorbei. Stoof schnupperte und sagte entrüstet: »Die backen da an Bord tatsächlich selbst Brot … und das, obwohl wir Schelvischvangers wirklich Know-how haben. Außerdem erhalten Fischerboote Schelvischvangerrabatt … das ist immer so gewesen, das hat mein Urgroßvater bereits eingeführt … Und später hat ein anderer Großvater die Regel auf alle Schiffe ausgeweitet … Tjaja, wir Schelvischvangers backen schon seit Marnix van Sint-Adlegondes Zeiten Brot … Als die Wassergeusen vor Den Briel lagen, bekam man bei uns bereits ein halbes Vollkornbrot oder ein Roggenbrot … tjaja … ach, ich würde so gern erleben, dass das so bleibt … Schelvischvanger, Bäcker und Konditor … auch in hundert Jahren noch … auch im kommenden Jahrhundert noch.«
Er schwieg, ergriff meinen Arm und kniff die Augen zu einem schmalen Spalt zusammen. Dann murmelte er: »Und du könntest mir dabei eine große Hilfe sein.«
»Ich?«, fragte ich verwundert.
»Ja, du«, sagte Stoof, »du müsstest nur kurz zu jemandem sagen: Es tut mir furchtbar leid. Das ist alles … nun, das kann doch keine große Mühe sein, das kommt dir doch ganz einfach über die Lippen.«
»Es tut mir schrecklich leid?«, fragte ich verdutzt.
»Na, sieh mal einer an, die Worte purzeln dir von ganz allein über die Lippen. Nur der Ton müsste sich noch ändern. Sag es einmal langsam und feierlich: Es tut mir schrecklich leid.«
Er artikulierte die letzten fünf Worte mit großem Nachdruck und sah mich dann erwartungsvoll an. Ich sagte nichts, sondern starrte nur vollkommen konsterniert auf den rauchenden Schornstein des Schleppers.
»Nun«, sagte er, »wie stelle ich das nur an, wie kriege ich dieses Zwergkaninchen in seinen Stall … Vielleicht sollte ich einfach am Anfang beginnen … Schau, wenn ich selbst einen Sohn hätte … ich habe eine Witwe geheiratet, wie du weißt … ihr habt ja alles aus nächster Nähe mitbekommen … deine Mutter hat mir sogar noch die Hosenträger zugeknöpft, stell dir mal vor … Die Witwe hatte ausschließlich Töchter, und da sollte man doch denken: Wenn sie noch ein Kind bekommt, dann ist es bestimmt ein Junge … aber von wegen … Dina, Gezina, Stina, Lina und Ina … da würde man doch meinen, das nächste Kind heißt ganz klar Rinus, aber Pustekuchen, es kamen noch eine Rina, eine Mina und eine Wina hinzu … Ich hätte es wissen müssen: einmal Töchter, immer Töchter … Nun ja, ich gebe es zu, ich hatte noch einen Hintergedanken dabei, ich habe auf zwei Pferde gesetzt und dachte: All die hübschen Mädchen … wenn ich mir die ins Haus hole, dann wäre es doch verrückt, wenn mein Neffe Cor nicht auf eine davon ein Auge werfen würde, und hängt er dann einmal am Haken, dann folgt der Rest schon von ganz allein. Er ist ja eigentlich auch der rechtmäßige Nachfolger.«
»Wieso?«, fragte ich. »Warum er?«