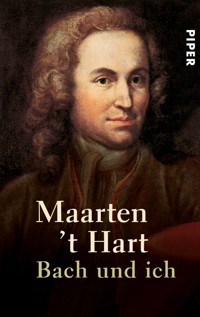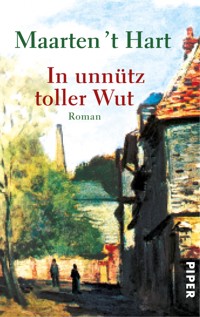10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Du wirst Diderica Croockewerff heiraten und damit basta!« Der Reederssohn Roemer Stroombreker folgt den Worten seiner Mutter. Doch seine Bestimmung am Vorabend des Psalmenaufstands ist eine andere … Maarten 't Hart versetzt uns in das Maassluis des 18. Jahrhunderts: Dramatische Lebensgeschichte und Zeitbild einer bewegten Epoche zugleich, ist »Der Psalmenstreit« ein großer Roman über Liebe und Konvention, Individualismus und Toleranz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Niederländischen von Gregor Seferens
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
3. Auflage 2011
ISBN 978-3-492-96037-3
© 2006 Maarten 't Hart Titel der niederländischen Originalausgabe: »Het Psalmenoproer«, De Arbeiderspers, Amsterdam 2006 Deutschsprachige Ausgabe: © 2007 Piper Verlag GmbH, München Umschlaggestaltung: semper smile, München Umschlagabbildung: Rijksmuseum Amsterdam Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Die vornehmen Meister
Am Abend des 9.Oktober anno 1739, nach dem Jahrhundertfest, durfte er mit einem brennenden Leuchter zu Bett gehen. Stolz trug er, nach jedem Schritt kurz innehaltend, damit sich die flackernde Kerzenflamme beruhigen konnte, den glänzenden Leuchter in sein Mansardenzimmer. Dort angekommen, stellte er das Licht behutsam auf die Kommode. Wenn der Schlaf sich seiner erbarmt hatte, würde Marije kommen, um die Kerze zu löschen.
Er lag in seiner Bettstatt und schaute durch die Wimpern zu der Kerze hinüber. Die Flamme kam schneller zur Ruhe als er. Noch immer glühten seine Wangen. Zum ersten Mal hatte er nicht nur Ventilhörner, Fagotte und Pauken gehört, sondern sogar echte Streichinstrumente! Lange bevor sie in der Kirche erklangen, hatte Meister Spanjaard der Reihe nach auf die schon bereitstehenden Instrumente gedeutet und feierlich ihre Namen genannt.
»Sind das etwa nicht die Geigen?« hatte er gefragt.
»Nein, das sind die Gamben, die Geigen sitzen schräg dahinter.«
»Aber die sind doch viel kleiner«, hatte er erstaunt und auch recht enttäuscht festgestellt.
»Ja, sie sind längst nicht so groß wie die Gamben, aber dennoch klingen Geigen am schönsten.«
Ob das stimmte? Das dunkelrote, gelackte Holz der großen Gamben hatte im Licht der Oktobersonne, das durch die hohen Kirchenfenster hereinströmte, prächtiger geflammt als der Firnis der Geigen.
An einem der Tage davor hatte Meister Spanjaard in der Schule aus der Zeitung vorgelesen: »Da es am kommenden Freitag hundert Jahre her sein wird, daß die Groote Kerk allhier vollendet und die erste Predigt dortselbst gehalten wurde, wird Pastor Hoffman zum Gedenken daran morgens predigen. Anschließend wird das Jubelfest mit mancherlei musikalischen Instrumenten durch vornehme Meister gefeiert werden. Während des Gottesdienstes sind jedwedes Handwerk und jedweder Broterwerb strikt untersagt, des weiteren der Ausschank, das Kegeln, das Schlagballspielen und dergleichen Exerzitien, auf daß der Tag des Dankes durch keinerlei Ungehörigkeiten turbiert werden möge.«
»Allerlei musikalische Instrumente hier in Maassluis, das übersteigt allen Verstand, es ist ihnen hoch zu Kopfe gestiegen, sie scheißen wahrhaftig höher, als ihnen der Schwanz hängt«, hatte Meister Spanjaard gesagt. »Dort eilen wir in aller Frühe hin, denn sonst finden wir nicht einmal mehr einen Stehplatz.«
»Das Presbyterium hat sogar dafür gesorgt, daß am Freitag kein Markt abgehalten wird«, hatte seine Mutter spitz bemerkt, als er zu Hause von den verschiedenen Musikinstrumenten berichtet hatte. »Die sind offenbar irre geworden. Na, mich werden sie jedenfalls nicht verrückt machen. Freitags in die Kirche! Im Morgengrauen hin und in der Abenddämmerung wieder zurück, das kann ich dir flüstern. Als ob ich dafür Zeit hätte. Freitag Schrubbtag, vorne und hinten, wo soll das hinführen, wenn sie aus Freitagen Sonntage machen? Werden die Mittwoche dann Freitage?«
Ungeachtet ihres wütenden Protests war die Kirche an jenem Freitagmorgen tatsächlich bereits lange vor Beginn der Feierlichkeiten voller Menschen. Und er hatte dort, sich unter dem dunklen Tonnengewölbe nichtig wie ein Sommergoldhähnchen fühlend, neben Meister Spanjaard und dessen Sohn Thade gesessen und zum grimmigen Pferdekopf von Pastor Hoffman aufgesehen. Das rechte Auge des Predigers war geschlossen, doch links von der Nasenwurzel wölbte sich hoch auf seiner Stirn, gleich unter der schmuddeligen Mähne seiner grauen Perücke, eine riesige Augenbraue, so daß es so aussah, als spähte der Pastor mit einem blitzenden, weit aufgerissenen Zyklopenauge unaufhörlich zu den Hunderten von Kirchgängern hinüber.
Hoffman hatte weitläufig geschildert, wie das Dorf aus einigen Hütten in Höhe der Monsterse Sluis geboren worden war und wie die eigensinnigen Bauern aus Maasland sich während des zwölfjährigen Waffenstillstands im Achtzigjährigen Krieg bis zum Äußersten gegen die Abtrennung von Maassluis gewehrt hatten. Dennoch habe der Ratspensionär Johan van Oldenbarneveld am 18.Mai 1614 das Separationsdokument unterschrieben. Danach sei das Dorf, dank der besonderen Gunst des Allmächtigen, so schnell gewachsen, daß sich sogar die aus dem Jahr 1598 stammende Kirche an der Hoogstraat, die anstelle einer hölzernen Kapelle errichtet worden war, schon bald als zu klein erwiesen habe. Indem man eine Steuer von einem Stuiver pro Tonne Kabeljau, Schellfisch und Dorsch sowie sechs Stuivern pro hundert Stück Lengfisch erhoben habe, sei es innerhalb von elf Jahren gelungen, ein Kapital von 14699Gulden und acht Stuivern anzusparen, genug für den Bau einer neuen Kirche. Der Grundstein sei im Jahre 1629 gelegt worden, und zehn Jahre später habe Pastor Fenacolius die Kirche am 8.Oktober 1639 weihen können.
Auf diese Erläuterungen zur Entstehungsgeschichte der Groote Kerk ließ Hoffman eine Predigt von gut einer Stunde über Jesaja 33, Vers 20, folgen: »Schaue Zion, die Stadt unseres Stifts«. Anschließend memorierte er die Vortrefflichkeiten aller Magistrate und Gerichtsherrinnen des vergangenen Jahrhunderts und dankte ihnen der Reihe nach für ihre Verdienste bezüglich der Groote Kerk. Zwischendurch wurden die Psalmen Davids angestimmt, getragener sogar als an echten Sonntagen, so daß manche Strophen fast eine Viertelstunde dauerten.
Aber nach Vortrag, Predigt, Dankeswort und schleppendem Psalmengesang waren schließlich doch noch die dunkelbraunen Violen und die geflammten Gamben erklungen. Während er von seinem Bett aus die bewegungslose Kerzenflamme fixierte, wußte er immer noch nicht, ob er das eigenartige wogende Rauschen der Violen und Gamben atemberaubender gefunden hatte oder den majestätischen Klang der nagelneuen Garrels-Orgel. Es war, als müßte man zwischen Iltis und Otter wählen. Den Iltis, der von allen verabscheut wird, hatte er vom ersten Tag an, als er ihn in der Abenddämmerung durch den Garten schleichen sah, heimlich geliebt. Welch einen wunderschönen, mattglänzenden, dunkelbraunen Pelz hatte so ein Iltis. Und wie lustig das spitze Schnäuzchen mit den dünnen, weißen Ohrmuscheln und die kecken Wechsel von grauen und dunkelbraunen Flecken bei Mund und Augen aussahen. Im Vergleich dazu fiel der Otter, von allen ebenso gehaßt wie sein kleiner Vetter, der Iltis, deutlich weniger auf, denn er war von gleichmäßigerer Färbung und hatte eine weniger ausdrucksstarke Schnauze. Allerdings hatte er, als er eines Morgens in aller Frühe in den Garten geschlichen war, einen Otter am Goudsteen im klaren Wasser der Noordgracht auftauchen sehen. In den ersten Strahlen der Morgensonne hatte sich der augenscheinlich auf der Stelle schwimmende Otter im Wasser des Vliet aufgerichtet und, während die Goudsteentropfen aus seinen Schnurrbarthaaren fielen, ohne jede Scheu zu ihm hinübergesehen. Er hatte den Blick erwidert und gesagt: »Wir haben noch eine halbe Tonne Präsenthering im Keller stehen. Ich werde dir ein Fischlein holen.« Doch als er mit dem Hering wieder in den Garten kam, war der Otter bereits verschwunden. Am nächsten Tag war er erneut mit einem Fisch in den Garten gegangen, und nachdem er eine kleine Weile gewartet hatte, kam der Otter beinahe geräuschlos angeschwommen und riß ihm dann blitzschnell und unerwartet den Präsenthering aus den Fingern, um ihn ein Stück weiter, im Schilfrand, laut schmatzend, prustend und brummend, aber auch ab und zu zufrieden aufschauend, rasend schnell hinunterzuschlingen. Danach war er bellend wie ein Hund in den goldenen Strahlen des ersten Sonnenlichts weggeschwommen.
Was danach im vorigen Sommer geschehen war, schien fast ein noch größeres Wunder zu sein als der sprechende Esel des Bileam oder die schwimmende Axt des Propheten Elias. Der Otter war schon nach etwa einer Woche aus dem Wasser des Goudsteen ans Ufer gekommen, hinein in ihren Garten, um ihm den Ihle aus der Hand zu reißen. Nach einem Monat hatte er den Otter streicheln dürfen, und eines Tages war der Otter, nachdem er seinen Hering verschlungen hatte, im Vliet verschwunden und mit einer glänzenden Brasse im Maul wieder aufgetaucht. Die zappelnde Brasse hatte er im Garten zwischen die blauweißen Blütenkronen des Ehrenpreis gelegt. War die Brasse für ihn bestimmt? Als er sie nehmen wollte, hatte der Otter warnend gebellt, den Fisch rasch wieder ins Maul genommen und war damit untergetaucht.
Gut, Samuel wurde, als er in seinem Bett lag, vom Herrgott selbst gerufen, und das war ihm noch nie passiert, aber Samuel hatte nie Freundschaft mit einem Otter geschlossen. Jedenfalls stand davon nichts in der Bibel, ebensowenig wie von Fledermäusen, die einem an schwülen Sommerabenden ganz knapp über den Kopf schwirrten, als wollten sie sich einen Scherz erlauben und einen erschrecken. Im Buch des Propheten Jesaja wurde die Fledermaus in einem Atemzug mit dem Maulwurf erwähnt und so getan, als handele es sich bei ihnen um gräßliche Tiere, in deren Löcher man Götzen hineinwirft. Aber Fledermaus und Maulwurf hatten doch keinerlei Gemeinsamkeiten? Und über flatternde Schmetterlinge stand auch nichts in der Bibel, obwohl man sich doch einen Sommer ohne gaukelnde Kohlweißlinge, Hauhechelbläulinge und Schwärmer kaum vorstellen konnte. Während er an die zierlichen unbiblischen Schmetterlinge dachte, tauchte, als müßte es jedesmal, wenn er im Bett lag, so enden, die drängende Frage auf: War tatsächlich von allen Tieren, also auch von den in der Bibel so schmählich vergessenen Schmetterlingen, ein Paar auf der Arche Noahs gewesen? Und auch von all den Käfern und Insekten, die in der Bibel ebensowenig erwähnt werden? Und von den Seehunden, die man auf den Sandbänken in der Brieler Maas in der Sonne liegen sehen konnte? Waren die etwa mühsam über Land zur Arche gerobbt?
Dieweil er mit immer noch weit geöffneten Augen über diese Frage grübelte, hoffte er wider besseres Wissen, daß Gott ihn, wie einst Samuel, rufen würde. »Siehe, hier bin ich! Du hast mich gerufen«, würde er erwidern und gleich darauf fortfahren: »Aber darf ich dich erst etwas fragen: Wie konnten die vielen tausend Paare in der Arche Noah Platz finden? In der Bibel steht, daß sie dreihundert Ellen lang, fünfzig Ellen breit und dreißig Ellen hoch war. Das erscheint recht groß, doch meiner Meinung nach ist sie selbst für alle Vögel zu klein, denn allein davon gibt es schon so viele. Und wie erging es den Schmetterlingen in der Arche? Schmetterlinge leben nicht tagelang, sondern nur ein paar Stunden. Sie waren demnach alle bereits mausetot, als die Arche nach vierzig Tagen auf dem Berge Ararat auf Grund lief. Sie können unmöglich aus der Arche geflogen sein. Oder hast du die Schmetterlinge erst nach der Sintflut geschaffen? Aber warum werden dann Schmetterlinge in deinem Buch nirgends erwähnt?«
Es gab so vieles, was er Gott über Tiere fragen wollte. »Warum, Herr, hast du ein so wunderbares Tierchen wie den Iltis geschaffen, dem fast jeder sofort ans Fell will, weil er die Hühner tötet und ihre Eier auffrißt?« Er starrte ununterbrochen auf die brennende Kerze. Als die Flamme leicht zu qualmen und zu flackern begann, da schoß ihm durch den Kopf: Jetzt ist es da, das stille, sanfte Sausen, genau wie bei Elia in der Höhle. Nun wird eine Stimme zu mir sprechen. Er richtete sich in seinem Bett auf und spitzte die Ohren.
Die Räder eines Handkarrens polterten über das Kopfsteinpflaster der Veerstraat. Er vernahm gellende Stimmen und darüber hinweg das schrille Gebell eines Hundes. Ein anderer Hund antwortete auf das Bellen, und ein dritter Hund schlug an. Dann schien es, als stimmten alle Hunde unten am Deich einträchtig bellend einen Kriegspsalm an. Offenbar mußte die unwirkliche Sonntagsruhe, welche die Stadt den ganzen Freitag über geknebelt hatte, doch noch gründlich gestört werden. Er setzte sich aufrecht hin. Die Kerzenflamme flackerte beängstigend. Vorsichtig glitt er aus dem Bett. Behutsam schlich er zum runden Mansardenfenster. Das erste, was er erblickte, waren das gekräuselte Wasser und der zarte Mondenschein. Es war, als spränge das Licht von Welle zu Welle, genau zu der Stelle hin, von der tagsüber die Treckschute nach Delft abfuhr. Dann erst schwenkte sein Blick zu dem im Mondlicht matt glänzenden feuchten Kopfsteinpflaster hinüber. Geschoben von zwei weniger vornehmen Meistern, als er früher am Tag gesehen hatte, und akkompagniert von schemenhaftem Mannsvolk, kam der Handkarren so unwirklich langsam näher, daß es fast so aussah, als stiege er nach jedem Stein in die Tiefe, um anschließend den folgenden Stein wieder hinaufzuklettern. Was auf dem Karren transportiert wurde, war ganz offenbar schwer wie Blei. Er konnte jedoch nicht so recht erkennen, worum es sich handelte. Von oben sah es aus wie ein dunkler, großer, an allen Seiten über den Hundekarren hinausragender Felsblock.
So schwer es war, den Karren vorwärtszuschieben, so schwer schien es auch, ihn zu bremsen. Die schemenhaften Begleiter mußten mit anpacken, um seine langsame, aber unaufhaltsame Bewegung zu stoppen. Schließlich kam er vor dem Haus des Nachbarn Govert van Wijn, der im vorigen Jahr vom Allmächtigen in die Ewigkeit aufgenommen worden war, zum Stillstand. Dort klopfte man deshalb auch nicht an, sondern eine der dunklen Gestalten, die geschoben hatten, schritt auf ihre Haustür zu und ließ feierlich den kupfernen Klopfer auf die massive Eichentür fallen.
Bald nachdem Marije die Tür geöffnet hatte, antwortete ihre helle Sopranstimme fröhlich auf das, was die dunkle Gestalt ihr mitgeteilt hatte. Die Gestalt ging wieder zum Karren, eine Art Kommando erklang, und alle Männer auf der Veerstraat stellten sich ordentlich um den Karren herum auf. Abermals erklang ein Befehl. Hände packten den Felsblock und hoben ihn vom Karren. Anschließend schleppten die Träger die schwere Last zur Haustür. Dann sah er nichts mehr. Rasch zog er sich Hemd, Hose und Strümpfe an und blies die Kerze aus. So vorsichtig wie möglich stieg er die Treppe wieder hinab, die er so stolz mit dem brennenden Leuchter hinaufgegangen war. Als er unten in den breiten, dunklen Flur kam, konnte er sich gleich der Prozession anschließen, die sich über die Fliesen in Richtung Küche bewegte. Er wollte nur eines wissen: Was trugen die Männer? Er nahm sich vor, in Windeseile wieder in sein Bett zu schleichen, sobald er dies in Erfahrung gebracht hatte. Weder Marije noch seine Mutter brauchten zu wissen, daß er heimlich aufgestanden war.
Im Gang war es jedoch so stockfinster, daß er kaum sehen konnte, was die Männer da trugen. An der Unterseite des Gegenstands schimmerte etwas grauweiß. Blasses Mondlicht fiel in die Küche. Doch auch dort war es so dunkel, daß er – obwohl Marije und seine Mutter die Prozession bereits erwarteten – ganz leicht und unbemerkt in die finstere Nische neben dem Kamin huschen konnte. Von dort schaute er zusammengekauert zu den Männern hinüber, die mit ihrer bleiernen Last vor der Anrichte stehengeblieben waren.
»Was nun? Wohin mit ihm?« fragte einer der Männer.
»Auf die Anrichte vielleicht«, schlug Marije vor.
»Ist nicht breit genug. Fällt er runter.«
»Nie zuvor ein solches Enakskind gesehen«, sagte ein anderer Mann. »Als wir ihn rausholten, haben wir gleich gesagt: ›Sobald wir die Duizent Vreesen im Kulk festgemacht haben, bringen wir den zur Witwe Stroombreker in die Veerstraat.‹ Wir haben ihn kaum in die Bünn gekriegt. Der Hinterleib ragte raus. Dennoch ist er nicht eingegangen.«
Marije holte einen Leuchter aus dem Wohnzimmer und entzündete mit dem brennenden Docht weitere Kerzen. Allmählich wurde es in der Küche heller. Hinzu kam, daß sich seine Augen inzwischen besser auf das Halbdunkel eingestellt hatten. Was die Männer dort in den Händen hielten, war ein unförmiger Fisch, ein Plattfisch, ein schreckliches Riesenvieh. Seine beiden schiefergrauen, fluoreszierenden Fensterglasaugen schienen genauso zu ihm herüberzuspähen wie das Riesenauge von Pastor Hoffman. Der Fisch ist noch nicht ganz tot, dachte er.
»Was ist das?« fragte seine Mutter.
»Ein Heilbutt«, sagte der Schipper der Duizent Vreesen, »wir haben ihn bei den Shetlandinseln gefangen. Es grenzt an ein Wunder, daß wir ihn aus dem Wasser bekommen haben. Als wir versuchten, ihn ins Boot zu kriegen, da hob eine tüchtige Welle ihn zum Glück in die Höhe. Sonst hätten wir es nie geschafft. Es schien fast, als wenn er aus eigener Kraft an Bord schwimmen würde. Das Spritzwasser lief ab, und da lag er und schlug mit dem Schwanz, als wollte er uns alle zermalmen. Ich glaube, er ist schwerer als eine Färse.«
»Darf ich euch allen zum Dank ein Glas Branntwein anbieten?« fragte seine Mutter.
»Da sagen wir nicht nein, Frau Stroombreker«, sagte der Schipper, »doch ehe wir uns ein Gläschen genehmigen, müssen wir ihn erst irgendwo ablegen.«
»Draußen vielleicht, auf den Steinen? Die habe ich vorhin noch geschrubbt«, sagte Marije.
»Ja, nur zu, Steuermann«, sagte seine Mutter, »da liegt er gut. Und er bleibt kühl.«
»Dort machen sich vielleicht allerlei Kater und Elstern über ihn her«, wandte der Skipper ein.
»Das wird schon nicht so schlimm werden«, meinte seine Mutter, »der Sommer ist vorbei, die Kater übernachten im Haus. Und Elstern, ach, die habe ich hier noch nie gesehen.«
»In Ordnung, Frau Stroombreker, wir legen ihn draußen hin.«
Die Sandelijnstraat
Auch wenn er noch so früh nach unten ging, seine Mutter kam ihm immer zuvor. Auch an diesem Samstagmorgen fuhrwerkte sie bereits eifrig in der Küche herum, als er nach unten kam. Sie legte allerlei Messer auf der Anrichte bereit.
»Denk bloß nicht, ich hätte nicht gesehen, daß du gestern abend aus dem Bett aufgestanden bist«, knurrte sie.
»Ich wollte sehen, was die Männer bringen«, sagte er leise.
»Bah, ein stinkendes Meeresungeheuer.«
»Wirst du es in Stücke schneiden?«
»Worauf du dich verlassen kannst. Weg damit, bevor der Fisch anfängt zu stinken.«
»Aber Thade … ich würde ihn sehr gern Thade zeigen. Und sein Vater will ihn bestimmt auch sehen.«
»Meister Spanjaard? Ein so launischer Witwer im Haus? Das gibt nur Gerede. Ich wollte, du wärest weniger oft mit seinem Sohn zusammen.«
»Er ist mein bester Freund«, sagte Roemer beleidigt.
Seine Mutter ging darauf nicht weiter ein. »Warum bringen die Männer mir in Gottes Namen ein solch grausiges Ungeheuer? Gut gemeint, zweifellos. ›Wir bringen der Reederswitwe, um sie günstig zu stimmen, den größten Heilbutt, den wir jemals gefangen haben.‹ Aber was soll die Witwe mit so einem unförmigen Untier? Selber aufessen? Einen Monat lang jeden Tag Heilbutt? Selbst wenn er nicht zu stinken anfinge, hinge er einem bald zum Hals raus. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als ihn sofort zu verteilen. Warum haben die Männer mir nicht so einen Geldsack gebracht, wie man sie voriges Jahr nach dem Ableben unseres Nachbarn Govert van Wijn auf dessen Dachboden gefunden hat? Sechsundzwanzig Scheffelsäcke und sechshundert glänzende Gulden in jedem Beutel! Ganz gleich, wie lange man sie aufbewahrt, nie werden sie stinken. Also gut, Meister Spanjaard darf sich den Heilbutt unter einer Bedingung ansehen: Er muß ein möglichst großes Stück davon abschneiden und mitnehmen. Doch bevor du wieder zu ihm hinläufst, ißt du erst schön deine Grütze auf.«
Eine Viertelstunde später erklomm er die breiten Deichtreppen seitlich der Monsterse Sluis. Auf der anderen Seite stieg er wieder hinunter, rannte durch den Schoolslop bis zu Thades Haus. Mit beiden Fäusten trommelte er an ein Fenster des Klassenraums. Beinahe augenblicklich kam Thade aus dem Hinterhaus angerannt. Während sein einziger Freund die Schultür öffnete, rief er: »Gestern abend hat die Mannschaft der Duizent Vreesen einen riesigen Heilbutt gebracht. Auf einem Handkarren. Komm und schau ihn dir an.«
»Was gibt es?« fragte Meister Spanjaard, der ebenfalls aus dem Hinterhaus auftauchte.
»Ein Riesenheilbutt, wurde gestern abend gebracht. Meine Mutter hat gefragt, ob Sie auch mitkommen wollen. Mit einem großen Messer. Um ein Stück davon abzuschneiden.«
Einen Moment lang wehte, als sie die breiten Treppen hinauf- und wieder hinabgingen, ein kalter, dünner Nieselregen über die Schleuse und die Veerstraat. Darum glänzte der Heilbutt matt im fahlen Oktoberlicht, als Vater und Sohn Spanjaard kurze Zeit später sprachlos um ihn herumgingen. Erst jetzt, im grauen Morgenlicht, zeigte sich so richtig, wie gruselig das Ungeheuer aussah. Auf seiner Haut glänzten überall unförmige, widerlich rotgefärbte, warzenartige Geschwüre, und der verzogene, mißgebildete Mund sah aus, als hätte man vergeblich versucht, ihn mit Handspaken zu schließen. Die kalten schiefergrauen Augen schienen noch immer, so mausetot das Ungeheuer inzwischen auch war, nach jedem Zuschauer zu schielen.
Der Schulmeister legte sein Messer demonstrativ auf eine Fensterbank und sagte: »Zuerst muß er saubergemacht werden. Kopf ab. Eingeweide raus. Aber wie? Versuch nur mal, ihn umzudrehen. Dafür braucht man mindestens vier Mann. Soll ich Verstärkung holen?«
»Gern«, sagte Roemers Mutter, »sagt jedem, der helfen will, daß er ein großes Stück abschneiden und mitnehmen darf.«
»Mir reicht die Leber«, sagte Meister Spanjaard, »Heilbuttleber, Hirnschmalzgeber.«
Nie sollte Roemer vergessen, wie die in aller Eile zusammengerufenen Männer eine gute halbe Stunde später beinahe schweigend mit Messern und Körben dem Heilbutt zu Leibe rückten. Es schien, als hätten sie schon früher einmal solch einen unheilverkündenden großen Plattfisch einmütig Hand in Hand arbeitend filetiert. Und alles, was sie von dem Heilbutt abschnitten, schien brauchbar. Sogar die Innereien verschwanden in den Körben. Einer der Kerle flüsterte: »Was für ein Vergnügen werden meine Schweine daran haben, ich höre sie schon verschmitzt grunzen.«
Als es vorbei war, lagen einige riesige Stücke Heilbuttfleisch auf der Anrichte. Seine Mutter murrte: »Das ist mehr, als wir in zwei Wochen schaffen. Mindestens die Hälfte muß weg. Aber wohin? Halt! Engeltje, das arme Kind! Noch blutjung, aber auch schon Witwe. Vier kleine Würmer. Bestimmt tut es ihr leid, daß sie uns damals verlassen hat. Nun gut, bevor du zur Schule gehst, bringst du ihr ein Riesenstück in die Sandelijnstraat. Frag dort, wo Engeltje Kortsweyl wohnt. Bestell ihr einen schönen Gruß von mir.«
Sie nahm ein ordentliches Stück, legte es in einen Eimer, gab ihm diesen und brummte: »Jetzt aber los.«
Er wollte sagen: »Kann Marije das nicht machen«, doch seine Mutter preßte die Lippen aufeinander, sah ihn kurz grimmig an, und ohne ein Wort des Protests ging er mit dem glänzenden Eimer durch den Gang auf die Veerstraat hinaus. Über die hohe Treppenbrücke gelangte er zum Markt. Dort angekommen, dachte er: Ich kippe den Eimer einfach in den Zuidvliet.
Ihm war jedoch plötzlich so, als tauchte das weiße Gesicht seiner Mutter für einen Moment zwischen den kleinen Wellen des friedlich sich kräuselnden Wassers auf. Er riß sich zusammen, ging am fahlgrauen Zuidvliet entlang und blieb beim Sluispolderslop stehen. Durch diese Gasse mußte er, wenn er zur Sandelijnstraat wollte. In dem engen Steg schien es noch Nacht zu sein. Weiter hinten, dort, wo der schmale Durchgang in das Sluispolderhofje überging, krakeelten Kinder. Jungen in seinem Alter sah er nicht. Die fuhren bereits als Prickenbeißer oder waren schon zum Ausweider oder Einpacker befördert worden. Dennoch pochte sein Herz, als er durch den Slop und über den kleinen Platz rannte. Sogar wenn er mit Thade durch die Stadt schlenderte, machten sie einen großen Bogen um die Gegend hinter dem Zuidvliet. Dort wohnte, in den engen, rechtwinklig zueinander verlaufenden Gassen, das grimmige Gesindel mit seinem gruseligen Gezücht. Und auch wenn die aufgeschossenen Burschen ausnahmslos bereits zur See fuhren, so begegnete man dort oft genug leicht reizbaren Lümmeln und hitzköpfigen Halunken, die sich, und waren sie noch so klein, mit einem herausgeputzten Reederssöhnchen oder Schulmeistersproß nur allzugern anlegten, vorausgesetzt, sie waren in der Überzahl.
Er schaute in die Sandelijnstraat hinein, die von den Bewohnern immer Lange Straat genannt wurde. Und das zu Recht, denn sie war ganz zweifellos die längste Straße der Stadt. Bei weitem nicht so schmal wie der Slop, der bereits hinter ihm lag, aber mit viel höheren Häusern. Es schien, als neigten sich die schmutzigen Giebel einander zu, so daß sich nur ein schmaler Streifen dunkelgetönter Himmel zwischen ihnen wölbte. Barfuß rannten zerlumpte Kinder in die Häuser rein und wieder raus. Schmuddeliges Federvieh scharrte zwischen dem Kopfsteinpflaster. In den Dachrinnen pirouettierten krächzende Krähen, und als er sich dann schließlich doch, wenn auch vorerst nur zaghaft einen Fuß vor den anderen setzend, in die Straße hineinwagte, da erschallte plötzlich eine Stimme aus einem halboffenen Fenster. »Bechehrteuchbechehrteuch.«
Vor Schreck ließ er den Eimer fallen. Scheppernd rollte er über das Pflaster. Um zu verhindern, daß das Heilbuttstück herausfiel, ergriff er rasch den Henkel, und abermals erklang die heisere Altmännerstimme: »Bechehrteuchbechehrteuch.« Erst jetzt sah er, daß ihn aus einem offenen Fenster ein himmelblauer Papagei mit seinen dunklen Knopfaugen beobachtete, und erneut erklang dieselbe Botschaft, deren Bedeutung er nun auch verstand: »Bekehrt euch, bekehrt euch.« Um jeden Irrtum bezüglich der Botschaft auszuschließen, fuhr der Schopf des Vogels nach jedem »Bekehrt euch« für einige Sekunden himmelwärts.
Wie schon früher an diesem Tag fiel ein kümmerlicher Nieselregen. Gleichzeitig riß dort, wo die Sandelijnstraat an das sumpfige Gebiet bei der Wippersmühle grenzte, die Wolkendecke auf, und es fiel ein Sonnenstrahl in die Straße. Das Licht machte ihn mutiger. Entschlossen ging er nun weiter, und als er ein Männlein entdeckte, das auf der Untertür seines Häuschens lehnte und pfeiferauchend die Straße beobachtete, da fragte er: »Können Sie mir sagen, wo Engeltje Kortsweyl wohnt?«
»Hintendurch«, erwiderte der Pfeifenraucher. »Was hass’n da? Weißfisch? Her damit.«
»Nein, den soll ich Engeltje Kortsweyl bringen.«
Der Alte nahm die Pfeife aus dem Mund, räusperte sich und spuckte dann einen großen, braunen Klumpen aus. Offenbar sollte der Schleim im Eimer landen, denn als der Rotz die Außenseite des Eimers traf, brummte der Mann: »Verdammt, daneben.«
Und erneut sog er seine Wangen nach innen, um soviel Spucke wie möglich zu sammeln. Roemer machte rasch ein paar große Schritte; trotzdem wurde sein Eimer von einem zweiten Strahl getroffen.
Die Begegnung mit dem spuckenden Pfeifenraucher hatte die Aufmerksamkeit von allerlei barfüßigem Kroppzeug auf Roemer gelenkt. Sie liefen hinter ihm her, schauten dreist in den Eimer, zogen deutlich vernehmbar die Nasen hoch und johlten: »Dreckschwein, friß deinen fiesen Fisch allein!«
Er mußte einem staubigen Hahn ausweichen, der mitten auf der Straße mit geschwollenem Kamm demonstrativ zum Wolkenhimmel krähte, als sende er ein Hühnergebet in die Höhe. Er ging an der Hoekerstraat vorbei und gelangte in den abgelegensten Teil der Sandelijnstraat. Die johlenden Kinder blieben zurück. Es schien, als gälte das Licht, das aus der Hoekerstraat in die Sandelijnstraat fiel, als Grenze, die nicht überschritten werden durfte. Doch so abgelegen dieses Ende der Sandelijnstraat auch war, er wurde dennoch aus allen Häusern heraus beobachtet, an denen er vorbeiwankte. Überall sah er hinter schmutzigen, mit zerflossenem Krähendreck verschmierten Fenstern die weißen Flecken der Gesichter. Lautlos bat er, es möge jemand erscheinen, den er fragen konnte, wo Engeltje wohnte. In der Ferne hörte er einen Esel schreien. Was tun? Einfach irgendwo anklopfen und nach Engeltje fragen?
Aus der Sint-Aagtenstraat tauchte plötzlich eine Nonne auf, die in die Sandelijnstraat schaute. Sie verschwand ebenso hastig, wie sie gekommen war, und doch brachte ihr wundersames, kurzes Erscheinen Hilfe. Obertüren wurden wild aufgerissen, Frauen zeigten sich, die ihre Fäuste in Richtung der Sint-Aagtenstraat ballten.
Eine der kriegswütigen Schürzenträgerinnen fragte er: »Wissen Sie, wo Engeltje Kortsweyl wohnt?«
»Vorletzte Tür in Het peerd z’n bek auf der Vlietseite«, sagte die Frau mürrisch. »Was hass’n da? ’n Stück Fisch? Gib nur her, Engeltje hat immer alles, was sie braucht.«
Roemer rannte rasch weiter. Erleichterung machte sich in ihm breit, nicht nur, weil er sein Ziel beinahe erreicht hatte, sondern auch, weil er anschließend durch Het peerd z’n bek und an der Zuidvlietkade entlang nach Hause zurückkehren konnte. Zum Glück mußte er also nicht wieder durch die Sandelijnstraat gehen, auch wenn es sehr schade war, daß er den blauen Papagei nicht noch einmal zu sehen bekam.
Er klopfte an die vorletzte Tür in der Sandelijnstraat. Zunächst öffnete ihm niemand. Ob vielleicht keiner zu Hause war? So früh am Tag? Er klopfte noch einmal. Dann hörte er Schritte, die Obertür ging quälend langsam ein Stückchen auf, und aus der Finsternis, die drinnen sichtbar wurde, schauten ihn unter einer enganliegenden Haube zwei dunkle Augen ängstlich an.
»Wohnt hier Engeltje Kortsweyl?«
Das Mädchen nickte. Dadurch lösten sich einige der unter der Haube verborgenen Locken. Das Mädchen versuchte, sie wieder unter die Haube zu stopfen, stieß dabei jedoch gegen die Kopfbedeckung. Es schien, als hätte ihr widerspenstiges Haar nur darauf gewartet, denn nun gab es kein Halten mehr. Zahlreiche Locken schaukelten unvermittelt an ihren Wangen herab, die sich feuerrot färbten.
»Meine Mutter hat mir aufgetragen, eine Portion Fisch abzugeben«, sagte er.
Das Mädchen starrte ihn an, als redete er in Zungen. In dem verzweifelten Versuch, seine offenbar als seltsam empfundene Mission zu erklären, stotterte er: »Engeltje hat früher bei uns gearbeitet. Als Küchenmädchen.«
Es nützte nichts. Mit hochgezogenen Augenbrauen starrte ihn das Mädchen ununterbrochen an.
Er versuchte es noch mal. »Gestern abend kam die Mannschaft der Duizent Vreesen zu uns und brachte auf einem Handkarren einen ungeheuer großen Heilbutt. Den können meine Mutter, Marije … Marije ist unser neues Küchenmädchen … den können meine Mutter, Marije und ich allein nicht essen, und darum verteilen wir ihn, und weil Engeltje früher bei uns …«
»Meine Mutter ist nicht zu Hause«, lispelte das Mädchen. »Meine Großmutter ist krank, da ist sie hin.«
Sie machte Anstalten, die Obertür wieder zu schließen.
»Fisch«, sagte er verzweifelt, »Heilbutt, schmeckt sehr gut, für euch, nimm du ihn doch bitte.«
Voller Abscheu starrte das Mädchen auf das riesige Stück Heilbutt im Eimer.
»Traust du dich nicht, ihn anzufassen? Macht nichts. Laß mich kurz rein, dann kippe ich den Fisch mit dem Eimer auf eure Anrichte, bitte.«
Das Mädchen schob ihre widerspenstigen Locken wieder unter das Häubchen, zog es sich fest über das Haar, öffnete die Untertür und ging vor ihm her durch einen stockfinsteren Gang, der in eine Höhle mündete, wo er eine in Bauchhöhe befindliche schmale Hartsteinplatte erkennen konnte. War das die Anrichte? Er war sich nicht sicher, ließ aber den Inhalt des Eimers darauf gleiten. Er drehte sich rasch um und sah durch die Türöffnung die Straße im Lichte eines erneuten kurzen Sonnenstrahls aufleuchten. Beinahe verzweifelt stürzte er auf das Licht zu. Da aber das Mädchen noch hinter ihm stand und in dem schmalen Gang nicht so schnell beiseite gehen konnte, stieß er mit ihm zusammen. Wieder löste sich die Haube, wieder sah er die Locken an den Wangen herunterfallen. Viel mehr brachte ihn aber aus der Fassung, daß er nach dieser ungewollten Berührung plötzlich auch den Duft des Mädchens wahrnahm, einen Duft, den er noch nie zuvor gerochen hatte, einen Duft, der – so unaufdringlich er auch war – seine Nasenlöcher so unbändig füllte, daß er das Gefühl hatte, sie würden aufgeblasen, einen Duft, der lieblicher und wärmer und tiefer war als der von Kalmusblättern, die man, wenn man an einem Sommertag den Maaslander Treidelpfad entlangging, um den in Maassluis allgegenwärtigen Geruch von Gerberlohe und Fisch loszuwerden, so lange zerrieb und einatmete, bis der Gestank von Wrackheringen endgültig aus der Nase verschwunden zu sein schien.
Noahs Eltern
Als Dreikäsehoch hatte er mit Thade in den Schlammgräben des Taanschuurpolders Kammolche gefangen. Mit dem Kahn von Thades Onkel waren sie zusammen auf das Maassluise Diep hinausgefahren, um beim Stellen der Reusen zu helfen, in denen die köstlichen Lachse gefangen wurden. Sowohl während dieser Fahrten als auch beim anschließenden Herumsitzen im Fischerschuppen hatte Thades Onkel bereits das ganze Leben mit ihnen besprochen und sie vor den Gören gewarnt. Als ob man – in diesem Punkt waren Thade und er sich immer sehr einig gewesen – von diesen komischen Wesen mit ihren aufgeputzten Körpern und langen Röcken jemals etwas zu fürchten haben könnte!
Darum konnte er sich auch nicht dazu durchringen, Thade von seinem Ausflug ans Ende der Sandelijnstraat zu erzählen. Schon lange bevor sie im Lehrbuch von Bartjens zum Dreisatz gekommen waren, hatte Roemer alles mit Thade geteilt. Nun ja, fast alles. Seine vagen Zweifel hinsichtlich der Vögel, Schmetterlinge und Seehunde in der Arche Noah hatte er, von Scham und Schuldgefühlen erfüllt, für sich behalten. Kein Wort der Heiligen Schrift durfte man mit einem Fragezeichen versehen und folglich auch nicht diese Passage: »Und du sollst in den Kasten tun allerlei Tiere von allem Fleisch, je ein Paar, Männlein und Weiblein, daß sie lebendig bleiben bei dir. Von den Vögeln nach ihrer Art, von dem Vieh nach seiner Art und von allerlei Gewürm auf Erden nach seiner Art: von den allen soll je ein Paar zu dir hineingehen, daß sie leben bleiben.« Glasklar stand es da, aber es fiel ihm entsetzlich schwer zu glauben, daß von allen Tieren ein Paar in der Arche gewesen war. Auch von den langsamen Schnecken? Waren die denn, schon Monate bevor Noah sein Werkzeug zur Hand genommen hatte, losgekrochen, um rechtzeitig an Bord der Arche gehen zu können? Wenn er und Thade, von einem Ausflug in den Taanschuurpolder erschöpft, im hohen Gras der Böschung des Prickenteichs ausruhten, hatte ihm schon oft die Frage auf der Zunge gelegen: »Ob wirklich ein Paar von jeder Tierart auf der Arche gewesen ist?« Doch was hätte er tun sollen, wenn Thade sich aufgerichtet und ihn voller Entsetzen angesehen hätte, weil er einfach so an der reinen Wahrheit einer Stelle in der Heiligen Schrift zweifelte? Darum hatte er über die Sintflut geschwiegen. Wenn er nun auch noch das Mädchen mit der enganliegenden Haube unerwähnt ließ, dann standen bereits zwei Geheimnisse zwischen Thade und ihm. Ein Geheimnis, das ging gerade noch so, aber zwei, das war entschieden zuviel. Leicht und ungezwungen mußte er von der Sandelijnstraat berichten, das war ihm klar, aber gerade das schaffte er nicht. Es schien ihm besser, eine Woche oder so ins Land gehen zu lassen; dann gelang es ihm bestimmt, ganz beiläufig zu sagen: »Weißt du, was mir neulich in der Nähe von Het peerd z’n bek passiert ist?«
Doch dann sah er sie wieder, in ebendem Taanschuurpolder, in dem er so oft mit Thade herumstreifte. Mit der schneeweißen Haube auf dem Kopf, die ihre roten Locken im Zaum hielt, saß sie mit ein paar anderen Mädchen ihres Alters auf der Tanweide und flickte Netze. Als er bemerkte, daß eine der widerspenstigen roten Locken unter der Haube hervorlugte, war ihm, als drückte eine Riesenpranke ihm die Kehle zu. Seine Ohren gellten plötzlich von dem dröhnenden Lärm, der von den Schmieden, Werften und Faßmachereien ausging. Es war, als ob ihr betörender Duft wieder seine Nasenlöcher füllte und den Heilbuttgeruch daraus vertriebe. Wie schrecklich rasch die Reste des riesigen Ungeheuers in Verwesung übergegangen waren! Seit dem ersten Montag nach dem Jahrhundertfest hatten Marije und seine Mutter die Steine hinter dem Haus täglich mindestens einmal kräftig geschrubbt, doch auch als vom Heilbutt keine Spur mehr zu sehen war, schien an der Stelle, wo er verendet war, ein bestialischer Gestank aufzusteigen. Auch wenn er morgens seine Grütze aß, kam es ihm wiederholt so vor, als klebte das schale Heilbuttaroma plötzlich an seinem Löffel, und jedesmal wurde ihm auf der Stelle schlecht.
Einige Tage nachdem er das Mädchen auf der Tanweide gesehen hatte, waren Thade und er auf dem Rückweg von einem Spaziergang zum Duifpolder, wo sie auf einem Bauernhof, den seine Mutter verpachtet hatte, eine kleine Tonne Kreuzhering gegen Speckseiten, Käse, Butter, Möhren und Zwiebeln getauscht hatten. Sie gingen am Trekvliet entlang. Jenseits des Wassers erstreckten sich die Brutplätze der Rohrdommeln und Zwergdommeln. So selten man sie sah, so häufig hörte man sie in der Brutzeit rufen. Manchmal entdeckte man für einen Moment die Cousins der Rohrdommeln, die Zwergdommel oder den Nachtreiher, doch auch die hielten sich meistens im hohen Schilf versteckt.
Auf der Schulter der Wanderer ruhten die Enden eines langen Stocks, der durch die Griffe ihres Korbs mit Viktualien geschoben worden war. Der Treidelpfad war nicht breit genug, um mit einem Korb in ihrer Mitte nebeneinander zu gehen. Also ging Thade, der Kleinere, voraus. Von den Brutplätzen auf der anderen Seite erklang das kurze, runde Bellen einer Nonnengans.
»Steckt dort etwa ein Hund?« fragte Thade erstaunt.
»Nein, kein Hund, sondern eine Nonnengans. Paß mal auf, wenn die Nonnengans bellt, hört man gleich danach, auch wenn jetzt keine Brutzeit ist, manchmal auch den Ruf der Rohrdommel. Anhalten.«
Sie stellten den großen Korb ins Gras und legten sich auf der Polderseite des Ufers auf die hohe Böschung. Tief unter ihnen erstreckte sich der große Commandeurspolder bis zu den Häusern von Maasland. In den Wiesen beratschlagten die Kiebitze über ihre Flugroute.
Er hatte darauf gewartet, und dennoch war Roemer überrascht, als er tatsächlich den seltsam dumpfen, dröhnenden Baß der Rohrdommel vernahm. Wie ein Schiffshorn, das im dichten Nebel auf dem Sluyser Diep ängstlich rief.
»Das ist sie«, flüsterte er ehrfürchtig.
»Hast du schon mal eine gesehen?« wollte Thade wissen.
»Schon oft«, erwiderte er stolz und nicht ganz der Wahrheit entsprechend, »aber man muß sich große Mühe geben. Früh aufstehen und sich dann mit einem Boot stundenlang ins Schilf legen. Sie sind so unglaublich scheu. Wenn die Rohrdommel ein Geräusch hört, streckt sie ihren langen gelben Hals ganz weit in die Höhe, so daß er wie ein Schilfrohr aussieht. Darum heißen sie auch Rohrdommeln. Man fragt sich …«
Wieder rief die Rohrdommel.
»Dreimal wird sie in der Heiligen Schrift erwähnt«, sagte er ehrfürchtig, »ich habe die Stellen in der Bibel angestrichen.«
Über Thades runde, rote, mit Sommersprossen übersäte Wangen sahen die meist schelmischen Augen einigermaßen erstaunt zu ihm hoch.
»Streichst du die Vögel in der Bibel an?«
»Ich habe alle Tiere angestrichen. Ich wollte wissen, wieviel darin vorkommen.«
»Warum?«
»Weil … weil …«
Er schwieg, holte tief Luft, seufzte, fuhr mit der Hand über die Augen, hörte tatsächlich wieder die Rohrdommel blöken und sagte: »Wie hat ein so unglaublich scheuer Vogel es über sich gebracht, aus dem Sumpf zu Noahs Arche zu fliegen?«
Sowohl Erleichterung als auch heftiger Schrecken stiegen von seinen Zehen aus durch den ganzen Körper in seinen Kopf hinauf, der sich feuerrot färbte. Dennoch hatte es den Anschein, als wäre es Thade überhaupt nicht bewußt, wie unerhört das Gesagte war. Ganz unbekümmert erwiderte er: »Die Menschen damals wurden steinalt, fast tausend Jahre. Noahs Vater und Mutter waren bestimmt noch nicht tot, als er mit seiner Arche losfuhr, und seine Großväter und Großmütter lebten vielleicht auch noch. Aber warum durften die nicht mit ins Boot? Verstehst du das? Man läßt doch seinen Vater und seine Mutter nicht ertrinken.«
Er war innerlich so aufgewühlt, daß er nicht in der Lage war, auf diese Frage zu antworten. Jahrelang war ihm vor dem Einschlafen pausenlos dieses eine Problem durch den Kopf gegangen: Wie konnte die Arche die Zehntausende von Tieren fassen, und nun gab es auf einmal noch ein zweites Problem, auf das er noch nie gestoßen war. Nachdem er sich ein wenig beruhigt hatte, versuchte er eine Antwort, die sich für ihn ganz selbstverständlich aus dem viel größeren Problem ergab.
»Die Arche war gerammelt voll. Sie paßten einfach nicht mehr rein.«
»Meinst du? Ein bißchen zusammenrücken, und schon geht’s.«
»Zehntausende von Tieren mußten mit. Vielleicht sogar hunderttausend.«
»Ich verstehe das nicht. Wer läßt denn seinen Vater und seine Mutter ertrinken? Sollen wir mal unseren Katechismuslehrer fragen?«
»Wen? Schlump? Dann schlägt er seinen Rohrstock auf deinem Rücken in Stücke.«
»Wenn ich ihn frage. Nicht aber, wenn du ihn fragst. Seinen Rohrstock erhebt er nicht gegen einen Reederssohn.«
»Ich … ich würde ihn lieber fragen, ob auch Seehunde in der Arche waren.«
»Natürlich waren sie in der Arche. Seehunde ertrinken, wenn sie nicht hin und wieder an Land gehen können.«
»Die Arche lag weit vom Meer entfernt. Wie sind die Seehunde denn hingekommen? Sind sie etwa wochen- oder gar monatelang über Land dorthin gewatschelt?«
»Sie sind einen Fluß hinaufgeschwommen, bis sie in der Nähe der Arche waren.«
»Wäre möglich.«
»Weißt du was? Du fragst Schlump nach den Seehunden, und ich frage ihn gleich anschließend nach Noahs Eltern.«
Dies schien ihm eine gute Strategie zu sein, doch als er am Sonntagabend im Konfirmandenunterricht nach dem Gottesdienst – Schlump blätterte bereits in dem Buch Kort begryp der Christelyke Leere von Jacob Borstius, während die anderen Konfirmanden noch aus der Kirche kommen mußten – seine Frage zu den Seehunden einfach stellte und Thade danach gleich auf Noahs Eltern zu sprechen kam, da klappte der bleiche Gnom das Buch von Borstius zu und zischte Thade an: »Wie den Esel des Bileam werde ich dich verprügeln.«
Als Schlump sofort seinen Rohrstock erhob, wiederholte Roemer Thades Frage hastig. Schlump ließ den Stock wieder sinken und zischte: »Noahs Eltern waren schon gestorben.«
»Steht das in der Bibel?« wollte Roemer wissen.
»Wir können nachsehen«, brummte Schlump, und er schlug zornig die Heilige Schrift auf, blätterte und las vor: »Lamech war hundertzweiundachtzig Jahre alt und zeugte einen Sohn und hieß ihn Noah. Darnach lebte er fünfhundertundfünfundneunzig Jahre.« Schlump blätterte um und las weiter: »Er war aber sechshundert Jahre alt, da das Wasser der Sintflut auf Erden kam.«
Schlump murmelte noch eine Zeitlang Zahlen und sagte dann bissig: »Vater Lamech war also bereits fünf Jahre tot, als der Herr der Heerscharen die ungläubige und unbußfertige Welt mit der Sintflut züchtigte.«
»Und Noahs Mutter?« fragte Roemer.
»Über sie schweigt die Heilige Schrift«, brummte Schlump.
»Und sein Großvater?« wollte Thade wissen.
Schlump antwortete nicht, sondern streckte die Hand nach dem Rohrstock aus.
»Und sein Großvater?« fragte Roemer.
Wieder blätterte Schlump im Buch Genesis und las vor: »Methusalem war hundertsiebenundachtzig Jahre alt und zeugte Lamech.«
»Als Noah geboren wurde, da war sein Großvater also dreihundertneunundsechzig Jahre alt«, sagte Roemer, »denn Lamech war hundertzweiundachtzig, als Noah geboren wurde, und hundertsiebenundachtzig plus hundertzweiundachtzig sind dreihundertneunundsechzig. Methusalem ist neunhundertneunundsechzig Jahre alt geworden, er war der Älteste überhaupt. Also, als Noah sechshundert Jahre alt war und auf die Arche ging, da war Methusalem … da war Methusalem …«
Er schluckte. So verblüffend einfach die Rechnung war, das Ergebnis schien dennoch unmöglich, undenkbar zu sein. Schlump sah ihn lauernd an, und im Bewußtsein, daß er keine große Gefahr lief, schaute er recht unerschrocken zurück und sagte dann beinahe triumphierend: »Als Noah in die Arche ging, da war Methusalem folglich neunhundertneunundsechzig Jahre alt.«
»Darum also ist Methusalem gestorben, als er neunhundertneunundsechzig Jahre alt war«, rief Thade triumphierend. »Er ist bei der Sintflut ertrunken. Noah hat seinen eigenen Großvater ersaufen lassen.«
Zitternd und rot angelaufen, holte Schlump mit dem Rohrstock aus. Thade zuckte zusammen, kein Wort kam über seine Lippen, als der Stock auf seine rechte Schulter herabsauste.
»Ich … ich werde dich verprügeln, wie Elia die Baalspriester züchtigte, ich werde dich schlagen, wie Pekah in Samaria die Kinder Gileads schlug …«
Roemer schubste Thade kräftig beiseite und fing einen Schlag des pfeifenden Rohrstocks auf. Daraufhin duckte Schlump selbst sich wie ein streunender Hund, der einen Schlag bekommt. Er zischte wie ein Knurrhahn, ließ sich hinter dem Tisch im Konsistorialzimmer nieder und murmelte: »Darüber werde ich mit dem Presbyterium sprechen.«
Diderica Croockewerff
Du heiratest Diderica Croockewerff, und damit Schluß!«
Er erwiderte nichts, sah aber seine Mutter so tief betrübt an, daß sie tatsächlich für einen Moment unsicher wurde.
»Ich habe es deinem Vater auf dem Sterbebett versprochen«, sagte sie, gleich ihren stärksten Trumpf ausspielend.
»Aber damals ging sie noch bei Annetje Engelbrechts in die Elementarschule, genau wie ich, und damals wußte er nicht, wie sie einmal aussehen würde.«
»Was stimmt denn mit Diderica nicht? Sie ist eine muntere Frau.«
»Sie sieht aus wie ein Treidelpferd mit entzündeten Hufen.«
»Na, na, mäßige dich. Erst neulich, als ich sie mit ihrer faltenlosen Haube und ihren leuchtenden goldenen Ohrringen gesehen habe, da habe ich stolz gedacht: Sieh da, meine Schwiegertochter.«
»Sie ist viel größer als ich.«
»Ich war auch größer als dein Vater. Ich will kein Wort mehr darüber hören. Willst du vielleicht nach eigener Laune heiraten? Hast du das etwa vor? Du heiratest Diderica! Ihre Mutter hat ihrem Mann auch auf dem Sterbebett versprochen, daß Croockewerff sich mit Stroombreker verbindet. Die Witwe besitzt zwei beinahe noch neue Büsen, wir bringen zwei Huker mit ein. Dann fahren vier Schiffe unter der Flagge von Stroombreker und Croockewerff. Wir sind dann mit einem Schlag die größte Reederei in Maassluis. Wie du weißt, haben die meisten Reeder ein Schiff auf Fahrt, manche haben zwei und nur ganz wenige drei, wie etwa der alte Schelvisvanger. Und wir haben bald vier. Stell dir nur vor: Deine Stimme hat dann im Fischereirat das Gewicht von zwei Büsen und zwei Hukern. Man wird dich nach Den Haag delegieren.«
»Ich will nicht nach Den Haag.«
»Das kommt mit der Zeit, du wirst schon sehen, bestimmt, vier Schiffe, du wirst Gott loben und preisen, du wirst der größte Reeder sein – komm schon, denk dran, auf welcher Seite dein eigenes Brot mit Butter bestrichen ist. Glaubst du, daß ich mich seinerzeit danach gedrängelt habe, deinen Vater zu heiraten? Mit ihren besten Mützen auf dem Kopf standen sie vor mir in der Reihe, aber dein Vater hatte zwei Langleinenschiffe auf Pökelfahrt. Dann unterdrückt man seine Zweifel. Dann denkt man nicht mehr: Was für ein mickriges Kerlchen, sondern schreitet frohen Sinnes und wohlgemut zum Altar.«
Also schritt er, übrigens alles andere als wohlgemut, zehn Jahre nach dem Jahrhundertfest an einem Donnerstagnachmittag im Oktober neben seiner riesigen Braut durch die Groote Kerk. Und wieder ragte dort auf der ohnehin schon so hohen Kanzel Pastor Hoffman mit dem schielenden Auge unter der Gaffelaugenbraue und der mattgrauen, schmuddeligen Allongeperücke hoch über sie hinaus. Hoffman verglich den Ehebund mit dem Bund, den Gott seinerzeit mit Adam geschlossen hatte und den er nach dessen Fall mit allen, die sich bekehrten, großherzig aufs neue schließen wollte. »Durch Adams Bruch des Bundes wurden wir«, so der Prediger, »von Gott abgeschnitten und sind dem Satan zugefallen. Mit unserem Stammvater Adam haben wir den Tod dem Leben vorgezogen, haben wir uns selbst vom lebendigen Gott losgerissen. Und wäre es nicht so, daß sich nicht unendliche Gnade über uns ergösse, wir hätten unsere Abstammung von Adam endgültig verschleudert. Die Kluft zwischen Gott und Mensch kann nur durch den Blutsteg überbrückt werden, welcher vom Gesalbten selbst auf der Schädelstätte Golgatha geschmiedet und kalfatert wurde. Dort, auf Golgatha, hat Christus der Herr sich selbst für uns vollkommen zu Tode geliebt. Dort hat er sein Bundesblut für die Tilgung all unserer Sünden vergossen. Dort hat der Mittler selbst, als Blutzeuge im großen Gnadenbund, freiwillig die Bürgschaft für unsere Sünden übernommen. Ach, dürften wir, die wir mit Blut erkauft wurden, doch an den reichen Wohltaten dieses Bundes teilhaben und als Auserkorene Gottes in diesen Bund aufgenommen werden. Und darum warten wir demütig ab, ob die unendliche Gnade uns einst, und sei es auch nur, wenn wir sterbend die letzte Stufe erreicht haben, verhaften wird, so wie ich jetzt diesen sündigen Roemer Stroombreker und diese sündige Diderica Croockewerff im Ehebund verhaften werde. Dieser Ehebund wird ihre Sündhaftigkeit keineswegs vermindern, doch möge dieser Bund dennoch ein Abbild des großen Bundes, des Gnadenbundes, sein, so daß sie, vielleicht nun schon, ansonsten aber im Laufe der Zeit, wahre Teilhaber des Bundes werden mögen, so wie sie jetzt Teil ihres gemeinsamen Bundes werden. Und möge dieser Ehebund, darum bitten wir den allmächtigen Herrscher, reichlich mit Kindern gesegnet werden, und mögen diese Würmchen ein Abbild dessen sein, was wir, einzig durch die mit Christi Blut teuer erkaufte Gnade Gottes, einmal zu sein hoffen: wahre, allen Pomp und Prunk der Welt meidende Bundeskinder, die unterwegs zu Zions ewigen Hallen sind, wo wir bis in alle Ewigkeit mit dem Blutbräutigam die ewige Hochzeit des Lammes feiern werden.«
Nach der Blutstegpredigt musizierten diesmal keine vornehmen Meister auf mancherlei Instrumenten, um ihn zu trösten. Die Garrels-Orgel wurde vom festen Organisten Dominicus Jaarsma bespielt, der bereits seit 1733 seinen Dienst versah. Dessen solides, aber wenig überraschendes Spiel konnte ihn nicht aufmuntern. Erst als er am Ende des Nachmittags den prassenden Hochzeitsgästen, die das Reederhaus an der Veerstraat bevölkerten, für einen Moment entkommen konnte und im Garten bis zum Ufer spazierte, gelang es ihm wieder, tief durchzuatmen. Er starrte auf die gekräuselte Wasseroberfläche. Nein, der Otter würde nicht mehr aus dem inzwischen stark verschmutzten Vliet auftauchen. Auch den Iltis hatte er schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Die Sonne warf ihre letzten Strahlen über den Goudsteen. Es war, als hätte er die ganze Zeit gewußt, wer dort, am Ende des Nachmittags, im verstohlen und schräg auf den Goudsteen fallenden Sonnenlicht über das glänzende Kopfsteinpflaster vorbeischlendern würde. Sie trug ein paar enganliegende Hauben übereinander. Dennoch lugten ihre roten Locken bei jedem Schritt, den sie machte, weiter unter den Haubenrändern hervor, und sie mußte sie mit ihrem Daumen wieder reinstopfen, wobei sie die Hauben mit den Zeigefingern mißmutig nach unten zog.
Er dachte daran, wie sie sich, wenn er an der Tanweide vorbeispazierte, immer tief über ihre Knüpfarbeit gebeugt hatte, wobei sie jedesmal so heftig errötete, daß die anderen Netzflickerinnen bereits beim ersten Mal, als er vorbeikam, alarmiert waren. Um ihr die oft bösartigen Sticheleien der anderen Mädchen und Frauen zu ersparen, war er, nachdem er vier- oder fünfmal dort gewesen war, nicht mehr an der Tanweide vorübergegangen. Das fiel ihm schwer. Er überlegte, wo er sie sonst noch sehen könnte. Jedesmal vom blauen Papagei ermahnt, sich zu bekehren, besuchte er oft die Sandelijnstraat, konnte sie aber nie entdecken. Auch während der Gottesdienste war sie nicht zu sehen. Ging sie etwa nicht zur Kirche? Soviel stand fest, jeden Morgen ging sie bei Tagesanbruch von der Sandelijnstraat zur Tanweide, und jeden Abend trottete sie todmüde in der blauen Abenddämmerung wieder nach Hause. Er mußte also nur herausfinden, wie spät sie hinging und wann sie wieder zurückwankte. Marije war früher einmal Netzflickerin gewesen, und sie erzählte ihm, daß die Arbeitszeit der Frauen durch den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang bestimmt würde. Im Sommer fingen sie manchmal schon um halb fünf an und arbeiteten bis zehn Uhr abends durch.
Darum ging er im Sommer oft schon im Morgengrauen am Zuidvliet entlang, und im Dämmerlicht des Abends spazierte er über den Zandpad. Und immer wenn er ihr auf seinen Streifzügen begegnete, errötete sie heftig und er auch. Nie sprachen sie ein Wort. Wohl aber lächelten sie sich nach einigen Jahren manchmal flüchtig und vorsichtig zu.
Und nun, da sie dort – zufällig? Absichtlich? Versehentlich? – übers Kopfsteinpflaster schritt, lächelte sie ihm offen zu, als wüßte sie, daß dies nun keine Konsequenzen mehr nach sich ziehen konnte, jetzt, da er an diesem Tag, wegen zwei Büsen, die zum Fang von frischem Hering bestimmt waren, ehelich mit einer riesigen Frau verbunden worden war, die aussah wie ein Bovenlander Pferd.
»Na«, erklang eine Stimme neben ihm, »wer mag das wohl sein?«
»Anna Kortsweyl«, sagte er.
»Sie kommt mir bekannt vor.«
»Kein Wunder, denn wenn wir zu deinem Onkel gingen, kamen wir immer an der Tanweide vorbei, wo sie mit den anderen Netzknüpferinnen saß.«
Thade winkte dem Mädchen zu, und das Mädchen winkte keck zurück. Er sagte: »So, so, an ihr hängt also dein Herz.«
Von heftigen Gefühlen übermannt, brachte er kein Wort heraus.
»Warum …?« fragte Thade.
»Meine Mutter hat es meinem Vater auf dem Sterbebett versprochen. Doch auch ohne dieses Versprechen hätte ich … hätten Anna und ich nie …«
»Und darum stehst du hier und trauerst wie Jakob, als er bemerkte, daß er Lea statt Rahel bekommen hatte? Na los, Kopf hoch, wirf die Flinte nicht ins Korn, du hättest es schlechter treffen können als mit dieser sündigen Diderica.«
»Sie ist so riesig.«
»Aber doch nicht viel größer als deine Anna.«
»Sie ist … in der Kirche stand ich gleich neben ihr … sie riecht nicht gut.«
»Ach, komm, nichts riecht hier gut. Hier stinkt alles nach Gerberlohe und Laberdan. Geh mit Diderica nach Maasland. Leg sie, wenn der Wiesenkerbel blüht, auf die Böschung des Treidelwegs beim Duifpolder, und dann wirst du schon sehen, wie herrlich sie zu riechen beginnt.«
»Wir sprechen uns noch, wenn man dich im Ehereusen fängt.«
»Bevor es soweit ist, bin ich hier schon lange weg. Du glaubst doch nicht, daß ich mit meinem Hang zur leichtfertigen Lebensführung hier in diesem widerlich stinkenden Kaff versauern will, wo man Menschen, die ihre Ehre und ihren guten Namen verloren haben, bis zum Ende ihrer Tage mit größter Verachtung begegnet.«
»Anderenorts ist es bestimmt genauso.«
»Selbst wenn du recht hast: Wer kennt schon dein Gesicht in einer fremden Stadt?«
»Bleib doch hier. Bald habe ich vier Schiffe auf Fahrt, dann bin ich tatsächlich ein großer Reeder und brauche einen Buchhalter.«
»Einen Buchhalter? Keiner kann besser rechnen als du. Als ich mich noch mit den Brüchen abmühte, konntest du schon damit rechnen. Ich will hinaus in die weite Welt.«
Wieder ging Anna Kortsweyl auf dem Kopfsteinpflaster vorüber, diesmal aber nicht allein. Sie war in Begleitung eines Fischers von der Duizent Vreesen.
»Das sieht ziemlich ernst aus«, sagte Thade.
Roemer sagte nichts, schaute nur, wunderte sich nur, daß es ihm tief in die Seele schnitt. Ausgerechnet ein Ausweider von einem seiner eigenen Schiffe. Ich schmeiße ihn runter von meinem Langleinenschiff, war sein erster Gedanke. Dann dachte er: Nein, dadurch benachteilige ich Anna, ich muß ihn umgekehrt fördern. Wenn er sich als fähig erweist, kann ich ihn schon in jungen Jahren zum Schiffsführer machen. Auf Pökelfahrt nach Island. Dann ist er den ganzen Sommer über weg. Geht dort vielleicht über Bord oder erleidet Schiffbruch bei den Shetlandinseln.
Meister Spanjaard gesellte sich zu ihnen, starrte zum Fischer und seinem Mädchen auf dem Goudsteen hinüber und reimte: »Das ist gewiß kein passender Galan, zu einem solch liebreizenden Hühnchen paßt kein mürr’scher Hahn.«
Im Halbdunkel des großen Schlafzimmers auf der Vorderseite des Hauses in der Veerstraat machte viel später am Abend die Braut Anstalten, sich zu entkleiden. Zuerst aber legte sie ihren Psalter mit silbernen Schließen auf die Kommode.
»Das ist mein Taufgeschenk«, sagte sie, »das habe ich immer bei mir.« Einen Moment lang hielt sie den Psalter ganz fest in der Hand, sie schloß die Augen, murmelte etwas vor sich hin, das offensichtlich für den Allmächtigen gedacht war, und flüsterte dann: »Unsere Mütter haben uns, obwohl wir beide das gar nicht wollten, zueinander verurteilt.«
»Ja«, sagte er nüchtern.
»Wir wollen dennoch gemeinsam versuchen, das Beste daraus zu machen.«
»Ja«, sagte er wieder.
»Du darfst dort wohnen bleiben, wo du immer gewohnt hast. Ich darf das nicht. Hier gehört nichts mir, und darum hoffe ich, daß du damit einverstanden bist, wenn ich mein Taufgeschenk hier hinlege. Gleich liege ich in einem wildfremden Bett neben einem wildfremden Mann in einem wildfremden Haus. Bitte verschone mich.«
»Wenn ich dir damit eine Freude mache, will ich gern auf dem Dachboden in meinem eigenen Bett schlafen.«
»Oh, das wäre … dann könnte ich mich allein an das Bett gewöhnen … oh, da wäre wirklich …«
Lautlos schlich er hinauf in sein Bett. So könnte es doch immer bleiben? Der einzige Unterschied zu früher wäre dann, daß nun drei Frauen im Haus waren, die Mahlzeiten bereiteten, schrubbten, putzten, bohnerten, wuschen und bügelten.
Ende der Leseprobe