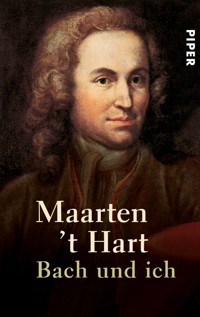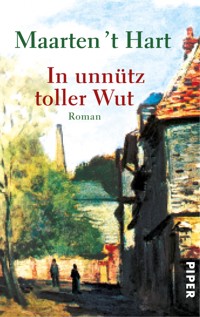8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Immer am Deich entlang wandert der junge Adriaan, vorbei an Rapsfeldern und blühendem Klatschmohn. Zusammen mit seiner Cousine Klaske wird er einen paradiesischen Sommertag verbringen – doch an dessen Ende steht ein Unglück, das Adriaans Leben in eine neue Bahn lenkt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Niederländischen von Gregor Seferens
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2012
ISBN 978-3-492-95475-4
© 1986 Maarten ’t Hart Titel der niederländischen Originalausgabe: »De jacobsladder«, De Arbeiderspers, Amsterdam 1986 Deutschsprachige Ausgabe: © 2005 Piper Verlag GmbH München Umschlaggestaltung: semper smile, München Umschlagmotiv: Tulip Fields with the Rijnsburg Windmill, 1886 (oil on canvas), Monet, Claude (1840–1926) / Musée d'Orsay, Paris, France / Bridgeman Berlin
Jakobsleiter (Jacobs…), w. (-n), 1. (eigentl.) die Leiter in der bekannten Traumvision des Stammvaters Jakob (Gen. 28, 12); – (fig.) Mittel, um mit dem Himmel in Verbindung zu treten; – sehr lange Leiter hinauf in die Spitze einer Mühle; – (sprichwörtl.) es war eine regelrechte Jakobsleiter, eine lange Reihe von Klagen, eine lange und ermüdende Geschichte; – 2. (Seemannsspr.) Bez. für unterschiedliche Strickleitern (event. mit hölzernen Sprossen); – 3. ein über Scheiben laufender, endloser Riemen (möglicherw. auch ein Seil oder eine Kette), auf dem oder an dem Tröge befestigt sind, die Getreide usw. unten im Schiff aufschaufeln und oben wieder ausschütten; – kleiner Bagger mit vertikal angebrachter Baggerleiter; – 4. (botan.) reg. Bez. für Speerkraut (Polemonium coeruleum); Jakobsleiterchen nennt man auch das Salomonssiegel (Polygonatum officinale).
Van Dale,Großes Wörterbuch der niederländischen Sprache
Teil 1
Eine Notwohnung für Gott
1
Ebbe; die Fähre hatte am niedrigsten Steg angelegt. Radfahrer fuhren ans Ufer; Autos starteten ihre Motoren. Jetzt mußte ich an Bord gehen. Doch die Fregatte, die drei Tage am Kai gelegen hatte, lief aus. Drei Abende waren Matrosen singend durch den Hafen gezogen. Manchmal waren sie sogar die Deichtreppen hinuntergestiegen. Nie zuvor hatten wir dergleichen erlebt; nie zuvor hatte ein Kriegsschiff in unserem Hafen angelegt. Schon vom Bahnübergang aus konnten wir die großen weißen Buchstaben und Zahlen auf dem Schiffsrumpf sehen. Jeden Tag war ich kurz hingegangen, um mir die Fregatte anzusehen. Nun würde sie auslaufen. Am liebsten wäre ich stehengeblieben und hätte zugeschaut, bis sie weit draußen auf dem Waterweg war. Dann hätte ich erst die nächste Fähre nehmen können. Wäre ich dann vor dem Abendessen wieder zu Hause gewesen, wie ich es meiner Mutter versprochen hatte? Bestimmt nicht. Trotzdem blieb ich noch einen Moment stehen, betrachtete noch kurz die vielen Matrosen, hörte all die schallenden Stimmen und sah auf der Brücke die Männer mit weißen Mützen. Am Heck wurden die Leinen bereits losgemacht. Rasch lief ich hin. Von dort konnte ich leicht vom höchsten auf den niedrigsten Steg zur Fähre springen. Noch einen Augenblick – dort waren so viele Möwen, Hunderte, so schien es, sie schwebten alle über dem Achterdeck. Es roch dort so herrlich, es war ein Duft, der keinem anderen Geruch ähnlich war, ein Duft von Verwesung und Schmieröl, Tauen und, merkwürdigerweise, auch Mist.
Weiter weg, am Bug des Schiffes, stand noch ein Junge und sah andächtig zu. Er war so alt wie ich. Wer mochte das sein? War das Jan Ruygveen? Jedenfalls stand er an der schönsten Stelle. Offenbar mußte er keine Fähre erreichen. Deren Signalhorn tutete. Beim nächsten Ton würde die breite, eiserne Planke langsam in die Höhe fahren. Jetzt mußte ich gehen. Vom einen Steg auf den anderen springend, erreichte ich den vorletzten Landungssteg. Das Signalhorn tutete erneut. Die breite Laufplanke ging hoch. Von der eisernen Kante des vorletzten Stegs konnte ich bequem auf die Planke steigen und mit ihr gen Himmel steigen. Sie fuhr so langsam in die Höhe, daß ich mich hinsetzen konnte. Dann wurde die Schräge immer steiler, und während ich noch einen Moment weiter in die Höhe stieg, rutschte ich langsam hinab aufs Deck. Dort erwartete mich ein wütender Bootsmann.
»Halunke«, schimpfte er, »du kleiner Angeber, wenn ich dein Vater wäre, ich würde dir die Hammelbeine langziehen. Du hättest genausogut zur anderen Seite abrutschen können, und dann wärst du zwischen Hafenmauer und Schiff gelandet.«
Er gab mir einen Schubs gegen die Schulter. Eine Ohrfeige wollte er mir auch noch verpassen, doch ich duckte mich und rannte zum turmhohen Achterdeck der Fähre. Auf den Kisten mit Schwimmwesten sitzend, konnte ich noch die ablegende Fregatte beobachten. Alle Trossen waren jetzt los. Jan Ruygveen stand an der Stelle, wo ich zuvor gestanden hatte. Offenbar war er zum Heck der Fregatte gelaufen. Zwei gewaltige, über das Wasser widerhallende Stöße aus dem Signalhorn. Der Bug mit der Kanone drehte sich langsam von der Kaimauer weg. Dann wendete die Fähre, und ich mußte mir eine neue Stelle auf der Hoofdingenieur Van Elzelingen suchen, um weiterhin die rasch kleiner werdende Hafenmole sehen zu können.
Sollte ich jetzt zum Bug gehen? Es war jedesmal so herrlich, zu der näher kommenden Insel Rozenburg hinüberzusehen, das salzige Wasser zu riechen und den Seewind zu spüren. Außerdem mußte die Fähre unterwegs fast immer einem Küstenfrachter oder einem Tanker ausweichen, so daß man diese Schiffe auch aus der Nähe betrachten konnte. Und fast immer flogen Flußuferläufer, Trauerseeschwalben oder Austernfischer in geschlossener Formation vorüber. Doch diesmal war es ruhig auf dem Fluß, und es waren nur ein paar Binnenschiffe unterwegs, die so langsam vorwärtskamen, daß wir ihnen nicht ausweichen mußten. Wie schade, ich liebte es, mit dem Schiff zu fahren, was mich anging, konnte die Überfahrt nicht lang genug dauern.
Rozenburg. Die Ebbe hatte ihren Tiefststand erreicht. Wir legten am vorletzten Steg an. Gemächlich senkte sich die eiserne Planke nach unten.
Als ich das steile Ufer hinaufging, bemerkte ich, daß auf der Kaimauer am anderen Ufer Dutzende Menschen da standen, wo ich vorhin die Fregatte beobachtet hatte. Was war dort passiert? Warum schwenkten die Leute die Arme?
Warum liefen sie aufgeregt hin und her? Warum war die Fregatte noch nicht abgefahren? Hätte ich doch bloß auf die nächste Fähre gewartet! Die Menschenmenge drüben wurde rasch größer. Polizisten auf Fahrrädern eilten über die Mole herbei.
Mit trockenem Mund starrte ich zu dem fernen Schauspiel hinüber. Daß ich das jetzt verpassen mußte und nicht wußte, was dort geschah oder geschehen war. Langsam ging ich den hohen Deich entlang und sah zum anderen Ufer hinüber, wo sich immer mehr Menschen bei der Fregatte zusammendrängten, die schon längst mitten auf dem Fluß hätte sein müssen. Ich dachte: »Tja, dann muß ich eben so rasch wie möglich zum Hof von Tante Sjaan laufen und Eier, Butter und Käse holen. Wenn ich schnell wiederkomme, krieg ich vielleicht noch raus, was passiert ist.«
Mit größtmöglichen Schritten stapfte ich über den Deich. Bei einem Wegweiser mußte ich den Deich hinabsteigen. Unten ging der Weg weiter. Dort roch ich auf einmal den alles beherrschenden, friedlichen, intensiven Duft von Raps, den Duft eines ganzen Rapsfeldes. Fast vergaß ich, was hinter mir lag. Außerdem blühten auf dem Deichhang Klatschmohn und Löwenmäulchen. Dazwischen flatterten zierliche Hauhechel-Bläulinge, orangefarbene Feuerfalter und gelbliche Kohlweißlinge. Sie verfolgten einander, überquerten den Weg, verschwanden im Raps, kamen in größerer Anzahl wieder. Dennoch war es stiller als in einer leeren Kirche. Und es war warm, sehr warm. Es schien, als verstärkten sich Stille und Wärme gegenseitig. »Es ist warmstill«, flüsterte ich, »es ist warmstill.« Ein braunes Hündchen kam mir entgegen, wedelte mit dem Schwanz und lief neben mir her. Zusammen gingen wir an einem Haus vorüber, das in den Deich hineingebaut war. Als wir an dem Haus vorbei waren, blieb der Hund stehen. Er bellte kurz auf, so daß es anschließend noch stiller zu sein schien.
Ich kam noch an einer ganzen Reihe von Häusern vorbei, die ebenfalls in den Deich gebaut waren; es sah so aus, als seien sie mit dem Erdwall verwachsen. Auf den Fensterbänken lagen Katzen in der Sonne. Manchmal bellten mich größere Hunde an. An jedem Häuschen standen schiefe, zum Waterweg hinweisende Pappeln, und Klatschmohn und Löwenmäulchen machten fast unbemerkt Platz für Gemüsegärten, in denen Prinzeßbohnen schräg den Deichhang hinaufwuchsen.
»Du mußt unten am Deich entlanglaufen, bis du an eine Kreuzung kommst«, hatte meine Mutter gesagt, »dort mußt du geradeaus weitergehen und dem Sandpfad folgen, der sich durch die Wiesen schlängelt. Du kommst dann zuerst zu einem Bauernhof und gehst quer über den Hof. Hüte dich vor dem großen Schäferhund. Wenn du diesen Hof hinter dir gelassen hast, siehst du ein Häuschen mit grünen Fensterläden. Daran mußt du vorbeigehen. Dahinter triffst du auf einen schmalen Pfad. Wenn du dem folgst, erblickst du hinter der Kurve zwischen den hohen Erlen ein Gatter. Vielleicht ist es offen, vielleicht auch nicht. Wenn es nicht offen ist, kannst du ruhig drüberklettern. Dann folgst du dem Weg, und irgendwann taucht plötzlich das Haus meiner Großkusine auf. Ach nein, zuerst siehst du einen Heuhaufen. Aber wenn du erst einmal bis dort gekommen bist, findest du das Haus bestimmt, und wenn du dich verläufst, dann kannst du immer noch jemanden nach dem Haus von Familie Kooistra fragen. Aber hüte dich vor dem Hund.«
Vorläufig konnte ich noch nichts entdecken. Vorläufig ging ich nur an einem Deich mit Klatschmohn entlang. Ich sah keine Menschenseele; dann und wann einmal bewegte sich hinter einem Küchenfenster ein blau-weiß karierter Vorhang, und ich meinte, ein Augenpaar zu erkennen. Niemand kam nach draußen, um mich aufzuhalten. Man dachte natürlich: »Ach, dort geht ein Junge, der auf dem Weg zu entfernten Verwandten seiner Mutter ist. Die hat vor kurzem erfahren, daß man bei ihrer Großkusine billig Eier, Butter und Käse bekommt, und darum hat sie nun ihren Sohn losgeschickt.«
In manchen der Deichgemüsegärten wuchsen Stachelbeersträucher, die ihre Früchte an langen Zweigen über den halben Weg hinweg darboten. Wenn ich meine rechte Hand aus der Hosentasche zog, konnte ich sie im Gehen pflücken. Der herbe Geschmack der noch unreifen Beeren vermischte sich mit dem intensiven Duft des Rapses.
Ich ging und ging, der Weg war viel länger, als ich aufgrund der Beschreibung meiner Mutter gedacht hatte. Pfauenaugen und Kohlweißlinge folgten mir manchmal, tauchten dann wieder in das riesige Rapsfeld ein und kehrten anschließend zurück, um vor mir den Pfad zu kreuzen, hinüber zu den Löwenmäulchen, wo sie kurz auf den dunkelgelben Blüten ausruhten. Aus allen Richtungen war das Zirpen der Heuschrecken zu hören. Am merkwürdigsten aber erschien mir, daß ich den Waterweg, der doch so nah war, nicht mehr roch. Es kam mir vor, als spazierte ich durch ein fernes Erdenland.
Der Rapsduft wurde schwächer. Ein riesiges Kartoffelfeld mit schon blaßrosafarbenen, aber kaum duftenden Blüten lag still und schmetterlingslos am Wegesrand. Es war, als sei der Himmel darüber dunkler gefärbt. Dann folgte das noch nicht ausgewachsene Kraut eines Rübenfeldes und anschließend die bereits mannshohe, rauschende Gerste, an deren Rand Kornblumen blühten, die verblichen aussahen und sich nicht aus voller Seele mitbogen, wenn der Wind durch das Getreide jagte. Wenn ich die Augen schloß, klang es, als hörte ich jemanden im Schlaf reden. Es schien, als unterhalte der ganze Acker sich mit dem Wind und dem Himmel und den Heckenbraunellen, die im Getreide herumraschelten und manchmal darüber hinwegflogen. »Die Heckenbraunelle ist bestimmt der schönste Vogel«, dachte ich, »kein anderer Vogel hat so ein hübsches, schiefergraues Köpfchen und ist so grazil gebaut.«
Hinter dem Gerstenfeld tauchte die Kreuzung auf. Doch da war kein Sandpfad. Lediglich zwei tiefe, sandige Rillen, zwischen denen Wegerich, Sauerampfer und Wiesenkerbel wuchsen, zogen sich durchs Gelände. Auch eine riesige Pfütze gab es dort, über die ich hinübersprang. Entlang den Rillen wuchs Eichenreisig. In den Büschen tummelten sich lauter Eichenwickler, deren Grün beinah in den Augen weh tat. Auf dem Wiesenkerbel krabbelten goldene Käfer in der Sonne. Auch sie waren grün, goldgrün. Gern hätte ich sie gefangen, aber ich mußte weiter. Nach einigen sanften Biegungen spaltete sich die Spur und wurde zu vier Rillen, die in einiger Entfernung zu Muschelwegen wurden. Welchen Weg sollte ich nehmen? Der linke führte zu einem Wäldchen aus verkrüppelten Kiefern. Es konnte gut sein, daß dahinter Häuser lagen. Der rechte Pfad schlängelte sich weiter unten am Deich entlang. Ein Windstoß brachte den Duft von Raps mit sich. Mannhaft wandte ich mich in Richtung Wäldchen und dachte dabei an das, was mein Großvater immer sagte: »Tja, mein Junge, eigentlich habe ich im Leben nur eins gelernt: Von dem, was die Menschen dir vormachen, stimmt nichts.« Es stellte sich heraus, daß hinter dem Wäldchen ein zweites aus Holunder- und Weißdornsträuchern versteckt war. Seitlich davon tauchte ein Bauernhof auf. War das der Hof mit dem Schäferhund? Allerdings zeigte sich, daß hinter dem Wäldchen ein breiter Sandpfad begann. Rasch überquerte ich den Hof. Von einem Schäferhund war nichts zu sehen und zu hören. Das Häuschen dahinter hatte rote Fensterläden, die geschlossen waren. Der Sandweg schlängelte sich daran vorbei, achtete überhaupt nicht auf das Häuschen. Er führte nah an einer rotblühenden Weißdornhecke vorüber, in der Hummeln brummten. Es schien, als führte der Pfad hinunter, als beschützte die laut summende Weißdornhecke alles, was dahinter lag. Man hätte meinen können, die Hecke stünde in Flammen. Als ich einige Zeit daran entlanggegangen war, erblickte ich das Gatter. Es war nicht offen und viel zu hoch, um darüberzuklettern. Als ich dagegendrückte, öffnete es sich. Vorsichtig ging ich hindurch. Ich gelangte auf einen Kiesweg, der um eine kreisförmige Wiese herumführte. Mitten in dem Rund ragten zwei riesige Platanen in den Himmel. Zwischen die beiden Bäume war eine Wäscheleine gespannt, auf der Laken trockneten. Das Gras selbst war blau vor lauter Ehrenpreis. Neben der Hecke war ein Komposthaufen, bei dem eine Ziege stand. Seelenruhig zog sie eine Brennessel zwischen den Blumen hervor. Sie legte sich die Nessel im Maul zurecht und fing bedächtig zu kauen an. Auf der blauen Wiese spielten zwei frischgeborene, gleichaussehende schwarze Ziegen mit weißen Söckchen. Dazwischen scharrten Hühner. Über das Ehrenpreis kam ein großer Hahn auf mich zu, verbeugte sich vornehm und stolzierte in Richtung Kiesweg weiter.
Regungslos schaute ich zu der blauen Wiese hinüber. Dort schien es noch wärmer zu sein als überall sonst. Unglaublich sommerlich war es dort, unglaublich friedlich. Dann trat aus dem weiter hinten liegenden Haus ein Mädchen meines Alters und kam auf mich zu. Sie erschrak nicht, als sie mich sah. Sie lief über die blaue Wiese. Es schien Zufall zu sein, daß sie dabei meine Richtung einschlug.
»Was machst du hier?« fragte sie mich.
»Eier kaufen, und Butter, und Käse«, erwiderte ich.
»Wir verkaufen nichts«, sagte sie.
»Meine Mutter hat aber gesagt … sie hat gehört, daß man bei euch …«
»Wir verkaufen nur an Verwandte.«
»Aber ich bin ein Verwandter.«
»Du? Du mit uns verwandt? Lügner! Ich habe dich noch nie gesehen.«
»Mein Großvater, Adriaan Voogd, ist ein Onkel deiner Mutter.«
»Meine Mutter hat gar keinen … die Ziege will ins Erdbeerbeet, halt sie fest!«
In aller Ruhe spazierte die Ziege zu den Erdbeerpflanzen und schleppte ein Seil mit einem Pflock hinter sich her, den sie aus dem Boden gezogen hatte. Hier und da futterte sie ein paar Pflanzen, ging weiter, gelangte in ein Gemüsegärtchen, wo sie einen Salat aus der Erde rupfte. Als sie den zweiten Salat ernten wollte, erreichten wir sie. Mit zwei Händen packte ich sie beim Nacken. Ich versuchte, sie nach hinten zu ziehen, hatte aber nicht damit gerechnet, daß sie so stark war. Außerdem bockte sie mit gekrümmten Vorderbeinen. Mit ihren seltsamen Augen sah sie mich an. Zwei große, breite, horizontale Pupillen, um die herum ein hellgelber Rand glänzte. Ich packte ihre Vorderbeine und hob sie in die Höhe. Danach konnte ich sie, meine Schultern gegen ihre gestemmt, langsam nach hinten schieben. Sie wedelte eifrig mit ihrem kurzen Schwanz, beugte den Kopf nach vorn und drückte damit gegen meine Brust.
»Wo soll ich sie hinbringen?« fragte ich das Mädchen.
»In den Schuppen, da links«, erwiderte es.
Langsam schob ich die Ziege nach links. Ich schaute dabei in die Augen, die so nah waren und solch einen merkwürdigen, verträumten Glanz hatten. Es schien fast, als sähe die Ziege mich überhaupt nicht, als wäre sie ganz in Gedanken versunken. Auf dem Kiesweg waren Schritte zu hören. Das Mädchen rief demjenigen, der sich mir von hinten näherte, zu: »Er hebt die Ziege hoch, er hebt die Ziege hoch.«
Erst nachdem ich die Ziege in den Schuppen geschoben und das Mädchen die Tür zugemacht hatte, konnte ich mich umsehen. In der warmen Sommersonne stand eine Frau auf dem Kiesweg. Sie wischte sich Tränen aus den Augen; offenbar hatte sie Zwiebeln geschält. Während ich die Ziege, die über die niedrige Schuppentür zu klettern versuchte, nach hinten drückte, sagte das Mädchen: »Er sagt, er sei mit uns verwandt. Wie kann das sein?«
Die alte Frau antwortete nicht, sie stand nur da, sah mich mit großen Augen an und seufzte dann: »Ist ja nicht möglich, ist ja nicht möglich. Und er ist genauso stark.«
»Genauso stark wie wer?« wollte das Mädchen wissen.
»Wie sein Großvater«, antwortete die alte Frau.
»Du weißt nicht einmal, wer er ist«, sagte das Mädchen.
»Er ist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten«, sagte die alte Frau, »ich kann … ich glaub’s nicht … daß das nach so viel Jahren passieren muß, nach so viel Jahren.«
Plötzlich erwachte sie aus ihrer starren, versteinerten Haltung und setzte sich wieselflink in Bewegung. Sie zog mich so grob und wild an sich, daß ich dachte, sie wolle mich vom Hof jagen. Dann begann sie, mich heftig zu liebkosen. Kräftig streichelte sie mir über den Kopf, was ich gar nicht angenehm fand.
»Wer ist der Junge denn?« fragte das Mädchen.
»Ein Enkel von Adriaan Voogd«, erwiderte die alte Frau.
»Warum hast du mir nie erzählt, daß wir noch mehr Verwandte …«
»Ach, Kind«, sagte die alte Frau, die offenbar die Mutter des Mädchens war, »es ist so viel geschehen. Sie haben sich über die Taufe gestritten.«
»Wer hat sich gestritten?«
»Sein Urgroßvater und mein Vater.«
»Und wie kann dann sein Großvater ein Onkel von dir sein?«
»Tja«, seufzte ihre Mutter, »alle Leute auf Rozenburg waren anscheinend darüber empört. Meine Großmutter starb, und innerhalb eines Jahres heiratete mein Großvater eine Frau von Anfang Zwanzig, die ebenso alt war wie meine Mutter. Meine Mutter hatte damals auch gerade geheiratet und wurde, wie ihre Stiefmutter, schwanger. Als ich zur Welt kam, wurde auch Adriaan geboren. Es war fast, als wären wir Zwillinge, und dennoch war Adriaan eigentlich mein Onkel.«
»Ich verstehe nicht die Bohne«, sagte das Mädchen.
»Sie gerieten in Streit«, sagte ihre Mutter, »mein Großvater war Mitglied der A-Kirche, und mein Vater bekannte sich zur B-Kirche. Ständig kabbelten sie sich wegen irgendwelcher Glaubensfragen, und schließlich ist mein Großvater dann weggezogen. Seitdem haben wir uns nur noch selten gesehen. Nun ja, als das geschah, da war ich schon beinahe zwanzig … ach, das Leben geht so schnell vorbei.«
»Sein Großvater ist also genauso alt wie du?« fragte das Mädchen.
»Ja«, sagte ihre Mutter.
»Aber das geht doch nicht«, sagte das Mädchen, »ein Großvater kann doch nicht genauso alt sein wie eine Mutter.«
»Warum nicht? Dein Vater und ich haben erst spät geheiratet. Wir bekamen keine Kinder, und erst nach fünfzehn Jahren Beten hat der Herrgott uns ein Kind geschenkt. Doch Adriaan, ach, der konnte nicht warten, der heiratete …«
Ihre Mutter wischte wieder Zwiebeltränen beiseite. Das Mädchen sah sie aufmerksam an und sagte dann: »Du weinst doch nicht etwa?«
Ihre Mutter antwortete nicht. Ich hörte nur das allgegenwärtige, wilde Summen der Fliegen, Bienen und Hummeln.
Den ganzen langen, wundersamen, warmstillen Sommernachmittag folgte mir ihr Blick. Klaske und ich suchten Würmer für die Hühner.
»Dann bekommen ihre Eier schöne, dunkelrote Dotter«, sagte Klaske. Mit einer Harke lockerte ich die Erde, und Klaske sammelte die Würmer ein. Manchmal fanden wir auch eine riesige braune Nacktschnecke. Furchtlos nahm Klaske sie dann in die Hand und gab sie der größten Henne.
»Die ist verrückt nach Schnecken«, sagte sie.
In der Weißdornhecke suchten wir nach Raupen. Ich spürte ihren Blick. Erst als wir dicke Bohnen pflückten, war ich für kurze Zeit aus ihrem Blickfeld.
»Bleibst du zum Essen bei uns?« fragte Klaske.
»Nein, ich muß schnell wieder nach Hause«, antwortete ich.
»Du mußt bleiben«, erwiderte Klaske, »ich finde es so schön, daß du da bist, ich habe mir immer so sehr einen Bruder gewünscht.«
Als wir die Bohnen in der Küche ablieferten, fragte sie ihre Mutter: »Er darf doch zum Essen bleiben?«
»Aber natürlich.«
»Ja, aber ich habe versprochen, gleich wieder nach Hause zu kommen«, sagte ich.
»Ach, deine Mutter weiß, wie das bei uns so ist, die denkt sich bestimmt, daß du zum Essen hiergeblieben bist, so haben wir das früher auch immer gemacht, und abends ist es noch so lange hell. Schade, daß wir kein Telefon haben, sonst könntest du kurz anrufen, aber was soll’s, deine Mutter wird sich schon keine Sorgen machen.«
»Wir haben auch kein Telefon«, sagte ich, »aber ich würde trotzdem lieber nach Hause gehen. Ich mag dicke Bohnen nicht besonders, die sind so bitter.«
»Ach, da liegt der Hase im Pfeffer«, sagte ihre Mutter, »tja, alle Kinder finden, daß dicke Bohnen bitter schmecken. Wenn du älter wirst, ändert sich dein Geschmack, du wirst sehen, später wirst du kaum etwas leckerer finden. Na, dann essen wir zur Feier des Tages doch Spinat.« Ihre Augen funkelten. Daß ich Spinat ebensowenig mochte, traute ich mich nicht zu sagen.
Bei Tisch sagte Klaskes Vater: »Wunder über Wunder, er sieht wahrhaftig aus wie Adriaan.«
»Ja«, sagte Klaskes Mutter, »und dabei hast du Adriaan nicht einmal gekannt, als er so alt war wie sein Enkel jetzt. Es ist wirklich kaum zu glauben, kaum zu glauben.«
»Wieso geht dir das Ganze denn so nahe?« fragte ihr Mann.
»Mir kommt es so vor, als hätte ich heute einen Sohn dazubekommen.«
»Was macht dein Vater?« wollte Klaskes Vater wissen.
»Er ist Küster«, antwortete ich.
»Na, da hockt er ja den ganzen Tag über drinnen«, brummte er, »das wär nichts für mich.«
»Pfui Teufel, Spinat«, sagte Klaske.
»Nimm dir doch mal ein Beispiel an Adriaan«, sagte ihre Mutter, die mir fast den ganzen Teller mit dem zu einem gleichmäßig grünen Brei gekochten Gemüse gefüllt hatte, das wir zu Hause immer verächtlich »Glibber« nannten.
Weil ich aus Erfahrung wußte, daß ich den Geschmack kaum merkte und erst hinterher würgen mußte, wenn ich sehr schnell aß, löffelte ich das Zeug mit rasender Geschwindigkeit in mich hinein.
»Ich habe noch nie ein Kind gesehen, das so gern Spinat ißt«, sagte Klaskes Mutter, »ich bin verblüfft.« Und erneut füllte sie meinen Teller. Ich dachte: »Das ist Verrat, denn sie mag keinen Spinat, ebensowenig wie ich, doch sie wird jetzt dazu gezwungen, ihn zu essen, weil ich das Zeugs so schnell in mich hineinschaufle.«
Nach dem Essen verließ ihre Mutter das Zimmer und kehrte mit einem dunkelbraunen Foto auf festem Karton wieder. Sie legte das Bild vor mir auf den Tisch. Was mich erstaunte, war nicht, daß der Junge auf dem Foto – mein Großvater – mir ähnlich sah, denn das tat er ganz und gar nicht, er ähnelte nur meinem Großvater, obwohl er damals noch nicht kahl war, sondern daß das Mädchen auf dem Bild Klaske erschreckend ähnlich sah.
»Damals waren wir genauso alt wie ihr jetzt«, sagte ihre Mutter.
Wieder sah ich die großen, stillen Tränen.
»Aber, aber«, brummte Klaskes Vater, »muß das jetzt sein? Springflut auf Rozenburg?«
»Es ist einfach zuviel auf einmal«, sagte seine Frau. »Zuerst all diese Berichte über Enteignung und jetzt auch das noch.«
»Ach, deshalb«, sagte Klaskes Vater, »da mach dir mal keine Sorgen, zur Not jage ich die mit einer Harke …«
»Aber eben davor habe ich ja Angst«, sagte ihre Mutter, »und du weißt ganz genau, daß das nicht erlaubt ist, das sind doch die Autoritäten, die über uns stehen, die von Gott eingesetzt wurden.«
»Von Gott eingesetzt«, sagte ihr Mann höhnisch, »vor allem die Hafenbarone. Und Drees bestimmt auch, dieser gottlose Sozialist! Von Gott eingesetzt!«
»Im Römerbrief steht aber …«, sagte Klaskes Mutter.
»Jaja, aber da steht auch: Ich wartete auf Recht, siehe, so ist’s Schinderei, auf Gerechtigkeit, siehe, so ist’s Klage.«
»Warum reden die beiden so merkwürdig miteinander?« fragte ich Klaske, die mich ein Stück auf dem Nachhauseweg begleitete, als wir zusammen an dem Bauernhof vorübergingen, wo auch diesmal kein Schäferhund zu sehen war.
»Hier auf Rozenburg sollen Hafenanlagen gebaut werden«, antwortete Klaske, »und das bedeutet vielleicht, daß wir umziehen müssen.«
»Findest du das schlimm?«
»Nein, ich finde das sehr spannend, ich würde gern woanders wohnen, aber mein Vater kann wegen dieser Sache nachts nicht mehr schlafen. Er hat Magenschmerzen und sagt fast gar nichts mehr. Auch meine Mutter findet es furchtbar schlimm. Den ganzen Tag über hat sie Tränen in den Augen, heute nachmittag auch. Alle finden das schlimm, alle Leute, die auf Rozenburg wohnen.«
»Wenn ich das nächste Mal komme, ist dann schon …«
»Witzbold, nein, bestimmt nicht. Willst du wirklich öfter kommen?«
»Wenn ich darf.«
»Natürlich darfst du. Aber wenn du nicht kommst … man weiß ja nie … wenn du nicht kommst … Sollen wir uns hier kurz hinsetzen?«
»Mir recht«, sagte ich.
Zwischen den roten Sauerampferblättern saßen wir am Wegesrand. Überall sah ich smaragdgrüne Springhähne auf den Blattnerven sitzen. Ich wollte einen fangen, doch sie nahm meine Hand und sagte: »Ich will dich später einmal heiraten.«
»Mich?« antwortete ich völlig verdutzt.
»Ja, denn du bist bärenstark«, sagte sie, »ich glaube, das ist später einmal praktisch.«
»Willst du mich deswegen heiraten?«
»Ja«, sagte sie fröhlich, »und auch weil du ein netter Junge bist, o nein, du bist ganz und gar nicht nett, du hättest wirklich nicht so viel Spinat zu essen brauchen, du Schuft.«
»Aber man muß einander doch nett finden, wenn man einander heiraten will.«
»Nein, nein, eben nicht, eben nicht, Menschen, die miteinander verheiratet sind, reden immer so übelgelaunt und beleidigt miteinander, habe ich recht oder nicht?«
»Ja, meistens ist das so«, sagte ich.
»Da hast du’s«, sagte sie.
»In Ordnung«, erwiderte ich ruhig, »ich will dich gern heiraten, vorausgesetzt …«
»Vorausgesetzt was?«
»Daß ich später mit dir in eurem Haus wohnen darf, wenn dein Vater und deine Mutter tot sind. Ich mach dann die ganze Arbeit.«
»Findest du unser Haus so schön?«
»Als ich durch das Gatter ging und in den Garten kam, dachte ich … dachte ich …«
»Nun, was dachtest du?«
»Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, es war, als wohnte dort, tja, es klingt verrückt, aber trotzdem war es so, es war, als wohnte dort der Sommer. Ich meine, woanders ist natürlich auch Sommer, aber bei euch wohnt er, dort sind sein Haus und sein Garten, verstehst du. Ja, nirgendwo würde ich lieber wohnen als dort. Und auch hier auf Rozenburg ist es so schön, schau nur, siehst du die Springhähne auf dem Sauerampfer? Bei uns sieht man sie kaum noch, und hier … da sitzen vielleicht hundert.«
Vorsichtig pflückte ich eines der Sauerampferblätter ab und legte es auf meine ausgestreckte Hand.
»Ich finde, das ist das schönste Grün«, sagte ich.
»Springhähne nennst du die?« fragte sie.
»Ja«, sagte ich, »so nennt mein Großvater sie, der hat mir alle Namen der Vögel, Pflanzen und Insekten beigebracht.«
»Du hättest also nichts dagegen … was aber, wenn wir nun doch von Rozenburg wegziehen müssen?« wollte sie wissen.
»Das kann ich mir nicht vorstellen«, sagte ich, »etwas so Schönes wie euren Garten wird man doch nicht … nein, nein, und außerdem ist der Waterweg so weit entfernt. Selbst wenn ein noch so großer Hafen gebaut wird …«
»Die Leute sagen aber …«
»Ach was, mein Großvater sagt immer, daß nichts so passiert, wie man es sich vornimmt.«
»Aber wenn wir einander nun versprechen, daß wir später heiraten, und unser Haus wird abgebrochen, was dann?«
»Ich kann doch versprechen, daß ich dich nur heirate, wenn euer Haus noch steht«, sagte ich.
»Habe ich’s nicht gesagt, daß du ein Schuft bist«, sagte sie, »o, du willst also nur das Haus haben … bilde dir bloß nicht ein, daß ich mich auf so etwas einlasse.«
»Na gut«, sagte ich, »dann verspreche ich es eben einfach so.«
»Hand drauf?« fragte sie.
»Hand drauf«, sagte ich.
Wir standen auf und gingen weiter. Sie sagte: »Ich bring dich bis zum Weg«, doch dann hinderte die Regenpfütze uns am Weitergehen. »Hier kehre ich um«, sagte sie. »Ich hebe dich drüber«, sagte ich. »Kannst du das?« fragte sie, doch ich antwortete nicht, sondern hob sie seelenruhig über die Pfütze. Wir gingen noch ein kleines Stück weiter. Sie sagte: »Ja, aber was soll ich machen, wenn ich jetzt gleich zurückgehe? Dann bist du nicht da, um mich über die Pfütze zu heben.« »Dann mach doch jetzt kehrt«, sagte ich, »ich gehe kurz mit und hebe dich rüber.«
So hob ich sie zum zweiten Mal über die Pfütze. Beide gingen wir unseres Wegs, beide schauten wir uns noch einmal um und winkten uns zu. Anschließend marschierte ich wieder unten am Deich entlang, und immer noch war es dort warmstill. Die Sonne verbarg sich hinter einem breiten Wolkenband, das sich im Westen über der Brielse Maas erhob. Der Himmel über mir war blauer als Ehrenpreis, und dicht über dem unteren Himmelsrand kurvten Mauersegler.
Es herrschte noch nicht wirkliche Dämmerung, sondern nur die Vordämmerung, die es nur dann gibt, wenn die Sonne hinter einem solchen Wolkenrand versinkt. Dennoch hörte ich in einem Kiefernwäldchen bereits das flinke Meckern des Ziegenmelkers, dem Lieblingsvogel meines Großvaters. Es war, als hörte ich meinen Großvater wieder sagen: »Ich hätte nichts dagegen, in Amerika zu leben, denn dort rufen die Ziegenmelker in der Dämmerung ›Wipurwil‹, aber wie man hört, sollen die Zigarren dort so schlecht sein.«
Die Welt war dunstig, durchsichtig, tiefblau. Überall machten sich jetzt die Ziegenmelker auf Insektenjagd. Die Fledermäuse auch. Und die Eulen. In der Ferne entdeckte ich auf einem schiefen Gatter die Silhouette einer Rohrweihe. Wenn der Wind kurz aufkam, war es, als holten die Bäume rasch Atem.
Erst auf dem Fluß, auf der Fähre setzte die wirkliche Dämmerung ein. Zweimal wichen wir einem Tanker aus, einmal einem Küstenmotorschiff. Ein durchsichtiger Nebel wallte über das Wasser. Vorbeieilende Uferläufer veranstalteten ein Wettrennen. Ein Vogel führte deutlich, wurde aber, in einiger Entfernung, dort wo die glitzernden Tanks von Pernis anfingen, von dem Vogel geschlagen, der zunächst ganz hinten geflogen war. In Pernis brannte ruhig das Ewige Licht, und aus den Fabrikschornsteinen stiegen Rauchsäulen senkrecht in die Höhe. Es sah aus, als wollten riesige Arme den Himmel auf die Erde herabzerren.
Das Kriegsschiff war ausgelaufen. Trotzdem waren viele Leute auf der Mole. Und immer noch dauerte die Dämmerung an, als müßte etwas aufgeschoben werden, als könnte niemand, auch Gott nicht, von dem friedlichen Abwarten genug bekommen. Erst als ich die Kirchentür öffnete, war es Abend. In der Ferne vernahm ich Stimmen. In dem langgestreckten Vorraum brannte Licht. Die Tür, welche die Eingangshalle mit unserem Haus verband, stand halb offen. Wer besuchte uns da? Auf der Matte vor der Tür zog ich meine Schuhe aus. Auf Socken schlich ich vorsichtig über den Marmor. Hinter der geöffneten Tür blieb ich stehen. Erst einmal lauschen, wer zu Besuch gekommen war.
»Nachdem er Ihnen das Kreuz auferlegt hat, wird Gott Ihnen auch die entsprechende Kraft geben«, sagte eine Stimme.
»Oh«, dachte ich, »das ist Pastor Guldenarm, nun, dann warte ich lieber, bis er weg ist.«
»Diese Kraft«, sagte mein Vater, »reicht mir nicht.«
Meine Mutter sagte nichts, aber ich wußte, daß sie auch da war, denn sie schluchzte und seufzte. Was war passiert? Das wollte ich wissen, bevor ich ihnen unter die Augen kam. Bestimmt waren sie böse, weil ich viel später als vereinbart heimgekommen war. Aber wie böse? Das hing von dem ab, was passiert war.
»Möge der Herr diesen Verlust dadurch ausgleichen, daß er sich selbst gibt«, sagte der Pastor, »und vergessen Sie nicht: Einmal wird es ein seliges Wiedersehen geben.«
»Es ist jemand gestorben«, dachte ich, »mein Großvater vielleicht.«
Mit pochendem Herzen und plötzlich schweißnassen Händen lauschte ich weiter.
»Er ist Ihnen nur einen Augenblick voraus«, sagte Guldenarm.
Meine Mutter weinte und stieß dabei leise Schluchzer aus, zwischen denen es für einen Moment still war.
»Mein Großvater«, dachte ich, »mein Großvater. Nein, nein, das kann nicht sein, er war noch nicht so alt, und krank war er auch nicht.«
»Ja, ich weiß«, sagte Guldenarm wieder mit seiner wogenden Stimme, »das ist das Schlimmste, was einem Menschen widerfahren kann, ein Kind zu verlieren.«
»Meine Schwester«, dachte ich erleichtert, »es ist nur meine Schwester, es ist nicht mein Großvater.«
»Ja«, sagte Guldenarm, »es ist ein großer Fehler, daß wir unser Herz zu sehr an unsere Kinder hängen. Manchmal straft der Herr uns dafür.«
»Betrachten Sie das als Strafe?« fragte mein Vater. »Daß ein Kind vollkommen zermalmt wird, vollkommen verstümmelt? Ist das eine Strafe Gottes?«
»Auch mit seinen Prüfungen sorgt er für uns.«
»Wollen Sie wirklich behaupten, dergleichen könnte eine Strafe Gottes sein? Sie haben nicht gesehen, wie das Kind zugerichtet war, nichts war mehr von ihm übrig – und das soll eine Strafe Gottes sein?«
»Ein Autounfall«, dachte ich, »sie ist überfahren worden, sie ist auf der Touwbaan unter einen Laster gekommen oder so.«
Im Haus waren Schritte zu hören.
»He, da läuft sie herum«, dachte ich, »wie ist das möglich?«
»Ich geh noch kurz zu Marian«, hörte ich meine Schwester sagen.
»Ja, geh ruhig«, sagte mein Vater.
Meine Schwester drückte die Tür auf, hinter der ich stand. Sie bemerkte mich nicht und lief rasch über den Marmor davon. Mein Vater sagte. »Ja, das Kind ist vollkommen durcheinander, gut, daß sie noch schnell zu ihrer Freundin geht, vielleicht kann sie das ein wenig aufmuntern.«
Dann hörte ich zum ersten Mal die Stimme meiner Mutter.
»Er war ein so lieber, lieber Junge«, sagte sie.
»An ihm war nicht die Spur von etwas Bösem«, sagte mein Vater.
»Warum nimmt der Herr uns ein solches Kind fort, solch ein liebes, folgsames Kind?«
»Von wem reden die eigentlich«, dachte ich, »wer kann denn sonst noch gestorben sein?«
Wieder schluchzte meine Mutter leise. Guldenarm sagte: »Ich glaube, ich geh jetzt, morgen schaue ich wieder vorbei.«
Niemand antwortete; meine Mutter murmelte: »Adriaan, Adriaan.«
»Sie glauben, daß ich tot bin«, dachte ich ganz ruhig.
Mir war, als müßte ich nun für immer hinter dieser Tür stehenbleiben. Es schien, als sei ich aus Glas, als könnte ich alles hören und sehen, ohne selbst gehört oder gesehen zu werden. Das war ein mächtiges, überwältigendes Gefühl, es machte mich größer, es hob mich empor und erfüllte mich mit einer unbändigen Freude – ein Gefühl, das man nie wieder verlieren, nie wieder preisgeben will, doch meine Mutter schluchzte wieder so herzerschütternd, daß ich mich zusammenriß. Ich begab mich aus dem Schatten der Tür heraus, trat in das Licht der Türöffnung und sagte ruhig: »Ich bin überhaupt nicht tot.«
Den Anblick dieser Menschen, die mich vollkommen erstarrt ansahen, werde ich nie vergessen. Man hätte fast meinen können, sie seien tot. Mein Vater stand am Kamin, eine Hand um eine Keramikvase; meine Mutter saß neben ihm und hielt seine andere Hand. Ihr freier Arm hatte eine Bewegung zu den Augen vollzogen, die aber mittendrin abgebrochen worden war. Ihr Mund stand halb offen, und es schien, als sei sie wahnsinnig geworden. Pastor Guldenarm, der offenbar gerade zur Tür hatte gehen wollen, stand da und hielt das linke Bein merkwürdig vorgestreckt. Es war, als betrachte man ein Foto.
Der Pastor war der erste, der sich aus der Erstarrung löste. Er zog sein linkes Bein zurück, nahm die kleine Bibel aus der linken Tasche seines Jacketts und beförderte sie blitzschnell in die rechte. Ich dachte: »Die Leute sagen immer, er ziehe seine kleine Bibel ebenso schnell aus der Tasche wie ein Cowboy einen Revolver aus dem Holster«, und ich wartete darauf, daß er die Bibel wieder aus der rechten Tasche herausholte. Das aber tat er nicht, er versuchte lediglich zu lächeln, was ihm aber völlig mißlang. Dann erst nahm er die Bibel in die rechte Hand, zog sie aber nicht wieder hervor.
»Wo kommst du her?« fragte mein Vater.
»Von Rozenburg«, erwiderte ich.
»Warum kommst du so spät?«
»Ich bin zum Essen geblieben«, sagte ich, »ich habe Glibber gegessen, ich bin bis oben voll Glibber, zwei Teller voller Glibber habe ich aufgegessen.«
Es schien, als wollte ich mit dem Spinat Buße tun für meine späte Heimkehr. Ich war bereits bestraft, ich hatte zwei Teller Spinat gegessen.
Pastor Guldenarm holte seine Bibel wieder hervor und ließ sie in der linken Tasche verschwinden. »Ich gehe«, sagte er.
»Einen Moment, bitte«, sagte mein Vater, »wäre es nicht klug, wenn Sie die Polizei informierten? Das Kind muß doch … Wessen Kind mag es dann sein? Zeig mal dein linkes Knie.«
»Mein linkes Knie?« fragte ich.
»Ja«, sagte er, »stell dich hier unter die Lampe und zeig dein Knie mal.«
Ich trat näher an die Lampe heran und hob mein linkes Knie. Mein Vater betrachtete es aufmerksam, schob das Hosenbein meiner kurzen Hose ein wenig hoch, deutete auf eine Narbe gleich über der Knieschneibe und sagte: »Da, seht ihr, er hat genau die gleiche Narbe auf dem Knie, er hat exakt die gleiche Narbe auf dem Knie, Allmächtiger, wessen Kind mag es sein?«
»Was ist denn eigentlich passiert?« erkundigte ich mich ungeduldig.
»Heute nachmittag, als das Kriegsschiff auslaufen wollte, ist ein Kind zwischen Kaimauer und Schiff gefallen. Das Kind ist in die Schiffsschraube geraten und vollkommen verstümmelt worden. Nur das linke Knie war nicht zerfetzt, und das … und das … ach, Junge, daß ich dich wiederhabe, ach, mein lieber Junge, mein lieber Adriaan, es ist kaum zu glauben, ich war so davon überzeugt, daß du … drei Leute haben dich auf der Mole beim Heck des Schiffs gesehen, und Hugo Aldrink, der beim Denkmal auf einer Bank saß, hat der Polizei berichtet, er habe gesehen, wie du ins Wasser gefallen seist, und jetzt bist du wieder da, aber wer ist dann … wer? Und warum hatte dieses Kind auch eine solche Narbe auf dem Knie?«
»Bestimmt ist es auch einmal aufs Knie gefallen«, sagte ich.
Nun fiel mir die Menschenansammlung auf der Mole wieder ein, und mir wurde klar, was passiert sein mußte, während ich mit der Fähre übersetzte. Ich sagte: »Jan Ruygveen hat sich auch das Schiff angesehen.«
»Nein«, sagte mein Vater, »nein, eines der Kinder von Ruygveen, nein.«
»Der ist kein Mitglied unserer Gemeinde«, sagte Pastor Guldenarm.
Mein Vater klopfte mir auf die Schulter und rief erneut: »Ach, mein Junge, ach, mein Junge, daß du noch lebst!«
Meine Mutter, die mich die ganze Zeit mit halboffenem Mund und wie erstarrt angesehen hatte, erhob sich ganz langsam von ihrem Stuhl, zog mich an sich und drückte mich kräftig. Eigentlich war das gar nicht so angenehm. An dem Tag war ich bereits zur Genüge liebkost worden.
»Wo ist … wohin hat man ihn gebracht?« wollte ich wissen.
»Vorläufig hat man den Jungen in der Leichenhalle beim Friedhof aufgebahrt«, sagte mein Vater kurz angebunden. »Die Polizei wollte das Kind noch nicht freigeben.«
Ende der Leseprobe