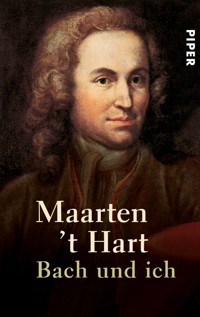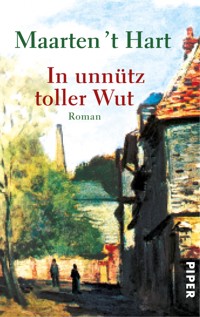
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die junge Lotte Weeda ist Photographin und will in einer kleinen katholischen Ortschaft die zweihundert markantesten Persönlichkeiten porträtieren. Kaum einer kann der Bitte einer so verblüffend schönen Frau widerstehen. Doch nicht nur Abel, der Graf, soll bald bereuen, der jungen Lotte Weeda eine Zusage gegeben zu haben ... Elegant, leichthändig und unerhört spannend erzählt Maarten 't Hart diese augenzwinkernde Geschichte und zeichnet ein skurriles Porträt der Bewohner, die offensichtlich nicht nur dem Sex, sondern zunehmend dem Wahn verfallen sind. »Mysterienspiel aus der niederländischen Provinz, ein literarischer Krimi und als solcher einer der besten des Jahres. Doch das Buch ist viel mehr.« Focus
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Niederländischen von Gregor Seferens Die Übersetzung wurde vom Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds, Amsterdam, gefördert.
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
2. Auflage 2012
ISBN 978-3-492-95659-8
© Maarten 't Hart 2004 Die niederländische Originalausgabe erschien unter dem Titel »Lotte Weeda«, De Arbeiderspers, Amsterdam 2004 Deutschsprachige Ausgabe: © Piper Verlag GmbH, München, 2004 Umschlaggestaltung: semper smile, München Umschlagfoto: Claude Monet (»Der Fluss Robec in Rouen«; Gemäldesammlung Musée d'Orsay)
Einzig der Wahn ist allen gegebenXenophanes
LOTTE
»Zieh dich schon mal aus.«
»Ganz?«
»Stell keine Fragen, deren Antwort du kennst.«
»Wo kann ich meine Sachen hintun?«
»Leg sie auf einen Stuhl.«
»Ich sehe hier keinen Stuhl.«
»Immer dasselbe. Leg sie auf die Fensterbank. Was willst du trinken? Kaffee?«
»Ich trinke nie Kaffee. Hast du Tee?«
»Kräutertee? Jasmin? Pfefferminz? Grünen Tee?«
»Schwarzen Tee, bitte.«
»Earl Grey?«
»Davon bekamen Nachtflugpiloten Herzrhythmusstörungen.«
»Dann kann ich dir nur noch Westminster vom Aldi anbieten.«
»Klingt gut.«
Molly stellte einen kleinen Wasserkessel auf den Gasherd.
»Wieviel hast du schon?« fragte ich.
»Laß mich mal überlegen, elf, glaube ich, du bist der Zwölfte. Was hab ich gesagt? Alles ausziehen … so ist gut. Allmächtiger, wie kommst du in deinem Alter zu einer so guten Figur? Nicht die Spur von einem Bäuchlein. Wie ist das möglich? Du bist doch schon über fünfundfünfzig, nicht?«
»Mehr oder weniger.«
»Ich verstehe das nicht. Die anderen elf … alle waren sie unter dem Rippenbogen tüchtig gewölbt, und du … wie schaffst du das? Machst du ständig Diät?«
»Nein, wer sich kasteit, der kommt nicht weit. Wer Diät hält, der verfeinert nur die Tricks des Körpers, Fett zu speichern, wenn man wieder normal ißt. Wer fastet, wird dick.«
»Was soll man denn sonst tun?«
»Halt dich an meinen Grundsatz: Du darfst überall reinbeißen, Hauptsache, du kannst danach ordentlich scheißen.«
»Ob das bei mir auch hilft?«
»Natürlich. Alles goutieren, aber laxieren.«
»In Reimen abnehmen.«
»Genau. Laß dir raten, sei sparsam mit Kohlenhydraten! Meidest du Fette, bleibst du schlank, jede Wette.«
»Das versteht sich von selbst. Hast du noch mehr Tips?«
»Verpaß dem, was du so futterst, ein Etikett.«
»Ein was?«
»Ein Etikett: als Mundvorrat das, was den Darm grummeln läßt.«
»Als da wären?«
»Roggenbrot, Rohkost, Mangos, Kiwis, Tomaten und vor allem Hülsenfrüchte. Wundermittel! Sojabohnen, Linsen, Erbsen, Bohnen, Kichererbsen.«
»Und ansonsten kann man nach Herzenslust naschen und trinken?«
»Bist du verrückt! Naschen ist sowieso ganz ausgeschlossen.«
»Aber du sagtest doch vorhin: Man darf naschen, was man begehrt, wenn man danach den Darm nur leert.«
»Von naschen habe ich nichts gesagt, ich sprach von beißen. Naschen und trinken … Alkohol ist einer der schlimmsten Dickmacher. Bier ist barbarisch. Abgesehen von einem Bauch bekommt man auch noch Brüste. Pro Tag höchstens zwei Gläschen Rotwein.«
»Teufel, welch ein strenges Reglement.«
»Du kannst es dir aussuchen.«
»Den Darm leeren, abführen, so ein Blödsinn. Du bist so schlank, weil du ständig in Bewegung bist. Jeden Tag sehe ich dich radfahren. Jeden Tag spazierst du ein paarmal mit dem Hund durch das ganze Dorf, du hackst dein Holz selbst, du gräbst deinen Garten um, du jätest, du harkst …«
»Sicher, nichts spricht gegen viel Bewegung, Bewegung ist mindestens genauso wichtig wie Abführen. Sich viel bewegen bringt Segen.«
»Dann eben mehr Sport. Lieber Fitneß als Dünnschiß.«
»Denk dran, was man in Schweden sagt: Ein Mann wünscht sich eine schlanke Frau zum Ausgehen und eine mollige zum Ins-Bett-Gehen.«
Zornig schnaubend goß sie Wasser in die Teekanne. Ich schaute nach draußen. Es herrschte Emily-Brontë-Wetter. Heftig rauschende grüne Bäume. Ein kräftiger Westwind. Vorbeijagende hellweiße Wolken. Phantastisches Wogen und Wiegen von Kammgras und Hundsgras in der munteren Brise. Während ich so dastand, pudelnackt, und sie mit der Teekanne zugange war, schauderte ich. Um mein Zittern zu unterdrücken, sagte ich: »Gestern habe ich in Home is where the wind blows von Fred Hoyle eine lustige Geschichte gelesen. Einem Beamten in einem Dorf in Wyoming wird von der Regierung folgende Frage vorgelegt: ›What is the death rate, die Sterberate, in Ihrem Dorf?‹ Der Beamte grübelt einige Nächte darüber nach. Death rate? Was ist damit gemeint? Nach einigen Tagen teilt er Washington stolz mit: ›Die Sterberate bei uns ist ebenso hoch wie überall sonst auch. Pro Einwohner gibt es nur einen Sterbefall.‹«
Warum lachte sie darüber nicht? Sie sah mich mißbilligend an. »Offenbar kannst du keinen Moment ruhig stehen. Fühlst du dich so unwohl?«
»Es ist ›rûzich waer‹, unruhiges Wetter, wie die Friesen sagen. Als ich noch Biologieunterricht gab, saßen meine Schüler bei so einem Wetter auch keinen Moment still.«
»Dennoch wäre es mir lieber, wenn du dich nicht bewegtest. Gibt es etwas, womit ich dich beruhigen kann? Sanfte Musik?«
»Was schwebt dir denn vor?«
»Woher soll ich wissen, was du magst? Mochtest du früher die Beatles oder eher die Stones?«
»Keine der beiden.«
»Elvis vielleicht?«
Statt zu antworten, fragte ich: »Hast du auch legitime Musik?«
Sie sah mich fragend an.
»Etwas von Mozart«, verdeutlichte ich, »oder zur Not auch von Mahler.«
»Ach, Klassik! Neulich habe ich eine Box im Drogeriemarkt gekauft. Soll ich daraus eine Platte auflegen?«
Sie nahm die Box, die noch eingeschweißt war, und versuchte, die Folie abzumachen. Dies gelang ihr nicht. Sie nahm ein Stanleymesser und ging energisch zu Werke; das Plastik knisterte und reflektierte das Sonnenlicht so, daß ich kurz geblendet wurde. Sie zog die Kunststoffolie ab, griff in die Schachtel und ging mit einer CD zu ihrer Stereoanlage.
Welch ein Klang in diesem hellen Raum mit Blick auf friedlich grasende Schafe in wildbewegten Weiden.
»Schubert, Streichquartett in d-Moll«, murmelte ich und versöhnte mich mehr oder weniger mit dem Umstand, daß ich nackt herumstand, weil ich mich von Molly dazu hatte überreden lassen, Modell zu stehen. Sie stellte einen Becher Tee vor mich hin, nahm dann an einem schräg in die Höhe ragenden Zeichentisch Platz und sah mich an, als sei ich ein Baumstumpf.
»Könntest du mir, bevor ich anfange, kurz deinen Lebenslauf diktieren? Der soll unter das Porträt.«
»Geboren im Hungerwinter 1944. Ausbildung: Kinderverwahranstalt, Grundschule, Lyzeum, Studium der Biologie. Nach dem Wehrdienst jahrelang Mitglied des Führungsstabs der Abteilung für Evolutionäre und Ökologische Wissenschaften. In den einstweiligen Ruhestand versetzt, als die Abteilung wegrationalisiert wurde. Familienstand: verheiratet, aber die Ehefrau ist mit meinem besten Freund abgehauen.«
»Kinder?«
»Keine Kinder.«
Sie notierte alles und fing dann an, Skizzen zu machen. Mitten im zweiten Satz, dort wo Schubert demütig mit Triolen aufwartet, richtete sie sich auf und sagte: »Was kommt denn da angelaufen?«
Ich drehte mich zum Fenster um. Die langen Schöße eines braunschwarzen Ledermantels flatterten über den Kiesweg.
»Sieht aus wie ein Umhang«, sagte ich. »Woher kommt der denn geflogen?«
»Wenn du mich fragst, dann steckt darin niemand.«
»Bestimmt nicht, es ist ein leerer Mantel, schau nur, die Schöße bewegen sich wie Flügel.«
»Aber ein so schwerer Mantel kann doch nicht so lange durch die Luft fliegen.«
»Auch nicht, wenn es so stürmt?«
»Aus dem zweiten Stock kann man nicht viel erkennen, aber wenn du mich fragst …«
»Ich geh kurz runter.«
Ihre Füße klapperten auf der hölzernen Wendeltreppe. Eine Tür schlug zu, dann hörte ich Frauenstimmen. Erneut Schritte auf der Holztreppe. Nicht einen Moment lang kam mir in den Sinn, Molly könnte ihre Begleiterin mit ins Atelier bringen, und darum blieb ich ganz ruhig stehen. Aber die Ateliertür schwang dennoch auf, Molly trat ein, und hinter ihr erschien, mit einem langen blau-violetten Schal abgebiest, der braunschwarze Mantel.
»Erschrick nicht«, sagte Molly nach hinten über die Schulter, »ich war gerade bei der Arbeit, das ist mein Modell.«
»Für dein Projekt?«
»Genau. Leg doch den Mantel ab. Möchtest du Tee?«
»Gerne.«
Das Mädchen, das sich seines Mantels entledigte wie eine sich häutende Schlange, sah zu mir herüber, als sei nichts Besonderes dabei, daß ich nackt am Fenster stand. Sie sagte zu Molly: »Ich wollte kurz wegen deines Projekts mit dir reden, weil ich nicht möchte, daß du denkst, ich würde in deinem Revier wildern.«
»Was hast du vor?«
»Ich habe in unserem Dorf zweihundert Menschen mit besonders markanten Gesichtern fotografiert und daraus ein Buch gemacht, das sich sehr gut verkauft hat. Alle wollten es haben. Die Leute haben es sogar Verwandten in Übersee geschickt. So ein Buch befriedigt ein Bedürfnis. Jetzt hat man mich gefragt, ob ich ein solches Buch nicht auch mit den zweihundert herausragendsten Menschen in diesem wunderschönen Dorf machen will. Aber du arbeitest bereits …«
»Ich mache keine Fotos. Ich zeichne. Ich denke nicht … aber nimm doch Platz.«
»Ich sehe hier nirgendwo einen Stuhl.«
»Ach, stimmt ja. Eine häufiger geäußerte Beschwerde. Wir können uns auf die Fensterbank setzen. Schieb die Hose einfach zur Seite. Aber vielleicht kann das Modell sich ja kurz anziehen.«
So schnell wie möglich sprang ich in meine Kleider. Schon war mir etwas leichter zumute! Nun konnte ich das Mädchen, das, bekleidet mit einem zitronengelben Pullover und einer gleichfarbigen Hose, wie ein Kanarienvogel aus dem braunschwarzen Mantel zum Vorschein gekommen war, genauer betrachten. Der Schöpfer hatte sich für seine Verhältnisse ordentlich ins Zeug gelegt. Sie war unglaublich schlank. Üppiges, jettschwarzes Haar, das in einem langen Zopf unaufhaltsam zur Poritze herabfiel. Mindestens fünfzig Prozent der Gene stammten aus dem Smaragdgürtel. Sie sah aus wie ein Mädchen von kaum tausend Wochen, doch bei diesen erschreckend graziösen balinesischen oder sulawesischen Frauen kann man sich fürchterlich vertun. Sie rührte bedächtig in ihrem gezuckerten Tee und sagte: »Ich will auf jeden Fall vermeiden, daß du meinst, ich wollte dir die Show …«
»Mach dir keine Sorgen, knips, wen du knipsen willst, du kommst meinem Projekt überhaupt nicht in die Quere. Ich habe jetzt etwa zwölf Männer auf der Leinwand. Insgesamt sollen es zwanzig werden. Das Ganze ist ein uralter Plan. An der Akademie mußten wir ständig aktzeichnen, und immer handelte es sich um junge, schlanke Mädchen. Nie war ein alter Kerl mit Bierbauch dabei. Also faßte ich damals den Entschluß … demnächst hängen sie alle in der Galerie Rozenhoed.«
»Diese zwanzig werde ich dann jedenfalls nicht fotografieren.«
»Warum nicht?«
»Damit es keine Überschneidungen gibt.«
»Ach was, du machst ein Foto, ich einen Akt, das ist etwas völlig anderes. Fotografier sie ruhig, es sind lauter charakteristische Köpfe, du würdest dir selbst schaden, wenn du dir diese Witzbolde durch die Lappen gehen ließest. Hier, mein Modell, den mußt du auf jeden Fall nehmen. Mit seinem Buch über Sex ist er weltberühmt geworden.«
»Ist er …?«
»Ja, er ist der Autor von Der kühne Überschlag.«
»Ich hab davon gehört.«
»Wer hat das nicht, aber hast du es auch gelesen?«
»Ich bin keine besonders eifrige Leserin.«
»Ich habe es auch nicht gelesen. Los, Freundchen, erzähl uns einmal mit eigenen Worten, was drin steht.«
»Klonen ist die einfachste und bequemste Art, sich fortzupflanzen. Sexuelle Reproduktion verbraucht Energie und ist sehr kompliziert. Wozu also Sex? Sex ist ein kühner Überschlag, ein verzweifelter Rettungssprung der Natur, um mit Hilfe eines Systems zum Austausch von Genen den Raubtieren, Parasiten und Prionen die Stirn zu bieten.«
Zwei Augenpaare starrten mich an, als spräche ich russisch.
»Alle Organismen«, erklärte ich, »werden von Parasiten, Bazillen, Viren und Prionen geplagt. Seht ihr die Schafe, die dort drüben so friedlich im Frühlingswind grasen?«
Beide Damen schauten aus dem Atelierfenster und warfen einen erschreckten Blick auf Bauer Heemskerks Merinos.
»Wie ihr seht, reitet auf fast jedem Schafrücken eine Elster«, sagte ich. »Wißt ihr, warum? In allen Schaffellen wimmelt es von Würmern. Die Elstern picken die Parasiten heraus. Der Parasitismus hat mit Hilfe der sexuellen Reproduktion die Evolution beschleunigt.«
»Ich versteh nicht die Bohne«, sagte Molly, »aber auch wenn Sex nur eine Verzweiflungstat der Natur ist, so würde ich doch nicht gern darauf verzichten wollen.«
»Ein langer Hindernisweg mit lauter Fallgruben«, sagte ich. »Vor allem, wenn du mehr in den anderen verliebt bist als er in dich. Der kann dann bestimmen. Wer am meisten liebt, hat die geringste Macht.«
Mit beiden Händen umklammerte die Ostinderin ihren Teebecher; sie starrte auf die Schafe. Molly fragte sie: »Und? Könntest du ohne Sex leben?«
»Ach«, erwiderte sie, »was so leicht zu haben ist, darauf kann man auch leicht verzichten.«
Ungestüm schüttelte der Frühjahrswind die jungen Blätter. Die Osterglocken und das Judassilberblatt krümmten ihre grünen Stengel in der steifen Brise.
Molly fragte: »Hast du vielleicht ein Exemplar des ersten Fotobuchs dabei?«
»Ja.«
»Darf ich es mir einmal ansehen?«
Die Dunkelhaarige öffnete ihre schwarze Tasche und nahm ein recht dünnes, aber großformatiges Buch heraus. Molly riß es ihr aus der Hand, blätterte es rasend schnell durch und sagte dann achtlos: »Willst du es dir auch anschauen?« Noch ehe ich antworten konnte, drückte sie es mir in die Hand. Auch ich wollte es nur rasch durchblättern, doch sehr bald schlug ich die Seiten immer langsamer um. Diese Ostinderin – Lotte Weeda, wie unter dem Titel Belichtungseifer auf dem Umschlag zu lesen stand – war ein Phänomen. Sie hatte die Dorfbewohner regelrecht »erwischt«. Die meisten in ihrer ganzen Selbstgefälligkeit, manche auch in ihrer Verlegenheit. Es schien, als habe sie versucht, den wahren Charakter eines jeden Porträtierten zu fassen zu bekommen. Am meisten beeindruckte mich das Foto einer Frau in mittleren Jahren. In der Nähe einer Straßenecke stand sie zögerlich unter einer brennenden Straßenlaterne. Sie war schräg von der Seite aufgenommen. Sie trug eine wenig vorteilhafte Brille, einen ebenso verknitterten Regenmantel wie Humphrey Bogart in Casablanca und so ein Regentuch aus Plastik, in dem immer noch die messerscharfen Falten zu sehen waren und das sogar Cathérine Deneuve allen Sexappeal geraubt hätte. Und dennoch stand die Frau dort, als summte sie die Kantate Nr. 84 von Bach: »Ich bin vergnügt mit meinem Glücke«. Ungeachtet der Tatsache, daß ihr ganz offensichtlich kalt war und sie sich jeden Moment in dem trüben Novemberregen auflösen konnte, schien sie vollkommen glücklich zu sein.
»Warum haben Sie die Frau an einer Straßenecke fotografiert?« fragte ich.
»Sag ruhig du«, sagte Lotte.
»Wenn du mich auch duzt.«
»In Ordnung. Die Frau selbst wollte an dieser Ecke stehen; sie hatte dort als Kind mit ihrem Kreisel und ihren Murmeln gespielt.«
»Aber sie sieht so aus, als könne sie jeden Moment um die Ecke gehen und als habe sie das auch akzeptiert.«
»Drei Tage nachdem das Foto gemacht wurde, ist sie tatsächlich um die Ecke gegangen.«
»War sie krank?«
»Nein, als ich sie fotografiert habe, war alles in Ordnung. Sie ist einfach so gestorben. Sie fühlte sich nicht wohl und hat sich auf die Couch gelegt. Eine halbe Stunde später ist sie endgültig von uns gegangen.«
»Man hat fast den Eindruck, als sehe man das auf deinem Foto kommen. Es ist wie ein Bild aus einem Film. Die Frau zögert kurz an der Straßenecke. Wenn der Film weiterläuft, biegt sie um die Ecke.«
Ich gab ihr das Buch zurück.
»Du machst wunderbare Fotos.«
»Du kannst das Buch behalten«, sagte sie.
»Vielleicht können wir tauschen. Ich habe meinen Überschlag nicht dabei, aber du kannst ja kurz mal vorbeikommen, wenn du wieder in der Gegend bist.«
»Gerne. Ich geh dann mal wieder.«
»Sollen wir dir eine Liste der Leute mit den markantesten Gesichtern machen?« fragte Molly.
»Nein, das muß nicht sein. Ich spaziere einfach ein wenig im Dorf herum, und dann sehe ich selbst, wer in Frage kommt.«
Mit Hilfe ihres Mantels verwandelte sie sich wieder in eine riesige Saatkrähe. Sie sagte: »Ich finde schon raus« und betrat den Treppenabsatz. Nachdem sie die Tür hinter sich geschlossen hatte, sagte Molly: »Was für eine dumme Gans. Als ob es mich stören würde, wenn sie Fotos macht.«
»Aber es ist doch sehr nett, daß sie dich darüber informiert.«
»Ach«, sagte Molly mürrisch, »was bildet diese Gans sich ein! Daß es mich stört, wenn sie so ein dummes Buch macht? Mein Projekt ist vollkommen anders geartet.«
»Sie macht phantastische Fotos.«
»Ach, komm! Du fandest diese Gans schön, aber darum sind die Aufnahmen noch lange nicht schön. Blöde Schnappschüsse! Zieh dich aus, los!«
STIJN
Eine Woche später traf ich Lotte in der Papst-Leo-XIII.-Gasse. Sie schleppte einen schweren Rucksack, aus dem die Beine eines Stativs ragten.
»Schon angefangen?« fragte ich.
»Ich spaziere einfach ein bißchen durchs Dorf«, sagte sie.
»Um diese Zeit wirst du nicht viel Erfolg haben; tagsüber ist das Dorf wie ausgestorben.«
»Das habe ich schon bemerkt.«
»Wenn du jemandem begegnest, dann einem Frühpensionär oder einem Rentner, der seinen Hund Gassi führt.«
»So wie du.«
»Genau. Dieses Dorf siecht langsam dahin«, stellte ich fest.
»Genau wie der Papst«, sagte sie.
»Hast du dich hier im Dorf schon überall umgesehen? Bist du schon durch das Mördergäßchen flaniert?«
»Nicht daß ich wüßte. Willst du gerade dorthin? Darf ich dich begleiten?«
»Wir fragen den Hund. Darf sie mitkommen?«
Mein Hündchen wedelte äußerst überzeugend mit dem Schwanz.
»Also ja«, sagte ich, und wir gingen eine ganze Weile schweigend unter den zarten rosafarbenen Blüten der Japanischen Kirschen nebeneinander her. In den Vorgärten leuchtete das umflorte Weiß von blühenden Magnolien.
»Wie heißt dein Hund?« fragte sie.
»Anders«, sagte ich.
»Anders? Wie anders?« wollte sie wissen.
»Sie heißt Anders.«
»Ja, das sagtest du bereits«, rief Lotte gereizt, »aber wie anders? Nicht Bello oder Waldi oder Pluto, das ist mir klar, aber wie heißt er dann?«
»Sie ist eine Hündin; also nicht er, sondern sie, und sie heißt Anders. Das ist ihr Name: Anders.«
Sie schüttelte wild ihren schönen Kopf, so daß ihr langer Zopf in ein senkrechtes Zittern geriet.
»Wer hat dich gebeten, hier bei uns ein ebensolches Fotobuch zu machen wie bei euch?« fragte ich, um sie abzulenken.
»Ein reicher Mann hier aus dem Dorf, der mich sponsert.«
»Wer denn?«
»Er möchte nicht, daß sein Name bekannt wird.«
»Soso, hast du was mit ihm?«
»Nein«, sagte sie spitz.
Sie schwieg einen Moment und sah mich mit ihren dunkelbraunen Augen an.
»Meine Freiheit ist in keiner Weise eingeschränkt. Ich darf selbst entscheiden, wen ich in mein Buch aufnehme. Ich brauche niemanden aufzunehmen, der mir nicht paßt.«
»Auch den Sponsor nicht?«
»Im Prinzip nicht, aber ach … he, verdammt, darüber will ich nicht reden. Bei dem anderen Buch habe ich alle möglichen Zugeständnisse machen müssen. Der Bürgermeister mußte rein und noch so ein paar von den hohen Tieren. Aber jetzt werde ich mir nicht mehr reinreden lassen. Okay, der Sponsor, um den komme ich nicht herum, aber da finde ich schon eine Lösung.«
Wieder gingen wir eine Weile schweigend nebeneinander her. Mit manchen Menschen fällt das Schweigen leichter als das Reden. Auf dem Kerzenzieherdamm fragte sie: »Überall hängen Plakate: ›Selbständigkeit für Monward‹. Ist diese Selbständigkeit bedroht?«
»Die Gemeinde soll aufgelöst und mit ein paar Nachbardörfern zusammengelegt werden. Früher einmal hatte unser Dorf sogar einen eigenen Bahnhof, wo im Sommer der Zug hielt. Und es gab einen Fährdienst über die Seen. Die Bahnhofskneipe und das Fährhaus stehen noch. Im Sommer ist die Fähre ein paar Wochen lang in Betrieb, um Radwanderer überzusetzen. Im Bahnhofscafé soll ein Restaurant eröffnet werden. Früher gab es eine richtige Postfiliale. Jetzt haben wir nur noch einen kleinen Schalter in einem Laden. Früher gab es acht Lebensmittelhändler, sechs Bäcker, vier Metzger, drei Milchmänner, sechs Gemüseläden, drei Schuster, fünf Zigarrengeschäfte. Obwohl immer noch ungefähr fünftausend Menschen hier wohnen, sind nur drei winzige Supermärkte übriggeblieben, außerdem ein Bäcker, ein Schuster, ein Metzger. Alle anderen sind verschwunden, eingegangen, haben Pleite gemacht. Man kann nirgendwo im Dorf mehr Gemüse kaufen.«
»Aber doch in den Supermärkten?«
»Dort bekommt man eingeschweißten Müll. Aber loses frisches Gemüse aus einem Fachgeschäft – vergiß es.«
In spitzem Winkel überquerten wir die Hauptstraße des Dorfes.
»Schräg über die Straße gehen: der kürzeste Weg ins Krankenhaus«, sagte ich munter.
»Hier nicht«, erwiderte sie. »Es ist kein Mensch unterwegs.«
»Morgens und am späten Nachmittag ist das hier auf der Kreuzherrenstraße aber ganz anders«, sagte ich, »dann ist hier der Teufel los, ein mörderischer Schleichverkehr. Lauter Leute, die versuchen, den Stau auf der A 44 zu umfahren.«
»Hat es dabei schon mal einen Unfall mit To… der Mann hinter uns, wer ist das?«
»Das ist Stijn, der will immer ein Schwätzchen mit mir halten. Jetzt bestimmt auch. Komm, laß uns schneller laufen.«
»Ach, warum? Unterhalt dich doch kurz mit ihm. Dann kann ich ihn in der Zwischenzeit vielleicht fotografieren.«
»Du willst Stijn in dein Buch aufnehmen?«
»Möglicherweise.«
Sie blieb am Bordstein stehen und wartete. Stijn holte uns ein und sagte zu mir: »Vorige Woche war es wieder soweit, da hat sie einfach Geld vom Girokonto geklaut und hat es zum Herrn Pastor getragen. Was soll ich tun, um dem ein Ende zu bereiten?«
»Stijns Frau«, sagte ich zu Lotte, »bringt alles Geld, das ihr in die Hände gerät, umgehend zum Pastor.«
»Seit Jahren jetzt schon«, sagte Stijn.
»Es ist ein Wunder, daß Stijn überhaupt noch Geld hat.«
»Zum Glück kommt hier und da immer wieder mal etwas Kleingeld rein«, sagte Stijn. »Meine Pension und die Betriebsrente, aber wenn ich sie lasse, schleppt sie seelenruhig alles weg. Schon ein paarmal bin ich stinksauer zum Herrn Pastor gestiefelt. Ich hab ihm gesagt, daß er mir und ihr sehr schadet, wenn er das Geld immer freudig annimmt. Da sagt dieser Schnösel, daß es nicht seine Aufgabe ist, Spenden abzulehnen, und er fängt an, sich herauszureden, von wegen Groschen der Witwen und so. Als ob meine Frau schon Witwe wäre … ach, ich hatte so eine wunderbare Frau; sie machte die Wäsche, sie putzte so eifrig die Fenster; und dann stirbt sie wahrhaftig weg, und ich sitze jahrelang allein hinter schmutzigen Fenstern und blase Trübsal. Und deswegen war ich so blöd, mit diesem schwachsinnigen Monster zum Standesamt zu gehen. Was sie im Laufe der Jahre nicht schon alles fortgeschafft hat. Es ist unglaublich, sie verschleudert meine ganzen Ersparnisse. He, gute Frau, was machen Sie da?«
»Ich mache ein Foto.«
»Davon bin ich nicht gerade begeistert. Was soll denn das werden?«
»Ich stelle ein Buch mit Porträts von Leuten aus diesem Dorf zusammen.«
»Da gibt’s doch genug andere, muß ich da unbedingt dabei sein? Ja, Herr im Himmel, da fängt die doch tatsächlich schon wieder an. Nun tu doch was dagegen.«
Auf dem römisch-katholischen Kiesweg wackelte die Liliputanerin, die Stijn seinerzeit zum Standesamt geführt hatte, Richtung Kirche. Ob sie damals auch schon so ein schmuddeliges, durchsichtiges grünes Kopftuch getragen hat, wußte ich nicht, und ich wußte auch nicht, ob sie damals schon so komisch wackelte. So wie sie dort auf dem leise knirschenden Kies angeschlurft kam, hätte man meinen können, sie stamme aus dem Zauberkabinett von Professor Spalanzani. Nicht mehr lange, dann würde der Federantrieb abgelaufen sein und sie mitten auf dem Kies erstarren.
»Oh, sieh, die Frau dort …«, sagte Lotte, und sie lief mit der Kamera den Kiesweg entlang. Vor Stijns Ehefrau ging sie in Position. Diese erstarrte tatsächlich, sie führte nur noch ihre Hand an die Stirn, als wollte sie salutieren, und stand dann stocksteif da. Charmant grinsend ließ sie sich in der hellen Frühlingssonne bereitwillig von allen Seiten fotografieren.
Als Lotte ihre Kamera sinken ließ, sagte Stijn barsch: »Komm mit.«
Er drehte seine Frau um einhundertachtzig Grad herum, schob sie über den Kiesweg zur Straße und ging dann auf dem Bürgersteig neben ihr her. Weil er normal ging und sie wackelte, hatte er sie schon bald einige Meter hinter sich gelassen. Folgsam schlurfte sie jedoch in einem Abstand von zwei Metern hinter ihm her. Er überquerte die Straße. Ohne nach links und rechts zu schauen, ging in seinem Kielsog auch seine Frau über die Fahrbahn. Ein Radfahrer konnte ihr, heftige Schlingerbewegungen vollführend, gerade noch ausweichen.
»Das also ist die katholische Kirche«, sagte Lotte und zeigte auf die wunderschön zwischen hohen Bäumen gelegene Kreuzbasilika.
»Dieses Dorf ist, wie du vielleicht schon an den Straßennamen gesehen hast, bis auf die Knochen katholisch«, sagte ich. »Die Leute hier wissen nicht einmal, daß es orthodoxe Kalvinisten und Reformierte gibt. Beide Gruppen werden hier immer noch hartnäckig Protestanten genannt. Sie reden auch immer von der protestantischen Kirche, wenn sie die orthodox-kalvinistische meinen.«
»Du bist also nicht katholisch?«
»O nein, Gott bewahre, auch wenn ich ehrlich zugeben muß, daß die Katholiken hier erstaunlich nett sind. Vermutlich hat es während der Reformation in diesem Dorf einen guten katholischen Priester gegeben, und darum sind alle katholisch geblieben.«
»Sind die Katholiken deiner Ansicht nach netter als die Protestanten?«
»Die einfachen Durchschnittskatholiken sind durch die Bank liebenswürdig, vor allem hier im Dorf, wo sie mit der Herstellung von Kerzen, Beichtstühlen und Meßgewändern immer ordentlich Geld verdient haben.«
»Von Haus aus bin ich auch katholisch«, sagte sie, »und du?«
»Ursprünglich bin ich synodal-reformiert. Für solche Gläubige gab es früher im Dorf keine Einrichtungen, aber heute könnte ich in die reformierte Kirche gehen, weil diese wahrhaftig zu einer Kirche für alle möglichen reformierten Gläubigen gemacht worden ist. Vorigen Sommer haben die Kirchenältesten mich gefragt, ob ich als Organist bei einem Gottesdienst einspringen könnte. Der eigentliche Organist war in Urlaub. Also betrat ich am Sonntag um zwanzig vor zehn die Kirche. Es war noch keiner da. Ich stieg auf die Orgelbühne, spielte aus Bachs Orgelbüchlein ›Alle Menschen müssen sterben‹ und schaute nach dem Schlußakkord ins Kirchenschiff. Immer noch keine Menschenseele. Dabei sollte der Gottesdienst doch um zehn Uhr anfangen. Ich spielte ›Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter‹, aber Er kam nicht, und die Kirchenbesucher kamen auch nicht. Um zehn war die Kirche immer noch leer. Ich ging hinunter. Im Konsistorialzimmer standen die Küsterin, die Kirchenältesten und die Pfarrerin und unterhielten sich angeregt.
›Es ist noch niemand da‹, sagte ich.
›Offensichtlich sind gerade alle im Urlaub‹, sagte die Küsterin.
›Dann findet der Gottesdienst also nicht statt?‹ fragte ich.
›Wir warten noch einen Moment‹, meinte die Pfarrerin. Ach, diese Pfarrerin. Weißt du übrigens, wie sie heißt? Du glaubst es nicht, aber sogar der Name der Pfarrerin ist hier dem Katholizismus angepaßt. Sie heißt Maria Rozenkrans. Das Kanzelfräulein mußt du unbedingt fotografieren, ein wunderbares Bild, sie sieht so herrlich aus in ihrem enzianblauen Talar. Fast alle ehrenvollen Ämter im Dorf, das des Bürgermeisters, des Hausarztes, des Pfarrers, liegen übrigens in den Händen des schwachen Geschlechts. Nun gut, um es kurz zu machen: Es tauchte tatsächlich niemand mehr auf. Zusammen mit der Pfarrerin, der Küsterin und den Kirchenältesten bin ich dann zum Pastorat gegangen, wo wir Mah-Jong gespielt haben. Oh, diese Kanzelprinzessin … tja, mit den Pfarrerinnen ist es sicher bald aus und vorbei, denn in Kürze wird auch das Christentum untergegangen sein.«
»Bedauerlich?«
»Nein, das nicht, aber vor einer so liebreizenden Pfarrerin in einem enzianblauen Talar, vor der könnte man doch mit gefalteten Händen auf die Knie fallen … ach ja, halt du mir beide Hände, hilf mir mit deinem Rat, deinen Schutz mir spende, auf dem schmalen Pfad. So eine Pfarrerin ist mir durchaus ein Stoßgebet wert. Verflixt, wenn man vom Teufel spricht, dann kommt er auch schon. Dort geht sie.«
»O nein, die will ich nicht in meinem Buch haben.«
»Das ist nicht dein Ernst. Gut, sie trägt jetzt eine Jeans und ein rosa T-Shirt, aber ich versichere dir, in ihrem enzianblauen Talar …«
»Hör auf zu quengeln, ich will sie nicht drin haben.«
»Aber schau doch, wie graziös sie geht … ach, was für ein Bild …«
»Eben darum. Die kann mit ihrem Talar und dem ganzen Gedöns in die Vogue. Ich hab schon einen Pfarrer in meinem anderen Buch, der mir ebenfalls aufgedrängt wurde.«
»Auch so ein bildhübsches Wesen?«
»Du hast das Buch doch. Schau also nach. Ein Kerl mit einem hinterhältigen Reptiliengesicht und einem schleimigen Grinsen.«
»Das kann man von unserer Pfarrerin wirklich nicht behaupten: Sie ist ein Schatz! Ich glaube, sie geht in den Ehrwürdiger-Vater-Weg. Dort wohnt ein schiefgewachsener Gnom, die alte Miep Heemskerk. Wenn das Wetter auch nur ein bißchen mitspielt, schiebt die Pfarrerin sie im Rollstuhl eine Stunde in der Akolythenstraße, der Kaplanstraße, der Ministrantenstraße und dem Unbefleckte-Empfängnis-Trift umher. Vielleicht solltest du ja die Frau im Rollstuhl fotografieren. Die wirst du in der Vogue bestimmt nicht finden.«
»Hört sich gut an. Sollen wir auf die beiden warten?«
»Mir recht, dann sehen wir auch die bezaubernde Pfarrerin noch einmal.«
Schon nach wenigen Minuten bog der Rollstuhl um die Ecke des Ehrwürdiger-Vater-Wegs. Weil die Sonne mir in die Augen schien, sah ich nicht viel mehr als das wilde Aufblitzen von Brillengläsern, doch Lotte meinte sogleich: »Ja, die will ich haben.«
Erneut überquerte sie die Straße und fragte geradeheraus: »Darf ich Sie für mein Buch fotografieren?«
»Womit habe ich das verdient?«
»Sie sehen phantastisch aus.«
»Ich? Wie meinen Sie das? Meine Arme sehen aus wie dünne Zweige, meine Beine sind faltig. Seit Jahren schon wächst mein Rücken krumm und krummer. Wenn ich aus meinem Stuhl aufstehe, dann bin ich stärker gekrümmt als ein Schürhaken. Wenn ich sterbe, muß man mir das Rückgrat brechen, damit ich in den Sarg passe. Ich bin schlicht und einfach ein Wrack. Und Sie wollen mich wirklich fotografieren?«
»Sehr gern.«
»Ich verstehe zwar nicht, wieso, aber meinetwegen.«
»Ich mache die Aufnahmen gleich hier; das Licht ist ein wenig grell, aber …«
»Was mich angeht, so muß das Ganze nicht Hals über Kopf geschehen. Nächste Woche ist mir auch recht, oder nächsten Monat. Vorausgesetzt, ich lebe dann noch. Die Ärzte haben mich bereits vor fünf Jahren aufgegeben. Wenn es nach ihnen ginge, wäre ich schon längst mausetot. Sie ärgern sich jedesmal schwarz, wenn ich komme, weil ich einfach immer weiteratme. Deshalb rechne ich die Zeit, die mir noch bleibt, in Stunden, damit es nach mehr aussieht, bis ich schließlich doch in die Herrlichkeit eingehe.«
Ich wartete auf der anderen Straßenseite, bis das Foto gemacht war. Als Lotte sich wieder zu uns gesellte, sagte ich: »Ich könnte wetten, die Pfarrerin ist mit auf dem Foto. Die ganze Zeit über stand sie genau hinter der Frau.«
»Die retuschiere ich weg. Oder ich schneide sie ab. Aber vielleicht ist das ja auch gar nicht nötig, denn ich habe die Frau so close fotografiert, daß der Hintergrund ganz verschwommen ist.«
»Welch eine Verschwendung.«
»Ich bin müde. Dieses Mördergäßchen, ist das noch weit?«
»Weit ist es nicht, das Dorf ist nicht groß, aber vielleicht können wir ja zu mir nach Hause gehen und dort eine Tasse Tee trinken. Ich wohne gleich um die Ecke. Dann kann ich dir als Dank für deinen schönen Fotoband ein Exemplar meines Überschlags geben. Das Mördergäßchen kann warten, das läuft nicht weg.«
Auf dem Weg zu meinem Haus fragte ich sie: »Fotografieren, ist das dein Beruf?«
»Inzwischen schon, ich bekomme zum Glück immer mehr Aufträge. Früher habe ich jahrelang als Krankenschwester gearbeitet, aber die Arbeit fiel mir immer schwerer. Ständig diese geilen Kerle! Egal wie krank sie sind, wenn du als Nachtschwester ins Zimmer kommst, versuchen sie immer wieder, dich in ihr Bett zu zerren. Aber wo ist denn nun dein Haus?«
»Noch einmal um die Ecke, dann siehst du es. Dank der Bäume kann man es vom Weg aus nicht sehen. Die Deutschen wollten seinerzeit alle Bäume fällen. Trotzdem haben wir den ganzen Krieg über Leute bei uns versteckt. Eines der Verstecke gibt es übrigens immer noch. Sollten also irgendwann einmal geile stalker hinter dir her sein, dann weißt du, wo du hin kannst.«
»Um dann vom Regen in die Traufe zu kommen.«
MÖRDERGÄSSCHEN
Meine Hündin geht am liebsten in der Akolythenstraße spazieren. Dort erschnüffelt sie an den Lindenwurzeln die herrlichsten Gerüche. Weil ich aber lieber ordentlich marschiere, habe ich mit ihr eine Vereinbarung getroffen: Wenn sie an einer Lindenwurzel geschnüffelt hat, dann lassen wir den nächsten Baum links liegen. Aber auch so kommen wir nicht so richtig vorwärts. Deshalb näherten wir uns eines wunderbaren Morgens nur langsam einer kleinen Menschenansammlung. Das leise Rauschen des jungen Lindenlaubs wurde vom schwermütigen Signalhorn eines Krankenwagens übertönt. Langsam verebbte das Geräusch im Frühlingswind. Einen Moment lang meinte ich, wo die Akolythenstraße endet und die Kaplanstraße beginnt, sei ein Unfall passiert, doch als ich näher kam, sah ich zwischen dem Hellgrün von Christusdorn und Pfaffenkäppchen eine Frau auf einer Trittleiter balancieren. Sie ragte hoch über eine kräftige Frau hinaus, die auf einem Schemel saß. Weil ich beide Frauen nur von hinten sah und Leiter und Schemel eine Verzerrung der Perspektive bewirkten, erkannte ich zunächst nicht, daß es sich bei den beiden Frauen um Maxischwester und Minischwester handelte. Die zwei Nonnen waren unzertrennlich. Eine Riesin und ein Zwerg hatten sich im Kloster gefunden. Was für eine Idee, die beiden – gleichsam als Umwertung aller Werte – auf einer Leiter und einem Hocker zu postieren!
»Weshalb sitzen Sie hier?« fragte ich Maxischwester.
»Wir werden gleich fotografiert«, erwiderte sie stolz. »Die junge Dame ist nur eben zu ihrem Wagen zurückgegangen, weil sie den Belichtungsmesser vergessen hat.«
»Wir kommen in ein Buch«, lispelte die Zwergnonne.
»Stütz dich doch auf meiner Schulter ab«, sagte Maxischwester, »sonst fällst du noch herunter.«
»Welch eine verrückte Idee, Sie beide …«, hob ich an.
»Auf allen Bildern«, fiel Maxischwester mir ins Wort, »bin ich groß, und Benedictina ist klein. Jetzt wird es endlich einmal andersherum sein.«
Mit ihrem braunschwarzen Mantel bekleidet, kam Lotte angelaufen. Wieder diese hochwirbelnden Mantelschöße!
»Guten Tag«, sagte sie, »schönes, klares Frühlingslicht. Als ich heute morgen aufstand, dachte ich: Heute muß ich auf jeden Fall in Monward ein paar Fotos machen.«
»Wieviel hast du denn schon?«
»Zwanzig oder so. Wenn ich die Nonnen fotografiert habe, möchte ich weiter herumspazieren. Wer weiß, wem ich noch begegne. Hast du Lust mitzugehen? Ich würde dich nämlich gern etwas fragen.«
»Anders und ich sind zum Mördergäßchen unterwegs.«
»Wie üblich. Wohl ein ruhiges Fleckchen. Ist man dort als Frau in Begleitung eines Mannes überhaupt sicher? Denn in so einer unheimlichen Allee ist doch garantiert keine Menschenseele unterwegs. Ein Motiv für mein Buch werde ich dort wohl nicht finden, aber warte, zuerst will ich die Nonnen fotografieren. Das wird eine Weile dauern. Hast du so viel Zeit?«
»Wir drehen inzwischen eine Runde durch die Akolythenstraße, die Kaplanstraße und die Ministrantenstraße.«
»Wenn ich eher fertig bin, warte ich auf euch.«
Als der Hund und ich wieder zu der Kreuzung kamen, erwartete sie uns bereits. Wir gingen durch das zarte Frühlingsgrün in Richtung des Gestrüpps, hinter dem sich das Mördergäßchen verbirgt.
»Neulich klopften Maxi- und Minischwester an meine Tür«, berichtete ich. »Die Maxischwester sagte:
›Wir haben gehört, daß Sie ein Sexbuch geschrieben haben, über das die ganze Welt spricht. Dieses Buch wollen wir ganz bestimmt nicht lesen, aber unser Gärtner hat gestern erzählt, Sie hätten auch noch ein anderes Buch verfaßt, ein Buch mit innigen Meditationen, Gebeten und frommen Erörterungen. In das Buch würden Benedictina und ich gerne einmal reinschauen. Können Sie uns vielleicht ein Exemplar verschaffen?‹
Maxischwester sah mich so treuherzig an, daß ich es nicht übers Herz brachte, ihr zu sagen: ›Schwester, heute haben wir den 1. April, Ihr Gärtner hat Sie hereingelegt.‹ Also habe ich ihr geantwortet, es müsse sich da wohl um ein Mißverständnis handeln. Ein solches Buch hätte ich leider nicht geschrieben.
Worauf Maxischwester meinte: ›Vielleicht können Sie das ja noch nachholen.‹
›Oh, wohl kaum …‹
›Ach, kommen Sie, die Menschheit sehnt sich danach.‹
›Ich werde darüber nachdenken‹, sagte ich, um die beiden wieder loszuwerden.
›Aber nicht vergessen‹, mahnte Maxischwester.
Und Minischwester stimmte ihr zu und fragte dann: ›Aber vielleicht haben Sie ja ein Andachtsbildchen für uns. Dann wären wir zumindest nicht umsonst hergekommen.‹
Ein Andachtsbildchen konnte ich ihnen natürlich genausowenig liefern wie innige Gebete und fromme Meditationen, und sie mußten also mit leeren Händen von dannen ziehen. Und fast jedesmal, wenn ich den beiden Schwestern begegne, fragen sie mich, ob das Buch mit den Gebeten und Meditationen bereits erschienen ist.«
»Ich habe aber nicht gehört, daß sie diesmal danach gefragt hätten«, sagte Lotte.
»Sie waren wohl zu aufgeregt wegen des Fotos.«
Noch ehe ich meinen Satz beendet hatte, rief sie: »Der Mann dort auf dem Platz, wer ist das?«
»Der Maulwurffänger des Dorfs.«
»Den will ich auf jeden Fall in meinem Buch haben«, sagte sie und lief mit flatternden Mantelschößen zu ihm.
»Jetzt sofort?« hörte ich ihn fragen.
»Nein, mit Ihren Fallen und mit Maulwürfen.«
»Die Maulwürfe muß ich aber erst noch fangen.«
»Oh, das macht nichts, ich habe Zeit.«
»Ende nächster Woche vielleicht, aber ich kann für nichts garantieren …«
»Ich komme bei Ihnen vorbei. Wo wohnen Sie?«
»Das ist ziemlich schwer zu finden. Wie soll ich Ihnen das erklären? Moment, der Bücherschreiber weiß, wo ich wohne, vielleicht kann er Ihnen ja den Weg zeigen.«
»Ich werde ihn fragen. Nächste Woche Freitag? Zehn Uhr?«
»Abgemacht.«
Nachdem ich ihr versprochen hatte, sie zum Haus des Maulwurffängers zu bringen, setzten wir unseren Spaziergang fort, und ich bemerkte: »So machst du das also. Du gehst einfach geradewegs auf deine Opfer zu …«
»Ist dagegen etwas einzuwenden?«
»Mir scheint, man sollte weniger stürmisch an sie herantreten. Erst einmal einen Brief schicken. Oder anrufen.«
»Bloß nicht. Auf einen Brief antworten die Leute nicht. Wenn du anrufst, lassen sie dich abblitzen. Sprichst du sie aber an, dann sagen sie auf der Stelle ja.«
»Aber auch nur, weil du ein so überaus hübsches Mädchen bist.«
»Wie alt schätzt du mich?«
»Ich denke: vierundzwanzig.«
»Nicht schlecht. Die Zahlen stimmen, nicht aber ihre Reihenfolge.«
»Du bist schon zweiundvierzig? Nein, nein …«
»Vergiß also das hübsche Mädchen. Aber was ich dich fragen wollte: Hättest du Lust, das Vorwort zu meinem neuen Buch zu schreiben?«
»Ich? Das Vorwort? Wie kommst du darauf?«
»Ich habe angefangen, dein Buch zu lesen. Ich verstehe kein Wort, aber du kannst gut schreiben. Vor allem über diese Tierchen mit fünf Geschlechtern.«
»Tierchen? Einzeller! Pilze!«
»Keine Ahnung, aber sag: Würdest du das tun? Schreibst du das Vorwort?«
»Bekomme ich dann ein Mitspracherecht? Darf ich dann eine Liste mit den Monwardern einreichen, die ich gern im Buch hätte?«
»Das darfst du, aber ich behalte mir das Recht vor, die Leute abzulehnen.«
»Ich weiß nicht, was daran so problematisch ist. Die Pfarrerin …«
»… in ihrem algenblauen Talar. Jetzt geht das schon wieder los.«
»Gut, lassen wir das, aber die Gräfin …«
»Wer?«
»Die Gräfin, die an der Goldküste wohnt. Warte, wenn wir hier abbiegen und dahinten noch einmal, dann kommen wir an ihrem Haus vorbei. Sie arbeitet oft in ihrem Vorgarten, oder aber man kann durch eine Lücke in der Ligusterhecke sehen, wie sie in der Küche herumfuhrwerkt.«
»Ist sie eine echte Gräfin?«
»Nein, aber weil ich nicht weiß, wie sie heißt, habe ich sie in Gedanken Almaviva genannt, nach der Gräfin in Mozarts Hochzeit des Figaro.«
»Zeig mir diese Alva.«
Wir bogen ab und gingen durch den Ehrwürdiger-Vater-Weg. Lotte betrachtete das Gedicht auf der fensterlosen Mauer des Restaurants Roma und fragte: »Hält man es hier auch für nötig, die Wände mit Gedichten zu verzieren?«
»Es ist das einzige Wandgedicht im ganzen Dorf«, sagte ich besänftigend, und ich konnte es mir nicht verkneifen, beim Weitergehen die Zeilen zu rezitieren:
Die gu-, guten Gedanken,
sie kommen in der Messe mir;
die gu-, guten Gedanken,
’s ist Jesus selbst, er schickt sie mir;
die gu-, guten Gedanken,
sind Honigsaft, sind Salbung mir,
die gu-, guten Gedanken!
»Du kannst es auswendig?« fragte Lotte erstaunt.
»Die letzten beiden Zeilen von Guido Gezelle sind leider nicht besonders gelungen«, sagte ich unerschütterlich. »Außerdem finde ich – und dafür ist auf der Mauer genug Platz –, daß die Schlußzeilen der ersten Antwort vom 30. Sonntag aus dem Heidelberger Katechismus dabei stehen müßten: ›Also ist die papistische Messe im Grunde nichts anderes als eine Verleugnung des einzigartigen Opfers und des Leidens von Jesus Christus und eine verfluchte Abgötterei.‹«
»Wenn du ein bißchen Mumm hättest, dann hättest du das schon längst nachts mit einem hübschen Pinsel daruntergeschrieben.«
Wir bogen nochmals ab und gingen kurz am Vorgarten der Gräfin vorbei. Mit dem Rücken zu uns saß sie auf den Knien und pflanzte blau-gelbe Violen auf einer ihrer Freitreppen.
Lotte warf einen Blick zu ihr hinüber und flüsterte: »Tut mir leid, die nicht.«
Ihr Mann kam aus der Villa und betrat die Freitreppe. Schwankend wie ein Rutengänger, ging er die Stufen hinab. Vorsichtig näherte er sich den Violen.
»Dieser Mann … ist das der Graf?«
»Wenn sie die Gräfin ist, muß das wohl der Graf sein.«
»Er sieht eher wie ein Marquis aus. Ein imponierender Mann! Ich wette zehn zu eins, daß er zu den Kerlen gehört, die nur zusammen mit ihrer Frau aufs Foto wollen. So what, zur Not schneide ich sie einfach ab.«
Wir gingen weiter.
»Wer steht sonst noch auf deiner Liste?« fragte sie.
»Die Chefin des Beauty-Salons.«
»Kommen wir da auf unserem Weg zum Mördergäßchen auch vorbei?«
»Wenn wir einen kleinen Umweg machen.«
»Einverstanden.«
Beim Beauty-Salon angekommen, spähte sie durch das große Schaufenster.
»Ich sehe nur eine muskulöse Farbige. Ist das die Frau, die du meinst?«
»Ja, sie kommt aus Somalia. Das heißt, ihre Eltern stammen daher. Soweit ich weiß, wurde sie selbst in den Niederlanden geboren.«
»Welch ein Koloß. Aus der kann man zwei Frauen meines Formats machen.«
»Nein, das stimmt nicht, das ist übertrieben.«
»Es tut mir leid für dich, aber ich glaube nicht, daß sie in mein Buch paßt.«
»Das ist Diskriminierung.«
»Damit hat es überhaupt nichts zu tun. Sie ist nicht echt. Bestimmt war sie ein Mann und hat sich zur Frau umoperieren lassen.«
»Wie kommst du darauf?«
»Weil sie alles, was als typisch weiblich gilt, womit aber keine Frau geboren wird, ganz besonders betont. Das ist typisch für Transvestiten und Transsexuelle. Monsterabsätze, Ohrringe wie Affenschaukeln, Regenbogenaugen, Silikonlippen, Raubtierkrallen. Und schau dir diese Tina-Turner-Frisur an. Wetten, daß das eine Perücke ist?«
»Sie ist im Dorf jedenfalls die auffälligste Erscheinung. Alle würden sich wundern, wenn sie in dem Buch fehlte.«
»Wenn ich dir damit eine Freude mache, kann ich sie gern fotografieren. Aber ob sie dann auch in mein Buch … Wenn nicht, dann bekommst du zum Dank für dein Vorwort ihr Foto. Das kannst du dir dann übers Bett hängen. So, und jetzt schnell in dein Mördergäßchen. Warum heißt es übrigens so?«
»Irgendwann hat ein Kanoniker hier einem Meßdiener mit einer Lunula den Schädel eingeschlagen und ihn dann mit einem Cingulum gewürgt, nachdem er sich an dem Schaf vergangen hatte.«
Als wir ungefähr zehn Minuten später, hinter dem Kinderbauernhof entlang, den schmalen, sich windenden Aschepfad erreichten, der zu einem breiten Sammelbecken führt, fragte sie mißtrauisch: »Ist dies nun das Mördergäßchen?«
»Ganz genau. Und hier ist auch die einzige Stelle im Dorf, wo man Gnadenkraut und Bachbunge findet. Siehst du die ganzen blauen Blüten dort am Ufer? Das ist Bachbunge. Es gibt, jedenfalls in den Niederlanden, kaum eine schönere Pflanze.«
»Leg dich hin.«
»Willst du mich fotografieren? Komme ich auch in dein Buch?«
»Ich glaube nicht. Höchstens ein winzigkleines Porträt beim Vorwort.«
»Das ist schon mehr, als ich zu hoffen wagte«, flachste ich und summte leise eine Melodie.
»Was summst du da?« fragte sie streng.
»›Eine liebliche Blume am Ufer ihm blüht‹ aus dem Lied Geheimnis von Hermann Goetz.«
»Sagt mir nichts«, erwiderte sie. »Wer war dieser Goetz?«
»Ein Komponist des neunzehnten Jahrhunderts. Ist jung gestorben. Spielst du zufällig Klavier?«
»Nein.«
»Schade. Ich suche schon seit Jahren einen Partner, mit dem ich dieses Juwel von einer Sonate vierhändig spielen kann.«
Auf dem Rückweg begegnete uns beim Kinderbauernhof der Gemeindepfarrer. Mit seinem Mondgesicht und seinem riesigen altmodischen, schwarzen Brillengestell sah er aus wie ein Weißnasenhusarenaffe.
»Wer ist das? Oh, den will ich für mein Buch haben«, sagte Lotte.
»Kann ich mir vorstellen«, sagte ich. »Das ist der Gemeindepfarrer, ein Stützpfeiler der Kirche, ein Stützpfeiler des Gemeinderats und ein Stützpfeiler von allem, was sonst in der Gemeinde noch stützbar ist.«
Breit grinsend posierte der Gemeindepfarrer kurze Zeit später am Eingang zum Kinderbauernhof.
SIRENA
Eine Woche später führte ich sie zum Wohnboot des Maulwurffängers. Unterwegs meinte sie ziemlich beleidigt: »Inzwischen weiß fast jeder im Dorf, daß ich dabei bin, einen Fotoband zu machen. Wenn ich aus dem Wagen steige, stürmen die Leute schon auf mich zu und fragen, wann sie an die Reihe kommen.«
»Oh, wie bequem für dich. Dann mußt du keinen mehr fragen.«
»Nein, ständig muß ich zusehen, daß ich die Leute wieder loswerde. Zweihundert Aufnahmen kann ich unterbringen, während hier im Dorf fünftausend Menschen wohnen.«
»Hast du heute noch eine andere Verabredung, außer mit dem Maulwurffänger?«
»Yes, mit dem Bestattungsunternehmer. Abends spielt er für seine Kutschpferde eine Serenade auf dem Akkordeon. Davon will ich unbedingt ein Foto haben.«
»Dann hast du zwischendurch Zeit für Sirena, die somalische Schönheit aus dem Beauty-Salon.«
»Jetzt fängst du schon wieder mit diesem Somalier an. Stehst du wirklich auf so was? Unglaublich! Geh zu dem Kerl hin und sag: Darf ich eine Nummer mit dir schieben? Eine direkte Frage funktioniert oft am besten.«
»Ach, Quatsch!«
»Bestimmt, so einer wie der …«
»Sie ist kein Mann.«
»Wetten?«
»Einverstanden, fünfzig Euro. Aber wie erfahren wir, daß du dich irrst?«
»Wir gehen rein und schauen ihn uns ganz genau an.«
»Traust du dich das?«
»Aber klar. Sollen wir gleich hingehen?«
»Nein, lieber erst zum Maulwurffänger.«
Auf dem Weg kamen wir am Apostelbrieffeld vorbei. Sie deutete auf eine Riesenkerze, die den Platz seit kurzem schmückte. »Ist das ein Denkmal?«
»Weil hier im Dorf seit Jahrhunderten Wachskerzen gegossen werden, hat man eine …«
»Eine Kerze? Soll das eine Tropfkerze sein?«
»Nein, eine Novenenkerze. Sie war kaum aufgestellt worden, da sprach alle Welt bereits vom ›Schwengel‹. Hätte die Gemeindeverwaltung mal bloß auf mich gehört.«
»Erzähl.«
»Man wollte hier auf der Wiese etwas hinstellen, ein Monument, ein Denkmal oder eine Skulptur. Anregungen waren ausdrücklich erwünscht. Mein Vorschlag war: Setzt Josyne van Beethoven ein Denkmal. Sie war eine Vorfahrin des Gewaltigen. 1595 hat man sie verbrannt. Sie war ebenso selbstbewußt und stolz wie Beethoven, aber die Papisten haben sie so lange gefoltert, bis sie zugab, eine Hexe zu sein. Am Abend vor ihrer Verbrennung hat sie einen Selbstmordversuch unternommen und Glasscherben verschluckt. Aber es hat nicht funktioniert. Bei lebendigem Leib haben die Papisten sie verbrannt. Die Katholiken sind immer entschieden gegen die Einäscherung gewesen, aber Ketzer und Hexen haben sie jahrhundertelang verbrannt, obwohl man doch eigentlich denken sollte, es ist schlimmer, einen lebenden Menschen ins Feuer zu werfen als einen toten. Mir scheint, ein Denkmal für Josyne wäre hier im katholischen Monward … als eine Art Schuldeingeständnis …«
»Dann vielleicht lieber ein Denkmal für Jan de Bakker? War er nicht der erste, der hier in den Niederlanden auf dem Scheiterhaufen landete?«
»Daß du das weißt! Und auch noch als Katholikin!«
»Man hat mich von der Nonnenschule verwiesen, und danach habe ich eine Zeitlang eine reformierte Schule besucht. Dort hörte ich zum ersten Mal von Jan de Bakker. Die Geschichte hat mich tief beeindruckt.«
»Von der Nonnenschule verwiesen? Warum?«
»In unserer Klasse sagte die Oberin stolz, sie sei eine Braut Jesu. Daraufhin rutschte es mir heraus: ›Ist unser Herrgott denn blind?‹«
Wir kamen an Bauernhöfen vorbei und erreichten einen schmalen Pfad, der zwischen glitzernden und funkelnden Wassersammelbecken hindurchführte. Auf beiden Seiten des Wegs war der Wiesenkerbel bereits so in die Höhe geschossen, daß er bis über Lottes Schultern reichte. Die großen weißen Blütendolden, auf denen häufig jede Menge Schwebfliegen (Cheilosia pagana) saßen, die sich den Wiesenkerbel als Fraßpflanze erwählt haben, wiegten sich im Wind hin und her und streichelten manchmal Lottes irrsinnig langen Zopf.
»Dort liegt das Wohnboot des Maulwurffängers«, sagte ich.
»Würde es dir etwas ausmachen, hier zu warten? Er scheint mir ein Mann zu sein, der sich unbefangener benimmt, wenn niemand kiebitzt«, sagte Lotte.
»Das ist mir recht, gibt es doch kaum etwas Schöneres, als, dem Rauschen des ranken Reets lauschend, dem wellenden Wasser nachblinzelnd, am stillen Ufer zu sitzen. Wer weiß, womöglich wabert auch noch ein sanfter Wind.«
Sie sah mich an, als wäre ich verrückt.
»Guck nicht so«, sagte ich, »das ist nur wieder ein Gezelle-Zitat.«
Aus dem Lauschen wurde nicht viel, wegen der landenden Boeings, des Lärms von Kettensägen, die sich auf der kleinen Insel Jahrhundertleid durch Baumstämme fraßen, und des Hintergrundrauschens der A 44. Ich war also froh, als Lotte nach einer Viertelstunde wieder zwischen den rahmfarbenen Dolden erschien.
»Ich hab ihn im Kasten«, sagte sie, während sie an mir vorüberging.
Ich stand auf und folgte ihr. »Du arbeitest wirklich unglaublich schnell.«
»Je länger man braucht, um die Leute zu fotografieren, um so mehr verstecken sie sich. Oft ist das erste Foto das beste.«
»Als mein Überschlag erschien und wie aus heiterem Himmel zum Bestseller wurde, da besuchten mich Dutzende von Fotografen. Manchmal brauchten sie einen halben Tag für ein Foto. Ich mußte mich dann bis zu den Hüften in einen Entwässerungsgraben stellen oder mich kopfüber an einen Ast hängen.«
»Wahnsinn, total überflüssig.«
»Oder auch nicht. Ein Fotograf einer großen Zeitung hielt auf meinem Hof, stieg aus dem Wagen und rief: ›Hacken Sie ruhig weiter Holz!‹ Er betätigte den Auslöser und brummte: ›Das war’s.‹ Später habe ich in der Zeitung gelesen, daß er mit diesem Foto für die Silberne Kamera nominiert worden ist.«
»Pah! Diese Art von Nominierungen! Als ob man darauf warten würde. Ich jedenfalls nicht. Als wäre Fotografieren ein Wettkampf. Preise … Auszeichnungen … dadurch wird alles verdorben, alles wird zur Fußballmeisterschaft degradiert. Pfui, damit will ich nichts zu tun haben, ich will … ich will …«
»… so ein Foto machen wie das von der Frau an der Straßenecke.«
»Genau, ich will etwas zu fassen kriegen, den ungreifbaren Kern, ich will die Essenz fotografieren. Das Unzerstörbare will ich zu packen bekommen, verdammt, das klingt so dämlich. Nie gelingt es mir, richtig auszudrücken, was ich meine … Ich will die Achillesferse …«
»Die unzerstörbare Achillesferse? Das ist aber ganz schön widersprüchlich, wenn du mich fragst.«
»Yes«, sagte sie wütend, »das ist widersprüchlich, ich weiß es, aber ich kann es nicht ändern. Ich will das Unbezwingbare zu fassen bekommen, aber auch das Verletzliche, und für mich sind beide ein und dasselbe.«
»Aber offenbar willst du nicht jedermanns Achillesferse zu fassen bekommen. Jedenfalls nicht die der enzianblauen Pfarrerin oder die der Gräfin oder die von Sirena.«
»Weil sie keine haben, nun versteh das doch endlich.«
»Und das siehst du mit deinen satinettebraunen Augen auf den ersten Blick?«
»Meistens ja. Manchmal nicht. Manchmal weiß ich es auch erst, wenn ich das Foto gemacht habe. Warte, bleib stehen, der Mann dort … wer ist das?«
»Wenn jemand keine Achillesferse hat, dann er.«
»Du hast von Fersen nicht den blassesten Schimmer. Wer ist das?«
»Teake Gras. Merkwürdiger Bursche. Der Busenfreund des Grafen. Weicht mir immer ein wenig aus, wenn wir uns begegnen.«
Ende der Leseprobe