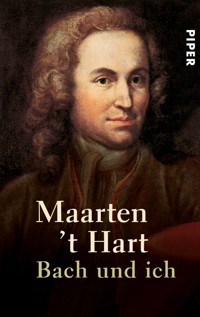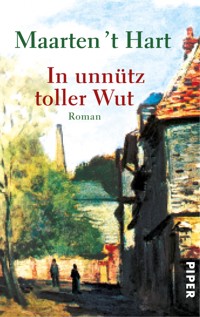9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Maarten ’t Hart gehört zu den beliebtesten Autoren der Niederlande. In seinem Roman schildert er die kleine Welt eines südholländischen Städtchens. Dort, in der President Steynstraat, ist der Komponist Alexander Goudveyl als Sohn eines Lumpenhändlers aufgewachsen, großgezogen mit Gebeten und den alten Geschichten vom Krieg. 30 Jahre später erinnert er sich an diese Zeit, vor allem an den 22. Dezember 1956, einen regennassen Samstagnachmittag, an dem der Polizist Vroombout ermordet wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
21. Auflage Februar 2010
© Maarten ’t Hart 1993
Titel der niederländischen Originalausgabe:
»Het woeden der gehele wereld«, B.V. Uitgeverij
De Arbeiderspers, Amsterdam 1993
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Piper Verlag GmbH, München 2005
Erstausgabe: Arche Verlag AG, Zürich – Hamburg 1997
Die Übersetzung erscheint mit freundlicher Unterstützung des
Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds.
Umschlag: semper smile, München
Umschlagabbildung: Claude Monet (»Damm und Schleusen am Achterzaan«, Ausschnitt)
Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-492-95046-6
Unterwegs aber, da wo er übernachtete, trat ihm der Herr entgegen und suchte ihn zu töten.Exodus 4, Vers 24
Teil 1
Prolog
Am Dienstag, 14. Mai 1940, legte ein Heringskutter nachmittags um halb fünf in einem Hafenstädtchen am Nieuwe Waterweg ab. An Bord waren sieben Mann Besatzung, ein »Prickenbeißer«1, eine Engländerin und drei jüdische Ehepaare. Eines der Ehepaare war nach der Kristallnacht aus Deutschland geflohen. Der Mann war ein begabter Geiger. Ein Vetter, selber Bratschist an der Rotterdamer Philharmonie, hatte ihm eine vorübergehende Anstellung bei diesem Orchester besorgt. Der Geiger war noch so jung, daß er, wie man in Rotterdam sagt, »gerade eben über seine Holzschuhe pinkeln kann, aber spielen, unglaublich… er kann seine Geige singen lassen wie eine Nachtigall, die mit Singfutter aufgezogen worden ist…« Bereits drei Wochen später bat ihn ein Gastdirigent, den grippekranken betagten Konzertmeister zu vertreten.
Die Frau des Geigers war noch jünger. Wer sie einmal gesehen hatte, vergaß sie nicht so leicht. Sie war groß und schlank, sie hatte langes dunkles Haar, sie hatte prachtvolle Zähne, sie hatte ein kleines, willensstarkes Kinn. Doch alles das war nichts gegen ihre hinreißende, tiefe, volle, ein wenig heisere Altstimme.
Als der geflohene Geiger am 10. Mai 1940 in aller Frühe durch die sonnigen Straßen von Rotterdam schlenderte und mit eigenen Augen sah, wie die Fallschirme jenseits des Flusses friedlich vom Himmel herabschwebten, beschloß er, nochmals zu fliehen. Seine Ehefrau wollte in den Niederlanden bleiben, sie wies auf seine guten Zukunftsaussichten hin.
»Schon bald wirst du Konzertmeister sein«, sagte sie am zweiten Pfingsttag.
»Man wird mich niemals offiziell zum Konzertmeister ernennen«, sagte er. »Dazu bin ich noch zu jung. Außerdem würden sich dann mindestens zehn erste Geiger übergangen fühlen. Nein, laß uns so schnell wie möglich nach England fliehen. Simon hat heute früh angerufen2. Er sagt, daß er einen Platz für uns auf einem Heringskutter wüßte. Der kann uns nach Harwich bringen.«
»Und dann? Dann stehen wir da mit unseren Koffern. Wir kennen niemanden. Was sollen wir dort machen?«
»Es kommen noch andere Freunde von Simon mit, die gute Kontakte in London zu haben scheinen. Sie würden sich um uns kümmern, hat Simon versprochen. Die Engländer lieben Musik…«
Sie ließ sich von ihm überreden. Am Dienstagmorgen, 14. Mai, kurz nach halb elf verließ ihr Zug den Bahnhof Delftse Poort. Dadurch entkamen sie dem Bombardement. Als sie am Nachmittag auf dem Waterweg fuhren, sahen sie die riesigen Rauchwolken. Damit war ihr jeder Zweifel genommen, ob es vernünftig sei, nochmals zu fliehen.
Wenige Stunden, bevor sie die trägen Rauchwolken gewahr wurden, waren sie an den hochgelegenen Mühlen von Schiedam entlanggefahren, vorbei an den Fischlagerhäusern von Vlaardingen und durch frische grüne Polder, die in der strahlenden Maisonne glänzten. In dem Hafenstädtchen wurden sie von dem Pharmazeuten Simon Minderhout abgeholt, der sich hier vor zwei Jahren als Apotheker niedergelassen hatte. Er versäumte kein einziges Konzert des Rotterdamer Philharmonischen Orchesters. Trotz seines jugendlichen Alters war er bereits im Vorstand des Orchesters. So hatte er das aus Deutschland geflohene Ehepaar kennengelernt. Er hatte sich mit dem Geiger angefreundet. Und nachdem er dessen Frau zum erstenmal gesehen hatte, habe ihm, wie er Jahre später erzählte, »sein Herz nicht in der Kehle, sondern dröhnend im rechten Ohr geklopft«. Immer wenn sie ihm zulächelte, schien es ihm, wie er später formulierte, »als schickte sie mich mit einer Balancierstange über den Waterweg«. Ging er kurz vor Kriegsbeginn in der Abenddämmerung zum Fluß hinunter, wunderte er sich, daß er sich ihr Gesicht nicht vorzustellen vermochte, während er gleichsam als schwachen Trost den salzigen Geruch des Flußwassers einsog.
Ganz selbstlos war seine Vermittlung bei diesem erneuten Fluchtversuch also nicht: »Wenn sie mir aus den Augen ist, wird sie mir wohl auch aus dem Herzen verschwinden«, hatte er bitter zu sich selbst gesagt, als er sich am zweiten Pfingsttag im Rasierspiegel betrachtete.
Minderhout kam aus Drenthe, hatte aber trotzdem schon persönliche Freunde in dem Hafenstädtchen. Nachdem er eines Samstagabends im Jahr 1939 die Witwe Vroombout, ohne daß eigens ein Arzt kommen mußte, bei einem Asthmaanfall vor dem Ersticken gerettet hatte, wurde er regelmäßig nach dem Kirchgang von der Witwe und ihren beiden Söhnen zu einer Tasse Kaffee und einem Schnaps eingeladen. An Winterabenden spielte er mit Willem Vroombout, dem Schiffer der »Majuba 2«, Dame. Mühelos wurde er von dem Fischer mit »Doppelopfern« und anderen trickreichen Zügen vom Brett gefegt. Danach spielte er mit Arend Vroombout, Matrose auf der »Majuba 2«. Gegen ihn gewann er nach einem meist nervenaufreibenden Endspiel, bei dem nur noch Damen auf dem Brett standen.
Am Samstag, 11. Mai, dem Samstag vor Pfingsten, war vlaggetjesdag3. Wären die Deutschen nicht am 10. Mai ins Land eingefallen, wäre die Heringsflotte am Dienstag, 14. Mai, ausgelaufen. Nach dem deutschen Überfall beschlossen die Reeder, die Heringsflotte im Hafen zu lassen. Da die Witwe Vroombout Eignerin der »Majuba 2« war, konnte Willem nach Rücksprache mit seiner Mutter selbst entscheiden, ob er ausfahren wollte oder nicht. Schon am Samstag, 11. Mai, beschloß er, doch zu fischen. Simon Minderhout erfuhr davon am ersten Pfingsttag bei der üblichen Tasse Kaffee nach dem Kirchgang.
Minderhout überlegte eine Weile. Als er seinen Schnaps vorgesetzt bekam, fragte er Willem, ob er eventuell bereit wäre, Flüchtlinge in Harwich oder Hull an Land zu setzen. Schiffer Vroombout nannte einen hohen Betrag; Minderhout meinte darauf, das sei zuviel, und halbierte den Preis. »Das ist ein Judenbakschisch«, sagte Willem Vroombout. Er fügte hinzu, daß er für einen solchen Spottpreis sein Schiff und seine Mannschaft nicht einem derartigen Risiko aussetzen könne. Woraufhin ihm Minderhout, der erst nach dem Krieg wirklich begriff, wie schrecklich es gewesen war, das Wort »Judenbakschisch« zu verwenden, vorschlug, für den zuerst genannten Betrag mehr Flüchtlinge mitzunehmen. Dem stimmte Vroombout zu. Minderhout telefonierte am Tag darauf frühmorgens zuerst mit einem jüdischen Studienfreund und danach mit dem Geiger. Und anschließend besuchte er in dem Hafenstädtchen noch ein jüdisches Ehepaar, von dem er wußte, daß beide Todesangst vor Hitler hatten. Außerdem ging er am zweiten Pfingsttag auch zu einer Engländerin, die in Hull einen niederländischen Lotsen kennengelernt hatte. Sie war in England mit dem Lotsen getraut worden. Anschließend war sie zu ihm in die Niederlande gekommen. Nach zwei Jahren war ihr Ehemann mit einem niederländischen Mädchen durchgebrannt. Seitdem erwähnte die Engländerin manchmal, daß sie plane, nach Hull zurückzukehren. »Das ist deine Chance«, sagte Minderhout. »Ja«, sagte sie.
Am Dienstag nachmittag, 14. Mai, standen die sieben Flüchtlinge an der Kade, dem Kai des Außenhafens. Sie stellten einander vor und gingen dann an Bord der »Majuba 2«.
»Am Samstag ist das Lotsenboot bei Schiedam auf eine Mine gelaufen«, sagte der Prickenbeißer auf dem Vordeck nervös.
»Ja, und zehn sind dabei ertrunken«, sagte Robbemond ruhig.
»Also, dann…«, fing der Prickenbeißer an.
»Warum gehst du nicht zu Muttern zurück, hier hält dich keiner, wir brauchen dich überhaupt nicht, wir fahren ja nicht auf Kabeljau oder Stockfisch«, sagte Robbemond.
Schiffer Vroombout kam hinzu. Er fragte: »Was ist los?«
»Unser Prickenbeißerchen hat Angst vor Minen«, sagte Robbemond.
»Ja, es scheint voll davon zu liegen«, sagte Vroombout.
»Meinst du, daß du sie umfahren kannst?« fragte Robbemond.
»Ich glaube schon«, sagte Vroombout, »die Minen liegen in der Fahrrinne. Wenn wir nah an Land kreuzen – und das geht, denn wir haben nicht geladen –, kann uns nichts passieren. Um halb fünf ist Flut, wir können also unterhalb von Rozenburg fahren.«
Sie fuhren an der Insel Rozenburg vorbei. Die Flüchtlinge starrten auf die blühenden Heckenrosen an der Deichböschung dieses Erdbeer- und Kartoffelparadieses, das erst später, in Friedenszeiten, vollständig zerstört werden sollte. Sie konnten von diesem Paradies nur den hohen Deich und die niedrigen Dächer der Häuser sehen, die auf der Landseite der Deichböschungen gebaut worden waren. Sie sogen die Luft des salzigen Wassers ein, sahen Schwärme von Uferläufern unter einem hellen, diesigen blauen Himmelsgewölbe. Deutsche Flugzeuge flogen über sie hinweg. Das Brummen der Motoren klang überraschend friedlich unter dem sonnigen, trügerisch sommerlichen Himmel.
Als sie auf offener See waren, teilte Vroombout einen Rachenputzer aus. »Um zu feiern, daß wir mit heiler Haut an den Minen vorbeigekommen sind«, sagte er.
Vielleicht hätte er das besser nicht tun sollen. Noch bevor sie in internationalen Gewässern waren, entdeckte der jüngere Bruder von Vroombout ein graues dunkles Gebilde. Er rief Matrose Leen Varekamp, der für seine außergewöhnlich scharfen Augen bekannt war.
»Kannst du sehen, was das ist?« fragte Arend Vroombout.
»Also, wenn du mich fragst«, sagte Varekamp, »ist das ein Walfisch!«
»Der hat doch gar nicht Luft genug, um so lange über Wasser zu bleiben«, sagte Arend Vroombout, der offenkundig nicht viel Ahnung von Walfischen hatte.
»Nee, da hast du recht«, sagte Leen Varekamp, der ebenfalls nicht viel Ahnung von Walfischen hatte.
Sie standen nebeneinander und schauten auf die dunkle Silhouette. Schiffer Vroombout trat zu ihnen, blickte kurz hin und sagte: »Das ist ein Unterseeboot, es hält direkt auf uns zu.«
Sie änderten ihren Kurs. Das Unterseeboot näherte sich jedoch schnell. Es war ein deutsches U-Boot, das, vom Atlantischen Ozean kommend, auf dem Weg nach Hamburg war. Als der Abstand keine zwei Meilen mehr betrug, gab das U-Boot einen Schuß ab.
»Wir sollen beidrehen«, sagte Fischer Vroombout ruhig.
Eins der beiden Beiboote der »Majuba 2« wurde ausgesetzt. Vroombout fuhr, zusammen mit seinem Bruder und Varekamp und Robbemond, an das U-Boot heran. In dem friedlichen Licht der immer noch warmen, aber schon im Westen stehenden Sonne erklommen sie die schmale Brücke. Der Kommandant, ein freundlicher, gesetzter, schon etwas älterer Deutscher, prüfte ihre Schiffspapiere und fragte nach dem Bestimmungsort des Kutters.
»Doggersbank, om haring te vissen«, sagte Vroombout.
»Ach so«, sagte der deutsche Kommandant, »Hering.«
»Jawohl«, sagte Vroombout, »Hering«, und griff einen imaginären Hering beim Schwanz, hielt ihn über seinen geöffneten Mund und ließ das unsichtbare Fischchen laut schmatzend in seiner Kehle verschwinden.
Der Kommandant lachte. Er sagte: »Machen Sie weiter!«
»Nein«, sagte ein Offizier. Er zog seinen Kommandanten beiseite, wies auf die »Majuba 2«, flüsterte ihm etwas ins Ohr. Der Kommandant antwortete. Der Offizier flüsterte wieder. Vroombout erzählte später, der Kommandant habe immer wieder gesagt: »Ach, laß doch die Fischer«, und der Offizier habe immer wieder geantwortet: »Man kann nie wissen, ob es wirklich Fischer sind. Laß uns das Gewisse für das Ungewisse nehmen. Wenn wir das Schiff in die Luft jagen, kann uns hinterher niemand den Vorwurf machen, wir hätten unsere Pflicht nicht erfüllt.«
»Sie standen da und redeten ganz gemütlich miteinander«, erzählte Vroombout später, »genau so, als ginge es darum, ob sie sich noch einen Schluck gönnen sollten, bevor sie in die Falle kriechen. Es sah aus, als ginge es überhaupt nicht um die ›Majuba‹, als debattierten sie über etwas völlig Alltägliches. Am Schluß kam der Kommandant wieder zu uns. Er sagte: ›Es tut mir sehr leid, aber wir sind mit Ihrem Land im Krieg. Wir müssen das Gewisse für das Ungewisse nehmen, es tut mir sehr leid, aber wir müssen Ihr Schiff doch sprengen.‹«
»Und da sagte ich zu ihm«, erzählte Vroombout später, »›Mann, unsere erste ›Majuba‹, die ›Majuba 1‹, ist ’14’18 von euch torpediert worden, mein Vater hat noch bis ’25 darunter gelitten. Und dann hat sich der alte Herr verabschiedet.‹ Na ja, das letzte kapierte der Kommandant nicht, aber er wurde doch wieder unsicher. Aber na ja, dieser zweite Mann, diese Rotznase, quengelte immer weiter, und das einzige, was der Kommandant dann noch zu sagen wußte, war: ›Leider, leider, leider.‹«
Vroombout fuhr mit seinen drei Mann Besatzung zurück. Das andere Boot wurde zu Wasser gelassen. Fünfzehn Menschen verteilten sich auf die beiden Boote. Ein paar deutsche Matrosen ruderten zur »Majuba 2«. Einer von ihnen befestigte eine Bombe am Vorsteven. Sie ruderten zurück. Die Bombe explodierte, schlug ein Leck oberhalb der Wasserlinie des Schiffes, so daß die »Majuba 2« nicht sank.
»Wir dachten damals«, erzählte Vroombout später, »daß es dabei wohl bleiben würde und daß wir wieder an Bord hätten gehen dürfen. Mit dem Leck hätten wir leicht nach England fahren können. Dann hätten wir es dort provisorisch abdichten können. Und notfalls hätten wir es mit Leck und allem auch noch hin und zurück geschafft. Wir fanden, daß es jetzt reichte. Und der Kommandant da drüben fand das offenbar auch. Doch da fing das gleiche Spielchen wieder an, da sah man den Kommandanten wieder mit diesem zweiten Mann herumreden, man sah sie auf der kleinen Brücke hin und her stapfen und in einem fort debattieren. Zuerst hatte ich ja noch ein bißchen Vertrauen, dachte, der Kommandant sitzt doch am längeren Hebel, aber als es schließlich immer länger dauerte, wurde mir ganz elend, und wirklich wahr, sie brachten eine zweite Bombe an. Jetzt hatten sie eine aus ihrem Laderaum geholt, die um einiges stärker war. Als die explodierte, hatte unser Kutter nichts mehr zu melden. Doch dauerte es noch eine Dreiviertelstunde, bis er völlig gesunken war. Dann verschwand das U-Boot, und wir ruderten also auch aus der Sonne. Spätabends waren wir zurück in Hoek. Wir haben niemals auch nur einen Cent von der Versicherung bekommen, die Bombe stünde nirgends in der Police, sagten sie, ich habe mit dem Vergrößerungsglas alles Kleingedruckte nachgelesen, aber sie hatten recht… na, jetzt ist man drüber weg, das sind so Sachen…«
Teil 2
Moses
Oft kostet es mich Mühe zu glauben, daß ich im Hoofd aufgewachsen bin, in dem Lumpenhandel an der Ecke President Steynstraat und Cronjéstraat. Es war eine so fremde Welt, diese Welt meiner Kindheit; ein Junge wie ich wurde als gassie bezeichnet; einen Polizisten nannte man juut, Bulle. Die verheiratete Frau, die man daran erkennen konnte, daß sie immer eine Schürze trug, wurde juffrouw genannt. Eine ansehnliche Frau hieß mokkel. Eine offensichtlich häßliche Frau wurde verächtlich als jodenbed bezeichnet. Die wunderlichen Wesen mit Haarschleifen, die anderswo als Mädchen bezeichnet wurden, hießen bei uns hittepetitjes. Heiratete solch ein hittepetitje einen gassie, der inzwischen ein goser geworden war, dann bildeten sie een spannetje. Ein solches Gespann setzte sodann hurtig ein halbes Dutzend wurmen oder aposteltjes in die Welt.
An den nach früheren Bürgermeistern benannten Kaden und in den nach Helden aus dem Burenkrieg benannten Straßen wohnten gutmütige Teerjacken, die sich selbst stolz als Seeleute bezeichneten. Sie fuhren auf Lotsenbooten oder Küstendampfern, sie waren selten länger als drei Tage von zu Hause fort. Waren sie an Land, dann schlenderten sie oder, wie sie es nannten, »stackerten« sie durch die Straßen auf der Suche nach einem akkefietje oder einem jankarretje. Man hörte sie dann zueinander sagen: »Na, ich will sehen, ob ich das für dich hinkriegen kann, aber hast du denn vielleicht noch ein Fitzelchen Tabak für mich?« Erst nach Jahren habe ich verstanden, daß ein »Fitzelchen« dort dasselbe bedeutete wie woanders »ein bißchen«, und noch immer weiß ich nicht genau, was im Hoofd akkefietje und jankarretje bedeuteten.
Obwohl die Seeleute ab und zu einen Rachenputzer oder einen Kurzen oder einen zum Abgewöhnen kippten, wurde nicht wirklich getrunken. Es gab nur eine Gaststätte, das Café Veerhoofd, aber das schloß immer um zehn Uhr abends. Und weil nichts konsumiert wurde, gab es auch keine Schlägereien. Zu mehr als »Balgereien« kam es nicht. Eigenartig war auch, daß man oft Sätze aus der klassischen niederländischen Literatur zitierte. Bekam man an der Hafenmole einen Stoß, weil man zu dicht am Rand der Kade stand, wurde er oft von der Bemerkung begleitet: »Pats, sagte Jacob Cats4!«, und wenn jemand, der bisher kerngesund gewesen war, plötzlich todkrank wurde, hörte man mit Sicherheit jemanden sagen: »Jaja, es kann sich alles ändern, wie Bredero5 schon sagte.«
Mein Vater und meine Mutter stammten aus Rotterdam. Sie sprachen anfangs noch nicht die Sprache vom Hoofd. Mein Vater bezeichnete eine Frau als frommes; das Wort gebrauchte sonst niemand im Hoofd. Aber oft sagte mein Vater zu mir, wenn ich im Lagerhaus zwischen den Lumpen spielte: »Na, was pusselst du da schon wieder rum?«, und er sagte auch nie: »Das ist meins«, »das ist seins«, sondern »das ist mir« und »das ist ihm«. Und meine Mutter benutzte oft das Wort »Schwung« im Sinne von »viel«. »Da hab ich wieder einen Schwung Kartoffeln geschält.«
An »pusseln« und »Schwung« wurde deutlich, daß meine Eltern anfingen, die Sprache vom Hoofd zu sprechen. Aber sie konnten, wie mein Vater oft bedauernd sagte, »ihren Hintern hier noch nicht richtig wärmen«. Meine Mutter fügte verdrießlich hinzu: »Das ist mir schnuppe.« Oft murmelte mein Vater nach weniger gelungenen Transaktionen: »Hier lernst du erst mal: Mache dich vertraut, aber vertraue niemandem!«, und mit schöner Regelmäßigkeit hieß es: »Wären wir nur in Rotterdam geblieben, hier ist es ein ewiges Auf und Ab.« Darauf sagte meine Mutter trocken: »Ja, aber wir mußten da weg.«
»Ja, verdammt schade«, sagte mein Vater, »denn die werden uns hier immer schief angucken!«
»Ja«, sagte meine Mutter dann, »wir sind den Leuten hier nicht gut genug.«
Da blickte mein Vater mich an und sagte: »Aber, Muttern, du mußt zugeben, daß der Herr uns, bevor wir uns hierher verziehen mußten, noch ein aposteltje geschenkt hat, ich schon Ende Vierzig, du gerade vierzig, und doch noch so ein aposteltje, wer hätte je davon träumen mögen, wir hatten schon zwanzig Jahre darum gebetet, wir beteten nicht einmal mehr darum, und dann doch noch…«
Wenn mein Vater das gesagt hatte, betrachtete er gewöhnlich eine Zeitlang die blauen Adern auf seinen Handrücken und sagte dann: »Nur schade, daß wir ihn nicht »erneuert« haben taufen lassen können.«
In all den Jahren meiner Kindheit blieb das ein Kummer. In Rotterdam waren meine Eltern Mitglieder der »erneuerten« evangelisch-lutherischen Gemeinde gewesen, aber im Hoofd fehlte eine solche Religionsgemeinschaft. Deshalb waren meine Eltern nach ihrem Umzug dann in Ermangelung eines Besseren »reformiert« geworden. »Viel lieber wäre ich ›erneuert‹ geblieben«, sagte mein Vater immer, »denn die Reformierten – na ja, ich will nichts Schlechtes über sie sagen: Gewöhnliche Muscheln gehen nun einmal schneller weg als Austern, und, ach, es ist wahr, auch ihre guten Sachen sind irgendwann abgetragen und landen bei mir, und im übrigen sind sie ganz brav.«
Letzteres mochte für die Teerjacken gelten, die selten oder nie auf die offene See hinausfuhren, aber es galt nicht für ihre Nachkommen, für die gassies, die die Straßen im Hoofd unsicher machten. Da die Teerjacken und die »Schürzen« meine Eltern weiterhin schief ansahen und sie schlichtweg als »Import« bezeichneten, fand ihre Nachkommenschaft, daß sie mich soviel wie möglich quälen, triezen und piesacken müßte. Wenn ich mich auf die Straße wagte, kamen sie in Schlachtordnung aus der Generaal de Wetstraat angerannt, um mir eine blutige Nase, ein blaues Auge oder aufgeschlagene Knie zu verpassen. Jeder Schulweg hin oder zurück war ein Wagnis. Meist rannte ich kurz vor Schulbeginn, wenn die gassies schon längst auf dem Schulhof waren, durch die leeren Straßen zur Boone-Schule. Und als ich in der dritten, vierten, fünften und sechsten Klasse war, wurde – nach Fürsprache von juut Vroombout – eine besondere Regelung getroffen. In all den Jahren durfte ich fünf Minuten, bevor die Schulglocke um vier Uhr läutete, die Schule verlassen, so daß ich durch die noch leeren Straßen nach Hause sausen konnte.
Hätte juut Vroombout sich nicht meiner angenommen, dann hätte vielleicht Exodus 2, Vers 6 (»und siehe, das Knäblein weinte«) tagaus, tagein für mich gegolten. Dank seiner konnte ich mich ab und an auf die Straße wagen, konnte manchmal sogar über die glatten Basaltblöcke an der Uferböschung dem Waterweg klettern. Er war fast immer in der Nähe; er hat mich viele Male gerettet, wenn die gassies mich bedrängten.
Juut Vroombout war ein stattlicher, muskulöser Mann von etwa dreißig Jahren. Sein Dienstfahrrad neben sich, schritt er durch die Straßen vom Hoofd, und wenn wir einander begegneten, lächelte er mich immer lange an, so daß ich mich irgendwie genierte. Auch die gassies sahen dieses Lächeln und nannten mich daraufhin verächtlich: »Der kleine Liebling vom juut!«
So wurde ich von ihnen auch an jenem Tag im Sommer 1952 genannt, an dem sie mich fast ertränkt hätten. Ich erinnere mich noch genau, daß Lehrer Mollema am Morgen dieses Tages aus der Bibel über Moses’ Rückkehr nach Ägypten vorlas. Eine Bibelstelle spukte mir den ganzen Tag im Kopf herum. »Unterwegs aber, da wo er übernachtete, trat ihm der Herr entgegen und suchte ihn zu töten.« Der Herr suchte ihn zu töten. Das begriff ich überhaupt nicht. Wenn Gott jemanden töten wollte, brauchte er doch nur mit den Fingern zu schnippen? Dann brauchte er doch nicht nach einer Gelegenheit zu suchen, jemanden zu töten? Und warum suchte er ihn zu töten? Die Bibelstelle kam für mich wie aus heiterem Himmel; offenbar konnte es plötzlich geschehen, daß Gott aus unerklärlichen Gründen auf einmal wütend auf dich war, und dann suchte er dich zu töten. Wenn er sogar Moses hatte umbringen wollen, dann war niemand jemals sicher vor ihm. Dann konnte er auch mich eines Tages zu töten suchen.
Vielleicht wäre die Bibelstelle weniger gut haftengeblieben oder hätte mich weniger beeindruckt, wäre ich nicht mittags im Schwimmbad beinahe ertrunken. Normalerweise war ich, da Bademeister Jacobs über uns wachte, im Schwimmbad ziemlich sicher. An diesem Sommernachmittag schwamm ich nach einem Sprung aus der Höhe gerade ins Tiefe. Es war warm, drückend warm. Ab und an strich ein glühendheißer Windhauch über das Wasser. Laut klang der Lärm der vielen Kinderstimmen. Auch das Wasser war warm, und ziemlich langsam schwamm ich zu einer der kleinen Treppen. Als ich nah am Rand war, hörte ich jemanden schreien: »He, da haben wir den gassie von Goudveyl, den wolln wir mal, den wolln wir mal…«
»Nicht rauslassen«, schrie eine andere Jungenstimme, »halt ihn fest, zieh ihn unter Wasser, den kleinen Liebling von unserm juut.« Bevor sie mich jedoch unter Wasser ziehen konnten, war ich schon an der Treppe. So schnell wie möglich versuchte ich, aus dem Wasser zu klettern, aber von allen Seiten krallten sich Finger um meine Hände. Obwohl ich meine Hände noch ziemlich lange um das Eisen klammern konnte, mußte ich mich nach einer Weile geschlagen geben. Klatschend fiel ich ins Wasser zurück, hörte das Gejauchze am Rand und fühlte dann, wie sich zwei Füße auf meine Schultern stellten und ich unter Wasser gedrückt wurde. »Mach ihn fertig, mach ihn fertig, Kurt«, hörte ich es johlen, »mach ihn nun endlich ein für allemal fertig, den blöden Bullenliebling!«
Wie merkwürdig, daß ich nicht die Geistesgegenwart hatte, unter seinen Füßen wegzutauchen. Aber vielleicht hätte mich das, selbst wenn es mir gelungen wäre, auch nicht retten können. Links und rechts klatschten gassies ins Wasser. Wäre ich unter den Füßen von Kurt Boog weggetaucht, dann hätten sie mich immer noch ein Stück weiter unter Wasser festhalten können. Wie dem auch sei: Bei dem Namen eines meiner schlimmsten Quälgeister, Kurt Boog, geriet ich erst recht in Panik. Verzweifelt versuchte ich hochzukommen, aber Kurts Füße drückten schwer auf meine Schultern. Ich hatte nicht die geringste Chance, und es war, als würde ich ersticken, ich mußte Luft holen, und ich tat es, und meine Lungen füllten sich mit Wasser. Danach wurde alles zuerst feuerrot und dann tiefschwarz, und von dem Augenblick an weiß ich nichts mehr.
Als ich wieder zu mir kam, lag ich auf dem schmalen Betonrand zwischen dem Becken für Nichtschwimmer und dem für Schwimmer. Bademeister Jacobs bewegte meine Arme abwechselnd auf und ab. Ich spuckte Wasser, schaute in den blauen Himmel und wußte, daß Gott von dort, aus unendlich weiter Ferne, überheblich aus dem Himmel auf mich niederblickte. Auch mich suchte er offenbar zu töten. Während ich dort lag und mir vorstellte, wie er, unzufrieden über seinen Fehlschlag, mich zu töten, die ganze Zeit auf mich niederblickte, hörte ich Kurt Boog zu Bademeister Jacobs sagen: »Ich hab ihn da rausgeholt, ich hab ihn da rausgeholt!«
So verwandelte er sich selbst von einem Peiniger in einen Retter. Später war es, als müsse er im nachhinein die Rolle des Retters wahrmachen. Er schlug sich auf die Seite von Vroombout und stellte sich vor mich, wenn die gassies es auf mich abgesehen hatten. Dennoch habe ich ihn in der Zeit, in der er mein Peiniger gewesen ist, weniger gehaßt als später, da er sich als mein Retter aufspielte.
Bei Tisch erzählte ich, ohne allerdings den Text von Moses zu erwähnen, daß die gassies versucht hätten, mich zu ertränken. Nach meinem Bericht sagte mein Vater: »Na, ich will für dich hoffen, daß es nicht deine letzte Niederlage ist.« Und meine Mutter sagte trocken: »Du wirst es wohl dementsprechend getrieben haben.«
Varekamp
Montag morgens strömten Hausfrauen und hittepetitjes gegen sechs Uhr mit leeren Eimern zum Eingang der Wäscherei De Vries. Sobald der Betrieb neben unserem Lagerhaus geöffnet wurde, verschwand die lange Reihe der Wartenden in einer Dampfwolke, die sich träge nach draußen wälzte. Abwartend blieb der Wolkenschleier zunächst in der President Steynstraat hängen. Dann fiel er auf einmal in Nebelschwaden auseinander. Träge stiegen sie auf, bis sie über den Schornsteinen zu sehen waren. Schließlich führte der Südwestwind sie eilig mit sich fort.
Als erste betrat immer juffrouw Varekamp die Wäscherei. Meistens wartete sie in ihrem Hauskittel, über dem sie je nach Wetterlage eine oder zwei gewöhnliche Schürzen trug, schon von halb sechs an, obgleich die Familie Varekamp neben uns in der Cronjéstraat wohnte und sie nur an unserem Wohnund Lagerhaus entlangzugehen brauchte, um zur Wäscherei zu kommen.
Mit der Familie Varekamp teilten wir uns, sparsam wie wir waren, eine Zeitung, und ich hatte die Aufgabe, die Zeitung kurz nach dem Abendessen zu holen. Aus dem senkrechten schmalen Schlitz des Briefkastens hingen die beiden Seilenden, mit denen die Tür aufgezogen werden konnte. Hatte man die Haustür geöffnet, schlug einem ein Geruch entgegen, den ich nirgendwo sonst gerochen habe, eine bedrohliche, säuerliche Fischluft, von der einem ganz übel wurde, noch bevor man den Flur betreten hatte.
Im Wohnzimmer war es fast immer dunkel. Elektrisches Licht – das brannte bei Familie Varekamp so gut wie nie, und es ist mir ein Rätsel, wie sie in den Herbst- und Wintermonaten die Zeitung haben lesen können.
Etwa einmal im Monat traf ich alle Varekamps – Eltern, vier Kinder –, über diverse Lehnstühle verstreut, leise stöhnend an. Ihre Köpfe ruhten, weit nach hinten gebeugt, auf den Rückenlehnen: Sie hatten alle sechs auf einmal Kopfschmerzen. Auf ihren Stirnen lag, um den Schmerz zu lindern, ein nasser Waschlappen. Von mir erwartete man, daß ich die sechs Waschlappen wieder frisch machte. Bei juffrouw Varekamp beginnend, sammelte ich die sechs Waschlappen ein. In der Küche ließ ich kaltes Wasser darüber laufen, wrang sie halb aus und drapierte sie, wieder bei juffrouw Varekamp beginnend, vorsichtig auf den leidenden Köpfen. Ohne etwas zu sagen, schnappte ich mir die Zeitung und rannte aus dem Haus.
Hatten sie keine Kopfschmerzen, saßen die sechs Varekamps, wenn ich das Wohnzimmer betrat, maulend im Dunkeln um den Eßtisch herum. Vater Varekamp trug dann stets eine Mütze mit Ohrenklappen.
»So, holst du jetzt schon die Zeitung?« brummte Varekamp mißmutig. »Ich hab kaum Zeit gehabt, um reinzugucken!«
»Da steht sowieso nie was drin«, sagte juffrouw Varekamp, »nimm sie in Gottes Namen nur schnell mit!«
»Nein, ich will sie noch lesen«, sagte der älteste Sohn.
»Und ich auch, und ich auch, und ich auch!« riefen die drei anderen Kinder.
»Mund halten, das ist ja wie in der Judenschule!« schrie juffrouw Varekamp, während sie die Träger ihrer Schürze hochschob.
Sie lief zum Kaminsims, wo die Zeitung noch ordentlich zusammengelegt auf der Bibel ruhte, nahm sie, kam auf mich zu, drückte sie mir in die Hand und sagte: »Weg damit! Nachrichten sind Ärger, Politik ist Schmutz!«
Mit der Zeitung unterm Arm trotzte ich dem säuerlichen Geruch auf dem Flur. Wieder auf der Straße, holte ich tief Luft.
Manchmal brannte bei den Varekamps über dem Eßtisch die mit gerafften Falten aufwendig drapierte Lampe. Die Varekamps saßen vergnügt um den Tisch herum. Mit uralten Fischermessern hämmerten die vier Kinder auf den Rand ihrer Abendbrotteller. Vater Varekamp brüllte: »Nur herbei, nur herbei an die Festtafel!«
Mit einer seiner riesigen Hände hielt er ein Schwarzbrot fest und strich Margarine auf die Schnittfläche. Danach schnitt er eine Scheibe Brot ab. So oft ich das mit angesehen habe, jedesmal war ich wieder verblüfft. Es schien mir viel logischer und einfacher, zuerst eine Scheibe Brot abzuschneiden, sie auf den Teller zu legen und dann Margarine darauf zu schmieren, statt das ganze Brot mit einer Hand auf Schulterhöhe festzuhalten und mit der anderen Hand Margarine darauf zu schmieren, so daß ich einmal stolz bemerkte: »Bei uns zu Hause schneiden wir zuerst die Brotscheibe ab. Dann schmieren wir, das ist viel einfacher.«
»Hör dir diesen Naseweis an«, sagte Varekamp, »so, so, das ist viel einfacher? Und was tut ihr, wenn so ein Butterbrot schon abgeschnitten ist und es dann keiner mehr will? Dann sitzt du ganz schön da mit der abgeschnittenen Brotscheibe, die sofort steinalt wird. Dann kannst du sie gleich wegwerfen. Nichts da: erst schmieren, dann schneiden.«
»Ja, erst schmieren, dann schneiden«, johlten die vier Varekamp-Kinder.
»Ihr eßt zu Hause sicher auch Blutwurst?« fragte juffrouw Varekamp.
»Manchmal«, sagte ich.
»Das hab ich mir gedacht«, sagte juffrouw Varekamp, »wo sie erst schneiden und dann schmieren, essen sie auch Blutwurst, hab ich schon oft gesehen!« »Igitt, Blutwurst!« riefen die Varekamp-Kinder.
»Also, das kann ich dir sagen«, sagte juffrouw Varekamp, während sie mich drohend anblickte und kämpferisch ihre Schürzenträger hochschob, »wir essen prinzipiell keine Blutwurst. Steht in der Bibel, gleich am Anfang, in Genesis: ›Alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise; nur Fleisch, das seine Seele – sein Blut – noch in sich hat, dürft ihr nicht essen.‹«
»Wenn ihr zu Hause Blutwurst eßt«, sagte Vater Varekamp, »dann seid ihr, es tut mir leid, daß ich das sagen muß, keine guten Christenmenschen. Das hätte ich nun niemals von euch gedacht, ehrlich nicht.«
»Du faßt es nicht«, sagte juffrouw Varekamp, »daß fast alle Christenmenschen einfach Blutwurst essen! Aber na ja, man hört auch nie einen Pastor darüber predigen, die übersehen das glattweg alle, obwohl es doch sozusagen das Nullte Gebot ist, denn es steht in der Bibel noch vor den Zehn Geboten.«
»Nun, ich bin froh, Mutti«, sagte Varekamp zu seiner Frau, »daß wir uns darin so rührend einig sind. In dieses Haus hier kommt keine Blutwurst. Stell dir mal vor, daß ich mit irgendeiner Mamsell verheiratet wäre, die Blutwurst auftischen wollte… Ach, Mutti Var, wenn ich dich nun nicht hätte…«
Er seufzte, hielt das Brot hoch, hob mit der anderen Hand das Messer, das, so wußte ich, gleich darauf wie eine Flußschwalbe in die Margarine eintauchen würde, und sagte: »Und doch hat nicht viel gefehlt, und es wäre nichts mit uns geworden. Du hättest rein gar nichts von mir wissen wollen, wenn ich nicht mit diesen meinen Fäusten…«
Er legte Brot und Messer hin und breitete dann seine beiden riesigen Hände auf dem Tischtuch aus.
»Mit diesen beiden Fäusten«, sagte er, während er seine Hände kurz auf und ab bewegte, »ja, mit diesen beiden Fäusten habe ich den ganzen Kasten von irgendwo bei Doggerbank nach Hoek zurückgerudert, Vroombout wollte mich dauernd ablösen, und dann sagte ich: ›Nee, Schiffer, ich bin noch nicht müde, es geht sehr gut, solange es noch geht, würde ich gern eben an den Riemen bleiben.‹
Und Vroombout sagte zu mir: ›Ja, Leen‹, sagt er, ›da findet man an der ganzen Wasserstraße keinen, der strammer rudern kann als du!‹ sagt er. ›Also wenn’s noch geht, dann ruder man weiter!‹ sagt er.«
Vater Varekamp rieb sich mit der linken Hand liebkosend über den Spann seiner rechten Hand.
»Mit diesen beiden Fäusten«, sagte er, seine Stimme erhebend.
Und im Hafen tutete wie zur Bestätigung dessen, was Varekamp gesagt hatte, zweimal das Lotsenboot.
»Da fährt die Sirius«, sagte Vater Varekamp.
Dann blickte er wieder auf seine Hände.
»Wo war ich noch mal stehngeblieben?« fragte er.
»Da, wo Sie nach Hoek ruderten«, sagte ich.
»O ja«, sagte er, »na, um es kurz zu machen, ich hab den ganzen Kasten mitten aus Doggerbank nach Hoek gerudert, und darüber haben sie hier im Hoofd hinterher noch tagelang geredet, und Mutti Var hat es damals auch gehört…«
Fragend schaute er juffrouw Varekamp an. »Wo hast du’s noch gleich zuerst gehört?«
»Am nächsten Montag, als ich so um sechs in der Schlange für heißes Waschwasser anstand«, sagte juffrouw Varekamp.
»Ach ja, da… das hätte ich nun direkt vergessen, wie ist das möglich, na ja, um es kurz zu machen, sie bekam da tatsächlich wohl ein bißchen Lust auf mich, nicht wahr?«
»Ein bißchen«, sagte juffrouw Varekamp mürrisch.
»Genau, du gingst doch nicht mehr ein so großes Stück zur Seite, wenn ich mich neben dich stellte, am Sonntag nach der Kirche, wo wir uns zufällig bei einem Schwätzchen trafen. Aber ich hab noch den ganzen Krieg dazu gebraucht, um dich zu bekommen, den ganzen Krieg. Und nachdem die Scheißmoffen dann abgehauen waren, hattest du immer noch irgendwie ein Auge auf so ’nen Mistkanadier geworfen… Na ja, als dieser Schwächling sich auch davongemacht hatte, konntest du mich Gott sei Dank nicht schnell genug heiraten… aber der Anfang war, als hier im Hoofd plötzlich jeder davon sprach, daß ich ganz allein die ganze Nacht… ja, Jungens, wenn dieser Scheißmoff unsern Kutter nicht versenkt hätte, säßet ihr vielleicht gar nicht hier. Dann würdet ihr vielleicht irgendwo sitzen, wo ihr Blutwurst fressen müßtet.«
Beim Anblick der Triefnasen von vier Varekamp-Kindern, die mit ihren Migränegesichtern auf ihre blutwurstlosen Brotteller starrten, konnte ich mir nicht verkneifen zu denken, daß es vielleicht gar nicht so schlimm gewesen wäre, wenn sie nicht geboren wären. Vater Varekamp dachte offenbar anders darüber, denn er fügte vergnügt hinzu: »Schiff zerronnen, Frau und Kind gewonnen, der Krieg hat wirklich nicht nur Schlechtes mit sich gebracht!«
»Das kannst du jetzt so sagen«, sagte juffrouw Varekamp, »aber ich glaube, daß Willem Vroombout aus Trauer über sein Schiff Krebs bekommen hat.«
»Des einen Brot ist des andern Tod«, sagte Varekamp philosophisch.
»Und seinem Bruder ist es auch nicht allzugut gegangen nach…«
»Wie kommst du denn darauf?« sagte Varekamp. »Dieser Knilch, dieser Arend, das war überhaupt kein Fahrensmann, der war verflixt froh darüber, daß sie ihn danach bei der Polizei haben wollten, das hatte er schon gewollt, bevor er über seine Holzschuhe pinkeln konnte. Ich kapier nur nicht, warum sie ihm nicht sofort als Schupo hier im Hoofd ein Dienstfahrrad unter den Hintern geschoben haben. Hier kannte er doch jeden, hier wohnte seine Mutter… nee, das kapier ich nicht, was hatte er bloß da in Rotterdam zu suchen? Er selber behauptet, das hätte zu seiner Ausbildung gehört. Als ob man ausgebildet werden müßte, um juut zu sein. Mich würde man dazu nicht auszubilden brauchen, zieh mir so eine Uniform an, gib mir ein Dienstfahrrad, und ich bin Schupo. Aber er hat den ganzen Krieg da gehockt. Na ja, heutzutage ist er hier bei uns Streifenpolizist, und wir haben es gut mit ihm getroffen, wirklich gut… er ist wie ein Vater zu uns.«
»Es gibt genug Leute, die anders drüber denken«, sagte juffrouw Varekamp, während sie die wieder heruntergerutschten Träger ihrer Schürze stramm über die Schultern zog.
»Das sind all die Blutwurstesser, Mutti«, sagte Vater Varekamp. Streng blickte er in die Runde, stellte das Brot auf den Tisch, sagte: »Jeder genug gehabt?«
Er erwartete keine Antwort. Er faltete seine Hände, schloß die Augen und brüllte ein Dankgebet:
Sparsamkeit
»Durch Sparsamkeit«, sagte mein Vater mindestens einmal die Woche, »ist noch nie jemand arm geworden.«
»Du sagst es«, sagte meine Mutter dann, »an dem Geld, das man ausgibt, hat man nur ein einziges Mal seine Freude!«
Deshalb gaben sie nie Geld aus. Deshalb sagten sie warnend: »Kost’ Geld«, wenn es etwas gab, das ein normaler Mensch vielleicht hätte anschaffen wollen. Deshalb wurden die Lumpen, die mein Vater in dem Hafenstädtchen einsammelte, immer, wie meine Mutter sagte, »mit einer Taschenlampe nachgesehen«, um festzustellen, ob brauchbare Hosen, Röcke, Oberhemden oder passende Unterwäsche darunter waren. Übrigens wurde für dieses »Nachsehen« niemals wirklich eine Taschenlampe verwendet; meine Mutter besah sich die Lumpen vorn am Fenster im Wohnzimmer.
»Was die Leute heutzutage doch alles so wegwerfen!« pflegte sie zu sagen und legte einen Rock oder ein Oberhemd beiseite. Auch meine Kleider rekrutierten sich aus den Lumpen. Bestimmt habe ich abgetragene Sachen meiner Klassenkameraden zur Schule angehabt. Vielleicht sahen mich die gassies auch deshalb schief an. Doch nie hat ein gassie gesagt: »He, du hast meine alte Hose an!« Kam das, weil ich schon damals sehr groß für mein Alter war und möglicherweise immer Kleidung von gassies trug, die eine Klasse über mir waren? Das ist nicht unwahrscheinlich, aber weil niemand sagte: »Du hast meinen alten Pullover an«, bin ich ständig mit dem Gefühl herumgelaufen, daß die gassies absichtlich ihren Mund hielten. Sie sahen und wußten es, aber redeten nicht. Erst das war das Beängstigende. Sie waren wie Gott, der auch niemals etwas von sich hören ließ, dich aber auf dem Wege – oder im Schwimmbad – zu töten suchte.
Daß er mich wirklich zu töten suchte, mußte offenbar immer und immer wieder von meinem Vater bestätigt werden, wenn er im Lagerhaus regelmäßig liebkosend über die Deckel der beiden Särge strich, die in der dunkelsten Ecke auf Böcken standen.
»Hab ich am Ende des Krieges für einen Pappenstiel ergattern können«, murmelte er mir manchmal zu. »Sie waren eigentlich für zwei Knilche aus dem Widerstand vorgesehen, aber bevor sie hingerichtet werden konnten, war der Krieg wegen Befreiung schon vorbei, also daher, schade nur, daß ich nicht auch für dich einen kleinen Kindersarg beschaffen konnte, na ja, für Muttern und meine Wenigkeit habe ich schon mal einen parat, wenn du so einen heutzutage kaufen wolltest, würde er eine schöne Stange Geld kosten.«
Die beiden Särge, an denen übrigens nach der Großen Sturmflut (dabei stand unser Lagerhaus unter Wasser, und die Särge wurden durch die Flut von ihren Böcken gehoben) zum Entsetzen meines Vaters Holzwurm festgestellt wurde (er entdeckte ihn, als er die Särge wieder auf ihre Böcke hob), blieben vorerst noch leer, weil meine Mutter alle Leiden abwechselnd und spottbillig mit einer Messerspitze Cuprum D3 oder einigen Tröpfchen Apis D4 zu heilen wußte. Dank dieser »Hömopathen«, wie meine Mutter die beiden Mittel nannte, waren wir kerngesund, auch wenn wir aus Sparsamkeitsgründen immer das Allerbilligste aßen: Griebenschmalz, Stippgrütze und die von juffrouw Varekamp verabscheute Blutwurst. Stippgrütze oder auch Buchweizengrütze gab es sogar mehr als einmal in der Woche als warme Mahlzeit. Nach der Stippgrütze strich sich mein Vater immer zufrieden über seinen Bauch und rief dann: »Bäuchlein, Bäuchlein, was hast du es wieder gut gehabt!«
Inzwischen bin ich geneigt zu glauben, daß mein Vater sich deshalb so zufrieden zeigte, weil ein Paket Grütze damals nur fünfzehn Cent kostete und ein halber Liter Buttermilch nur zwanzig Cent, aber damals fand auch ich Buchweizengrütze herrlich, und wenn ich wirklich Hunger habe und allein zu Hause bin, mache ich mir auch heute noch gern Stippgrütze. Bedauerlich ist, daß nur noch wenige Händler Buchweizengrütze in ihren Regalen stehen haben.
Daß mein Vater und meine Mutter unvorstellbar sparsam waren, hat mir nie etwas ausgemacht. Sogar, daß ich anderer Leute abgelegte Sachen tragen mußte, konnte ich, von der ewigen Angst vor dem vielsagenden Schweigen der gassies abgesehen, billigen. Was meine Mutter aus den Lumpen heraussuchte, war immer noch heil, und bevor sie es mich anziehen ließ, wurde es gründlich mit grüner Seife gewaschen. »Ich sorg schon dafür«, sagte sie stets, »daß du nicht schlampig herumläufst«, und das war zweifellos wahr. Mit grüner Seife brauchte sie nicht zu sparen. Die bekam sie gratis von Wäscher De Vries, als Gegenleistung für das Bruchholz, mit dem er seinen Kessel heizte. Sie nähte, flickte, stopfte, konnte Ärmel verlängern und kürzen, Hosenbeine kürzen und verlängern und konnte fast jedes Kleidungsstück, das sie den Lumpen abrang, in ein Oberhemd oder eine Hose verwandeln, so daß sie für den ursprünglichen Besitzer nicht mehr zu erkennen waren. Vielleicht haben die gassies deshalb niemals auch nur eines ihrer Kleidungsstücke wiedererkannt.
Dank ihrer beängstigenden Sparsamkeit waren mein Vater und meine Mutter beinahe immer gut gelaunt. Fast jeden Tag gelang es ihnen, an irgendwas zu sparen, und daran wurde abends bei Tisch stolz erinnert. Und wenn an einem Tag keine Gelegenheit gewesen war zu sparen, konnte mein Vater immer noch zu meiner Mutter sagen: »Sie wollen einführen, daß man jedes Jahr einen festen kirchlichen Beitrag gibt. Wie kommen sie bloß darauf! Es ist doch verflixt schade, daß wir hier nicht ›erneuert‹ haben bleiben können, denn bei den ›Erneuerten‹ kennen sie solche Verrücktheiten nicht, das kannst du mir glauben, na ja, wenn sie nur wissen, daß hier aber auch rein gar nichts zu holen ist!«
»Nein, ein kahles Kinn kann man nicht scheren«, sagte meine Mutter.
»Genau so ist es«, sagte mein Vater, »und nun zieh ich mir erst mal einen Splitter aus der Ritze.«
Er stand auf und ging zur Toilette, und dabei murmelte er: »Feste kirchliche Beiträge! Feste kirchliche Beiträge! Die sind nicht ganz bei Trost, wie können sie es wagen! Also, wenn es jemanden gibt, der kein Geld nötig hat, dann Gott. Wofür sollte der es denn ausgeben?«
Auf der Toilette konnte man ihn manchmal ausrufen hören: «Wer hat, will mehr!« Ob das auch für Gott galt oder nur für den Kirchenrat, weiß ich nicht, aber das war auch gleich. Wir wollten nicht mehr, wir sparten. Wir sparten sogar an Wasser und an Sunlichtseife. Einen um den anderen Tag mußte ich »Katzenwäsche« machen. Bei einer Katzenwäsche benutzte man keine Seife, sondern spritzte sich morgens ein paar Wassertropfen ins Gesicht.
Daß wir – jedenfalls erweckte mein Vater immer den Anschein – bitterarm waren, wurde für mich vollständig durch einen wunderbaren Gegenstand kompensiert, der links neben den Särgen im Lagerhaus stand. Mein Vater murrte manchmal darüber, sagte, daß er schon dastand, als er den Trödelladen im Krieg hatte übernehmen können, aber Gott sei Dank hat in den Jahren vor dem Mord an juut Vroombout nie jemand einen Blick auf den phantastischen und merkwürdigerweise niemals ganz verstimmten Blüthner geworfen. Daher blieb das Instrument dort stehen, und ich konnte darauf spielen, sooft ich wollte. Außerdem lag auf dem Blüthner neben einem Gedichtband von Guido Gezelle6 ein Stapel Klaviernoten. Eines der Bücher, ein riesiger, in rotes Leder gebundener Foliant, war eine »vollständige Anleitung, um ohne Lehrer Klavier spielen zu lernen«, wie jemand mit Bleistift in niederländisch über den deutschen Untertitel geschrieben hatte. Alles, was das phantastische Riesenwerk außerdem noch an Text – in Fraktur gedruckt – enthielt, war für mich unleserlich. Aber eine feste Hand hatte mit Bleistift unter und über den Text Übersetzungen geschrieben. Außer den Übersetzungen enthielt das Werk auch noch Anmerkungen des Bleistiftschreibers. Als Kind wußte ich das nicht; ich habe es erst später entdeckt. Wie dem auch sei: Mit diesem Buch habe ich mir selber das Klavierspielen beigebracht. Alles stand darin, Dur- und Molltonleitern, Harmonielehre, Kontrapunkt und auffallend kluge Übungen und raffinierte Etüden. Es war meine Bibel, mein Buch der Bücher, mein Gradus ad Parnassum, meine Via Regia in die Welt der Kreuze und Bs, der Dreiklänge und verminderten Septimenakkorde. Wenn ich darin studierte, war es, als schaute mir der anonyme Wohltäter, der mit Bleistift in seinen gut lesbaren Zwergenbuchstaben überall den ursprünglichen, deutschen Text ergänzt hatte, über die Schulter.
Das riesige rote Buch tröstete mich über alles hinweg, was ich als Kind entbehrte, auch wenn ich kaum wußte, was ich entbehrte. Freunde? Brüder und Schwestern? Großeltern? Andere Kinder hatten Großeltern und Onkel und Tanten. Meine Großeltern waren schon lange tot, und mein Vater und meine Mutter waren wie ich Einzelkinder gewesen, so hatte ich keine Onkel und Tanten und keine Vettern und Cousinen. Schlug ich das Buch auf, dann vergaß ich, wie verwaist wir waren. Blätterte ich darin, dann verschwamm sogar die irgendwie irreale und erst durch den Mord an juut Vroombout konkretere Wahnvorstellung, daß Gott mich, ebenso wie Moses, zu töten suchte. Und je weiter ich in dem Buch vordrang, desto sicherer wußte ich, daß es noch eine andere Welt gab als die enge Welt vom Hoofd, eine Welt mit anderen Namen, Namen, die man im Hoofd nie hörte: Bach, Mozart, Beethoven, Schubert; und von jenem Bach, über dessen Namen der Bleistiftschreiber schwungvoll »schwere Kost« geschrieben hatte, stand in dem Buch ein Stück mit der Überschrift Allegretto quieto, das man spielen und spielen konnte und das einen doch niemals langweilte. Man konnte es auf der Straße nachpfeifen, und dann war es, als beschützte es einen vor den gassies und gosern, beschützte vor dem Lächeln von Vroombout, sicherte ab gegen Gott, der danach suchte, einen zu töten. Und von jenem anderen Mann, Schubert, stand in dem Buch ein Stück mit der einfachen Überschrift Trio, ein Stück in As-dur und wahnsinnig schwer zu spielen. Das beschützte gerade nicht, im Gegenteil, das machte einen wehrlos, das zog einem die Haut ab. Wenn man es nachpfiff, bekam man jedesmal wieder Tränen in die Augen. Dann schien es, als löse sich die ganze Welt in süßen Schmerz auf. Dann war es, als würde es immer November bleiben und als wanderte man immer weiter im Abendlicht auf Straßen, die vom Nieselregen glänzten.
Wenn ich Samstag nachmittags am Blüthner saß, passierte es oft, daß mein Vater mit einer Papiertüte, die er schon im Wohnzimmer aufgeblasen hatte, ins Lagerhaus schlich. Direkt hinter mir schlug er dann auf die Tüte, und ausführlich genoß er danach meinen Schreck über den dröhnenden Knall. Er tat das so regelmäßig, daß ich mich an diesen Samstagnachmittags-Knall gewöhnte. Um ihm eine Freude zu machen, simulierte ich nach einiger Zeit, daß ich mich erschrak, denn über einen gelungenen Knall und meinen anschließenden Todesschrecken konnte er sich noch stundenlang amüsieren. Ohne diesen Samstagnachmittags-Knall hätte er es wahrscheinlich gar nicht akzeptieren können, daß ich so viele Stunden hinter dem Blüthner vertat, der nicht einmal in Mitleidenschaft gezogen wurde, als in der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar 1953 Salzwasser in unser Lagerhaus strömte.
Zugeständnis
Ich erinnere mich an einen Tag des Herrn im Sommer 1953. Weit weg wütete noch immer der Koreakrieg. »Ob sie wohl am Sonntag auch kämpfen?« fragte ich mich. Meine Mutter und mein Vater saßen im hohen Gras an der Deichböschung bei der Booner-Schleuse; ich lag neben ihnen, ganz und gar erfüllt von dem weiten, weiten Himmel und dem Weltall, diesem schwindelerregenden Weltall, über das Lehrer Mollema gar nicht aufhören konnte zu reden. Jedesmal wenn er davon erzählte, schien es noch größer geworden zu sein. Daß Gott nach Moses suchen mußte, schien in einem solch unermeßlichen Weltall verständlich.
Das Gras duftete, es war ein sonniger Tag. Über mir glänzte ein strahlendblauer, wolkenloser Himmel. Dort war das Weltall, mit all den Sternen und Planeten, und mir wurde schwindlig. Ich schloß die Augen und roch den trostreichen Duft der Rapsblüten. Dumpf begann die schwere Glocke der evangelischen Kirche zu läuten. Wenig später stimmte die schnelle Glocke der reformierten Kirche mit ein.
»Kirchzeit«, sagte meine Mutter.
»Ich geh nicht«, sagte mein Vater, »wir waren heute morgen schon.«
Hell und klar schloß sich jetzt die Glocke der christlich-reformierten Kirche an, die schon läutete.
»Warum nicht?« fragte meine Mutter.
»Hörst du eine ›erneuerte‹ Glocke?« fragte er.
»Bist du immer noch nicht darüber weg?« sagte sie.
Eifrig schlug plötzlich auch das Glöcklein der römischen Kirche.
»Es ist überhaupt keine Messe«, rief mein Vater empört, »der Pfarrer läßt die Glocke nur läuten, weil all die anderen Glocken ebenfalls läuten. Er will nicht zurückstehen.«
»Laß ihn!« sagte meine Mutter.
»Ich wollte, ich würde eine ›erneuerte‹ Glocke hören!« sagte mein Vater.
»Ach, komm«, sagte meine Mutter. »Was macht das schon? Überall dienen sie demselben Gott!«
»Ja, aber unter verschiedenen Dächern«, sagte mein Vater.
Eine fünfte Glocke ließ sich hören. Mein Vater fragte verblüfft: »Welche Kirche ist das?«
»Der Protestantenbund«, sagte meine Mutter.
»Den gibt’s hier nicht«, sagte er, »nee, und wenn es den hier gäbe, würden sie doch keine Glocke läuten. Nee, das ist ’ne andere Kirche, aber welche? Ich versteh überhaupt nichts mehr. Wer… welcher Tempel…?«
Er stand auf, schnüffelte wie ein Hund, sagte: »Ich komm einfach nicht dahinter, welche Kirche das nun sein könnte. Oder ob hier doch eine ›Erneuerte‹…«
»Diese Glocke klingt nicht ›erneuert‹«, sagte meine Mutter, »und ich wollte, daß du jetzt endlich aufhörtest, darüber zu trauern, daß du hier nichts ›Erneuertes‹ hast. Wir sind jetzt reffermiert, und die Pastoren, die sie hier haben, predigen ganz ordentlich, vor allem Pastor Dercksen, also hör auf zu quengeln.«
»Ich bin gar nicht so versessen auf die Reffermierten«, sagte mein Vater, »ich würde mich da ganz gern heimlich und still verdrücken. Was kann das nur für eine Glocke sein? Sie klingt lange nicht so grob wie das giftige reffermierte Glöckchen, es ist doch ein schöner, runder Klang, aber nicht so sumpfig wie die evangelische Glocke. Es ist verrückt, aber an diesen Glocken kann man hören, wie sie Gott dienen. Ich wollte, ich wüßte… he, da ist Vroombout, der weiß bestimmt, in welchem Tempel diese Glocke bimmelt. Mal fragen.«
Er stieg die Deichböschung hinauf. Er winkte Vroombout zu. Der Polizist winkte zurück, kurvte über den Deich, hielt an der Stelle an, wo mein Vater heraufkommen würde, wenn er weiter auf geradem Weg hochkletterte. Vroombout blieb auf seinem Fahrrad sitzen. Ein Fuß stand auf dem Deich, der andere noch auf dem Pedal. Dort saß er, hoch über uns, und es schien, als sei er die Verbindung zwischen dem riesigen Weltall und der kleinen, sonnigen, sommerlichen, nach Gras und Raps duftenden Welt, in der so viele Glocken bunt durcheinanderläuteten.
Mein Vater kam bei ihm an, und Vroombout, der auf seinem Dienstfahrrad sitzen blieb, überragte ihn weiterhin. Mein Vater wies nachdrücklich in den blauen Himmel. Vroombout schüttelte den Kopf. Mein Vater gestikulierte heftig mit beiden Armen, wies in die Luft, aus der soviel Glockengeläut auf uns niedertönte. Vroombout zuckte mit den Schultern, nahm seine Dienstmütze ab und kratzte sich am Kopf. Er setzte die Mütze wieder auf, und zugleich sagte er etwas zu meinem Vater. Die Arme meines Vaters fielen schlaff an seinem Körper herunter. Er schien auf einmal einen Buckel zu haben. Jetzt gestikulierte Vroombout; mein Vater hörte schweigend zu, nickte ab und an, schüttelte manchmal den Kopf. Vroombout stieß sich mit dem Fuß, der auf dem Deich stand, ab. Ruhig radelte er in die Richtung des Glockengeläuts davon. Mein Vater kam langsam die Deichböschung herab, gesellte sich wieder zu uns, setzte sich ins Gras, schlang die Arme um die Knie.
»Vroombout sagt, daß er heute morgen in den Nachrichten gehört habe, sie hätten da einen Waffenstillstand geschlossen«, sagte mein Vater mißmutig.
»Wo?« fragte meine Mutter.
»Da hinten in Korea«, sagte mein Vater.
»Da bin ich aber froh«, sagte meine Mutter.
»Ich nicht«, sagte er, »ich überhaupt nicht. Morgen ist das Alteisen nur noch die Hälfte von dem wert, was es letzte Woche eingebracht hat.«
Er schluckte ein paarmal. Ich blinzelte in den blauen Himmel. Die Glocken läuteten. Mein Vater murmelte: »Er wollte wieder Geld leihen.«
»So«, sagte meine Mutter.
»Was können wir da machen?« sagte mein Vater.
»Nichts«, sagte sie.
»Dieses Ekel«, sagte mein Vater.
»Viel?« fragte meine Mutter.
»Kein Pappenstiel«, sagte mein Vater.
Wütend zog er ein ganzes Grasbüschel und ein paar Stengel Sauerampfer aus dem Boden. Er sagte: »Ich würde keine Träne vergießen, wenn er ins Gras beißen würde, ich habe keine Nachsicht mehr mit ihm, wirklich nicht…«
»Ach, reg dich nicht auf«, sagte meine Mutter, »du kannst dich drehen und wenden, wie du willst, du kannst doch nichts dran tun, dir sind Hände und Füße gebunden. Ich würde einfach die Augen schließen und die Hand in den Spartopf stecken.«
»Aber wann hört das auf?«
»Es ist erst das dritte Mal«, sagte meine Mutter, »und er hat immer versprochen, daß er es zurückzahlen wird.«
»Glaubst du das?«
»Ja, warum nicht? Wenn die bewußten Leute damit überkommen…«
»Kommen sie nicht.«
»Doch, sicher, aber wenn nicht: Wir haben doch keine Wahl. Wenn er den Mund aufmacht…«
»Wäre das nun so schlimm?«
»Ich denke schon, ich denke, daß wir dann hier wegmüssen, ich denke, daß wir dann vielleicht sogar…«
»Ich glaub kein Wort davon!«
»Ich denke, daß es vernünftig ist, wenn wir jetzt mal unsern Mund halten. Kleine Kinder haben große Ohren. Hast du denn wenigstens nach dieser Glocke gefragt?«
»Er wußte nicht, welche Glocke es war. Vielleicht eine von Rozenburg, sagt er.«
»Würde man die hier hören können?«
»Vielleicht, bei Südwind.«
»Es ist kein Südwind, wir haben Ostwind!«
»Nee, jetzt, wo du’s sagst… Er wußte es nicht, er sagte, daß er keine Ahnung hätte. Er hatte die Glocke bisher auch noch nie gehört, er sagte, es sei vielleicht die Glocke von Arnemuiden.« Mein Vater sang traurig: »… bim, bam, bim, bimbam, o trauriger Graus…«
»… versunken das Schiff mit Mann und Maus«, sang meine Mutter vergnügt.
»Und du machst immer noch deine Witze«, sagte mein Vater empört.
Ende der Leseprobe