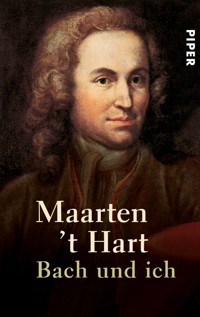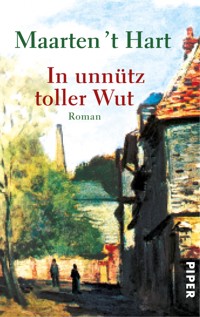8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Dame spielender Onkel, der bibelfeste Vater, der verliebte Biologe, ein Pastor auf dem Rennrad: Immer ist es Maarten 't Hart selbst, dem wir in diesen zwölf grandiosen Geschichten begegnen, die der Autor eigens für die vorliegende Ausgabe zusammengestellt hat. Seine Orte und Landschaften, die Klänge eines Konzerts, das Summen von Wespen im April – Maarten 't Harts ganzer Kosmos findet sich in diesen poetischen Stücken wieder und zeigt den Autor des Bestsellerromans »Das Wüten der ganzen Welt« als einen der großen niederländischen Geschichtenerzähler. »Man kann sich nicht losreißen – einfach weil Maarten 't Hart ein hinreißender Erzähler ist.« Die Zeit
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Niederländischen von Marianne Holberg
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2004
ISBN 978-3-492-96035-9
© 2001 Maarten ’t Hart Deutschsprachige Ausgabe: © 2002 Arche Verlag AG, Zürich – Hamburg Umschlaggestaltung: Büro Hamburg, Isabel Bünermann, Friederike Franz, Charlotte Wippermann, Katharina Oesten Umschlagmotiv: Jules Breton (»The song of Lark«, 1884) Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Brachland
Die meisten Plätze sind noch nicht besetzt, als mein Vater und ich über die dunkle Wendeltreppe auf die Empore kommen. Aber Quack und Parre sind schon da; Quack sitzt in der Ecke an der Wand, und auf dem linken Ärmel seines schwarzen Anzugs sind verwischte weiße Streifen. An einem Haken in der Bank hängt sein Spazierstock. Parre thront wie ein Fürst gleich bei der wackligen Stufe am Anfang der Bank. In der Kirchenbank von Quack und Parre sind jetzt noch zwei Plätze, einer für meinen Vater neben Parre, einer für mich neben Quack. Wenn ein fremder Pastor predigt, Pastor Zelle zum Beispiel aus Den Briel, der die zehn Kilometer von seinem Haus bis zu unserer Kirche auf dem Rennrad zurücklegt, seinen Talar in Packpapier eingewickelt und mit Bindfaden an den Lenker gebunden, in kurzer Hose und offenem Sporthemd, das er auch während der Predigt unter seinem Talar anbehält, sitzen viele Menschen auf der Empore, auf den Klappstühlen im Gang und auch zwischen Quack und mir, weil ich mit meinen sieben Jahren nur wenig Platz einnehme.
Diesen Sonntag predigt unser Pastor. Ich blicke, sobald ich neben Quack sitze, zum Taufbecken. Zum Glück hängt kein Handtuch da, also keine Taufen. Auch der Abendmahlstisch ist säuberlich mit einem schwarzen Tuch abgedeckt. Ein Abendmahlsgottesdienst dauert länger als ein Predigtgottesdienst, und außerdem gehen Quack, Parre und mein Vater und alle anderen Männer und Frauen von der Empore nach unten, wenn Brot und Wein gereicht werden, so daß ich allein zurückbleibe und Angst habe, die Empore könnte einstürzen. Ich bin immer froh, wenn sie laut polternd die Wendeltreppe wieder heraufkommen.
Jetzt sitze ich neben dem schweigenden Quack. Mein Vater redet mit Parre. »Leusing ist gestorben«, sagt er, »das ist was! Ein Herzanfall. Einfach so tot.«
»Leusing? Dieser Alte aus der Sandelijnstraat?«
»Nein, sein Sohn. Der Alte lebt noch.«
»Sein Sohn? Aus dem Trödelladen in der Hoekerdwarsstraat? Der mit einer Frau von den Inseln verheiratet war, so ’ner Schwarzhaarigen?«
»Ja, den mein ich.«
»Wie alt ist er geworden?«
»Vierundfünfzig.«
»Zwanzig Jahre jünger als ich, und schon vor Gottes Angesicht. Na, er hat Gott und sein Gebot mit Füßen getreten, er hat gesoffen, er hat gehurt, er wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Er taugte nichts, ich weiß noch, daß er mit achtzehn Jahren was mit der Frau von Lagrauw angefangen hat. Damals war ich Kirchenältester, und ich habe …«
»Bitvoorn ist auch tot.«
»Aus der Aagtenstraat. So, so, auch tot, großes Aufräumen mit diesem Gesindel, er war …«
Die Kirchenältesten kommen über den verschlissenen Teppich im Mittelgang zwischen den Kirchenbänken hereinmarschiert. Hinter ihnen schlurft der Pastor, der seinen Talar etwas anhebt. Er bleibt an der Treppe zur Kanzel stehen, er betet lange, steigt dann hinauf, und seine Stimme tönt durch die Kirche: »Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, Amen. Wir singen Lied Nr. 138, Strophe 1.«
Ich singe nicht. Ich starre die Hände des alten Quack an, der sein Gesangbuch aufgeschlagen hat und zitternd, ohne Melodie, die Worte hervorbringt: »Lobsingen will ich dir, o Herr, und beugen mich, denn du, o Herr, mir ja verheißt den Weg zum ew’gen Paradeis, zu deinem Palast im Garten der Gärten.«
Die Hände sind krumm. Auf dem Handrücken sind dicke blaue Adern zu sehen. Die Finger zittern. Quack ist alt, älter als Parre. Mein Vater hat mir erzählt, daß Quack ein schlechter Mensch gewesen ist, er ist zur See gefahren, er hat den Herrn nicht gefürchtet, aber jetzt ist er bekehrt und sitzt zweimal jeden Sonntag an der weißen Wand, und die struppigen grauen Haare seines Schnurrbarts bewegen sich, wenn er singt. Niemals spricht Quack mit Parre und meinem Vater über den Tod anderer Leute: Er sitzt nur da, schweigend und vor sich hin murmelnd und mit seinen krummen, faltigen Händen in dem schwarzen Gesangbuch mit den gelben Seiten blätternd. Mit denselben Händen wird er mir gleich, wenn die Predigt beginnt, ein Pfefferminzbonbon geben, wie er es immer getan hat, und dann werde ich, zusammen mit den drei Pfefferminzbonbons, die ich von meiner Mutter bekommen habe, insgesamt vier Pfefferminzbonbons haben, um die Predigt durchzuhalten. Eine Predigt dauert ungefähr sechs Pfefferminzbonbons Lutschzeit. Wenn ich vier aufgelutscht habe, dauert es zum Glück nicht mehr so lange. Die drei Pfefferminzbonbons brennen schon jetzt in meiner Hosentasche neben dem Geld für die Kollekte, aber ein Pfefferminz nehmen, bevor die Predigt beginnt, ist Sünde, und Gott sieht alles.
Während der Pastor die Zehn Gebote verliest, denke ich an den Vers aus dem Gesangbuch. »Lobsingen will ich dir, o Herr, und beugen mich, denn du, o Herr, mir ja verheißt den Weg zum ew’gen Paradeis, zu deinem Palast im Garten der Gärten.« Ich sehe einen vereisten Weg vor mir, eine riesige Eisfläche, einen gefrorenen See, größer als das Bommeer, auf dem ich in diesem Winter Schlittschuhlaufen gelernt habe. In der Ferne liegt der Palast im Garten der Gärten. Ich beuge mich und laufe über das Eis. Es muß starker Gegenwind sein. Schlittschuhlaufen in Richtung Palast. Zu welchem Palast? Gottes Palast, dem Himmel. Also das geschieht, wenn man stirbt, man läuft Schlittschuh über einen großen See, zum Palast, zum Himmel. Aber weshalb ein Garten? Eden, das Paradies, war auch ein Garten. Und weshalb muß man auf Schlittschuhen über das Eis zu Gott laufen, weshalb kann man nicht im Sommer in einem Segelboot über den See fahren? Nein: Im Winter ist es besser, man hat Gegenwind, und dann würde man mit einem Segelboot nicht weit kommen. Also deshalb sind tote Menschen so kalt, es ist Winter, wenn sie sterben. Aber weshalb hat man Gegenwind?
Während ich über den Gegenwind nachdenke, wird der Klingelbeutel herumgereicht. Mein Vater gibt mir den schwarzen Beutel mit den gedruckten goldenen Buchstaben, ich werfe das Geld in den Beutel, der alte Quack übernimmt den Beutel von mir. Sogar sein Arm zittert jetzt, und er läßt den Beutel aus den Händen fallen. Ohne viel Lärm fällt der Beutel auf den Boden. Ich rutsche zwischen den Bänken nach unten und suche in der staubigen, dunklen Tiefe unter den Bänken nach dem Beutel, bringe ihn nach oben und gebe ihn meinem Vater, der ihn an die Leute in der Bank vor uns weiterreicht. Nach der Kollekte singen wir wieder aus dem Gesangbuch, und ich behalte nur das Wort »Gottesfrucht«. Nochmals sehe ich das Eis und den Garten des Palastes vor mir, in dem jetzt Bäume mit Gottesfrüchten wachsen. Die Früchte sind gelb, hellgelb wie Zitronen, aber größer. Sind es Äpfel? Ich weiß es nicht. Kann es Früchte im Winter geben? Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Es bereitet mir ein Gefühl der Befriedigung, weil ich das nun auch weiß: In dem Garten stehen Bäume mit Gottesfrüchten, die Zweige und Blätter bewegen sich heftig hin und her im Gegenwind.
Die Predigt beginnt. Ich warte auf das Pfefferminz von Quack, das kommt, sobald der Pastor sagen wird: »Geliebte, im Herrn versammelte Gemeinde.«
Quack sitzt in der Ecke, die Augen geschlossen. Er blickt diesmal nicht auf, als der Pastor mit seiner Predigt beginnt. Ist Quack mir etwa böse? Schämt er sich? Ist er böse, weil ich den Kollektenbeutel aufgehoben habe, den er hat fallen lassen? Weshalb gibt er mir das Pfefferminz nicht? Ich halte es nicht ohne dieses Pfefferminz aus, die Predigt dauert so lange, und wenn man nur drei hat, muß man die halbe Zeit ohne Pfefferminz auf den Schluß der Predigt warten, auf das erlösende Amen, und man weiß dann nicht, wie weit der Pastor ist, noch vor oder schon nach dem vierten Pfefferminzbonbon. Aber ich bekomme es nicht. Ich bin traurig, weil ich es nicht bekomme. Immer gibt Quack mir ein Pfefferminz, doch jetzt nicht. Warum nicht? Ich nehme das erste aus meinem eigenen Vorrat, ich lutsche geduldig und zähle die Orgelpfeifen. Ich weiß genau, wie viele Pfeifen es sind, ich habe sie schon so oft gezählt. Dennoch zähle ich sie jeden Sonntag wieder, um die Langeweile zu vertreiben, ich zähle auch die Buchstaben auf der Tafel über der Kanzel mit dem vornehmsten Gebot unseres Herrn aus dem Matthäus-Evangelium; ich zähle die kleinen, bleigefaßten Scheiben, aus denen ein Kirchenfenster zusammengesetzt ist; ich zähle die Lampen in der Kirche. Als ich das alles zweimal gezählt habe, bin ich müde. Ich habe mein erstes Pfefferminz aufgelutscht. Es dauert noch so lange! Ich schaue den Fliegen zu, die in der Kirche herumsummen und sich manchmal auf die glänzenden, kahlen Schädel der Kirchenältesten setzen. Manchmal höre ich den Worten des Pastors zu. Ich habe gut aufgepaßt, über welchen Text er predigt, mein Vater wird nach dem Gottesdienst danach fragen. Ein Text aus Jeremia. »Brecht, ihr Leute, brecht ein Brachland und säet nicht unter die Dornen.« Was ist das: ein Land brechen? Brechen ist ein anderes Wort dafür, wenn man sich übergeben muß, das weiß ich, aber Brachland, warum nicht Brechland, und wie soll ich mir das vorstellen? Ist es eine Grasfläche, worauf Menschen gebrochen haben?
Mein Vater tippt mir ungeduldig auf den Rücken.
»Zuhören«, sagt er, »nicht dösen.«
»Ja, Vater«, flüstere ich.
»Sind noch heilsbegierige Menschen unter uns«, sagt der Pastor, »so lautet für sie des Herren Wort an diesem Morgen: ›Brecht, ihr Leute, brecht ein Brachland‹, das ist ein Aufruf zur Umkehr, zur Bekehrung, das Brachland, aus dem ein Garten aufblühen wird, wie das Paradies, worin Adam mit Gott wandelte, ein Garten, in dem wir wandeln werden, der neue Himmel und die neue Erde, die ihr, Brüder und Schwestern, bewohnen werdet, wenn ihr euch bekehrt. Brecht, brecht ein Brachland für Gott, macht einen neuen Anfang. Umkehr: Das ist das Wort Gottes, welches Gott in seinem unendlichen Erbarmen an diesem Morgen hören läßt, ›brecht, ihr Leute, ein Brachland und säet nicht‹ …«
Ich höre nicht mehr zu. Ich versuche, es zu verstehen. Ein Brachland für Gott, aus dem ein Garten erblüht, der neue Himmel. Wieder sehe ich das Eis vor mir, in der Ferne ist der Palast mit dem Garten Eden. Muß das zuerst ein erbrochenes Land sein? Weshalb? Ich verstehe es nicht. Erbrochenes gefriert, wenn es Winter ist. Auf dem See ist es kalt, der Gegenwind heult einem um die Ohren, man beugt sich zum Eis hinunter, zu deinem Palast. Oder ist es in dem Garten vielleicht gar nicht Winter? Dort blühen Gottesfrüchte, und man sagt, daß im Himmel der große Sommer beginnt. Ich will dem Pastor zuhören, aber ich kann die Worte kaum verstehen, sie hallen durch die Kirche, der Pastor wischt sich mit einem weißen Taschentuch die Tränen aus den Augen. Ich nehme das nächste Pfefferminz, ich blicke zu Quack. Vielleicht sieht er es und wird sich an sein Versäumnis erinnern. Aber der alte Mann hält noch immer die Augen geschlossen, die Wangen sind blaßrot. Plötzlich seufzt Quack, er rutscht etwas an der Wand entlang, er scheint sich zu krümmen. Der Mund öffnet sich. Kleine Speichelblasen entstehen auf den Lippen und verschwinden im Schnurrbart. Manchmal platzen die Bläschen, aber ohne Geräusch. Die Augenlider zittern. Jetzt seufzt Quack. »Was ist mit Quack?« fragt Parre leise meinen Vater.
Der alte Mann wird plötzlich blau im Gesicht, die Adern auf seinen Händen schwellen an. Mit diesen Händen zerrt Quack am Gesangbuch vor ihm auf der Bank. Er zerreißt ein paar Seiten, das Geräusch hört man auf der ganzen Empore. Andere Kirchgänger blicken sich um, und als das Seufzen in lautes Schnarchen übergeht, das wild aufklingt, stehen die Menschen in ihren Bänken auf, um besser sehen zu können. Sogar der Pastor hört auf zu predigen, er sagt: »Ob der Bruder auf der Empore vielleicht geweckt werden könnte?«
Mein Vater stößt Quack heftig an. Der alte Mann schnellt bei der Berührung hoch, schlägt vornüber auf die Bank und rutscht gleich darauf nach unten. Mein Vater schiebt mich an sich vorbei zu Parre hinüber, er sitzt jetzt neben Quack und zieht ihn hoch. Der alte Mann ist blaßblau. In den Mundwinkeln klebt Erbrochenes. Er schnarcht nicht mehr. Mein Vater steht auf und stellt sich aufrecht in die Bank, er ruft: »Ist ein Arzt in der Kirche?«
»Ja«, klingt eine Stimme von unten.
»Kommen Sie bitte nach oben.«
Mein Vater schiebt mich aus der Bank. Gemeinsam mit Parre zieht er den alten Quack über die Kirchenbank, und sie legen den Mann vorsichtig im Gang hin. Der Arzt und der Küster erscheinen im Treppenaufgang, der Arzt läuft hastig zu Quack, er zieht ein Augenlid hoch. »Es ist vorbei«, sagt er. Der Küster und der Arzt tragen Quack fort.
»Ein schöner Tod so in der Kirche«, sagt Parre.
»Ja, mögen wir auch so vor dem Angesicht Gottes erscheinen, weggerufen aus seinem heiligen Haus«, sagt mein Vater.
»Gibt es etwas Schöneres?« sagt Parre.
»Nein«, sagt mein Vater.
Ich sitze da, jetzt in der Ecke auf Quacks Platz. Wo mochte Quack jetzt sein? Er läuft Schlittschuh, er beugt sich über das Eis. Aber ein alter Mann kann doch gar nicht Schlittschuh laufen. Er brauchte einen Stock zum Gehen. Der Stock hängt noch an dem Haken in der Kirchenbank. Und dann Schlittschuh laufen? Und dieser Gegenwind! Wie lange wird er dazu brauchen? Vielleicht darf man auch zu Fuß über das Eis gehen. Aber das dauert länger, und dann wird man sehr kalt. Und natürlich ist es dunkel, es ist Nacht. Und man hat nichts für unterwegs. Vielleicht könnte man die Gottesfrüchte essen. Aber die Bäume sind so weit entfernt. Und bevor man beim Palast ist, muß man erst ein Brachland machen. Ein Brachland! Quack hatte sich ein bißchen übergeben. Und er war blau vor Kälte. Wo mochte er jetzt sein? Ob er wohl genug Erbrochenes hatte für das Brachland? Er hatte nur wenig erbrochen. Weshalb sterben Menschen, wenn sie alt sind, sie können dann doch nicht mehr Schlittschuh laufen. Und doch müssen sie das, »… und beugen mich, denn du, o Herr, mir ja verheißt den Weg zum ew’gen Paradeis, zu deinem Palast im Garten der Gärten«. Ich sehe ihn in der dunklen Nacht über das Eis gehen. Aus dem Palast strahlt Licht durch die Fenster nach draußen. Aber der alte Mann ist so allein, und er friert so. Vielleicht fällt er in ein Eisloch. Er hat auch nichts zu essen für unterwegs. Nichts zu essen? Plötzlich flüstere ich der weißen Wand leise zu: »Er hat das Pfefferminz noch für unterwegs. Doch gut, daß er es mir nicht gegeben hat!«
Das Tal Hinnoms
Erst am Abend vorher erfuhr ich, daß ich nach Zonnemaire mitdurfte. Ich konnte fast nicht schlafen. Weinend winkten meine Schwester und mein Bruder uns nach. Sie würden der kratzigen Haarbürste von Tante Riek ausgeliefert sein, die gekommen war, um auf sie aufzupassen. Bei De Molen stiegen wir in den Bus, der schon um halb sechs aus Maasland losgefahren war. Ganz vorn saßen mein Großvater und meine Großmutter. Dahinter, dem Alter nach, die sechs Brüder meiner Mutter mit ihren vier Ehefrauen und die beiden Schwestern meiner Mutter mit ihren Verlobten. Ich wunderte mich, daß Onkel Bert, der Bräutigam, unscheinbar neben meinem Onkel Cor saß. Mir schien, er hätte Anrecht auf einen festlich geschmückten Platz ganz vorn gehabt. Wer war nur auf die Idee gekommen, einen, der jetzt heiraten würde, neben einen zu setzen, der sich seit Jahren heftig danach sehnte zu heiraten, aber nie eine Frau hatte finden können?
Bis zum Maastunnel herrschte Grabesstille im Bus. Jeder war noch damit beschäftigt, wach zu werden. Erst als wir durch Ijsselmonde fuhren, wurden die ersten Worte gewechselt. Erst da bat mein Großvater mit seiner dunklen, vollen, tiefen Stimme um Ruhe.
»Kinder«, sagte er, »wir fahren nach Zonnemaire, um dort die Hochzeit von Bert und Bep zu feiern. Ihr wißt, daß Beps Familie nicht sehr glücklich ist mit ihrer Wahl. Ist nun mal ein anderer Menschenschlag, die und wir. Und so denken die da in Zonnemaire, daß man uns einfach wegpusten kann wie ein Zwerghuhnfederchen. Müssen wir also zeigen, daß wir dem Herrn genauso demütig dienen wie sie.«
»Wie wollt Ihr das zeigen, Vater Arie?« fragte mein Vater.
»Auf zwei Arten«, sagte der, »erstens, indem wir alle so ernsthaft wie nur möglich gucken. Zweitens, indem wir unterwegs die Psalmen auswendig lernen, die wir beim Traugottesdienst singen müssen. Paßt mal auf, die singen da noch die gereimten Psalmen aus dem Datheen. Es wird einen enormen Eindruck auf sie machen, wenn wir Datheen aus dem Kopf mitsingen können. Also los, kommt, ich hab auf dem Speicher noch ein uraltes Gesangbuch gefunden und …«
»Woher wißt Ihr denn, was wir singen werden?«
»Ja, ich hab da so meine Spione in Zonnemaire. Wir werden mit Nr. 68, Vers 1 anfangen, und der heißt in den gereimten Versen bei Datheen:
Steh auf, Herr, und sei unverzagt,
Dann werden verstreut und auch verjagt
Rasch alle deine Feinde.«
Bis zur Fähre nach Oud-Beierland übten wir Nr. 68, den ersten Vers. Als wir die letzten drei Zeilen auswendig lernten:
Gleich wie das Wachs vor dem Feuer vergeht,
Wird jeder Gottlose, der hier steht,
von unserem Herrn verzehret werden,
sagte Onkel Joris: »Damit sind garantiert wir gemeint.«
»Teufel noch mal«, sagte mein Vater, »ja, natürlich.«
»Und wenn schon«, sagte mein Großvater, »habt ihr wenigstens Grund, ernsthaft zu gucken. Ihr guckt alle noch viel zu fröhlich, nimm das Lachen mal aus deinem Gesicht, Cor.«
»Ich hab überhaupt kein Lachen auf meinem Gesicht, im Gegenteil, ich bin todtraurig. Bert heiratet, nicht ich!«
»Du wirst sehen«, sagte mein Vater, »wir treiben da schon noch ein Honigfrauchen für dich auf. Nur daß wir dann wieder mit dem Bus nach Zonnemaire müssen. Läßt sich denn nicht näher bei uns was finden?«
»Ich wüßte genug«, sagte Cor, »aber sie wollen mich nicht, und dabei gibt es viele, die schlechter aussehen als ich und doch verheiratet sind.«
»Andererseits hab ich viele Leichen begraben, die blühender ausgesehen haben als du«, sagte mein Vater, »aber du wirst sehen, da in Zonnemaire … Bert hat es da auch geschafft, also warum du nicht? Und was du dir von weit her holst, ist appetitlich, nicht wahr, Bert?«
»Pau«, sagte mein Großvater, »hör auf damit. Laßt uns noch ein letztes Mal Nr. 68 üben. Und nun viel, aber auch viel langsamer, und das letzte Wort von jeder Zeile aushalten. Los, kommt.«
Unendlich langsam sangen wir »Steh auf, Herr, und sei unverzagt«. Es schien geradezu, als würde auch der Bus langsamer fahren.
Ich betrachtete die leere, festliche Welt draußen, die Pappeln, die den Horizont begrenzten, die grünen Äcker, die Haufenwolken, die den weiten Himmel schmückten. An einer Wegbiegung hing ein Turmfalke in der Luft, und Onkel Joris flüsterte zwischen zwei Psalmenzeilen: »Siehst du den Falken da?«
»Ja«, sagte ich.
»Sieh mal ganz genau das Gras darunter an«, sagte er. »Bewegt es sich?«
»Ein bißchen«, sagte ich.
»Das kommt, weil da zwei Feldmäuse sitzen«, sagte er, »und weißt du, was die eine Feldmaus zur andern sagt? Piet, da hängt einer genau über unserm Kopf und spricht sein Tischgebet, los, komm, nichts wie weg.«
»Aufgepaßt«, rief mein Großvater, »das zweite Lied, das wir singen …«
Bevor wir jedoch mit Psalm 188, Vers 11 beginnen konnten, erreichten wir unterhalb von Numansdorp die Autofähre nach Zijpe. Als wir ausstiegen, regnete es noch immer.
»Hättest du nicht zu deiner Hochzeit für besseres Wetter sorgen können?« fragte Onkel Joris Onkel Bert.
»Es ist noch keine zehn, und Regen vor zehn Uhr am Morgen bringt nicht Kummer und nicht Sorgen«, sagte Onkel Bert, »es klart schon noch auf.«
»Man kann die andere Seite fast nicht sehen«, sagte ich aufgeregt.
»Auf die Seite da drüben wollen wir gar nicht«, sagte Onkel Joris. »Das ist Goeree-Overflakkee. Wir wollen nach Schouwen-Duiveland.«
Wir fuhren. Es war, als würde das nie aufhören. Die Sonne hatte Zeit genug durchzubrechen. Links und rechts von uns waren Ufer, aber dorthin steuerten wir nicht, wir fuhren zwischen durch. Meine Mutter begann zu singen: »Schifflein unter Jesu Schutz.«
Mein Großvater rannte zu ihr. »Halt!« rief er. »Das ist kein Psalm, wenn die das in Zonnemaire hören, können wir die Hochzeit vergessen. Das nennen sie ein Hurenlied.«
»Oh«, sagte sie betreten.
»Wir können gar nicht vorsichtig genug sein«, sagte er.
Wir fuhren und fuhren, über das Volkerak, das genauso aussah wie der Nieuwe Waterweg. Nur war der Horizont weiter entfernt, der Horizont mit den schrägstehenden Pappeln, an denen Vogelschwärme entlangzogen. Onkel Cor stand an der Reling und starrte verbittert hinüber zu dem fernen Ufer.
Ich hörte Tante Aagt sagen: »Ja, Cor, du kannst dir nicht alles genau zurechtschneidern.«
»Warum er, und warum nicht ich?«
»Er muß dafür aber nach Zonnemaire.«
»Als wenn es mir das nicht wert wäre.«
»Sag ich doch gar nicht.«
»Ich würde so furchtbar gern …«, sagte Onkel Cor.
»Ja«, sagte mein Vater. »Jeder will nun mal der Deckel sein, der auf den Topf paßt.«
Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so lange mit dem Schiff gefahren, dachte ich, nein, noch nie, und ich hörte das eigenartige Tuckern des Motors, ein Geräusch, das sich über das Volkerak verlor, bevor man es richtig in sich aufgenommen hatte. Wenn man die Augen halb schloß, schien es, als führe das Land und wir lägen still. Alles, was geredet wurde, klang so flüchtig, und es schien, als kämen die Worte aus dem Dunst, der über dem Wasser hing. Onkel Cor sagte leise: »So was Besonderes ist die übrigens nicht, diese Bep aus Zonnemaire.«
»Nein«, sagte mein Vater, »womit du recht hast. Mit so einer unter die Decke zu kriechen, na, ich würde lieber in einem vollen Aschkasten schlafen, aber du weißt ja: Liebe und Husten, dagegen kämpft man vergebens. Wir hatten in der Leeuwenwoning ein Schaf, das ganz verrückt nach einer Kuh war. Wo diese Kuh auch graste, da war das Schaf. Ob die Kuh das Schaf liebte, weiß ich nicht, aber wenn es regnete, durfte das Schaf unter der Kuh stehen. Es paßte genau darunter. Als wir die Kuh zum Schlachthof brachten, ist das Schaf vor Kummer gestorben, also, ich will nur sagen …«
»Ja, aber du kannst dir nicht alles genau zurechtschneidern«, sagte Tante Aagt hartnäckig.
»Nein, das ist wahr«, sagte mein Vater, »aber es wäre doch zu verrückt, wenn Cor nicht auch seinen Stall finden würde.«
»Meinst du?« fragte Cor hoffnungsvoll.
»Die besten Schiffe bleiben nun mal am längsten an Land«, sagte mein Vater.
»Sie hat irgendwie etwas Hochnäsiges, diese Bep«, sagte Onkel Cor.
»Ja«, sagte mein Vater, »sie trägt die Nase hoch, als ob sie Psalm 115 dichten könnte.«
Jedesmal wenn es so aussah, als würden wir uns dem Ufer nähern, machte die Fähre wieder eine Wendung. Bei jeder plötzlichen Drehung des Schiffes war es, als könne man das Wasser besser riechen. Solange wir fuhren, behielt ich diesen herrlichen Salzgeruch in der Nase. Da begann das Ufer zurückzuweichen, wir überquerten auf einmal das breite Wasser und sahen das andere Ufer näher kommen. Dennoch dauerte es noch lange, bevor wir in Zijpe anlegten.
Psalmen singend, fuhren wir durch Schouwen-Duiveland. Wir kamen durch Sirjansland, das mir kleiner vorkam als sein Name. In Dreischor blieben wir kurz stehen – niemand wußte, weshalb. Der Busfahrer schlug sich die Hände vors Gesicht, startete den Bus dann wieder und fuhr dreimal im Kreis ums Dorf, rund um die Kirche. War es eine Beschwörung? Kam er aus Dreischor? Niemand fragte nach, und wir wagten uns aufs neue in den flachen, unendlichen Raum, über dem sogar Haufenwolken klein aussahen. Auf den Feldern blühten lila die Kartoffeln, und niemand war zu sehen. Zonnemaire schien aus Häuschen zu bestehen, die, genau wie auf Rozenburg, mit dem Deich verwachsen waren. Onkel Bert lief nach vorn, gab dem Chauffeur Anweisungen.
»Oh, Oud-Bommede«, hörte ich den Fahrer sagen.
»Ja«, sagte Onkel Bert.
Wir hatten Zonnemaire schon wieder hinter uns gelassen. Plötzlich schien das Ziel erreicht zu sein. Wohlgeordnet stiegen wir aus und blickten dabei so ernsthaft wie möglich. Gleich neben dem Bus stand eine festlich geschmückte Kutsche, vor die allerdings keine Pferde gespannt waren. Schweigend drückte mein Großvater dem Vater der Braut die Hand. Auf einmal war der ganze Hof voller Menschen, es war, als könnte ich zwischen all den unbekannten Leuten und den Gemüsekisten und den Frauen in Kittelschürzen, die Kaffee ausschenkten, ganz einfach verlorengehen. Hastig lief ich zu meinem Vater.
»Ich seh schon was für dich«, sagte er gerade zu Onkel Cor.
»Wo denn?« fragte Cor hoffnungsvoll.
»Da, bei der Linde.«
»Ein bißchen mager.«
»Was macht das schon. Wenn sie nur zwei Hände hat.«
»Sie ist bestimmt schon verheiratet.«
»Die? Wer sollte die denn haben wollen? So einen Fahrradständer.«
»Na, siehst du.«
»Du kannst nicht wählerisch sein, nimm nur, was dir vor die Nase kommt, mit etwas gutem Willen klappt es heute nachmittag schon. Aus ’ner Hochzeit kommt ’ne Hochzeit.«
Es war, als sollten wir dort auf dem Hof zwischen säuberlich aufgestapelten Kisten alle miteinander stehenbleiben, und nach ein paar Stunden würden Onkel Bert und Tante Bep dann verheiratet sein, und wir würden wieder abreisen können. Mißtrauisch starrten all die Brüder und Schwestern von Tante Bep die Brüder und Schwestern von Onkel Bert an. Und die ganze Zeit liefen die Väter von Braut und Bräutigam in eifrigem Gespräch zwischen den Linden hin und her.
»Es sieht aus, als könnten sie sich noch nicht einigen«, sagte mein Vater.
Ein Scheunentor schwang auf. Drinnen waren Bretter über Gemüsekisten gelegt. Irgendwo in einer Ecke spielte jemand auf einem alten Harmonium die Melodie von Psalm 68.
»Herrschaften, der Traugottesdienst beginnt.«
In einer Scheune, dachte ich erstaunt. Gehen wir nicht erst zum Rathaus und dann zur Kirche?
Als wir alle auf den Brettern saßen, hatte sich die Scheune plötzlich in ein Rathaus verwandelt. Onkel Bert und Tante Bep waren schon gesetzlich verheiratet, bevor ich richtig begriff, daß die Zeremonie, auf die ich wartete, vorbei war. Und wieder erklang Psalm 68 auf dem Harmonium. Ein Mann in schwarzer Jacke mit Rockschößen tauchte hinter dem Tomatensortierer auf. Neben einem durch Gemüsekisten erhöhten Platz betete er lange. Dann stellte er sich obendrauf. Und vor den erstaunten Augen und besonders Ohren aller Einheimischen sangen wir aus dem Kopf: »Steh auf, Herr, und sei unverzagt.« Bald zeigte sich, daß sie dort wahrhaftig schneller sangen als wir. Wir hielten unser Bustempo, zwangen das Harmonium zur Langsamkeit, hielten jedes letzte Wort einer jeden Zeile unendlich lange aus. Das Scheunenholz begann schon zu knacken. Meinen Vater konnte man klar und deutlich heraushören, und bei dem Wort »werden« konnte er kein Ende finden. Am Schluß war er der einzige, der noch sang, der das eine Wort noch aushielt, und der Pastor sah ihn strafend an, aber »den« tönte und tönte, bis sogar mein Großvater fand, es sei genug, und meinen Vater anstieß. Beim zweiten Psalm hatten die von Zonnemaire sich schon angepaßt und hielten auch das letzte Wort einer jeden Zeile ewig lange aus. Es war wie ein Zweikampf. Besonders komisch war es, daß der Tomatensortierer bei einigen hohen Tönen merkwürdig zu piepsen anfing. Zuerst hatte ich es noch nicht begriffen, daß das Geräusch von dem Sortierer stammte, aber bei Psalm 118 sah man ganz kurz ein Zittern durch den Apparat gehen. Nach dem Eheversprechen folgte die Predigt über Jeremia 3, Vers 14: »Bekehret euch, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr; denn ich habe euch vertraut, und ich will euch nehmen, je einen aus jeder Stadt und je zwei aus jedem Geschlecht, und euch nach Zion heimbringen.« Es war eine gewaltige Predigt. Nach anderthalb Stunden, nachdem der Pastor uns viele Male zugerufen hatte: »Kehret euch zu dem, der euch schlägt«, schien das erlösende Wort »Amen« in Sicht zu sein. »Einst, Geliebte, wird der Tag kommen, der Tag des großen, ewigen Hochzeitsfests, der Tag, an dem er seine Auserwählten mit seinem Geist betauen wird. Einmal, Geliebte, wird dieser Tag kommen, der Tag des echten Hochzeitsfests. Ob für das ewige Fest an jenem Tag wohl noch einige von Boas Acker aufgelesen werden können? Ob an dem Tag wohl einer noch Josefs Scheunen zugefügt werden kann? Ach, welch unverdiente Gnade wäre das.« Der Pastor schlug mit der Faust auf die Gemüsekiste, die als Kanzel diente. Ein Zittern ging durch den Tomatensortierer. »Aber wißt, Gemeinde, daß die, welche die Leblosigkeit des Menschen leugnen und ihm einen freien Willen zuerkennen, nie die ewigen Küsten erreichen werden. Wißt, Gemeinde, daß das ewige Wunder der unbegrenzten freien Gnade nur einem aus der Stadt und zwei aus einem Geschlecht zuteil wird. Oh, wer von uns wird dort beim ewigen Mahl sitzen? Wer von uns? Einer aus der Stadt, zwei aus einem Geschlecht, sagt die Heilige Schrift. Wer wird das sein, dieser einzige aus der Stadt? Wird das jener schüchterne kleine Junge sein, der sich dort hinter dem Bruder mit der kräftigen Lunge versteckt?«
Mein Gesicht brannte wie Feuer. Meine Ohren wurden röter als irgendeine Tomate, die jemals diese Scheune auf dem Weg über den Sortierer verlassen hatte.
»Du Glückspilz«, flüsterte mein Vater.
»Und die zwei aus einem Geschlecht, wer von uns wird das sein?« Lange blickte der Pastor die Familie der Braut an. Dann sagte er: »Kehret euch zu dem, der euch schlägt, Geliebte. Wollen wir noch Schüler der Heimsuchung sein? Liegt euer Anker fest, Geliebte? Einer aus der Stadt, zwei aus einem Geschlecht, sie werden im himmlischen Jerusalem bis in alle Ewigkeit beim Mahle des Herrn von den Raben gespeist werden, Amen.«
»Ein Mordspastor«, flüsterte mein Vater Onkel Joris bewundernd zu.
»Ein Laienprediger«, sagte Onkel Joris.
»Wie heißt er eigentlich?«
»Pastor Aangeenbrug.«
»Ich wünschte, den hätten wir in Maassluis. Der predigt dich nicht einfach in den Himmel rein, nein, an dem hast du was, der stößt dich knallhart mit der Nase auf die Tatsachen, phantastisch!«
Wir sangen wieder. Mein Vater zeigte seine Hochachtung vor der Predigt, indem er das letzte Wort einer jeden Zeile beinahe eine halbe Minute aushielt. Beim Schlußgebet wiederholte Pastor Aangeenbrug seine Predigt kurz: »Ach, Herr, Herr, du, der du einen aus der Stadt und zwei aus einem Geschlecht versammelst, du, der du zwei hinzufügen und viele verstoßen wirst, wir nähern uns demütig deinem Angesicht und flehen deinen Segen herab auf dieses Brautpaar.«
Der Tomatensortierer piepste wieder. »Ach, Herr, Herr, laß uns doch teilhaben an deiner Heilstat«, flehte der Pastor. Draußen sang eine Lerche, wir beteten, wir beteten lange, ich sah grüne und rote Flecken vor meinen Augen, sah die Ufer, an denen wir entlanggefahren waren, sah Haufenwolken über all den schrägstehenden Pappeln.
Dann, nachdem die Gemüsekisten im Kreis um lange Tische gestellt worden waren, folgte das Essen. Am Kopfende des Tisches saß Pastor Aangeenbrug. Er sprach ein langes Tischgebet. Wir bekamen Saubohnen, Salat, neue Kartoffeln, ein Stück Rindfleisch. Onkel Joris steckte genießerisch jede Saubohne einzeln mit der Gabel in den Mund.
»Als ob ein Englein dir auf die Zunge scheißen würde«, sagte er, »aber schade, daß soviel Sand im Salat ist.«
»Was macht das schon«, sagte mein Vater. »Sand reinigt den Magen.«
Onkel Cor saß der mageren Frau gegenüber, die mein Vater ihm empfohlen hatte. Er sagte kein Wort, und sie ebensowenig. Ihr Mund war ein schnurgerader Strich, ihr Haar streng nach hinten gekämmt. Manchmal spähte sie durch die Zinken ihrer Gabel zu Onkel Cor hinüber. Es schien, als wüßte sie, daß er noch Junggeselle war und eine Frau suchte. Als Pastor Aangeenbrug nach dem Pudding ein langes Dankgebet sprach, machte ich meine Augen ganz kurz auf. Onkel Cor hatte seine Augen auch offen und spähte zur anderen Seite hinüber. Da öffneten sich ihre Augen plötzlich ebenfalls, und sie sahen sich an, während Pastor Aangeenbrug betete: »O Herr, gieße dein Heil aus. O Geist, komme aus den vier Himmelsrichtungen und hauche deinen Odem diesen Gestorbenen ein, auf daß sie wieder leben, Amen.«
Verstört blickten wir einander nach diesem plötzlichen Amen an. Der Vater der Braut stand auf und sagte: »Wohl bekomm’s euch allen! Und dann habe ich jetzt eine große Überraschung für uns alle, die wir hier beisammen sind. Pastor Aangeenbrug hat sich bereit erklärt, Hochzeit mit euch zu feiern! Er wird heute mittag mit und für euch die Heilige Schrift auslegen. Er wird eine Einführung zu der Frage halten: Wo lag das Tal Hinnoms?«
»Das kann doch nicht wahr sein«, flüsterte mein Vater erfreut.
Die Gemüsekisten wurden wieder in Reihen aufgestellt. Pastor Aangeenbrug lehnte sich an den Tomatensortierer und sagte: »Geliebte, in der Heiligen Schrift wird das Tal Hinnoms zum erstenmal in Jeremia 7, Vers 31 genannt. Danach wird es noch einmal in Jeremia 19, Vers 6 genannt, während das Wort des Herrn, unseres Gottes, noch einmal in Jeremia 32, Vers 35 davon spricht. In jenem Tal, Geliebte, haben die Kinder Judas die Höhen Thopheths erbaut, die in Jeremia 32 ›die Baalshöhen‹ genannt werden. Worüber wir heute mittag nachdenken werden, ist: Wo lag das Tal Hinnoms, wer war Hinnom, und wer war Hinnoms Sohn? Warum sagt der Herr, daß er das Tal von Hinnoms Sohn ›Mordtal‹ nennen werde? Warum spricht die Schrift zuerst von den ›Höhen Thopheths‹ und später von den ›Baalshöhen‹? Und schließlich werden wir über die Frage nachdenken: Finden wir heutzutage noch Täler von Hinnoms Sohn?«
»Na, und ob«, sagte mein Vater.
Bin ich danach eingeschlafen? Habe ich nur geträumt, daß der Tomatensortierer jedesmal stöhnte, wenn der Pastor mit erhobener Stimme »Hinnom« rief? Habe ich auch geträumt, daß mein Vater entrüstet aufsprang, als Pastor Aangeenbrug behauptete, der Geist, der Hesekiel in Kapitel 37 in eine Ebene voller Gebeine führte, habe ihn damit in das Tal Hinnoms geleitet? Habe ich geträumt, daß es immer dunkler wurde in der Scheune? Bin ich erst aufgewacht, als der erste Donnerschlag ertönte? Habe ich da erst gesehen, daß die Brüder und Schwestern der Braut einer nach dem andern hinausschlichen? Oder war das schon früher passiert?
»Verflixt«, sagte mein Vater, »die ganze Familie von Bep ist draußen.«
»Ja, und wir sitzen hier auf dem Trocknen!« sagte Onkel Joris entrüstet.
»Komm, wir gehen auch nach draußen, es ist hier nicht mehr auszuhalten«, sagte mein Großvater.
Wir standen alle auf, während Pastor Aangeenbrug ruhig weitersprach. Als ich nach draußen huschte und mich kurz umsah, schien er mit dem Tomatensortierer zu verschmelzen.
Der Himmel war schwarz wie Tinte. In der Ferne sahen wir immer wieder Feuer aus dem Himmel herabfahren, das Feuer über den Höhen von Thopheth. Viel näher, aber unwirklich und schemenhaft, sahen wir die gebückten Gestalten aller Brüder und Schwestern der Braut. Hintereinander gingen sie zwischen den Salatpflanzen, den Bohnen und den noch kleinen Rotkohlköpfen hindurch. Immer wieder schlugen sie mit etwas, das sie in der Hand hielten, auf den Boden.
»Sie schlagen Schnecken«, sagte mein Vater.
»Ja, die kommen bei diesem Wetter zum Vorschein«, sagte Onkel Joris, »ich kann gut verstehen, daß sie alle heimlich aus der Scheune gegangen sind. Bei diesem Wetter mußt du Schnecken schlagen. Kommt mit, laßt uns helfen.«
Langsam ging ich zum Vater der Braut. Die Augen starr auf den Boden gerichtet, schob er sich zwischen den Bohnen hindurch. Immer wieder schlug er mit einem kleinen Beil eine große braune Nacktschnecke in zwei Teile. Sobald er die Schnecke durchgehackt hatte, war es, als liefe diese aus. Ich sah gelb und grün gestreifte Fäden ordentlich aus der Schnecke zum Vorschein kommen. Es hätten dünne Elektrokabel sein können. Noch bevor er am Ende des Pfads zwischen den Bohnen angekommen war, gesellte sich mein Großvater zu ihm.
»Soweit ich sehe«, sagte er, »hast du jetzt noch eine letzte unverheiratete Tochter im Haus.«
»Ja, Pie«, brummte der Vater der Braut, während er wieder eine riesige Schnecke zerteilte.
»Nicht viel dran, mal so unter Männern«, sagte mein Großvater.
»Nein? Ach, ist aber sonst ein prima Mädchen.«
»Glaub ich gern, aber … bleibt doch ’ne Last …«
»Von wegen, sie kann alles, sieh mal, sie schlägt zwei Schnecken, und dein Filius nur eine einzige.«
»Na, aber ich denk, daß du es doch ganz gern sehen würdest, wenn für sie auch ein Freier auftauchen würde. Glaub mir, ich weiß, wie das ist, ein Kind im Haus zu haben, das längst verheiratet sein könnte, ich hab auch noch einen Sohn im Haus … Ja, es wird einem nichts geschenkt, aber …«
»Einen Sohn im Haus? Dieses Gerippe, das am Tisch Pie gegenüber …«
»Gerippe? So einen wie den mußt du mit der Laterne suchen! Der hat keine zwei linken Hände.«
»Woran hast du denn so gedacht?«
»Du hast so einen phantastischen Tomatensortierer in der Scheune stehen, wo ihr hier gar keine Verwendung dafür habt, denn ihr baut ja keine Tomaten an.«
»Es ist ein Erbstück.«
»Willst du ihn loswerden?«
»Oh, das schon.«
»Das heißt also, wenn ich meinen Sohn …«
»Wird der Pie haben wollen?«
»Der hat nichts zu wollen.«
»Wenn du das hinkriegst, bin ich mit von der Partie.«
Ende der Leseprobe