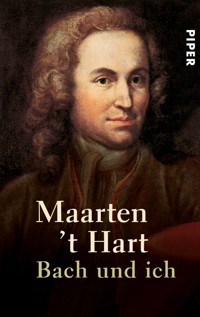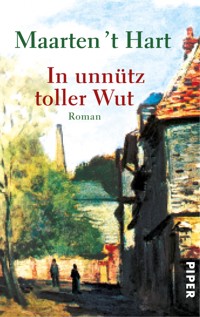9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Leonie Kuyper führt ein ganz und gar unspektakuläres Leben – bis ihre beste Freundin Roos, die Laborantin mit den superlangen Fingernägeln, plötzlich stirbt. Als Leonie ihrem Tod genauer nachgeht, stößt sie auf verwirrende Geheimnisse in Roos' Leben. Ein hinreißendes Krimistück, in dem 't Hart auch eine komödiantische Seite zeigt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Niederländischen von Marianne Holberg
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
11. Auflage 2011
ISBN 978-3-492-96036-6
© 2002 Maarten ’t Hart Titel der niederländischen Originalausgabe: »De zonnewijzer«, B.V. Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam 2002 Deutschsprachige Ausgabe: © 2005 Piper Verlag GmbH, München Erstausgabe: Arche Verlag AG, Zürich – Hamburg 2003 Umschlaggestaltung: semper smile, München Umschlagmotiv: Alfredo Dagli Orti / The Art Archives / Corbis (Recrational Boats by Claude Monet) Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
1
Roos war tot, und ich wußte nicht, was ich anziehen sollte. Wenn es doch Winter wäre, dachte ich, dann würde ich meinen schwarzen Mantel anziehen. Wer stirbt denn auch im Sommer? Zugegeben, es war ein holländischer Mogelsommer mit kalten, nassen Tagen. Schon seit Anfang Juni herrschte der westeuropäische Monsun. Dennoch, ein Wintermantel, das ging nicht. Aber was dann?
Wie eigenartig, deine beste Freundin ist gestorben, und du stehst da und reißt verbissen, beinahe wütend, ein Kleidungsstück nach dem andern aus dem Schrank und schleuderst es aufs Bett. Als dreiviertel meiner verwaschenen, armseligen Garderobe ausgebreitet vor mir auf dem großen Bett lag, ließ ich mich mutlos auf einen Stuhl fallen. »Warum, in Gottes Namen?« fuhr ich den Türpfosten an. Mir war klar, daß ich schnell wieder aufstehen mußte. Wenn ich sitzen bliebe, würde ich langsam, aber sicher versteinern. Mich hatte in dem Moment, als mein Blick im Aufbahrungsraum flüchtig über den gläsernen Sargdeckel geglitten war und ich ihr starres blaßblaues Gesicht gesehen hatte, urplötzlich eine aschgraue Mutlosigkeit überfallen. Solange man in Bewegung blieb, konnte man sie auf Abstand halten. Wenn man sich aber hinlegte oder hinsetzte, versank man in Minenschächten, von denen nicht einmal der Dichter von Psalm 130 eine Ahnung hatte. »Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir.«[1] Der hatte noch rufen können!
»Der Tod, der Tod, der Tod, das Sterben und die Toten«[2], murmelte ich eine Gedichtzeile von du Perron, und ich stand wieder auf. Entschlossen griff ich zur schwarzen Jacke meines Designerkostüms. Das war meine erste Wahl gewesen. Doch da ich es von Roos bekommen hatte, fand ich es nicht gerade passend. Zur Beerdigung in den Kleidern der Verstorbenen?
Zweifellos das schönste Kostüm, das ich besaß. Außerdem tiefschwarz, also hervorragend geeignet für eine solche Feier. Aber der Rocksaum reichte mir nur bis zum Knie, und die Jacke war tailliert. Einigermaßen provozierend. Ging das bei einer Beerdigung? Gut, das konnte ich ausgleichen, indem ich mein Haar hochsteckte. So konnte ich gleichzeitig verbergen, daß es strähnig war und nicht mehr saß. Ich sollte endlich zum Friseur gehen.
Als ich das Kostüm angezogen hatte und sah, daß ich etwas zu dick dafür geworden war, murmelte ich: »Wenn ich es anziehe, gehören auf jeden Fall schwarze Strümpfe dazu.« Besaß ich noch schwarze Strumpfhosen ohne Laufmaschen? In der unteren Schublade meines Kleiderschranks fand ich zwei Paar, fünfzehn Denier, jede mit einer Laufmasche an einem der Beine. Ohne Rücksicht auf Verluste schnitt ich bei beiden das beschädigte Bein ab. Auf diese Weise hatte ich zwei mutierte Strumpfhosen mit jeweils einem schönen Bein. Ob sie gleich aussahen und glänzten – ich war mir nicht sicher, aber was sollte ich tun? Zeit, noch einmal loszugehen, hatte ich nicht. Außerdem waren die Läden am Montagmorgen geschlossen. Zuerst aber zog ich mir Handschuhe an. »Strumpfhosen ohne Glacéhandschuhe anziehen, das gibt gleich wieder eine Laufmasche«, murmelte ich.
Dann kam das Problem mit der Handtasche. Ich besaß ein billiges schwarzes Lacktäschchen. Paßte das zu einem so teuren Kostüm? Es mußte einfach.
Auch wegen der Schuhe ging ich erst einmal ausführlich mit mir zu Rate, doch schließlich stand ich wahrhaftig in schwarzen Pumps im kalten Sommerregen an der Bushaltestelle. Und weil ich dort nun stehen und warten mußte, meldete sich unerbittlich die quälende Niedergeschlagenheit wieder, so daß ich, als ein Gelenkbus endlich mit rutschenden Rädern bremste, kaum fähig war einzusteigen. Am Bahnhof mußte ich umsteigen. Glücklicherweise stand der Bus zum Friedhof schon abfahrbereit da.
Als wir uns Rhijnhof näherten, riß der Himmel auf. Zarte Wölkchen schoben die graue Monsundecke nach Deutschland. Und in dem Augenblick, als ich bei Boeketterie Datura ausstieg, kam sogar die Sonne durch. Ich machte mich lächerlich mit meinem schwarzen Regenschirm.
In den Wandelgängen des Krematoriums mußte man warten. Die vorhergehende Feier zögerte sich hinaus. Ich stellte fest, daß mein Kostüm aufreizend wirkte. Oder reagieren Männer sowieso lüsterner auf einem Friedhof oder in einem Krematorium? Wie dem auch sei, Aufsehen erregte ich jedenfalls.
Als ich in meinen Pumps zu den großen Flügeltüren der Trauerhalle aufrückte, wurde ich prompt von einem Schlipsträger fortgeschrittenen Alters angesprochen.
»Haben Sie Roos gut gekannt?«
»Sie war meine beste Freundin«, sagte ich aggressiv.
»Nicht zu glauben«, sagte der Mann, »auf einmal tot … und noch so jung.«
»Nächste Woche«, sagte ich, »wäre sie dreiundvierzig geworden. Sie war eine Löwin. In diesen dummen Astrologiebüchern steht immer, daß Löwen eine so gute Haltung haben, daß sie kerzengerade gehen, beherzt handeln. Bei ihr stimmte das, als sei sie dazu geschaffen gewesen, diesen blödsinnigen Sterndeutern recht zu geben …«
Erschrocken verstummte ich. Woher dieser Redefluß? Bei einem Menschen, den ich noch nie gesehen hatte? Und dann noch in diesem aggressiven Ton?
»Genau«, sagte der alte Mann ebenso freundlich wie unbeirrt, »sie sah immer großartig aus. Und wunderbar kerzengerade, genau wie Sie sagen, kerzengerade.«
Es folgte noch mehr, aber ich hörte nicht zu, ich dachte: Ob Thomas wohl hier ist? Unter den Leuten, die vor mir in der Reihe standen, konnte ich ihn nicht entdecken. Als ich mich umwandte, sah ich einem seiner früheren Kollegen direkt ins Gesicht. Obwohl jünger als Thomas, war er vor Jahren aufgrund sensationeller Untersuchungen über blutdrucksenkende Mittel zum Nachfolger des Professors für Pharmakologie ernannt worden. Thomas war natürlich verbittert. Hatte damals zuerst seine Wut an mir ausgelassen und sich dann auswärts beworben. War jetzt im Ausland. Nicht daran zurückdenken, ermahnte ich mich, alles besser als eine verpfuschte, kinderlose Ehe.
»Hallo«, sagte der Hypertonie-Professor, »weißt du, ob Thomas kommt?«
»Das hab ich mich auch gerade gefragt«, sagte ich, »aber vielleicht weiß er nicht, daß Roos gestorben ist.«
»Hast du ihn denn nicht angerufen?«
»Nein«, sagte ich kurz.
Ich erschrak selbst über meinen Ton. Er wandte sich an seine Frau, die in einem dottergelben Kostüm herausgeputzt war wie ein Pfingstochse, und sagte gekränkt: »Um ein Uhr sollte es anfangen, und jetzt ist es schon zehn nach eins.«
»Für Roos ist das jetzt egal«, sagte Marjolein spöttisch, »und deine Rede steht auf dem Papier, was macht es also schon aus, ob es ein paar Minuten später anfängt.«
»Pünktlich auf die Minute, das ist meine Devise.«
»Genau wie der Tod«, sagte Marjolein.
»Warum stellst du dich bloß immer quer?«
»Wer stellt sich hier quer? Roos nicht, sie liegt nämlich, und zwar hübsch gerade in ihrem Sarg. Wer nörgelt hier wegen lächerlicher zehn Minuten …«
Er wollte etwas erwidern, aber die Flügeltüren schwangen auf. Wir durften also endlich hineingehen. Vorn stand ihr Sarg. Ich setzte mich in die zweite Reihe. Aus den Lautsprechern erklang der langsame Satz aus dem ersten Haydn-Quartett von Mozart.[3] Greift einem nicht zu sehr ans Herz, dachte ich, ganz passend, hab ich gut ausgesucht.
Als alle einen Platz gefunden hatten, schritt einer jener Männer ans Rednerpult, die man früher »Leichenbitter« nannte. Er sagte: »Professor Wehnagel hat das Wort«, und verließ das Rednerpult wieder. Eduard, seinerzeit der typische Chef mit Bauch, jetzt emeritiert und alt und verschrumpelt, wankte zum Rednerpult, nahm einen Schluck Wasser und sagte: »Wir sind hier zusammengekommen, um Abschied zu nehmen von unser aller Roos Berczy. Wie die meisten von Ihnen wahrscheinlich wissen, war Roos ungarischer Herkunft. Im November 1956 sind ihr Vater und ihre Mutter aus Ungarn geflohen. Im Jahr darauf wurde sie geboren. Sie war das einzige Kind. Alle ihre Verwandten sind im ungarischen Aufstand ermordet worden. Ihre Eltern starben kurz nacheinander in den achtziger Jahren. Viel zu jung noch ist sie nun selbst gestorben. In der Blüte ihrer Tage mußte sie, wie das alte Buch sagt, dahingehen durch die Tore des Totenreiches und den Rest ihrer Jahre entbehren.«
Er machte eine Pause, nahm wieder einen Schluck und sagte: »Ich weiß es noch, als sei es gestern gewesen, wie sie sich bei uns als Chemielaborantin bewarb. Sie hatte zwei Konkurrentinnen, aber sie fiel sofort aus dem Rahmen. Sie war ein unglaublich hübsches Mädchen, ich weiß noch, daß ich damals dachte: Geh bitte nicht nach dem Äußeren. Und ich dachte damals auch: Ein Mädchen mit so langen Fingernägeln kann niemals präzise arbeiten. Also entschloß ich mich entgegen meiner Intuition, eines der anderen beiden Mädchen auszuwählen. Nette Graue-Maus-Mädchen, diese anderen beiden Bewerberinnen. Nachdem ich mit allen dreien gesprochen hatte und bei Gott nicht wußte, wen ich nehmen sollte, ließ ich sie alle drei zu einem zweiten Gespräch wiederkommen. Das erste graue Mäuschen fragte ich: ›Können Sie ein dubbeltje hochkant hinstellen?‹ Das Mädchen nahm ein Dubbeltje aus ihrem Portemonnaie und versuchte verzweifelt, es hinzustellen. Wenn Sie das jemals versucht haben, wissen Sie, daß das nicht geht. Auch das zweite Mädchen versuchte, das Dubbeltje hochkant hinzustellen, aber Roos blickte mich an, blickte mich an … ich sehe es noch vor mir, wie auch sie ein Dubbeltje aus ihrem roten Portemonnaie fischte … ich weiß noch genau, daß ich damals enttäuscht dachte: Ob sie es auch versucht … aber sie nahm eine Streichholzschachtel aus ihrer Tasche, klemmte das Dubbeltje geschickt zwischen die Hülle und das Kästchen, in dem die Streichhölzer liegen, und stellte die Schachtel dann gerade hin. ›Bitte sehr‹, sagte sie, ›ein Dubbeltje hochkant.‹ Da konnte ich also nicht mehr anders, da mußte ich sie nehmen.
Eine bessere Wahl hätte ich nicht treffen können. Jahrzehnte habe ich mit ihr zusammengearbeitet. Wenn meine Forschung Aufsehen erregt hat, dann vor allem durch Roos. Dank ihrer Genauigkeit, ihrer guten Spürnase und ihres Scharfsinns haben wir im pharmakologischen Institut phantastische Forschungsarbeit leisten können. Wie wird man sie vermissen!«
Er verließ das Rednerpult, ging zum Sarg, strich mit der rechten Hand über das Holz und sagte bewegt: »Leb wohl, Roos«, und setzte sich dann.
Wieder schritt der Leichenbitter durch den Raum. In der Blüte ihrer Tage mußte sie dahingehen und den Rest ihrer Jahre entbehren, dachte ich, wo steht das? Daß ich aber auch nicht bibelfest genug bin, um das sofort zu wissen!
»Dann gebe ich jetzt Professor Mentink das Wort.«
Bas Mentink bekam von seiner dottergelben Ehefrau einen Stoß in den Rücken und trottete zum Rednerpult. Unterwegs zog er seine Rede aus der Innentasche seines Anzugs, der dieselbe dunkelgraue Farbe hatte wie die neuen Müllsäcke. Noch bevor er alle Blätter auseinandergefaltet hatte, schnitt seine hohe, helle Stimme durch den Raum. Er sagte: »Ich kenne Roos seit über zwanzig Jahren. Wir haben ungefähr gleichzeitig im Labor angefangen, ich noch als Medizinstudent, der Pharmazie als Nebenfach nehmen wollte. Daß ich für immer dort bleiben würde, wußte ich damals noch nicht. Für meine Forschung habe ich nicht sofort ihre Mitarbeit in Anspruch nehmen können. Sie arbeitete full time für meinen Lehrer, für denjenigen, der vorher gesprochen hat, aber wir sahen uns jeden Tag. Sobald sie Zeit hatte, auch für mich zu arbeiten, wie habe ich da ihre Hingabe, ihren Eifer, ihre Genauigkeit schätzen gelernt! Es ist kaum zu fassen, daß sie nicht mehr da ist. Am Morgen jenes verhängnisvollen Tages war sie, als ich ins Labor kam, schon eifrig bei der Arbeit.
›Es sieht danach aus, als würde es heute endlich ein schöner Sommertag‹, sagte sie.
›Ja‹, sagte ich, ›von mir aus kannst du heute nachmittag freinehmen und an den Strand gehen.‹
›Furchtbar gern‹, sagte sie.
Wer wäre jemals auf den Gedanken gekommen oder hätte auch nur ahnen können, daß sie nachmittags am Strand von Katwijk einen so üblen Sonnenstich bekommen würde, daß sie ins Koma fiel. Wenn man das rechtzeitig bemerkt hätte, vielleicht wäre sie noch zu retten gewesen. So aber lag sie nur da, und die ganze Zeit in dieser sengenden Sonne. Sogar, als endlich ein Badegast entdeckte, daß sie im Koma lag … sogar da wäre doch niemand auf den Gedanken gekommen, daß sie noch am selben Abend … daß sie spätabends im Diaconessenhuis sterben würde.«
Die hohe Stimme verklang im Raum, in den dieselbe Sonne, die Roos umgebracht hatte, verschwenderisch durch die hohen Fenster hereinschien. Mentink nahm einen Schluck Wasser, riß sich zusammen und wiederholte: »…daß sie im Diaconessenhuis sterben würde.«
Er wischte sich mit der rechten Hand über die Lippen.
»Roos, was sollen wir ohne dich tun? Niemand wird dich je ersetzen können. Du warst der Sonnenschein der Abteilung. Du warst eine phantastische Frau. Unbegreiflich, daß du nie geheiratet hast. Verehrer hattest du genug, aber offenbar lag dir nichts an einem Ehemann, an Kindern, an der Geborgenheit einer Familie. Du warst nun einmal mit deiner Arbeit verheiratet. Du warst seltsam allein, du hattest keine Verwandten. Aber viele Freunde und Freundinnen – einen großen Raum voll, wie wir jetzt sehen können. Wir werden dich alle schrecklich vermissen.«
Auch er ging zum Sarg, strich mit der Hand darüber, murmelte etwas Unverständliches und kehrte dann an seinen Platz zurück.
Da saßen wir nun in diesem sonnigen, warmen Raum. Niemand sagte etwas, und ich dachte: Jetzt müßte vielleicht noch Musik erklingen, aber ich hatte nicht mehr als zwei Stücke angegeben, Mozart am Anfang, Beethoven zum Schluß. Der Leichenbitter ging nach vorn und fragte, ob noch jemand das Wort ergreifen wolle. Er warf einen vorwurfsvollen Blick in meine Richtung, als wollte er sagen: »Sie auch nicht? Mit Ihnen habe ich den Ablauf der Feierlichkeit besprochen, Sie müßten doch auch etwas sagen.«
Wenn ich mich da hinstelle, dachte ich, kann ich vielleicht gerade mal zwei Worte sagen, bevor ich anfange zu heulen.
Draußen hörte man das helle Lachen eines Grünspechts, hörte man das Gurren der Türkentauben, den weinerlichen Gesang des Grünlings. Es war nun einmal Hochsommer, und wir saßen noch eine Zeitlang in dem funkelnden Sonnenlicht, das sie vor einigen Tagen umgebracht hatte. In dieser seltsamen Stille – höchstens zwei, drei Minuten – dachte ich: All die sechs Milliarden Menschen, die jetzt auf der Erde herumlaufen, müssen einer wie der andere begraben oder eingeäschert werden, und es schien mir, als würde bei einem derart überwältigenden Angebot an potentiellen Toten weder Zeit noch Gelegenheit dazu sein. Tausend Tode starb ich wegen des logistischen Problems all dieser Milliarden Trauerfeiern. All diese Reden, mindestens drei bis vier pro Begräbnis – denn zwei, das erwies sich jetzt, war offensichtlich dürftig –, mindestens achtzehn Milliarden Reden, wo sollten die um Gottes willen herkommen?
Pianissimo erklang aus den Lautsprechern der Trauerhalle der langsame Satz aus dem letzten Streichquartett von Beethoven.[4] Auch das konnte man noch als Beerdigungsmusik akzeptieren, es ging einem nicht zu nah, warf einen nicht in Tiefen, aus denen Rufen unmöglich war.
Aus der Trauerhalle wurden wir in einen Nebenraum mit hohen Fenstern und Topfpalmen dirigiert. Da Roos keine Verwandten mehr hatte, konnte man im Prinzip niemandem kondolieren. Aber man kann nach einer Beerdigung selbstverständlich nicht nach Hause gehen, ohne jemandem sein Beileid ausgesprochen zu haben, also stellten Bas und ich uns nebeneinander zwischen die beiden Topfpalmen. Bas sagte: »Mein Vorgänger muß sich auch dazustellen«, aber der war offensichtlich schon gegangen. »Das wundert mich nicht«, sagte Bas, »es hat ihm sehr zugesetzt, er war völlig fertig, und hier noch Hände zu schütteln und Konversation zu machen, das schaffte er anscheinend nicht. Und seine Frau ist krank, vielleicht wollte er auch deshalb schnell wieder nach Hause.«
Also standen wir beide nebeneinander. Alle Anwesenden schienen aufrichtig erfreut, daß sie jemandem ihr Beileid aussprechen konnten, und machten eifrig Gebrauch davon. Es wundert mich immer, daß die meisten Menschen nach einem Begräbnis oder nach einer Kremation erleichtert sind. In einem Kondolenzraum bei Kaffee und Kuchen geht es nach einiger Zeit richtig fröhlich zu.
»Weißt du, wo in der Bibel steht: ›In der Blüte ihrer Tage mußte sie dahingehen, sie entbehrt den Rest ihrer Jahre‹?« fragte ich Bas.
»Weißt du bestimmt, daß es aus der Bibel stammt? Er sprach von einem alten Buch.«
»Welches andere alte Buch könnte er denn sonst gemeint haben?«
»Keine Ahnung, aber die Bibel … ja, wahrscheinlich, aber was macht das aus, wo es steht, passend war es, in der Blüte ihrer Jugend mußte sie dahingehen, sie entbehrt den Rest ihrer Jahre.«
Ich wollte sagen: Nicht Jugend, sondern Tage. Er war aber zu sehr von den Kondolierenden in Anspruch genommen.
Als wir allen Anwesenden die Hand geschüttelt hatten, sagte Bas: »Ich glaube, das hätten wir geschafft, wir können uns jetzt unters Volk mischen.«
»Da kommt noch jemand«, sagte ich, aber er hörte mich nicht, sondern lief hastig fort.
Ein zartes rothaariges Mädchen, wie aus Alabaster, kam auf mich zu. Sie schüttelte mir die Hand, murmelte etwas Unverständliches, aus dem ich das Wort »Beileid« herauszuhören meinte, und eilte sofort wieder zum Ausgang. Ich ging zu Bas. Ich wollte ihn fragen: Kanntest du das Mädchen? Aber er unterhielt sich gerade mit seiner Frau. Es hörte sich schon wieder nach Zank und Streit an. Bas’ Frau wandte sich wütend ab, sah mich, warf einen mißbilligenden Blick auf meine Strümpfe, anschließend auf mein armseliges Lacktäschchen, kam einen Schritt auf mich zu und sagte: »Was für ein wunderschönes Kostüm du anhast.«
»Danke«, sagte ich.
»Nur schade«, sagte sie, »daß sie es nicht in deiner Größe hatten.«
2
An das Gezwitscher der heutigen Telefone kann ich mich einfach nicht gewöhnen. Ich hätte lieber wieder das altmodische Klingeln. Dieses unterdrückte Gemecker wie von einem kastrierten Ziegenbock aus einem Kellergewölbe – wer hat sich das bloß ausgedacht?
Als das Telefon ein paar Tage nach der Beerdigung morgens um halb neun so unangenehm zirpte, erschrak ich denn auch halb zu Tode.
»Leonie Kuyper.«
»Hier ist das Büro von Notar Graafland, ich verbinde Sie mit dem Anwalt persönlich«, sagte eine Soubrette.
Ein leises Klicken, dann eine joviale Stimme: »Hab ich richtig g … habe ich die Ehre, spreche ich mit Mevrouw Kuyper?«
»Am Apparat.«
»Schön. Viel zu tun g … viel Arbeit heute morgen?«
»Nein«, sagte ich erstaunt, »ich wollte gerade zum Friseur gehen, aber das kann warten.«
»Könnten Sie dann heute vormittag hierherkommen? Hätte am liebsten alles auf einmal abg … durchg … erledigt. Können natürlich auch einen Termin in ein paar Tagen vereinbaren, aber wenn Sie zufällig nicht beschäftigt sind, bin ich auch nicht beschäftigt, und können wir sofort ein paar Sachen … Sie sind die einzige, die g … nur Sie haben etwas g … kurz, Sie erben alles. Wollte ich g … wollte ich mit Ihnen durchsprechen.«
»Bin ich die einzige, die geerbt hat?« fragte ich erstaunt.
»Ja, Sie sind die einzige, die … ja, Mevrouw Berczy hat erst vor kurzem ihr Testament g … machen lassen, und darin sind Sie die einzige, die g …«
»Geerbt hat«, ergänzte ich.
»Richtig«, sagte der Anwalt erfreut. »Es wäre schön, wenn Sie und ich die näheren Einzelheiten besprechen könnten. Können Sie jetzt sofort hierherkommen?«
»Gleich auf der Stelle? Ist das wirklich nötig?«
»Nötig, was ist nötig, das g … ganze Leben ist unnötig, aber kommen Sie g … sofort … Formalitäten erledigen … Besprechung. Die Frage ist: Wollen Sie die Erbschaft annehmen? Ist so einiges damit verbunden. Denken Sie im Auto hierher darüber nach.«
»Ich habe gar kein Auto.«
»Macht g … macht nichts. Fahrrad auch g … Fahrrad in Ordnung oder Taxi. Oder Schusters Rappen. Von mir aus zu Pferd. Oder auf einem Esel. Wenn Sie nur eben vorbeikommen, mein Büro ist in der G … Galig … Galigaangr … gracht 40 in Gr … Groenh …«
Soll man ein Wort, bei dem ein Stotterer steckenbleibt, ergänzen? Ich glaube nicht, dennoch sagte ich: »Groenhoven«, selbst auch fast über das G stolpernd.
Auf dem Fahrrad dachte ich kaum an die Erbschaft, sondern dachte immer nur: Kannst du kein G sagen, heißt du Graafland und wohnst in der Galigaangracht in Groenhoven.
Aufgrund seiner jovialen Stimme hatte ich mir schon ein Bild von Graafland gemacht. Wie man sich doch täuschen kann! Die Stimme gehörte nämlich nicht der langen, leicht gebeugten Gestalt eines Fünfzigers, als den ich ihn mir vage am anderen Ende der Leitung vorgestellt hatte, sondern einem gedrungenen, kräftig gebauten, sehr jungenhaft aussehenden Mann mit fröhlich blitzenden Augen und einem lächerlichen Schnurrbart. Er trug ein kamelhaarfarbenes Jackett mit Stacheldrahtmuster und einen breiten hellgrünen Schlips.
»So, so … Sie sind also Mevrouw Kuyper. Setzen Sie sich doch, Sie können g … gern den Sessel nehmen. Leg ich also sofort los. Mevrouw Berczy wollte alles ihren Katzen hinterlassen. In Amerika kann man das, hier nicht. Da haben wir die Möglichkeit erwogen, eine Stiftung zu errichten. Der Vorstand würde dann jemanden anstellen, um die Katzen zu versorgen, ist aber alles g … ganz kompliziert. Haben schließlich doch eine einfachere Lösung bedacht. Alles einer zuverlässigen, tüchtigen, soliden Person zu vererben, die es übernimmt, die Katzen zu verwöhnen. Da fiel Ihr Name. Sie sind also die einzige, die etwas g …, na gut, Sie wissen, was ich meine. Unterwegs überlegt, ob Sie die Erbschaft annehmen?«
»Sie haben davon gesprochen, daß noch so einiges damit verbunden ist.«
»Nicht wenig. Sehen Sie, Mevrouw Berczy … Aber Sie werden das doch alles schon wissen, es sicher gr … intensiv mit ihr besprochen haben. Seitdem sie tot ist, kümmern Sie sich schon, nehme ich an, um ihre drei Katzen?«
»Ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad zu ihrer Wohnung.«
»Richtig, dachte ich mir schon, also g … schön, aber haben Sie auch mit ihr besprochen, daß Sie dort wegen der Katzen einziehen sollen?«
»In ihrer Wohnung wohnen? Irgendwann hat sie mich beiläufig gefragt: ›Würdest du dich, wenn mir etwas passiert, um meine Katzen kümmern?‹, und da habe ich gesagt: ›Das ist doch selbstverständlich‹, aber konnte ich ahnen … ich meine, man rechnet doch nicht damit … sie war Anfang Vierzig.«
»Soll ich daraus schließen, daß Sie einen Rückzieher machen?«
»Ich mache keinen Rückzieher, ich hatte nur nicht erwartet …«
»Also haben Sie doch nicht alles g … ausführlich besprochen. Die Katzen, die waren ihr ein und alles, nun, das werden Sie besser wissen als ich. Sie wollte so g … sie wollte nichts lieber, als daß die Katzen nach ihrem Tod in ihrer vertrauten Umgebung bleiben … darum dreht sich ihr Testament. Alles hat sie Ihnen vererbt, unter der Voraussetzung, daß Sie zunächst einmal g … dort einziehen, daß Sie sozusagen in ihre Fußstapfen treten, ihre Rolle übernehmen, sie playbacken, ihre Katzen verwöhnen, wie sie das tat. Für die Katzen muß es so scheinen, als sei alles noch beim alten, als würde ihr Frauchen noch leben. Sie müssen ihre Rolle übernehmen, Sie sollten … Sie könnten mit einem Hauch ihres Parfüms einen G … in ihren Kleidern, ich mache nur einen Vorschlag … Ach, wissen Sie, für Katzen zu sorgen, so schlimm ist das nicht. Wenn es Frettchen oder Pythons wären, und hinzu kommt noch, sie wohnte traumhaft.«
»Ja, sie wohnte sehr schön, aber erbe ich das Apartment denn auch?«
»Aber ja, und hypothekenfrei. Die hatte sie abbezahlt. Sie sind ein Sonntagskind. Aber natürlich, die immense Erbschaftssteuer. Sie hatte deshalb eine ziemlich hohe Lebensversicherung abg … abgeschlossen. Ob das g … ob das ausreicht, Häuserpreise sind so unmäßig g … viel höher in den letzten Jahren. Weiß ich also noch nicht. Muß alles noch ausg … muß ich alles noch austüfteln.«
Seine Fingerknöchel hämmerten einen schneidigen Marsch auf den Schreibtisch, er blätterte in einer Mappe mit Schriftstücken, blickte mich an und fragte: »Sie wohnen jetzt in einer Seitenstraße der Burg … g … gravenlaan? Schlimm, da wegzugehen?«
»O nein, überhaupt nicht. Ich wohne in einer häßlichen Mietwohnung. Da bin ich nach meiner Scheidung gelandet. Denn als mein Mann sich abgesetzt hat, war ich nicht in der Lage, die Hypothek unseres Hauses allein …«
»Sieh einer an, also umziehen, das g … wäre möglich.«
»Im Prinzip, ja.«
»Schön, Sie könnten also schon einmal einziehen und es beispielsweise zunächst mieten.«
»Mieten? Von wem denn? Sie hatte das Apartment doch gekauft.«
»Sie mieten von den Erben.«
»Von den Erben?«
»Ja, von den Erben Berczy, also sensu stricto von sich selbst. Denn wissen Sie, ehe alles erbrechtlich g … geregelt ist, sind wir schon wieder ein Jahr weiter. Dann haben Sie schon mal ein Jährchen Miete g … bezahlt. Mietwohnung immer sechzig Prozent weniger wert als Eigentumswohnung. Also dann auch weniger Erbschaftssteuer. Jedenfalls, wenn der Fiskus darauf reinfällt. Und sonst … verkaufen Sie ein paar von ihren Aktien … nehmen Sie notfalls eine kleine Hypothek auf … auch nicht schlimm.«
»Kleine Hypothek? Das ist mir nun aber … ich verstehe … ich kapiere … nun fang ich auch schon an zu stottern, o Gott, warum sag ich jetzt so was Dummes, entschuldigen Sie.«
»Oh, keine Ursache, ich stottere schon, seit ich in den Windeln … unmöglich? Ein bißchen später dann, schon seit dem Laufställchen. Funktioniere trotzdem g … recht ordentlich. Florierende Praxis. Plädoyer manchmal ein Problem, aber das kann man so hinkriegen, daß man es g … g … ganz ohne G schreibt. He, hören Sie das, auf einmal ging es, auf einmal kommen sie raus. Gediegen ist das. All die Gs. Wenn wir Glück haben, bis zum Lunch kein Problem mehr. Das kommt von Ihnen, kommt, weil Sie so frank und frei über mein Gestotter … ja, es geht immer noch … Große, gute Greise geben grauen Gorillas gratis Gerstengrütze …«
Verblüfft starrte ich auf den kleinen, muskulösen Mann. Mit seinen blitzenden Augen sah er mich strahlend an. Er faßte ohne Stottern zusammen, was er bisher gesagt hatte: »Sie sind also die einzige, die geerbt hat. Sie können das meiste ganz beruhigt annehmen. Schulden gibt es keine. Sie hinterläßt viel. Leider sind Sie nicht mit ihr verwandt, die Erbschaftssteuer ist also nicht gering, aber auch dafür ist gesorgt. Sie hatte eine Lebensversicherung, die sich sehen lassen kann. Sie hatte auch eine Bestattungsversicherung, die Einäscherung ist also gedeckt. Das einzige ist: Sie müssen dort einziehen und die Versorgung der Katzen übernehmen.«
»Ich verstehe das nicht … warum hatte sie denn schon ein Testament gemacht? Warum hat sie alles bis ins kleinste geregelt? Rechnete sie damit … dachte sie, daß sie nicht mehr lange zu leben hätte? Ich traue der Sache nicht. Wenn man noch nicht mal dreiundvierzig ist, geht man doch nicht davon aus, daß man bald sterben wird, da geht man doch nicht zum Notar …«
»Ein Fehler, den viele Menschen machen, zu denken: Hat noch Zeit, bin noch jung, hab das Leben noch vor mir …, oh, wie dumm. Es kann mir nichts, dir nichts mit einem zu Ende sein, dazu gehört nicht viel, es kann zwischen Frühstück und Mittagessen vorbei sein. Ein Testament, das kann man gar nicht früh genug machen …«
»Ich finde es merkwürdig, sehr merkwürdig.«
»Ich nicht. Sie war eine kluge Frau. Als sie ihr Apartment kaufte, war ich an der Übergabe beteiligt, da habe ich zu ihr gesagt: ›Mevrouw, denken Sie an Ihren Letzten Willen‹, und das sage ich jetzt auch zu Ihnen. Ich stehe zu Ihrer Verfügung … ist nicht teuer. Und zeitgemäß. Bestimmt, man kann das gar nicht früh genug machen.«
»Am besten noch in den Windeln, was?«
Graafland brach zuerst in Lachen aus und sagte dann erschrocken: »Ich habe Ihnen noch nichts angeboten.«
»Macht nichts«, sagte ich.
»Eine Tasse Kaffee?«
»Gern.«
Er schaltete die Sprechanlage ein und rief: »Margreet, würdest du bitte zwei Tassen Kaffee bringen?«
Nervös trommelte er mit den Fingern auf seinen Schreibtisch und sagte: »Kommt so einiges zusammen bei so einem Nachlaß. Finanzamt, Steuererklärung … haben Sie einen Steuerberater?«
»Nein«, sagte ich, »warum sollte ich?«
»Sie könnten ihren Steuerberater nehmen. Ist gut in ihre Sachen eingearbeitet und hat eine Hotline zu meinem Büro, also können wir Sie mit vereinten Kräften durchmanövrieren, wenn Sie wollen. Sie können sich natürlich auch einen anderen Notar suchen und einen anderen Steuerberater.«
Ein leises Klopfen an der Tür, sie schwang auf, ein Arm erschien, der ein Tablett auf einem Tischchen hereinschob.
»Ja, der Kaffee«, sagte Graafland und erhob sich eilig.
»Zucker? Milch?«
»Ein paar Tropfen Milch«, sagte ich.
Er überreichte mir ein Tütchen Kaffeeweißer. Vergnügt sagte er: »Aufpassen. Ist bemerkenswert leicht entflammbar.«
»Leicht entflammbar?« fragte ich erstaunt.
»Nie gesehen?«
Er öffnete ein zweites Päckchen Kaffeeweißer, schüttete den Inhalt in seine geöffnete linke Hand, griff mit der Rechten nach einem Feuerzeug, knipste es an, warf den Kaffeeweißer in die Luft und hielt die kleine Flamme darunter. Für den Bruchteil einer Sekunde erschien eine riesige Stichflamme, die sofort erlosch.
»Immer wieder großartig«, sagte er begeistert.
Erstaunt schaute ich den untersetzten Mann an. War das wirklich ein Notar, dieser stotternde Pyromane? Begeistert blickte er mich an. Er sagte: »Falls Sie jetzt denken: Mal lieber keinen Kaffeeweißer in den Kaffee, dann hab ich noch eine Büchse entrahmte Kaffeesahne in Reserve.«
»Gern, ehrlich gesagt.«
»Komisch! Läßt man Kaffeeweißer brennen, wollen die Leute ihn nicht mehr in ihren Kaffee. Verständlich. Aber nicht zu fassen ist, daß so viele Leute, oft sogar noch ohne letztwillige Verfügung, sorglos alles in sich reinstopfen, von dem sie nicht wissen, was es enthält, nicht wissen, wie leicht entflammbar es ist, nicht wissen, wie g … g … o nein, nicht schon wieder, nein, nein, große Graue graben Gräber … ha, geht doch …«
Er setzte sich wieder und rührte in seinem Kaffee.
»Haben Sie Kinder?«
»Nein«, sagte ich kurz.
»Ich ja. Drei. Süße Krabben!«
Er nahm ein paar Schlucke hintereinander und sagte: »Da gibt es einige Legate, also Sie bekommen nicht alles. Großes Legat an den Tierschutz, großes Legat an die Stiftung gegen Pelz, Bont voor dieren.«
»Stichting Bont voor dieren«, sagte ich erstaunt, »sie selbst hatte zwei Pelze, ein hellbraunes Bisamjäckchen und einen Nerzmantel …«
»Ja, den trug sie, als sie hier ihr Testament … ja, wunderschöner Pelz … gehört jetzt Ihnen … wird Ihnen auch hervorragend stehen.«
»Ja, aber … ein Legat für eine Anti-Pelz-Stiftung, während sie selbst …«
»Ist doch nicht so merkwürdig? Schuldgefühle … Prachtstück von Mantel … sich freigekauft. Es sind die Diebe, welche die Diakonie unterstützen. Es sind die Kinderverführer, die Geld für Waisenhäuser spenden.«
Mit lautem Klirren stellte er seine Tasse auf die Untertasse.
»Womit verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt?« fragte er.
»Ich bin Übersetzerin, und ab und zu gebe ich vertretungsweise Französischunterricht«, sagte ich, »aber ich habe keine feste Stellung.«
»Hätten Sie nicht Lust, zwei halbe Tage pro Woche bei mir zu arbeiten? Zum 1. September geht Margreet weg.«
»Hier? In welcher Funktion?«
»Repräsentieren … empfangen, beruhigen. Dafür haben Sie Talent. Durch Sie kommen meine Gs mühelos heraus, schon allein darum … Denken Sie mal drüber nach … demnächst eine Hypothek … da kommt ein kleiner Job doch gelegen …«
»Hatte sie keine Hypothek?«
»Die hatte sie schon abbezahlt, wie ich Ihnen eben gesagt habe.«
»Abbezahlt? Wovon?«
»Weiß ich nicht, hatte gutes Gehalt, konnte was auf die Seite legen.«
»Schon abbezahlt, wie ist das möglich?«
»Apartment war spottbillig, als sie es kaufte. Die Preise sind seitdem irrsinnig gestiegen, aber damals …«
Verträumt blickte er mich an, er flüsterte: »Fangen Sie doch hier an, zwei halbe Tage. Sie haben etwas … so eine hübsche Erbschaft … Schön, daß die bei Ihnen landet. Ach, nun muß ich mal wieder an die Arbeit … kleine Beurkundung. Scheuen Sie sich nicht, mich anzurufen, wenn es Probleme gibt. Kommen Sie, ich begleite Sie hinaus.«
Er brachte mich nicht nur zur Haustür, sondern lief auch noch mit bis auf die Straße. Er zeigte zum Regenhimmel und sang: »Wo bleibt der Sommer, der schöne Sommer.«
»An einem einzigen Tag war strahlendes Wetter«, sagte ich bitter, »und da hat Roos diesen Sonnenstich gekriegt.«
»Sonnenstich. Das hört man doch selten, nicht wahr, daß Menschen an einem Sonnenstich sterben?«
»Man hat sie zu spät gefunden«, sagte ich.
»Ach, kommen Sie«, sagte er, »es kann niemals nur der Sonnenstich gewesen sein … schon so oft hatte sie stundenlang in der Sonne gelegen … da war natürlich auch etwas anderes nicht in Ordnung, schwaches Herz, was weiß ich, kleine Gehirnblutung, man kann sich alles mögliche vorstellen … Sonnenstich, na ja, was weiß ich, ich bin kein Leichenbeschauer. Hat man sie überhaupt richtig angeschaut? Wer hat den Totenschein ausgestellt? Lassen Sie es sich eine Lehre sein: Bevor Sie sich’s versehen, kann es mir nichts, dir nichts mit Ihnen zu Ende sein, bestimmt, dazu gehört nicht viel. Denken Sie einmal über Ihren Letzten Willen nach … Testament … immer zu Ihren Diensten.«
3
Als sei es so vorherbestimmt, lag Roos’ Apartment genau in der Mitte zwischen der Galigaangracht und meiner trostlosen Mietwohnung. Seitdem Roos gestorben war, fuhr ich einmal am Tag spätnachmittags mit dem Fahrrad dorthin, um Tijg, Ober und Lellebel ihr Luxuskatzenfutter zu servieren. Jetzt, auf dem Weg nach Hause, konnte ich es nicht übers Herz bringen, einfach vorbeizufahren, obwohl es noch lange nicht Zeit für ihre Abendmahlzeit war. Sollte ich fortan wirklich dort wohnen? Ich konnte es kaum glauben. Ein so schönes, helles Apartment in einem vornehmen Haus aus dunkelrotem Backstein, mit Doppelfenstern, Feuertreppen und den modernsten Sicherheitsraffinessen? Zum Beispiel mit einem niedlichen kleinen Bildschirm im Flur, auf dem man sehen konnte, wer im Hauseingang vor der Tür stand, wenn es klingelte.
Unten holte ich zuerst ihre Post aus dem Briefkasten. Schon wieder üppiger Zuwachs an diesen Hochglanz-Katzenzeitschriften: das vervielfältigte Blättchen Schnurrbarthaare, die gedruckte Katzenzeitung, Der gestiefelte Kater in glänzendem Schwarzweiß und das teure glossy-Magazin Majestät.
Als ich oben in ihren Flur mit dem Minibildschirm trat, stach mir der Katzengeruch in die Nase. Natürlich hatte ich diesen Geruch früher auch wahrgenommen, hatte ihn ganz sicher eingeatmet, wenn ich Roos besuchte. Jetzt schien es, als sei er stärker – so ein gemeiner, durchdringender Katzenpissegeruch. Oder bildete ich mir das nur ein? Mußte die Katzenstreu schon wieder erneuert werden? Ein Glück, daß diese Katzenklos auf dem überdachten Balkon stehen konnten. Stell dir vor, sie stünden in der Küche oder im Schlaf- oder Badezimmer!
Sollte ich also fortan wirklich so eine Katzentante werden? Widerwillen gegen Katzen hatte ich zwar keineswegs. Dennoch wäre ich nie auf den Gedanken gekommen, mir selbst eine Katze anzuschaffen. Von diesem unverkennbaren Geruch war mir, wo ich ihn auch wahrgenommen hatte, immer übel geworden. Und jetzt sollte ich hier, in diesem Geruch, wohnen, o mein Gott! Noch ganz benommen von ihrem unerwarteten Tod, hatte ich mich bisher kaum gefragt, was auf die Dauer mit den Katzen geschehen sollte. Ich hatte nur gedacht: Ich versorge sie, solange es nötig ist.
Tijg war der erste, der mich begrüßte. Schöne Katze, hübsches, geschecktes Muster. Schaute mich wie immer mit dem Blick aus Baudelaires Gedicht an:
Je vois avec étonnement
Le feu de ses prunelles pâles
Clairs fanaux, vivantes opales
Qui me contemplent fixement.[5]
Ober sah ich erst, als ich ins Wohnzimmer ging. Pechschwarz bis auf ein dreieckiges weißes Beffchen unterm Kinn. Lellebel war natürlich nirgends zu entdecken. Die hielt sich immer unter einem Bett oder in einem Schrank versteckt. Die sah man selten.
»Ich werde bei euch wohnen«, sagte ich zu Tijg und Ober, »ich kann hier sofort einziehen, meinen armseligen Krempel kann ich als Sperrmüll an die Straße stellen. Aber … all diese Uhren … Warum hatte Roos so viele Uhren? Seid ihr einverstanden, wenn ich ein paar davon wegtue?«
Über der Wohnzimmertür hing eine altmodische Kuckucksuhr. Direkt neben dem großen Fenster prangte eine von diesen Friesischen Stühlchenuhren, die ohrenbetäubend tickte. Wie schade, daß die Diebe, die sich auf das Entwenden solcher Uhren spezialisiert hatten, diese offenbar übersehen hatten. Verkaufen? Undenkbar. Aber all diese Digitaluhren mit ihren fluoreszierenden Ziffern, durfte ich die auch nicht wegtun? Im Wohnzimmer leuchteten sowohl im Bücherregal als auch unten auf dem Display des Fernsehers diese aufdringlichen roten Ziffern. In der Küche an der Mikrowelle glühten blaue Ziffern. Ich ging ins Schlafzimmer. Dort standen ein Radiowecker mit roten Ziffern und ein hypermoderner Wecker mit roten Ziffern und auch noch ein altmodischer kleiner Wecker, der schrecklich wütend tickte. Ich nahm ihn, lief damit ins Badezimmer und stellte ihn auf die Ablage über dem Waschbecken, wo er verbissen weitertickte. Ich schaute in das kleine Nebenzimmer, in dem Roos immer ihre Gäste unterbrachte. Es schien auf den ersten Blick uhrenfrei zu sein. Ich ging wieder zurück in ihr Schlafzimmer. Vorsichtig ließ ich mich in den hohen Lehnstuhl sinken, der vor ihrem Frisiertisch stand. Solch einen Frisiertisch hatte ich mir schon immer gewünscht, aber der sparsame Thomas hatte sich eisern dagegen gewehrt, und in meiner Wohnhöhle hatte ich keinen Platz dafür.
Ich beugte mich vor und drückte auf einen Kippschalter. Tatsächlich, wupp, gingen all die Lämpchen an, und gleichzeitig hörte ich wieder das durchdringende Ticken der Uhren und nahm den aufdringlichen Katzengeruch wahr. Wütend sprang ich auf. Ich lief zur Schlafzimmertür, schloß sie und kehrte zum Frisiertisch mit seinem komfortablen Lehnstuhl zurück. »Neulich habe ich im Fernsehen einen Physiker gesehen, der behauptete, Zeit existiere nicht«, sagte ich zu Tijg, der mir nachgelaufen war und es sich auf dem Bett gemütlich gemacht hatte. Ich war mir nicht sicher, ob ich das mochte, aber Roos hatte es bestimmt geduldet. »Dieser Knallkopf hat gesagt, daß ich in die Fußstapfen von Roos treten soll«, sagte ich leise zu Tijg, »ich soll sie playbacken, ich soll in ihre Haut kriechen, ihre Kleider anziehen, ich soll einen Hauch von ihrem Parfüm … eine gute Idee, dann dufte ich angenehm, dann schaffe ich es vielleicht, all dieses dumme Geticke und eure elende Pißluft zu ertragen. Und auch, daß du hier in aller Seelenruhe auf ihrem Bett liegst.«
Ich betrachtete das große Farbfoto von Roos, das neben dem Frisiertisch hing. Hatte Roos dort ein Foto von sich selbst aufgehängt, damit sie beim Schminken vergleichen konnte? Weshalb sonst hatte sie dort ein Foto aufgehängt? Oder war sie so eitel gewesen? Ich betrachtete mich selbst in dem erleuchteten Spiegel. Ich betrachtete all die sündhaft teuren Make-up-Sachen, die dort fein säuberlich und verführerisch bereitlagen. Sie hatte oft Dolly Parton zitiert: »There is no such thing as natural beauty«[6], und zu mir gesagt: »Spare nie am Make-up. Nimm immer das Allerteuerste. Nur das Allerbeste ist gut genug für deine zarte Haut.« Wie hätte ich von meinen armseligen Übersetzerhonoraren jemals diese unverschämt teuren Cremes bezahlen sollen? Jetzt konnte ich das eine oder andere ausprobieren, und mit ungekannt leichtem Herzen und in dem sicheren Wissen, daß Roos es begrüßt hätte, und noch mit den Worten des Notars im Ohr begann ich vorsichtig, mich mit ihren Kostbarkeiten zurechtzumachen. Zuerst war mir noch nicht recht klar, was ich da eigentlich tat, aber während es mir immer besser gelang, wurde mir immer mehr bewußt, daß ich versuchte, sie heraufzubeschwören. Der Prozeß hatte schon begonnen, als ich ihr Designerkostüm zu ihrer Beerdigung angezogen hatte. Dadurch hatte ich die quälende Niedergeschlagenheit auf Abstand halten können. Jetzt, an ihrem Frisiertisch, gelang das sogar noch besser. Wenn ich es schaffte, in ihre Haut zu kriechen, war sie noch nicht endgültig tot, höchstens vorläufig, dann konnte sie wieder ins Leben zurückkehren.
»Ich sollte meine Haare so schneiden lassen wie Roos«, sagte ich zu Tijg, »das ginge sicher, denn mein Haar ist länger, davon kann ein ganzes Stück herunter, das kriegt man hin, ihre Frisur … vielleicht noch tönen, und dann …«
Ich überlegte, daß ich mir jetzt schon das Haar hochstecken und eine ihrer flotten Baskenmützen aufsetzen könnte, um der Sache näherzukommen.
Nachdem ich mich, immer wieder mit einem Seitenblick auf ihr Foto, um mich inspirieren zu lassen, geschminkt und mein Haar hochgesteckt und eine weiße Baskenmütze aufgesetzt hatte, holte ich ein hellblaues Sommerkostüm aus ihrem Kleiderschrank. Es paßte, aber genau wie das Designerkostüm hätte es besser gesessen, wenn ich ein paar Kilo weniger drauf gehabt hätte. »Da hilft nur Abnehmen«, sagte ich zu Tijg, und er miaute ermutigend.
Ich stand vor dem Spiegel, betrachtete mich, sah, daß es gut war. Jedoch mußte ich mir ihre kerzengerade Haltung aneignen. Und es würde noch besser werden, wenn ich mir ihre Frisur machen ließe.
Lange stand ich dort, schaute im Spiegel das Schattenbild von Roos an und fragte mich die ganze Zeit: Weshalb mache ich das? Mache ich das im Auftrag des Notars oder von mir aus? Es konnte Pflicht sein oder Zwang oder geistige Verwirrung. Ich erinnerte mich, irgendwo gelesen zu haben, daß trauernde Männer manchmal die Kleider ihrer verstorbenen Frau anzögen. Vielleicht war es etwas Derartiges. Ich wußte es nicht.
Ich versuchte, ob ich ihren Blick schaffte. So ein bißchen spöttisch und fröhlich, und oft auch etwas hochmütig. Verdammt schwierig! Mir fehlten die schweren, halb gesenkten Augenlider. Moment, wenn ich mir falsche Wimpern aus ihrem reichen Vorrat aufklebte? Als ich das nach einigen Mühen zustande gebracht hatte, schien ich der Sache tatsächlich nähergekommen zu sein.
Und wenn ich erst mal ihre Frisur hätte, wäre es bestimmt noch einfacher, ihren Gesichtsausdruck zu imitieren. Spöttisch blicken, das konnte ich zwar, aber es paßte nicht zu mir. Ich warf die Arme in die Luft, wie sie es immer tat, wenn sie sich abschätzig über gemeinsame Bekannte ausgelassen hatte. Das war nicht schlecht. Jetzt noch ihren ausgestreckten Zeigefinger, auch so eine charakteristische Geste. Das gelang mir ziemlich gut, aber sofort begriff ich, daß sie dabei ihre Hände mit den extravaganten Hexennägeln ausgestreckt hatte.
Ich starrte eine Weile auf meine Hände. Mußte ich mich, wenn es offenbar sogar notariell verlangt wurde, daß ich in ihre Haut kroch, auch noch mit diesen ordinären Fingernägeln schmücken? Solange ich Roos gekannt hatte, mindestens schon zwanzig Jahre, war sie mit langen, lackierten Nägeln herumgelaufen. Ein paarmal hatte ich sie gefragt: »Warum denn nur diese Nägel?«, und dann hatte sie geantwortet: »Weil ich es schön finde«, und dann hatte ich gesagt: »Schön? Ist es nicht einen kleinen Tick ordinär?«, und dann hatte sie geantwortet: »Was ordinär oder vulgär ist, mußt du nicht meiden, auch das hat einen Platz im Leben. Wenn du es durch die Vordertür hinauswirfst, kommt es mit Aplomb durch die Hintertür wieder herein.« Jetzt, da sie tot war, fühlte ich mich schuldig, weil ich mich manchmal kritisch über ihre extravaganten Nägel ausgelassen und sie oft mißbilligend angesehen hatte.
Gewissermaßen als Buße zog ich eine Schublade des Frisiertischs auf. Noch mehr Make-up. Ich zog eine zweite Schublade auf: eine angebrochene Packung mit mindestens noch der Hälfte der hundert künstlichen Nägel Modell Curve Oval, die der Aufschrift zufolge darin gewesen waren. Plus Acrylpulver und einem Fläschchen mit der dazugehörigen Flüssigkeit.
»Also los«, murmelte ich, »ich kann es einfach ausprobieren, man kriegt es sofort wieder ab. Prüfet alles, und behaltet das Beste, um mit Paulus zu sprechen.[7] Alles? Nein, keine Drogen, keinen Inzest, kein Bungee-Jumping, keinen Sadomasochismus!«
Eine Sache habe ich gelernt in meinem Leben: Lies zuerst die Gebrauchsanweisung. Dennoch warf ich nur einen halben Blick auf den Beipackzettel, der in der Schachtel lag, dennoch las ich nur, daß man erst die Oberfläche des eigenen Nagels mit einer Nagelfeile bearbeiten solle, bevor man die Nägel aufklebte. Daß sie an dem feinen Staub haften würden, der dann auf dem Nagel lag, und der Klebstoff besser hielte.
Welch eine Geduldsarbeit war das, dieses Kunstnägel-Anbringen. Ich hatte Roos ein paarmal dabei zugeschaut. Den künstlichen Nagel auf die Spitze des eigenen Nagels heften. Mit stinkendem Acryl den Streifen zwischen Nagelbett und Unterkante des künstlichen Nagels ausfüllen. Obwohl ich es also besser hätte wissen müssen, machte ich sofort einen typischen Anfängerfehler. Zuerst muß man die Nägel seiner rechten Hand aufkleben. Beginnt man, wie man von Natur aus geneigt ist, umgekehrt, steht einem anschließend nur die linke Hand mit den störend langen Nägeln zur Verfügung, wenn man danach seine rechte Hand in Angriff nimmt.
Also gut, nach viel Herumgepussel hatte ich es geschafft. Zwei Hände versehen mit, was sage ich, bewaffnet mit langen, ovalen, scharfen, ein wenig gekrümmten Nägeln. Ziemlich vulgär, sehr fremd, gräßlich faszinierend. Doch eines war offensichtlich, meine fleischigen Hände wirkten weniger plump.
»Jetzt noch anmalen«, hörte ich mich selbst fast wollüstig sagen. »Wo ist der Nagellack?«
Das Fläschchen stand genau vor meiner Nase auf dem Frisiertisch, also hatte ich es zuerst übersehen. Es war eine grauenhafte Farbe: ein violettes Rot, durchzogen von blauer Glut. Aber, nun ja, das war die Farbe, die sie in den letzten Wochen getragen hatte. Mir blieb keine Wahl.
Und als hätte ich nichts dazugelernt, begann ich wieder mit den Nägeln meiner linken Hand. »Nur Esel stoßen sich nie zweimal am selben Stein«, schnaubte ich, nachdem ich meinen linken Daumennagel bearbeitet hatte.
Als ich endlich fertig war und die Nägel trocken waren und ich zuerst mit beiden Händen die Wegwerfgeste probierte und danach die Finger ausstreckte, wie wenn ich jemanden durchbohren wollte, stellte ich mit Genugtuung fest, daß ich einen tüchtigen Schritt vorangekommen war. Mit diesen Curve Ovals hatte ich wie von selbst einen anderen Blick, schon viel Roos-artiger, hatte ich mich weiter von meiner eigenen nachgiebigen Art entfernt, hatte ich meine engelhafte Ausstrahlung eingebüßt. Zugleich spürte ich, daß ich nahe daran war, wieder einmal zu heulen. Aber wenn ich damit anfing, würde ich mein, nein, ihr ganzes Make-up zerstören. Ich fühlte, wie es mir in den Augenwinkeln prickelte, wie die Tränen vor Verlangen zitterten herauszukullern. Ich hob die Hände, krümmte meine Finger, krallte die Curve Ovals in meine Handflächen und riß mich zusammen.
Dann hörte ich die Wohnungstür. Kam da jemand? Aber wer, um Himmels willen? Ich ging ins Wohnzimmer, fühlte mein Herz rasen wie ein ängstliches Kaninchen, umklammerte die angelehnte Wohnzimmertür und zog sie vorsichtig zu mir heran. Der Einbrecher war inzwischen bis in den Flur vorgedrungen. Das erste, was er von mir wahrnahm, waren meine Curve-Oval-Finger, die die Tür umklammerten. Ich hörte ein Geräusch wie das unterdrückte Jammern einer Waldohreule. Ich riß die Tür auf. In dem halbdunklen Flur stand Bas Mentink. Er sah mich natürlich auch. Noch immer hatte ich die schöne weiße Baskenmütze auf und trug das hellblaue Kostüm. Er blickte mich an, wie Saul seinerzeit zu Endor auf Samuel geblickt haben muß. »Und er neigte sich mit seinem Angesicht ehrfurchtsvoll zur Erde[8]«, sagt des Herrn Wort. Auch Bas neigte sein Angesicht zur Erde, auch er neigte sich, aber er richtete sich nicht wieder auf, er neigte sich immer tiefer und knallte dann auf den Vinylfußboden.
»Bin ich ohnmächtig geworden?« fragte er, nachdem er wieder zu sich gekommen war.
»Nicht richtig«, sagte ich, »du bist höchstens fünf Sekunden bewußtlos gewesen.«
Ende der Leseprobe