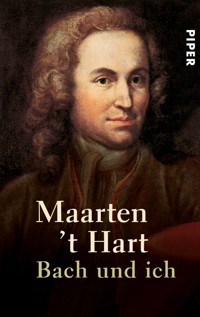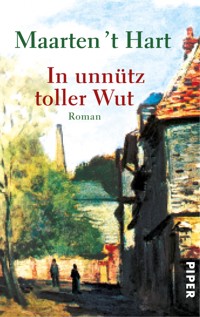9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vom ersten Tag an war seine Mutter misstrauisch gewesen gegenüber der »dürren Missgeburt«, wie sie seinen Freund Jouri immer nannte. Als Sohn eines Kollaborateurs hatte Jouri in den Niederlanden der Fünfziger Jahre wahrhaftig nicht viel zu lachen, genauso wenig wie der Erzähler selbst, der mit seinem eigensinnigen Humor und seinen Darmwinden Mitschüler und Lehrer quälte. Als sich dann einmal die kleine Ria Dons tapfer an seine Seite stellt und ihm, gegen Bezahlung von fünf Cent, sogar erlaubt sie zu küssen, ist das der Beginn einer schmerzlichen Erfahrung – denn Jouri zerreißt das zarte Band und spannt ihm ungerührt die Freundin aus. Voller funkelnder Lust am Erzählen ist »Der Schneeflockenbaum« ein Roman um verlorene Liebe, ein lebenslanges Missverständnis und eine unerklärliche Freundschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Die niederländische Originalausgabe erschien 2009unter dem Titel »Verlovingstijd« im VerlagDe Arbeiderspers, Amsterdam.
Übersetzung aus dem Niederländischen vom Gregor Seferens
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
3. Auflage 2010
ISBN 978-3-492-95017-6
© 2009 by Maarten ’t Hart / De Arbeiderspers
© Piper Verlag GmbH, München 2009
Umschlaggestaltung: Cornelia Niere
Umschlagabbildung: Melchior de Hondecoeter (Ausschnitt), Rafael Valls Gallery, London, UK/bridgemanart.com
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Begräbnis
An einem sonnigen, windstillen Septembertag rasten wir zu einer Grube in Groningen. Jahrelang hatte meine Mutter mit meinem Stiefvater in dieser Provinz, genauer gesagt in dem Ort Baflo, gewohnt. Sie war dort, »gleich unter dem Polarkreis«, wie sie sagte, allmählich verschmachtet. Schließlich hatte sie meinen Stiefvater, kurz bevor er anfing, dement zu werden, so weit gekriegt, dass er einem Umzug in die Auen bei Schipluiden zustimmte, wo meine Mutter und er geboren und aufgewachsen waren. Er stellte aber die Bedingung, in Baflo begraben zu werden. Aus diesem Grund machten wir uns also drei Tage nach seinem Tod von Südholland aus auf die Reise nach Nordgroningen.
Dass wir die Fahrt in einem Reisebus absolvieren würden, war sozusagen bereits bei der Erschaffung der Welt von Gott vorherbestimmt worden. In unserem Clan wird bei Wochenbettbesuchen, Taufen, Konfirmationen, Eheschließungen und Begräbnissen jedes Mal ein Reisebus gechartert. Anders geht es auch kaum, da sowohl mein Vater als auch meine Mutter, schön übersichtlich, mit neun Brüdern und drei Schwestern gesegnet sind. Mit deren besseren Hälften samt Kinderschar füllt man leicht einen Doppeldeckerbus.
Auch anlässlich der Heirat meiner Mutter und meines Stiefvaters waren wir mit einem Reisebus quer durch die Niederlande gefahren. Am Tag nach dem Begräbnis meines Vaters hatte meine Mutter mir geschworen, sich nie wieder trauen zu lassen. Trotzdem hatte sie mich zwölf Jahre später, am Telefon wohlgemerkt, vollkommen überrumpelt mit der Mitteilung: »Ich werde wieder heiraten.«
»Wen denn?«, hatte ich sie gefragt.
»Siem.«
»Wie kommst du auf Siem?«
»In der Zeitung sah ich die Todesanzeige für seine Frau. Ich habe ihn angerufen, um ihm mein Beileid auszudrücken. So hat es angefangen.«
Sie hatte mir nicht erklärt, wie aus einer Beileidsbekundung so wundersam schnell Liebe erblüht war, aber natürlich wurden wir gebeten, zur Hochzeit nach Baflo zu kommen. Nachdem mein Bruder erfahren hatte, dass dank der Beileidshochzeit unsere dezimierte Familie um sechs Stiefschwestern vergrößert werden würde, hatte er eine Woche lang kaum schlafen können.
»Unglaublich, da kriegt man einfach so sechs Schwestern dazu! Es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn es darunter nicht einen heißen Feger gibt.«
Nach unserer Doppeldeckerfahrt saßen wir bereits im beengten Standesamt von Baflo, als die Schwestern hereinmarschiert kamen: sechs grobknochige, korpulente, o-beinige Gemeindeschwestern, eine herzlicher als die andere, weshalb es mich auch nicht störte, dass sie wie Dänische Doggen aussahen. Mein Bruder jedoch war tief enttäuscht, und während der häuslichen Eheschließung weigerte er sich mitzusingen. Als der Pfarrer zu Beginn der Feier einen Kassettenrekorder als Kirchenorgelersatz auf der Fensterbank platzierte und es ihm nicht gelang, daraus andere Geräusche als lautes Rauschen hervorzuzaubern, da sagte mein Bruder: »Hör nur, Lied 33.«
Schade nur, dass keiner der Anwesenden wusste, welches Lied die Nummer 33 in der nicht genug zu rühmenden Liedersammlung von Johannes de Heer hat. Selbst wenn ich es nicht gewusst hätte, wäre mir dennoch sofort klar gewesen, dass mein Bruder auf den berühmten Sonntagsschulschlager »Es rauscht durch die Wolken ein liebliches Wort« anspielte.
Dieses Lied sangen wir nicht. Wir sangen Psalmen. Der Pfarrer verband meine Mutter mit einem Mann in der Ehe, der aus derselben Schablone des Schöpfers zu stammen schien wie der Lehrer Splunter. Tja, werter Leser, du weißt nicht, wer Lehrer Splunter ist, aber mein Bruder und ich waren bei ihm in der Klasse. Beide stammen wir noch aus der Zeit vor der Sturmflut, doch mein Bruder ist sieben Jahre jünger als ich, und als er zu Splunter in die Klasse kam, da war der Pädagoge zwar auch sieben Jahre älter, aber sein Vokabular hatte sich kein bisschen verändert. Sein Lieblingssatz lautete: »Ich werde dir die Rippen blau färben.« War er etwas freundlicher gestimmt, rief er: »Ich werde das Wilhelmus auf deinen Rippen klimpern.« Weniger angenehm war es, wenn er ankündigte, statt der niederländischen Nationalhymne Psalm 119 mit allen achtundachtzig Strophen auf deinen Rippen zu intonieren.
Dass wir ihn nun in der Gestalt von Siem Schlump wiedersahen, war an und für sich schon ein schlechtes Vorzeichen. Trotzdem übertraf das Auftreten des Lehrer-Splunter-Doppelgängers, den wir seit der Besiegelung des Ehebundes mit leisem Spott Onkel Siem nannten, unsere schlimmsten Erwartungen. Nachdem meine Mutter zu ihm nach Baflo gezogen war, verbot er ihr, uns anzurufen. Das sei zu teuer. Sie durfte am Sonntagmorgen auch nicht mehr ihre Lieblingssendung Hour of Power sehen. Obwohl es sich dabei um die Übertragung von Gottesdiensten eines reformierten amerikanischen Pfarrers handelt, fand Onkel Siem die Sendung zu frivol, zu weltlich, zu wenig wiedergeboren. Fuhren wir quer durch die Niederlande, um unsere Mutter zu besuchen, dann sah Siem Schlump uns so unfreundlich an, dass wir lieber gingen als kamen. Also verabredeten wir uns mit unserer Mutter in schmuddeligen Gaststätten in Bethlehem oder Winsum, wohin sie dann von Baflo aus mit dem Rad fuhr.
Meinem Bruder gegenüber beklagte sie sich in Bethlehem manchmal. Aber weil sie, wenn sie den Mund überhaupt aufmacht, alles und jeden mit feststehenden Ausdrücken abhandelt, wiederholte mein Bruder amüsiert das, was sie den Klagen anderer immer entgegenhielt: »Wer klagt, hat keine Not«, »Wir schleppen uns hier in Baflo gemächlich von einem Tag zum anderen«, »Golgotha liegt um die Ecke«, »Wir essen tapfer unser Tränenbrot«, »Mehr Herzenspein als Mondenschein«.
Als die Alzheimerkrankheit Siem Schlump schüchtern ihre Aufwartung machte, lebte meine Mutter auf. Es fing damit an, dass er die Namen seiner Enkelkinder kaum noch zusammenbekam. Als er dann auch seine Töchter verwechselte, war er schon so dement, dass er nicht mehr protestierte, wenn meine Mutter zu Hour of Power hinüberzappte. Er sagte dann höchstens zu ihr: »Fräulein, könnten Sie das bitte ausschalten.« Zu ihrem großen Schrecken hatte er nämlich plötzlich angefangen, sie zu siezen und mit »Fräulein« anzusprechen. Sie konnte uns jetzt auch wieder anrufen. Und schließlich verstand sie es, ihn, der kaum noch etwas verstand, dazu zu überreden, nach Maasland zu ziehen.
Nach dem Umzug hat sie sich jahrelang vorbildlich zu Hause um ihn gekümmert. Sogar als er, wenn er von der Toilette kam und seine Exkremente mitbrachte und diese, unter Hinweis auf die wundersame Speisung im Evangelium, freudig an die Anwesenden verteilte, durften wir den Ausdruck »unhaltbare Zustände« nicht in den Mund nehmen. Mein Bruder, dem Onkel Siem immer freigiebig die größten Stücke schenkte, nahm für sich in Anspruch, einen Platz in einem Pflegeheim für ihn organisiert zu haben. Zweimal am Tag besuchte meine Mutter ihn dort. Sie selbst litt inzwischen an der Parkinsonkrankheit und hatte, vor allem im Winter, Probleme, den Weg ohne Pause mit dem Fahrrad zu bewältigen. Unterwegs hielt sie beim Restaurant einer Versteigerungshalle an und ruhte sich dort im Wintergarten kurz aus. Man sagte ihr aber, dass sie dort nicht sitzen dürfe, ohne etwas zu konsumieren. Sie bestellte eine Tasse Kaffee, doch mit ihren zitternden Parkinsonhänden konnte sie die nicht trinken, ohne zu kleckern. Also bat sie um einen Strohhalm. »Strohhalme reichen wir nur zu Limonade«, sagte der Kellner barsch. Darum ließ meine Mutter den Kaffee immer unangerührt stehen.
Als Siem Schlump schließlich nach all diesen bizarren Prüfungen ruhig verstorben war und ich vorne im Bus neben ihr saß, gelang es mir nicht herauszufinden, wie es meiner Mutter nun ging. Der Platz meines Bruders war schräg hinter uns, auf der anderen Seite des Ganges, und wir waren auf dem Weg zu einem irgendwo in der Gegend von Harderwijk am Wolderwijd gelegenen Rasthof, wo wir eine Pinkelpause einlegen wollten. Es war erstaunlich, wie furchtbar schnell wir mit dem Doppeldeckerbus dahinrasten. Als wir von der A 20 auf die A 12 abbogen, tippte mein Bruder mir auf die Schulter.
»Setz dich mal kurz zu mir«, sagte er.
»Was ist?«, fragte ich, nachdem ich mich neben ihm niedergelassen hatte.
»Die machen ein Wettrennen«, flüsterte er.
Ich schaute zum Leichenwagen, der vor uns herfuhr. Immer wieder wich er auf die linke Spur aus, um zu überholen. Unser Bus folgte ihm augenblicklich. Schnell war mir klar, dass der Leichenwagen versuchte, uns abzuschütteln. Waghalsig schlingernd, wich er nach einem solchen Überholmanöver, bei dem er, ohne zu blinken, auf die rechte Fahrbahn zurückgekehrt war, plötzlich wieder nach links aus, gab dann Gas und raste davon. Unser Chauffeur zog dann auch jedes Mal nach links rüber und trat aufs Gaspedal.
»Müssen wir da nicht einschreiten?«, fragte mein Bruder. »Das ist Wahnsinn. Und hinzu kommt, dass der Sarg jedes Mal hochhüpft, wenn der Leichenwagen blitzschnell auf die linke Fahrbahn wechselt. Schau nur, da hüpft er schon wieder.«
Er hatte recht. Bei jedem Spurwechsel machte der Sarg einen kleinen Luftsprung. Infolge dieses »danse macabre« war das Bahrtuch bereits halb heruntergerutscht, sodass wir schon den Lack des Sarges im Heckfenster des Leichenwagens glänzen sahen.
»Bist du damit einverstanden, dass ich kurz mit dem Fahrer rede?«, fragte mein Bruder.
»Ich stehe voll hinter dir.«
»Nein, bleib du mal lieber sitzen, du musst Mutter ablenken, damit sie nichts merkt.«
Ich nahm wieder neben meiner Mutter Platz. Mein Bruder stieg zum Chauffeur hinunter, flüsterte etwas in dessen rechtes Ohr, erhielt eine geflüsterte Antwort, flüsterte wieder etwas, worauf der Fahrer mit einem mürrischen Nicken reagierte. Anschließend begab mein Bruder sich wieder zu seinem Platz. Der vor uns dahinjagende Leichenwagen wechselte erneut wagemutig auf die linke Fahrbahn. Unser Fahrer hupte, folgte ihm aber nicht. Im Leichenwagen hüpfte der Sarg kurz in die Höhe, und das Bahrkleid glitt vollständig herunter. Weil wir so hoch saßen, konnte ich die bizarre Fahrt des Leichenwagens von der rechten auf die linke Spur und wieder zurück noch lange beobachten, doch schließlich verschwand er aus meinem Blickfeld.
Wir erreichten die Raststätte am Wolderwijd. Meine Mutter wollte wissen, wo Onkel Siem sei, und mein Bruder erwiderte: »Der ist nach Baflo weitergefahren.«
Alle Passagiere aus einem solchen Doppeldeckerbus schaffen, sie auf die verschiedenen Tische verteilen, dafür sorgen, dass sich, in Anbetracht der noch bevorstehenden langen Fahrt, Jung und Alt zur Toilette begibt, und die ganze Meute anschließend wieder einsteigen lassen, das ist eine logistische Operation, die Takt, Verstand und äußerste Wachsamkeit erfordert. Regelmäßig kommt dabei einer der zur Toilette schlendernden älteren Brüder, Schwestern, Schwägerinnen, Schwager, Neffen und Nichten abhanden, vor allem jene, die nur angeheiratet sind. Wenn man glaubt, alle seien wieder im Bus, fehlt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein angeheirateter Onkel, eine angeheiratete Tante, ein Neffe oder eine Nichte. Dann muss man erst einmal herausfinden, wen man vermisst, und muss die entsprechende Person anschließend auf dem Rastplatz suchen. Dabei ist scharf darauf zu achten, dass keiner der bereits im Bus befindlichen Senioren aussteigt, um bei der Suche zu helfen, denn den verliert man sonst garantiert auch.
Nachdem mein Bruder und ich alle wieder in den Bus getrieben hatten, fehlte tatsächlich der älteste Bruder meiner Mutter. Mein Bruder sagte: »Onkel Joost sammeln wir nachher auf der Rückfahrt wieder ein«, doch davon wollte meine Mutter nichts wissen. Also musste ich mich auf die Suche machen, während mein Bruder dafür sorgte, dass niemand den Bus verließ. Ich fand den alten Mann bei einem Zigarettenautomaten. Er schlug auf das Ding ein und schimpfte, weil er Geld hineingeworfen hatte, aber keine Zigaretten herausgekommen waren. Ich schleppte den sich heftig wehrenden Greis zum Reisebus.
Und weiter ging die Fahrt, unter einem blauen Himmel mit frischen, schneeweißen Waschpulverwolken entlang, über Autobahnen, die tatsächlich immer weniger befahren waren, je mehr wir uns Baflo näherten. Dort angekommen, parkten wir bei der reformierten Kirche. Waren Siems Töchter samt Ehemännern und Kindern schon da? Dies schien nicht der Fall zu sein, aber wir hatten ja noch Zeit. Ebenso unverständlich wie besorgniserregend war jedoch, dass der Leichenwagen offensichtlich noch nicht angekommen war.
»Haben Sie eine Ahnung, wo der Leichenwagen sein könnte?«, fragte mein Bruder den Busfahrer.
»Kann überall sein«, erwiderte der Mann äußerst griesgrämig. »Sie wollten ja nicht, dass wir im Konvoi fahren.«
»Der Fahrer wusste aber doch, wo er hinmuss?«, fragte mein Bruder sehr höflich.
»Reformierte Kirche in Baflo«, sagte der Chauffeur.
»Der Wagen ist vorgefahren. Er müsste doch schon längst hier sein?«
»Sie hätten uns eben nicht getrennt fahren lassen sollen.«
»Sie haben mit dem Leichenwagen ein Wettrennen veranstaltet.«
»Warum gönnen Sie uns nicht diesen kleinen Spaß?«
Auch nachdem die sechs Töchter der Reihe nach mit sämtlichen Ehemännern und Nachkommen in diversen Kombis angekommen waren, konnte die kirchliche Trauerfeier nicht beginnen. Die Orgel spielte schon, der diensthabende Presbyter hatte uns bereits eingeladen, im Konsistorialzimmer dem rauschenden Kassettenrekorderpfarrer mit seinem makellosen apostolischen Spitzbärtchen schon mal die Hand zu drücken. Aber der Leichenwagen war noch immer nicht da. Weil die vornehmste Sorge meiner Mutter war, dass während der Trauerfeier nur Psalmen in der alten Bereimung gesungen wurden, bemerkte sie erst einmal nicht, dass Onkel Siem noch auf seinem Begräbnis fehlte.
»Können wir nicht schon mal anfangen?«, fragte ich den Pfarrer.
»Äußerst unüblich«, sagte der. »Ein Sarg vorne in der Kirche ist doch wohl das Mindeste.«
»Wo bleibt der Wagen nur?«, sagte mein Bruder.
»Gibt es hier in der Gegend einen Ort, dessen Name so ähnlich klingt wie Baflo?«, fragte ich den Pfarrer. »Könnte er nicht dort hingefahren sein?«
»Balloo vielleicht«, erwiderte der Pfarrer.
»Möglicherweise steht der Wagen dort vor der reformierten Kirche?«, mutmaßte mein Bruder.
»Balloo hat keine reformierte Kirche«, sagte der Pfarrer.
»Wissen Sie das genau? Ein Ort in den Niederlanden ohne reformierte Kirche? Da will ich hinziehen«, sagte mein Bruder.
Heutzutage ist es nicht unbedingt ein Problem, wenn etwa ein Leichenwagen nicht auftaucht. Schließlich hat jeder ein Handy. Der Busfahrer rief seinen Kollegen an, doch der ging nicht ran.
»Der vertritt sich die Beine, und sein Handy liegt in der Mittelkonsole. Und im Wagen ist natürlich niemand, der rangehen könnte. Aber gut, ich werde es weiter probieren.«
Als alle bereits in der Kirche Platz genommen hatten, wusste immer noch keiner, wo sich die sterblichen Überreste von Onkel Siem herumtrieben. Der Organist improvisierte ausführlich über Psalm 103, »Wie das Gras ist unser kurzes Leben«, und ich dachte: Auch hier, wie fast überall, so ein Tastendrücker, der nicht hört, wie elendig sein Geklimper klingt.
Dann mengte sich eine dröhnende Hupe unter die dunklen Basstöne des Sechzehn-Fuß-Pedalregisters der Orgel.
»Das werden sie sein«, sagte ich. »Gott sei Dank, Mutter hat noch nichts gemerkt.«
Wir sangen einen Psalm nach dem anderen in der alten gereimten Form, sodass nicht nur ich, sondern vor allem auch meine Mutter alle auswendig mitsingen konnte. Sie lebte dabei gewaltig auf. Als sie von der Kirche direkt hinter dem Sarg zwischen meinem Bruder und mir zum Grab schritt, sagte sie strahlend: »Wie herrlich, alle Psalmen mit den alten Reimen.«
Mit einem Lächeln auf den Lippen beobachtete sie, wie ihr zweiter Gatte in die Grube sank, und als mein Bruder und ich, nach Kaffee und Kuchen in einem Nebenraum der Kirche, unsere unglaublich schwierige logistische Aufgabe befriedigend gelöst hatten und alle wieder im Bus saßen, da murmelte sie bei der Abfahrt aus Baflo noch einmal: »Alte Bereimung.«
Dann sagte sie: »Und glaub nicht, ich hätte nicht gesehen, dass du alle Lieder auswendig mitgesungen hast. Der Herrgott hat dich noch längst nicht losgelassen. Deinen Bruder schon. Der Herrgott weiß inzwischen, dass der ein hoffnungsloser Fall ist, aber dich hält er noch immer am kleinen Finger.«
»In der Bibel sind aber immer die älteren Söhne die Bösen«, erwiderte ich, »Kain und Abel, Esau und Jakob. Und der verlorene Sohn ist auch der Jüngere der beiden. Mit Pleun wird es also bestimmt noch gut enden.«
»Der Herr hat sie mir in umgekehrter Reihenfolge geschenkt, erst Abel, dann Kain, erst Jakob, dann Esau.«
»Ach, mach dir nichts vor«, entgegnete ich, »du weißt doch, dass ich, auch wenn mein Kopf kahl ist, am ganzen Körper ebenso behaart bin wie Esau, während sämtliche Haare, die Pleun besitzt, ausschließlich auf seinem Schädel wachsen.«
»Ja, er hat einen hübschen Kopf mit seinen schwarzen Locken«, sagte sie stolz, »genau wie meine Brüder und mein Vater.«
Ramponierte Hosenträger
Siebzig Jahre lang war Psalm 141, Vers 3, der Leitspruch meiner Mutter gewesen. »Herr, behüte meinen Mund, schütz meiner Lippen Türe, auf dass ein unbedachtes Wort mich nicht ins Elend führe.« Zum Ausgleich dafür, dass sie so selten sprach, sang sie den ganzen Tag über bei allem, was sie tat, pianissimo Psalmen, die sie praktisch auswendig konnte, alle einhundertfünfzig. Hörte sie, was nicht oft geschah, jemand anderen etwas sagen, das ihr gefiel, dann sagte sie entschieden: »So ist es«, und summte leise den nächsten Psalm.
Ob sie das Sprechen in ihrer Jugend verlernt hat, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass ihre Mutter die mit Abstand gesprächigste Frau in der riesengroßen Verwandtschaft war. Ein unaufhaltsamer Redestrom wogte von morgens früh bis abends spät über ihre Lippen. Einmal saß sie bei uns im Wohnzimmer und quasselte in einem fort, während mein Vater die Zeitung und ich ein Buch las. Mein Vater schaute ziemlich zerstreut von seiner Lektüre auf und sagte zu mir: »Schalt mal das Radio aus.«
Mit einer solchen Mutter verlernt man logischerweise das Sprechen, aber wer hätte ahnen können, dass nach dem Tod ihres zweiten Mannes die Sprachgene, die sie von ihrer Mutter geerbt haben musste, plötzlich Wirkung zeigen würden. Vielleicht hatte sie ja immer schon sprechen wollen, aber ihre beiden Männer hatten ihr den Mund verboten? Wie dem auch sei, als wir auf der langen Rückfahrt wieder vorne im Bus nebeneinandersaßen, da erzählte sie mir plötzlich, vollkommen unerwartet, ihre Geschichte.
»In gewisser Weise«, hob sie an, »ging ich ja schon mit Siem, bevor ich deinen Vater kennenlernte, na ja, zusammen gehen, das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber wir beide konnten uns gut leiden, und kurz vor meinem siebzehnten Geburtstag, da fragte er mich: ›Christa, gibt es etwas, womit ich dir zu deinem Geburtstag eine Freude machen kann?‹ ›Unsere Nachbarn‹, erwiderte ich, ›die haben so einen schwarzen Hund, und immer wenn ich mit dem Fahrrad an ihrem Haus vorbeikomme, dann rennt er laut bellend hinter mir her und schnappt nach meinen Waden. Ich habe meine Brüder schon so oft gebeten, dem Köter einen tüchtigen Tritt zu verpassen, sodass er zum Krüppel wird und nicht mehr auf die Idee kommt, nach mir zu schnappen. Aber das wollen sie nicht, sie sind total verrückt nach dem Vieh, sie streicheln und herzen das Miststück, und ab und zu geben sie ihm sogar eine Speckschwarte. Wenn du also das Tier zu meinem Geburtstag zum Krüppel treten würdest, dann wäre ich dir sehr dankbar.‹ Darauf erwiderte er: ›Soll ich den Hund heimlich für dich ersäufen?‹ Ich sagte: ›Nein, Siem, das muss nicht sein, das ist ein wenig zu drastisch, und die Nachbarn sind auch ziemlich verrückt nach dem Hund, also, lass das mal lieber.‹ Aber er fuhr daraufhin ein paarmal mit mir am Nachbarhaus vorüber und sah, dass ich jedes Mal ganz panisch wurde, wenn der Hund knurrend hinter mir herrannte. Eines Tages war die Töle verschwunden. Alles haben die Nachbarn nach ihrem Hätschelhund abgesucht. Ich fragte mich, ob Siem das Tier hatte verschwinden lassen, aber ich traute mich nicht, ihn zu fragen. Und er sagte auch nichts dazu. Erst als ich ihn anrief, um ihm Beileid zu wünschen, hat er mir gestanden, dass er den Hund damals an einem dunklen Winterabend gefangen und in einen Jutesack gesteckt hat. Zwei große Ziegelsteine hat er noch dazugepackt und den zugebundenen Sack in den Kanal geworfen. Ich sagte: ›Siem, ich wusste, dass du es getan hattest, und dafür bin ich dir heute noch dankbar.‹«
Meine Mutter schwieg einen Moment, sah mich von der Seite her an und sagte dann anklagend: »Ja, du hast auch so eine schwarze Töle.«
»Wenn jemand meinen Hund in einem Jutesack ersäufen würde, dann würde ich ihm zuerst die Augen ausstechen, dann die Ohren abschneiden, ihn würgen und vierteilen, und anschließend würde ich die Körperteile verbrennen«, sagte ich.
»Du weißt nicht, wie das ist, jedes Mal von so einem Scheißköter angebellt zu werden. Dein Hund hat auch so grelle Augen. Wenn du ihn nicht festhalten würdest, dann würde er sofort auf meine Waden losgehen.«
»Aber nicht doch, mein Hündchen hat noch niemanden gebissen.«
»Ich hab’s nicht so mit Hunden.«
»Aber Katzen magst du doch bestimmt?«
»Auch nicht. Ich mag Tiere generell nicht besonders, Mücken, Spinnen, Asseln, Kühe, Schafe, Ziegen, Pferde ... Warum der Herr bloß Tiere erschaffen hat, das verstehe ich nicht. Weißt du noch, dass dein Vater einmal gesagt hat: ›Ein Pferd kann man mehr lieben als eine Frau.‹ Aber so ein Pferd, das lauert doch nur darauf, dir einen Tritt zu verpassen. Dein Vater hat tatsächlich bei Loosduinen auch einmal so einen Tritt abbekommen, und seitdem hinkte er mit dem linken Bein. Ach, ach, dein Vater! Eines Sonntags fuhr ich mit dem Rad zum Gottesdienst ...
»Am Sonntag?«, fragte ich. »Bist du dir da sicher? Du durftest sonntags doch nicht Rad fahren.«
»Ja, das stimmt, du hast recht, wie konnte ich das nur vergessen. Nein, es war nicht an einem Sonntag, es war an einem Mittwochabend, nach so einem Dankgottesdienst für die Früchte der Gärten und Felder, im Herbst war es, jetzt weiß ich es wieder, es war ein schöner Abend, und ich fuhr bei strahlendem Wetter durch den Westgaag mit dem Rad nach Hause. Siem holte mich ein und fuhr neben mir her. Wir sagten kein Wort. Aber als ich zur Seite sah, bemerkte ich, dass zwischen unseren Hinterrädern ein Vorderrad auftauchte, und dieses Vorderrad schob sich immer weiter vor. Siem wich ein wenig zur Seite aus, denn das war ziemlich beklemmend, dieses unheimliche Vorderrad dort zwischen unseren Hinterrädern. Es hätte ganz leicht unsere Räder berühren können, und deshalb wich Siem noch ein wenig mehr zur Seite aus, und auch ich fuhr ein bisschen weiter nach rechts, ganz knapp an der Böschung vorbei. Ach, ich sehe das hohe Gras immer noch vor mir, es musste unbedingt mal gemäht werden, tja, das Ende vom Lied war, dass Siem in die Pedale trat und vorfuhr, weil uns jemand entgegenkam, und da radelte ich plötzlich neben einem anderen Jungen. Siem schaute sich um, und ich sehe immer noch sein verdattertes Gesicht vor mir. Dabei konnte ich doch gar nichts dafür. Es war das Vorderrad deines Vaters, das sich zwischen unsere Hinterräder geschoben, und das Fahrrad deines Vaters, das Siems Rad einfach beiseitegedrängt hat, dein Vater, der dann auch noch in aller Seelenruhe zu mir sagte, ich sei seine Freundin.«
»Und das hast du dir gefallen lassen? Du hättest doch sagen können: ›Spinnst du, ich geh schon mit Siem.‹«
»Das habe ich, aber er erwiderte nur: ›Siem kannst du abhaken, der ist ein Halbvetter von dir, mit dem darfst du gar nicht ... Nein, nein, du hast meine Hosenträger repariert, du bist meine Freundin.‹«
»Stimmt das? Hast du ...
»Dein Vater kam nach dem Katechismusunterricht mit einem meiner Brüder zu uns nach Hause. Er tat mir ein wenig leid, weil er so heruntergekommen aussah. So mager. Bei ihm zu Hause kümmerte sich keiner um ihn. Und seine Hosenträger ... ja, die waren ziemlich kaputt. Er konnte sie nicht mehr gut verstellen, und richtig festmachen konnte er sie auch nicht, weil die Knöpfe ... Alles wurde mit Schnüren und Sicherheitsnadeln zusammengehalten. Ich hatte gerade mein Nähzeug auf dem Schoß und sagte zu ihm: ›Gib deine Hosenträger mal kurz her, dann werde ich sie, so gut es geht, reparieren.‹ Er setzte sich also hin und drückte mir die Hosenträger in die Hand. Tja, so ist das alles gekommen, wenn ich diese Hosenträger nicht geflickt hätte ...
»Das ist ja vielleicht ein Ding«, sagte ich. »Wenn ich dich recht verstehe, muss ich zu dem Schluss kommen, dass ich das Nebenprodukt von ramponierten Hosenträgern bin.«
»Wenn seine Hosenträger heil gewesen wären, wäre mein ganzes Leben anders verlaufen. Dann hätte ich vielleicht damals schon Siem geheiratet.«
»Ich begreife nicht, dass Siem sich einfach so durch ein paar ausgefranste Hosenträger hat verdrängen lassen.«
»Hinzu kam ja noch, dass wir verwandt waren. Bei mir zu Hause sah man darin kein großes Problem, aber Siems Eltern hatten Schwierigkeiten damit. Vielleicht suchten sie aber auch nur einen Vorwand, um mich von ihm fernzuhalten, denn ich glaube, dass sie mich eigentlich nicht gut genug für ihn fanden. Siems Vater war Gemeindesekretär, meiner Gärtner. Ich erinnere mich noch daran, wie wir eines Nachmittags Hand in Hand hinter einem Gewächshaus mit Trauben gesessen haben; da roch es so herrlich. Hast du den Duft dort auch einmal gerochen?«
»Klar«, erwiderte ich, »sogar auf Madeira, wo es doch so wunderbar riecht, duftete es nicht so gut wie hinter dem Gewächshaus deines Vaters.«
»Woher dieser Duft kam ... ich weiß es nicht, es waren jedenfalls nicht nur die Trauben. Wenn man dort saß, hätte man fast meinen können, man bekäme schon mal einen Vorgeschmack auf die Düfte des Himmels. Wir haben dort einen ganzen Nachmittag nebeneinandergesessen und kein einziges Wort gesagt; ab und zu kullerte ein Tränchen, und im Nachhinein denkt man: Auf diesen Nachmittag habe ich, ohne es zu wissen, hingelebt, und danach habe ich davon weggelebt, und dieser eine Nachmittag, den vergisst man dann nie ... dass man dort gesessen hat, Hand in Hand, das Herz übervoll, aber auch zu betrübt, um etwas zu sagen.«
»Na, komm, am Ende ist doch noch alles gut geworden, und du hast ihn geheiratet.«
»Nachdem er zuerst fast vierzig Jahre mit einer anderen verheiratet war. Sie hat seine sechs Töchter großgezogen.«
»Hättest du denn sechs Töch…«
»Meine Mutter sagte immer: ›Söhne, davon hast du nichts, die putzen keine Fenster.‹ Was gab dieser anderen Frau das Recht, meine Töchter zu erziehen?«
»Wenn du ihn damals, vor dem Krieg noch, geheiratet hättest, dann hätte er dir seinerzeit schon verboten, Hour of Power anzusehen und anzurufen.«
»Red keinen Quatsch! Was für ein Unsinn! Damals gab es überhaupt noch kein Fernsehen, und Leute wie wir hatten kein Telefon.«
»Das stimmt, aber stur und unbeugsam wird er auch als junger Mann schon gewesen sein.«
»Nein, dazu hat ihn erst dieses Weibsbild gemacht. Die hätte er niemals heiraten dürfen, genauso wenig wie ich euren Vater hätte heiraten dürfen. Meine Mutter hat mich noch vor eurem Vater gewarnt. Sie sagte: ›Der Bursche kommt aus keinem guten Nest. Das sind lauter Schürzenjäger. Und sein Vater, der Krämer, der sagte immer: Feudel, acht Cent das Stück, drei Stück im Sonderangebot für fünfundzwanzig Cent. So ein Kerl ist das.‹«
»Man hat dich also in jeder Hinsicht gewarnt, und du wolltest ihn überhaupt nicht, du wolltest Siem, und dennoch hast du ihn geheiratet. Wie soll ich das verstehen?«
»Dein Vater kam immer nach dem Katechismusunterricht mit einem meiner Brüder zu uns. Jedes Mal war an seiner Kleidung etwas nicht in Ordnung, und dann erbarmte man sich eben wieder und nähte ihm einen Knopf an.«
»Und mit jedem Knopf, den du annähtest, wurdest du enger mit ihm verknüpft. Muss ich es mir so erklären?«
»Durch diese elenden Hosenträger bin ich auf eine abschüssige Ebene geraten. Ich rutschte hinab, obwohl ich nicht wollte. Plötzlich trug ich einen dünnen Ring, und wir waren verlobt. Dein Vater ... das muss ich ihm lassen ... dein Vater war überaus unterhaltsam, er konnte sehr nett erzählen, das konnte Siem nicht, der war schweigsam wie ich. Wenn ich deinem Vater einen Knopf annähte, dann setzte er sich zu mir und erzählte genüsslich, und dann musste man lachen, ob man wollte oder nicht, er konnte wirklich gut erzählen, das muss ich ihm lassen, und was ihn außerdem von Siem unterschied, war, dass er keine Angst kannte. Er fürchtete sich vor nichts. Von Kindesbeinen an habe ich mich vor allem Möglichen gefürchtet: vor Spinnen, vor Asseln, vor Hausierern, aber dein Vater ... es war im Krieg, wir waren schon verheiratet, und ich war mit dir schwanger, da fuhren wir abends einmal durch den Lijndraaierssteeg. Das heißt, ich fuhr, dein Vater ging, denn die Deutschen hatten ihm sein Fahrrad abgenommen. Mein Rad aber, das bestand nur aus klappernden Felgen und rostigen Speichen, das wollten sie nicht haben ... Ich fuhr also durch den Lijndraaierssteeg, und dein Vater ging neben mir her, als wir tatsächlich in eine Ausweiskontrolle gerieten. Weil ich mit meinem dicken Bauch nicht schnell genug absteigen konnte, trat einer der Deutschen mich von meinem Rad. Da packte dein Vater den Moff beim Handgelenk ... stell dir das mal vor ... so einen Wegelagerer mit einer hochragenden Mütze auf dem Kopf und einem Gewehr auf dem Rücken ... dein Vater packte ihn also beim Handgelenk und sah ihn mit seinen giftgrünen Augen an; der Kerl schrumpfte regelrecht in sich zusammen. Der andere Moff hob mich von der Straße auf und sagte: ›Das ist garantiert eine Jüdin‹, und dein Vater erwiderte: ›Nein, das ist nicht wahr.‹ Die beiden Kerle haben daraufhin meinen Pass von vorne bis hinten angeschaut und beschnüffelt, sie haben ihn abgeklopft und gegen das Licht gehalten, und als sie auch mich von allen Seiten betrachtet hatten und der eine immer noch meinte: ›Das ist eine Jüdin, ganz sicher‹, da widersprach dein Vater ihm in aller Ruhe, ohne jede Spur von Angst ... Es kommt mir noch immer wie ein Wunder vor, dass wir heil wieder nach Hause gekommen sind, aber ich habe damals beschlossen, nicht mehr vor die Tür zu gehen. Meine Brüder, meine Schwestern und ich ... den ganzen Krieg über haben wir Schwierigkeiten gehabt. Jedes Mal, wenn sie jemanden aus meiner Familie sahen, dachten die Deutschen, sie hätten es mit einem Juden zu tun ... Ohne deinen Vater hätte ich es nicht geschafft, dort im Lijndraaierssteeg. Wenn man fürchterlich in der Klemme sitzt, aber dennoch keine Angst hat, dann erzwingt man Respekt. Furchtlosigkeit macht unverletzlich.«
»Meinst du? Übermut tut selten gut.«
»Dein Vater war nicht übermütig, der war unerschrocken und tapfer. An dem Tag, als du geboren wurdest, gab es eine Razzia. Die Moffen waren hinter allen jungen Burschen her. Die sollten nach Deutschland gebracht werden. Zum Arbeitseinsatz. Am frühen Morgen bereits war Riekie gekommen, die Hebamme, und am Mittag sagte sie zu deinem Vater: ›Das wird eine schwierige Geburt, ich schaff das nicht allein, eigentlich müsste deine Frau ins Krankenhaus.‹ Ins Krankenhaus, das sagt sich so leicht. Das nächste Krankenhaus war in Schiedam, zwanzig Kilometer entfernt. Dorthin, mitten im Winter, ohne Auto? Krankenwagen fuhren auch keine mehr. Das ging also nicht. Das sah Riekie auch ein. ›Wenn wenigstens ein Arzt hier wäre‹, sagte sie. ›Ist in Ordnung‹, sagte dein Vater, ›ich werde ihn holen.‹ Er ging also los, und das, während die Razzia im vollen Gange war und er Gefahr lief, einkassiert zu werden. Zweimal wurde er unterwegs angehalten, und jedes Mal hat er es geschafft, den Scheißmoffen klarzumachen, dass er wirklich nicht mitgehen konnte, weil er auf der Suche nach einem Arzt war, der bei einer schwierigen Geburt helfen musste. Am späten Nachmittag brachte er dann Doktor Jansen mit. Auf den hättest du mal besser kurz gewartet, aber nein, du wolltest unbedingt raus, und darum hat Riekie, die inzwischen am Ende ihres Lateins war, mich komplett aufgeschnitten. Und wie du nach deiner Geburt ausgesehen hast! Dein Schädel war seltsam verformt. Du hattest einen länglichen Eierkopf. Deine Augen waren hinter den Wangen versteckt. Dein Mund war schief, und deine Ohren waren nirgends zu entdecken. Und eine Nase hattest du auch nicht, ach, es war schrecklich. ›Wenn das mal gut geht‹, sagte Riekie. Draußen war es schon dunkel, Licht machen, das ging nicht, und dann kam dein Vater nach Hause, mit Doktor Jansen. Der sah mich an, wie ich so dalag, komplett aufgeschnitten und überall Blut, und er sagte zu deinem Vater: ›Das sieht nicht gut aus.‹ Und dann, ich sehe es immer noch vor mir, als wäre es gestern gewesen, hat er sich die Hände gewaschen, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Siebenmal hat er sich die Hände gewaschen, und nach jedem Waschen trocknete er sie sehr gründlich ab. Und dabei starrte er mich an. Pontius Pilatus war nichts dagegen. Damals war mir sein Verhalten schleierhaft. Heute denke ich: Er wusste nicht, was er tun sollte, und darum wusch er sich die ganze Zeit die Hände. Und ich lag da, fix und fertig, ich existierte kaum noch, ich war eine junge Frau von vierundzwanzig, die noch gar nicht so weit war, ein Kind zu gebären, aber es ist über mich gekommen, so wie es über so viele junge Frauen kommt, ohne dass man gefragt würde, ob man das leisten kann oder leisten will. Ich weiß noch genau, dass ich damals dachte: Nie wieder, nie, nie wieder, und darum habe ich mir deinen Vater danach sieben Jahre lang recht gut vom Leib gehalten, das heißt, ich habe immer zu ihm gesagt: ›Zieh ihn rechtzeitig raus.‹ Nach sieben Jahren ist es dann einmal schiefgegangen, und tatsächlich, ich war gleich wieder schwanger, mit deinem Bruder.«
Als habe er auf das Wort »Bruder« gewartet, tauchte plötzlich neben uns im Gang einer der Brüder meiner Mutter auf. Er fragte mich: »Legen wir unterwegs noch irgendwo an, um den inneren Menschen zu stärken?«
»Das musst du Pleun fragen, er ist heute der Verpflegungsoffizier.«
Während sich mein Onkel mit meinem Bruder über die Stärkung des inneren Menschen unterhielt, flüsterte meine Mutter wütend: »Auch unterwegs noch die ganze Bagage beköstigen! Als wäre das alles nicht schon teuer genug.« Dann presste sie die Lippen wieder aufeinander und fiel zurück in die für sie übliche Rolle der schweigsamen Frau.
Das versetzte mich in die Lage zu hören, was mein Onkel meinem Bruder anvertraute: »Also keine gemeinsame Mahlzeit? Wie schade! Gerne hätte ich nach der Suppe das eine oder andere über meine genealogischen Nachforschungen berichtet. Ihr würdet staunen. Es würde euer aller Leben auf den Kopf stellen.«
Später am Tag brachte mein Bruder mich mit seinem BMW nach Hause. Unterwegs berichtete ich ihm von dem Gespräch mit unserer Mutter und dass wir das Nebenprodukt ramponierter Hosenträger seien.
Mein Bruder fragte: »Ja, und? Bedrückt dich das?«
»Es ist nicht sonderlich erhebend«, erwiderte ich.
»Ach, hab dich nicht so, Hosenträger heben die Hose, was willst du mehr?«
Schlamm
Ein paar Wochen später fuhr ich mit dem Rad zu meiner Mutter. Würde sie mich, so fragte ich mich unterwegs, erneut mit bestürzenden Enthüllungen überraschen, oder würden ihre Lippen wie gewohnt versiegelt bleiben? Als ich bei ihr ankam, verabschiedete sie sich gerade an der Haustür von einer erstaunlich attraktiven jungen Dame.
»Wer war denn das?«, fragte ich.
»Meine Hausärztin«, antwortete sie. »Sie kam vorbei und sagte sehr freundlich: ›Frau Schlump, ich will Ihnen nur rasch eine Grippeimpfung verpassen.‹ ›Aber das will ich gar nicht, Frau Doktor, das ganze Mistzeug in meinem Körper, ich denk nicht dran‹, erwiderte ich. ›Sie sind bereits weit über achtzig‹, sagte sie, ›Sie gehören zur Risikogruppe. Wenn Sie eine Grippe kriegen, dann könnten Sie ruckzuck daran sterben.‹ ›Frau Doktor, darf ich vielleicht auch mal sterben‹, habe ich darauf gesagt, und dann ist sie wieder gegangen, denn ihr war klar, dass sie das Mistzeug bei mir nicht loswird. Ich bin nur froh, dass du noch nicht da warst, denn sonst hättet ihr beide gemeinsam ...
»Aber nein, ich hätte ihr nicht geholfen. Meinetwegen darfst du ruhig irgendwann mal sterben. In zehn Jahren oder so.«
»So lange noch? Kreuzsapperlot!«
»Ach, die Zeit vergeht im Flug, zehn Jahre sind nichts.«
»Meinst du! Nein, nein, ein Tag dauert lange, die Stunden kriechen dahin, und zehn Jahre, die dauern demnach eine Ewigkeit.«
»In der Ewigkeit kannst du mir dann noch mehr von früher erzählen. Neulich im Bus bist du bis zu deiner ersten Niederkunft gekommen. Der Doktor wusch sich siebenmal die Hände. Und dann?«
»Danach hat er getreulich eine Woche lang jeden Tag wieder hereingeschaut. Er sagte jedes Mal: ›Mädchen, du willst dich heimlich davonmachen, aber das geht nicht, du hast jetzt ein Kind, und das muss gefüttert werden.‹ Und ich erwiderte darauf: ›Das Kind hat nicht einmal eine Nase‹, woraufhin er sagte: ›Das wird schon werden‹, und tatsächlich, am Montag – oder war es am Dienstag –, da sah ich tatsächlich so etwas Ähnliches wie ein Näschen, und dann kamen auch die Augen zum Vorschein, und schon bald hast du alle mit deinen abnormal hellen Guckern angestarrt. Als du etwa zehn Tage alt warst, machte mein Vater einen Wochenbettbesuch, und nachdem er bei dir gewesen war, sagte er: ›Als ich wegging, da hat der Knirps mir von seinem Bettchen aus mit großen Augen hinterhergeschaut.‹ Wie du da in der Wiege gelegen und geguckt hast! Als hättest du die ganze Zeit total erstaunt gedacht: Wo um Himmels willen bin ich nur gelandet?«
»Das stimmt, das denke ich bis heute.«
»Obwohl dir das, was du sahst, offenbar ganz und gar nicht passte, so hat es dich doch auch nicht bekümmert, denn du hast nie geschrien, während der Kleine von Hummelman, Harcootje Hummelman, der am selben Tag geboren und am selben Tag wie du von Pastor Breuk getauft wurde, den ganzen Tag in seinem Bettchen lag und plärrte. Ich weiß noch genau, wie du einmal geweint hast. Du warst schon ein Jahr alt, und wir gingen durch den Westgaag zu meinen Eltern. Es war so bitter, bitter kalt, ach, war das kalt. Der Krieg war gerade vorbei, und wir hatten nichts. Du warst viel zu dünn angezogen, du hast gezittert, und dann hast du angefangen zu weinen, ach, ach, du hast so fürchterlich geweint ... Die Lippen meiner Mutter begannen zu beben.
Ich sagte: »Lass gut sein, ich habe doch keinen Schaden davon zurückbehalten, außer dass ich schon damals abgehärtet worden bin und bis heute nie friere.«
»Das stimmt, du machst nie den Ofen an! Wie du das nur aushältst! Ob du damals ... ach, damals hast du so geweint, und dann hat dein Vater dich auf den Arm genommen und hat seinen weiten Mantel halb um dich gelegt, und so gingen wir weiter. Es fing schon an zu dämmern, die Welt war so grau, so eisig, so abweisend, kein Mensch zu sehen, krächzende Krähen auf den fahlen Wiesen, der Himmel bleigrau, Windstöße fuhren durch das raschelnde Schilf, und ab und zu stieg zwischen den Revers deines Vaters noch ein leiser Schluchzer auf, doch schon bald hast du nicht mehr geweint.«
Sie ging in die Küche. »Ich mach dir Tee, aber du musst dir selbst eine Tasse holen kommen, meine Hände zittern zu sehr.«
Sie kam zurück ins Wohnzimmer und fragte: »Erinnerst du dich noch daran, dass du einmal vor Wut geweint hast, als du aus dem Kindergarten kamst?«
»Weinen? Tränen? Wenn du den Tag meinst, an dem Jouri ...
»Ja, den meine ich. Bereits damals hättest du gewarnt sein müssen. Hättest du nur auf deinen Vater und deine Mutter gehört. Ich erinnere mich noch genau, wie du nach Hause gekommen bist. Deine Augen blitzten zornig. Zunächst wolltest du nicht sagen, was passiert war, und erst nach einer Weile bist du damit herausgerückt. Du hattest im Sandkasten mit Ansje Groeneveld gespielt. Dann setzte Fräulein de Kwaaisteniet einen Wicht in den Sand, so eine dürre Missgeburt, der noch immer der Hungerwinter in den Knochen steckte, und dieses Kerlchen hat dir dann in null Komma nichts Ansje ausgespannt. Wie eigentlich? Weißt du das noch?«
»Na, und ob, das ist so ziemlich das Erste, woran ich mich erinnere. Jouri saß zunächst eine Weile ruhig da und schaute sich um. Dann fing er gemächlich an zu graben. Wie es seine Art ist. Grauenhaft genau und ordentlich, ganz anders als die meisten Kinder. Ans und ich bauten gerade eine Sandburg, aber währenddessen schielte sie ständig zu Jouris geschicktem Schäufelchen hinüber ... und langsam wie eine Schnecke rutschte sie immer weiter von mir weg, bis sie, als er fertig war, genau neben Jouri saß. Dann fragte sie ihn: ›Was gräbst du da?‹ Und er antwortete stolz und ruhig: ›Ein Grab.‹ ›Für wen denn?‹, wollte sie wissen. ›Für eklige Tiere‹, sagte er. ›Für schreckliche Spinnen?‹, fragte sie. ›Ja‹, sagte er, ›für schreckliche Spinnen, dann können sie dich nicht mehr beißen.‹ Wenn ich daran zurückdenke ... mit einem Spinnengrab hat er sie rumgekriegt. Ich war gerade vier, kein Wunder also, dass mich das mitgenommen hat.«
»Mitgenommen? Du warst vollkommen niedergeschlagen.«
»Nun übertreib nicht. So schlimm war es nun auch wieder nicht.«
»Nicht so schlimm? Als du nach Hause gekommen bist, konntest du zunächst nichts essen, und später konntest du nicht einschlafen. Dein Vater und ich sind an dem Abend bestimmt drei- oder viermal an deinem Bett gewesen, weil du immer wieder geweint hast.«
»Ans war meine Freundin. Ich hatte sie schon ein paarmal nach Hause gebracht, ganz bis raus zum Stort, und wir hatten verabredet, dass wir später heiraten würden, und dann kommt auf einmal ein Neuer in den Kindergarten, so ein Zwergmurmeltier aus Melissant auf Goeree-Overflakkee, und zack, schon ist es aus zwischen Ans und mir. Nach dem Spinnengrab durfte ich sie nicht mehr zum Stort bringen.«
»Da siehst du’s! Es ärgert dich immer noch.«
»Das kommt, weil er seitdem ...
»Genau, du hättest damals schon gewarnt sein können, aber stattdessen hast du dich mit dem Kerl angefreundet.«
»Das war die beste Methode, ihn im Auge zu behalten und den Schaden, so gut es ging, zu begrenzen.«
»Ach, red keinen Unsinn! Du machst mir nicht weis, dass du deshalb dein Leben lang wie ein Zwillingsbruder zu ihm gewesen bist. Dein Vater und ich haben dich von Anfang an vor ihm gewarnt, das musst du doch zugeben. Selbst als wir noch nicht wussten, dass sein Vater von Goeree-Overflakkee weggegangen ist, weil der Herr im Krieg auf der falschen Seite gestanden hat, haben wir bereits gesehen: Der Bursche taugt nichts, weg mit ihm. Wenn du unbedingt einen Freund haben wolltest, warum hast du dir nicht Harcootje Hummelman ausgesucht?«
»Jetzt fängst du schon wieder mit Harco Hummelman an!«
»Hättest du dir den doch zum Freund gewählt! Gut, er war kein so pfiffiges Bürschchen wie dieser Jouri, aber neulich ist er doch noch Diakon geworden.«
»Dann muss die Not aber groß gewesen sein, und sie konnten keinen anderen finden.«
»Pfui! Sag nicht immer so hässliche Dinge! Ich wünschte, du wärest damals mit Harco statt mit diesem Jouri ... Mit Jouri gingst du tief in den Polder, und wenn du Stunden später nach Hause kamst, warst du voller Schlamm. Und manchmal hattest du auch noch in die Hose gemacht!«
»Ach, die schönen Entwässerungsgräben, die es damals noch gab! Und was da alles drin war! Rückenschwimmer, zwei Arten Salamander, Bachröhrenwürmer, Wasserasseln, Süßwassergarnelen, geränderte und schwarze Wasserkäfer, Eintagsfliegen, Wasserspinnen und die unglaublichen Wasserwanzen und Wasserskorpione ... ach, wenn man davon einen fing ...
»Ja, widerlich, die brachtest du dann stolz mit nach Hause!«
»Und musste dann sofort, weg damit, wieder vor die Tür.«
»Ja, natürlich, ich sehe die widerlichen Viecher noch vor mir. Du brachtest sogar sich windende schwarzrote Blutegel mit. Warum bloß?«
»Zu mir sprach der Graben, beseelt war mir’s Getier, mich grüßten Gottes Gaben, sie war’n der Schöpfung Zier. Und so ist es noch immer, mit dem Unterschied, dass die Gräben rund um mein Haus total leer sind. Man kann froh sein, wenn man einen einsamen Rückenschwimmer mit einer silbernen Luftblase am Bauch vorbeipaddeln sieht. Steckte man früher einen Finger ins Wasser, wurde man sofort fürstlich von drei großen Rückenschwimmern gebissen. Darauf braucht man heute gar nicht mehr zu hoffen! Und so eine Wahnsinnswasserwanze oder so einen unglaublichen Wasserskorpion, den findet man überhaupt nicht mehr.«
»Wenn wir im Garten meines Vaters und meiner Mutter waren, dann hast du auch die ganze Zeit nur in den Wassergraben gespäht.«
»Ja, das war auch so ein phantastisches Biotop! Dort lebten sogar große Kolonien von Moostierchen unter der Balkenbrücke. Nicht, dass ich das damals gewusst hätte, aber mir war klar, dass ich etwas Besonderes in den Händen hielt, wenn ich so einen braungelben Klumpen Glibber aus dem Wasser holte.«
»Ich bin froh, dass du dieses Zeugs zumindest nicht mit nach Hause gebracht hast. Was warst du doch nur für ein widerlich schmutziges Bürschchen! Ständig hast du dich am Hintern gekratzt und in der Nase gebohrt.«
»Stimmt, und deshalb habt ihr meine rechte Hand in Petroleum gesteckt.«
»Das hat aber nicht geholfen.«
»Und darum habt ihr mir die rechte Hand auf den Rücken gebunden, sodass ich, obwohl ich doch Rechtshänder bin, seitdem mit der Linken in der Nase bohre.«
»Womit ich das verdient habe, dass mein Ältester so ein schrecklicher Schmutzfink war? Von mir kannst du das nicht haben. Bei uns zu Hause waren alle sauber, frisch und ordentlich. In dieser Hinsicht war dein Bruder eine Erleichterung.«
»Abgesehen davon, dass er immer aus dem Kohlenkasten naschte.«
»Aber nur, als er fünf oder so war.«
»Nein, nein, viel länger. Wenn ich an ihn zurückdenke, sehe ich diese schwarze Visage vor mir. Dann hatte er wieder ein schmackhaftes, glänzendes Stück Anthrazit aus dem Kohlenkasten gefischt, das er geduldig, als bewegte er ein Kaugummi zwischen seinen Milchzähnchen, zermalmte. Und weil er sein Gekaue mit den Händen unterstützte, wurde sein Gesicht immer schwärzer.«
»Wir waren manchmal regelrecht verzweifelt, dein Vater und ich. Hat man so was schon mal gehört? Ein Kind, das ständig aus dem Kohlenkasten isst! Wenn man jemandem davon erzählte, stieß man auf Unglauben. Hilfe oder guten Rat konnte man also vergessen, denn damit konnte keiner dienen.«
»Seine Hand in Petroleum stecken, wäre das nicht eine gute Idee gewesen?«
»Pleuns Hand? Wenn man nicht aufpasste, hätte er mir nichts, dir nichts die Petroleumkanne leer getrunken.«
»Na, dann hätte man ihm vielleicht die Hand auf den Rücken binden können. Bei mir bist du davor doch auch nicht zurückgeschreckt?«
»Nein, aber dich konnte man wirklich mit nichts beeindrucken. Mit dir war nichts anzufangen, außer wenn es schneite, dann saßt du, solange Schneeflocken fielen, mucksmäuschenstill am Fenster. Was mich angeht, so hätte es damals, als du klein warst, jeden Tag schneien können, denn ansonsten warst du ein schrecklicher Lümmel. Manchmal hast du einfach so die Decke vom Tisch gezogen, mit allem, was darauf stand, und dann purzelte alles Porzellan auf den Boden, und der ganze Kladderadatsch lag in Scherben. Und welch einen Spaß du dann hattest! Du hast schallend gelacht, so wie du auch immer lachtest, wenn du in der Gärtnerei meines Vaters wieder einmal mit einem Holzschuh ein Huhn getroffen hattest. Heute tust du so, als wärest du immer schon der allergrößte Tierfreund gewesen, aber ich weiß es besser. Nichts bereitete dir mehr Freude, als die armen Hühner immer wieder mit Holzschuhen, Ästen und Steinen zu bewerfen. Und wenn du eines getroffen hattest und das bedauernswerte Tier sich den Schnabel wund gackerte, dann brülltest du vor Lachen. Wenn wir dich im Haus so lachen hörten, sagte mein Vater: ›Sapperlot, jetzt hat er schon wieder ein Huhn getroffen. Das kostet uns jedes Mal ein Ei.‹ Solchen Unsinn machte Pleun nicht. Und er spielte auch nicht so wie du an seinem Zipfel.«
»Habe ich daran herumgespielt?«
»Als ob du das nicht mehr wüsstest! Du warst kaum sieben, da hast du bereits wie wild daran herumgerieben. Schrecklich, schrecklich, ein so kleiner Kerl noch und doch schon ein so großer Sünder.«
»Ach, ich hatte doch keine Ahnung, es fühlte sich an wie ein angenehmes Jucken, was war so schlimm daran?«
»Ich war vollkommen ratlos. Ein Dreikäsehoch noch, und trotzdem spieltest du schon daran herum. Das musste man bei Pleun nicht befürchten, dein Bruder war als Kind viel artiger, wenn man mal von den Kohlen absieht ... aber das hat er ja auch nicht sehr lange gemacht.«
»Mindestens drei oder vier Jahre.«
»Hätte ich doch nur gleich Siem Schlump geheiratet. Dann hätte ich sechs nette Töchter gehabt statt eines Anthrazitnaschers und eines kleinen Dreckschweins, das das Geschirr in Scherben wirft, anderer Leute Hühner bombardiert und mit Blutegeln nach Hause kommt. Sechs Töchter, stell dir doch nur einmal vor: eine zum Fensterputzen, eine zum Kochen, eine zum Waschen, eine zum Schrubben, eine zum Nähen, eine zum Flicken, eine zum ...
»Halt, jetzt bist du schon bei sieben.«
»Ach, das wäre mir durchaus recht gewesen, sieben Töchter statt eines Bengels, der regelmäßig in die Hose macht.«
»Sei froh, dass du auf diesem Gebiet schon etwas Erfahrung hattest, als Onkel Siem dement wurde und ständig in die Hose machte.«
»Oh, das war so fürchterlich. Und dennoch hätte ich es durchaus ertragen, wenn er es nur zugelassen hätte, dass ich ihn, wenn es wieder einmal passiert war, sauber mache. Aber er wollte nicht, dass ich ihn berühre. ›Fräulein‹, sagte er dann ... Ach, das war auch so schrecklich, dass er ›Sie‹ zu mir sagte und ›Fräulein‹ ... ›Fräulein, wenn Sie es noch einmal wagen, mich zu berühren.‹ Und anschließend fing er sofort an, wie ein Känguru zu boxen. Ich rief dann deinen Bruder an, der sofort in seinen Wagen sprang und in null Komma nichts vor der Tür stand. Der packte Siem dann bei den Handgelenken, und die beiden rangen eine Weile miteinander, so wie Jakob am Ufer des Jabbok mit dem Engel gerungen hat. Und dann sagte Siem plötzlich mit einem Kloß in der Kehle: ›Fräulein, ich kann diesen Burschen nicht besiegen‹, und danach ließ er sich unter Tränen sauber machen. Immer wieder habe ich zu den Hampelmännern vom Sozialdienst gesagt: ›Das geht so nicht länger‹, aber die haben immer nur geantwortet: ›Durchhalten, wir haben für ihn noch keinen Platz frei.‹ Eines Tages aber kam ein junger Bursche, dem ich ebenfalls mein Leid klagte, und der sagte: ›Frau Schlump, eigentlich darf ich Ihnen das nicht sagen, aber die einzige Möglichkeit, eine Lösung des Problems zu erzwingen, ist, Sie laufen weg.‹ Also bin ich eines Nachmittags, als Siem hier friedlich auf dem Sofa saß und döste, abgehauen. Ich bin zu meiner Schwester, habe den Pastor angerufen und gesagt: ›Herr Pastor, ich bin weggelaufen.‹ Der Pastor hat daraufhin den Arzt angerufen, der wiederum eine Pflegerin benachrichtigt hat, und am nächsten Morgen sind sie hin, um nachzusehen. Er saß immer noch genauso auf dem Sofa wie zum Zeitpunkt, als ich gegangen bin. Allerdings war seine Hose randvoll. Ich hatte bei meiner Schwester die ganze Nacht kein Auge zugemacht, und am nächsten Morgen kam jemand vom Sozialdienst vorbei und sagte: ›Frau Schlump, wie konnten Sie nur! Wissen Sie, wie wir ihn heute Morgen vorgefunden haben?‹ Dann schaute sie mich an, und das, was sie da erblickte – ich sah fürchterlich aus nach der Nacht –, jagte ihr einen derartigen Schrecken ein, dass sie nachgab und sagte: ›Ja, ich verstehe, dass es so nicht länger weitergehen kann.‹ Tja, und am nächsten Tag hatten sie für ihn einen Platz im Pflegeheim. Dort hat es ihm sehr gut gefallen, doch eines Mittags, als ich ihn besuchte, da sitzt er da und weint fürchterlich. Und auf einmal sagt er zu mir: ›Christa, warum konnte ich nicht bei dir bleiben?‹ Ich bin regelrecht im Boden versunken. Etwas Schlimmeres ist mir im ganzen Leben nicht widerfahren. Ich kam mir vor wie Judas. Aber am nächsten Tag sagte er wieder: ›Guten Tag, Fräulein, nett, dass Sie gekommen sind.‹«
»Alzheimer, ich hoffe inständig, dass mir das erspart bleibt.«
»Es ist längst nicht immer so schlimm. Manche werden auch wieder zu Kindern. Mit denen kann man dann Kindergartenlieder singen. Die können sie immer noch auswendig und finden es wunderschön, sie zu singen.«
»Ringel, Ringel, Reihe, wir sind der Kinder dreie, sitzen hinterm Hollerbusch, machen alle husch, husch, husch.«
»Genau. Und, was ist daran so schlimm? Mit ein bisschen Glück stirbt so ein bedauernswerter Mensch leise singend, mit dem letzten Atem murmelnd: ›Ja, Amen, ja, er starb fürwahr, um uns an Gott zu binden, er gab sein Blut auf Golgotha, als Preis für uns’re Sünden.‹ Tja, mit ein bisschen Glück ...
Jouri
Hätte ich gewarnt sein müssen? Hätte ich mich nicht mit ihm anfreunden sollen? Wenn ich an meine Kindergartenzeit zurückdenke, erinnere ich mich vor allem daran, dass mir die Dinge, die wir dort tun sollten, nicht gefielen. Die Tätigkeiten, zu denen man uns anhielt, hasste ich. Weil ich mich jedes Mal wieder zutiefst entrüstet weigerte, zu prickeln, zu malen, zu kleben, zu schneiden, kurzum: zu fröbeln, galt ich als arbeitsunwillig und musste in der Ecke stehen. Ich sehnte mich danach, Wassertierchen zu fangen und zu studieren. Doch solch extravagante Wünsche wurden im Programm des Kindergartens nicht berücksichtigt. Also rutschte ich eben auf den lächerlichen Stühlchen herum oder langweilte mich, bei gutem Wetter, im Sandkasten.
Mein Kindergartenleiden wurde, jedenfalls während der ersten Monate, noch dadurch vergrößert, dass ich, wenn ich auf der Toilette gewesen war, um ein großes Geschäft zu erledigen, und eine halbe Stunde später wieder musste, mit drohendem Ton zu hören bekam: »Du bist doch gerade erst gewesen!«
»Aber ich muss schon wieder.«
»Du lügst. Das kann nicht sein.«
»Wirklich, ich muss, ich ...
Nach dem Verbot versuchte ich verzweifelt, das Unabwendbare aufzuhalten. Meistens gelang mir das nicht, sodass ich penetrant riechend auf dem Kinderstuhl hockte. Mit etwas Glück saß ich, wenn es passierte, im Sandkasten. An der frischen Luft konnten sich die anderen Kindergartenopfer aus dem Staub machen. In null Komma nichts hatte ich dann den Sandkasten für mich allein. Alles, was eifrig mit Schäufelchen zugange war, flüchtete panisch vor dem Gestank. Der Einzige, der nie weglief, egal, wie unerträglich ich stank, war Jouri. Fröhlich arbeitete er neben mir auf seinem friedlichen Spinnenfriedhof.
War mir das Malheur drinnen passiert, konnten meine Schicksalsgenossen natürlich nicht so leicht das Weite suchen. So saßen sie anschließend da und ächzten und stöhnten. Die etwas Hartgesotteneren hielten sich übertrieben die Nase zu, während die etwas Feinfühligeren – ich will nicht den Eindruck erwecken, sexistisch zu sein, aber um der Wahrheit Genüge zu tun, muss ich sagen, es waren meistens die Mädchen – oft in Tränen ausbrachen. Man sollte annehmen, den Erzieherinnen hätte bereits nach wenigen Tagen klar sein müssen, dass man ihnen ein Bürschchen mit dauerhaft intensiver Verdauung aufgehalst hatte. Aber das war ganz und gar nicht der Fall. Es schien fast, als wollte es ihnen einfach nicht in den Kopf, dass es auch beim Stuhlgang große Abweichungen von der Norm geben kann. Wenn man irgendwann am Tag die Erlaubnis bekommen hatte, ein großes Geschäft zu erledigen, dann war es nach Ansicht von Fräulein de Kwaaisteniet, und das Gleiche galt eine Klasse höher auch für Fräulein Fijnvandraad, offensichtlich undenkbar, dass man nach einer halben Stunde wieder musste. Und sie waren schon gar nicht in der Lage zu begreifen, dass man im Laufe des Tages noch mindestens zwei- oder dreimal das stille Örtchen aufsuchen musste. Folglich saß ich jedes Mal aufs Neue wie eine Raffinerie stinkend inmitten von schimpfenden Jungs und weinenden Mädchen.
Der Einzige, der nie schimpfte und sich auch nie die Nase zuhielt, war Jouri. Unsere Freundschaft, unser Bund oder wie immer man unsere Beziehung nennen will, entspringt daher unter anderem meiner ungewöhnlichen Verdauung. Er war der Einzige, der es im Kindergarten und später in der Schule neben mir in der Bank aushielt. Denn selbst nachdem endlich bei den mit Lernschwierigkeiten geschlagenen Kindergartenerzieherinnen der Groschen gefallen war und sie wussten, dass man mir, wenn ich mich in höchster Not meldete, sofort freie Bahn zur Toilette geben musste, um zu verhindern, dass ich notgedrungen in die Hose machte, drängten oft zwischen den Toilettengängen, auch wenn ich krampfhaft die Pobacken zusammenpresste, lautstarke und in jedem Fall niederschmetternd stinkende Darmwinde nach draußen und sorgten immer wieder für immense Aufregung in allen Klassenzimmern, in denen ich verkehrte.
Ende der Leseprobe