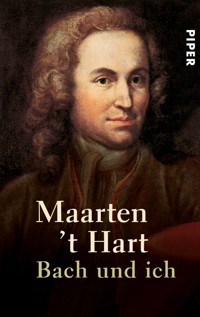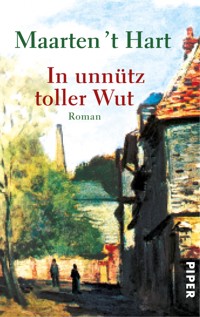9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vom taumelnden Glück eines Sonderlings: »Ein echter Maarten 't Hart.« Trouw Gabriel Pottjewijd ist bestürzt. Er ist nach Südholland gereist, um dort eine der letzten Garrels-Orgeln zu stimmen. Nun aber dröhnt die Schiffswerft, die Ankerketten klirren – und die der Unrast anheimgefallenen Städter machen Gabriel das Leben schwer. Allein die sonderbare Lanna steht ihm beim Stimmen geduldig zur Seite. Bis er anonyme Drohbriefe erhält, die auf ihre kratzbürstige Mutter Gracinha anspielen. Denn die hat schon ganz anderen den Kopf verdreht. Nach zehn Jahren Abstinenz erscheint nun endlich ein neuer Roman des ewig staunenden, ewig zweifelnden Meisters des skurril Poetischen. »Eine leichtherzige und emotionale Version der Geschichte, die Maarten 't Hart seit den siebziger Jahren mit Verve zu erzählen weiß: die des Außenseiters, der sich danach sehnt, in etwas Größeres einbezogen zu werden.« De Groene Amsterdammer »›Der Nachtstimmer‹ ist ein unbeschwerter 't Hart mit melancholischem Unterton, in dem sich die Extreme berühren und die Liebe zur Musik und zum Orgelbau auf jeder Seite spürbar ist.« De Telegraaf
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher: www.piper.de/literatur
Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens
Die niederländische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel De nachtstemmer bei Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam.
© Maarten ’t Hart 2019
© Piper Verlag GmbH, München 2021
Covergestaltung: Cornelia Niere
Coverabbildung: akg-images/Eyck, Jan van, um 1390 – 1441 (in Zusammenarbeit mit Hubert van Eyck)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Cover & Impressum
Zitat
Eine Reise um die Welt
Die Eselin des Bileam
Stabat Mater Dolorosa?
Mutter und Tochter
Eine Schiffswerft
Pastor Berenschot
Ein Bibelregal
Schwarz stimmen
Hendrik Schoonbroodstraat
Stimmen!
Hübsch langweilt, an hässlich gewöhnt man sich
Sirene
Ködern
Langweilig
Ein Velomobil
Ein Brief am Sonntag
Eine Grubenlampe
Mord im Schwellkasten
Papiertüten
Apostasie
Im Hafen
Zuschauer
Beklemmung
Anzeige
Auflösung
J. Worp
Ein Krankenwagen
Krijn Lagrauw
Furieade
Zurück nach Groningen
Das Stimmen einer Pfeifenorgel ist eine mühsame Arbeit, die ein scharfes Gehör, Umsicht, Körperbeherrschung, logisches Denken, Sinn für praktisches Handeln und zu all dem noch Geduld und Ausdauer des Stimmers erfordert. Nur in einem Raum, in dem vollkommene Stille herrscht, und mit einem geschickten Helfer an den Manualen kann er seine Aufgabe pflichtgemäß erfüllen und bei einer großen Orgel und günstigen Klimabedingungen auch Befriedigung in seiner Arbeit erfahren.
A. P. Oosterhof und A. Bouwman, Orgelbaukunde
Eine Reise um die Welt
In dichtem Nebel stießen 1980 bei Winsum zwei Blaue Engel zusammen. Neun Tote, einundzwanzig Verletzte. Eine der Toten war Lore. Seitdem habe ich, wenn ich mit dem Zug unterwegs bin, die wegen ihrer Farbe sogenannten Blauen Engel möglichst vermieden. Jetzt ließ es sich allerdings nicht umgehen. In Godlinze nahm ich am Montag, nachdem ich im Laufe des Vormittags meine Arbeit dort vollendet hatte, den Bus nach Loppersum. Dann stieg ich in den Blauen Engel nach Groningen um. Ich hatte fünf Minuten Zeit, um in den Zug nach Amsterdam umzusteigen, musste dafür aber zu einem anderen Bahnsteig. Ich kam gerade noch rechtzeitig und landete in einem neuen, wegen der Form der Lokomotive sogenannten Hundekopf. In Zwolle wurde der Hundekopf aus Leeuwarden angekoppelt, und danach raste der Zug durch die Heidelandschaft Veluwe. In Amersfoort musste ich nur zum gegenüberliegenden Gleis gehen und dort den Schnellzug – natürlich ebenfalls ein Hundekopf – nach Rotterdam nehmen.
Es kommt nicht oft vor, dass die Firma Auerbach & Wüste mich für so einen großen Auftrag so weit in die Ferne schickt. Und mich wundert es auch, dass ich ihn angenommen habe. In Ostfriesland gibt es schließlich genug zu tun, und noch dazu lässt es sich in Norddeutschland angenehm arbeiten. Garantiert äußerst höfliche, freundliche Menschen. Nette kleine Hotels. Und immer kann man dort gut essen und trinken, der unvermeidlichen Bratwurst zum Trotz. Seltsam, dass die Menschen in Ostfriesland, Luftlinie nicht weit von Groningen entfernt, so viel netter und zuvorkommender sind als die Groninger. Denn auch wenn man reimt: »Schön, wie die gold’nen Ähren sprießen, schuf Gott die Drenter, Groninger und Friesen, und aus der Spreu und andren Resten, schuf er die Drecksäcke im Westen«, kann man nicht sagen, dass Drenter, Groninger und Friesen wirklich nette Menschen wären. Ostfriesen, das sind nette Menschen. Groß gewachsen durch die Bank und, o, was für schöne, platinblonde Frauen! Mit einer dieser Frauen, aus Norden stammend, Serviererin in meinem Hotel, bin ich, als ich mich dort wegen des bis dahin größten Auftrags in meiner noch jungen Laufbahn gut einen Monat aufhielt, nach Feierabend durch die verlassenen Straßen geschlendert. Als ich dann wieder daheim war, in meinem Haus in der Geuzenstraat in Heiligerlee, habe ich vergeblich versucht, sie zu vergessen. Und so habe ich die Grenze noch einmal überquert und ihr kurzerhand kühn einen Antrag gemacht. Sie sah mich, Tränen schossen ihr in die Augen, sie brachte kein Wort mehr über die Lippen, und schließlich nickte sie in einem fort mit dem hübschen kleinen Kopf, um den der Schöpfer verschwenderisch viele, sehr helle, fast weiße Locken angebracht hatte.
Wie sich zeigte, liebte Lore Gesellschaft, während ich ein Einzelgänger bin; wir passten also nicht zueinander. Dennoch kommt es mir so vor, als sei mein Leben zum Stillstand gekommen. Nach ihrem Tod habe ich, von Natur aus alles andere als reiselustig, einen Auftrag in Mariana, Brasilien, angenommen. Was für ein Ritt! Und welch unglaublicher Aufwand, meine Arbeit dort einigermaßen befriedigend zu erledigen. Nun ja, das war auch in Porto und Faro so gewesen. Portugal – herrliche Weine, köstliche Mahlzeiten mit deliziösem Bacalhau, das schon, doch einmal und nie wieder, denn was man dort an Orgeln vorfindet, ist entsetzlich schlecht gepflegt und kann daher auch nicht mehr so recht in Ordnung gebracht werden.
In Rotterdam stieg ich um. Bei dem am Gleis wartenden Zug handelte es sich um eine sogenannte Mausenase, was mich verwunderte, denn soweit ich wusste, war die Mausenase 1984 außer Dienst gestellt worden. Wurde auf den Nachtverbindungen etwa noch heimlich mit der Mausenase gefahren? Oder fehlte es der Bahn an Material, und man hatte eine alte Mausenase aus dem Eisenbahnmuseum geholt? So wie viele Männer, die klassische Musik lieben, interessiere ich mich auch brennend für Züge und Straßenbahnen. Dafür muss man sich wirklich nicht schämen. Auch der Komponist Antonín Dvořák war ein Eisenbahnenthusiast. Seinen zukünftigen Schwiegersohn, Josef Suk, eines der größten Talente der tschechischen Musik, hat er einmal losgeschickt, um am Prager Bahnhof die Nummern der dortigen Lokomotiven zu notieren. In Suks Augen war dies ein verrückter Auftrag, und er kehrte mit einer falschen Nummer zu seinem Schwiegervater in spe zurück. Der rief zornig: »Die Nummer kann nicht richtig sein, diese Lokomotive fährt jetzt in der Gegend von Brünn.« Seine Tochter Otylka hat er daraufhin davor gewarnt, diesen Trottel von Suk zu heiraten. Otylka aber lachte ihren Vater aus und nahm Suk dennoch zum Mann. Als sie 1905, kurz nachdem ihr Vater im Jahr zuvor verschieden war, an Herzversagen starb, war Suk untröstlich. All sein Frohsinn, der für so viele prachtvolle Momente in seinen frühen Werken gesorgt hatte, etwa in dem entzückenden Scherzo fantastique, war Vergangenheit. Stattdessen komponierte er vier schmerzvolle, großartige Orchesterwerke à la Mahler. Trauerarbeit, wie es sie nie zuvor und nie wieder danach in der klassischen Musik gegeben hat.
Was ich sah, als ich mit der muffig riechenden, keuchenden und klappernden Mausenase unterwegs war, erstaunte mich. Angeblich sind die Menschen im Westen ja wohlhabender als in Groningen, doch was ich zu Gesicht bekam, war grau und verfallen, und je weiter wir in Richtung Nordsee ächzten, umso schlimmer wurde es. Die Mausenase hielt an, fuhr wieder los, hielt erneut und fuhr dann im Zuckeltrab zwischen potthässlichen, vollkommen verfallenen Lagerschuppen hindurch. Immer langsamer kroch sie über die Schienen. Fast schien es so, als wäre das Absicht: Werte Fahrgäste, sehen Sie, das ist nun das wohlhabende Rhein-Maas-Delta. So farblose Lagerschuppen, kaputte Ziegeldächer, verwitterte Simse und verwahrloste Schornsteine hatte ich noch nirgendwo gesehen, ganz zu schweigen von dem grauen, schäbig zwischen den Steinen aufsprießenden Gänsefuß. Welch eine Trostlosigkeit, dachte ich, und dann erschienen auf den Zugfenstern auch noch glitzernde Regentropfen. Draußen nieselte es offenbar. Es war Ende September, doch es wirkte wie Ende November. Nachdem wir über eine Hafenbrücke gerumpelt waren, hielt der Zug erneut. Musste ich hier schon aussteigen? Nein, noch nicht. Am nächsten Bahnhof. Die Türen öffneten sich, ein unangenehmer, scharfer Wind wehte herein. Reisende stiegen fröstelnd ein. Der Schaffner schloss die Türen, die Pfeife ertönte, die Mausenase setzte sich wieder in Bewegung. Tatsächlich, es folgte tatsächlich noch ein Stück Polderland, auch wenn es nicht im Entferntesten an den weitläufigen Johannes Kerkhovenpolder in Ostgroningen erinnerte, wo ich aufgewachsen bin. Alles war hier kleiner, dumpfer. Ich sehnte das Ende meiner Reise herbei. Seit meiner Abfahrt in Godlinze waren jetzt gut sechs Stunden vergangen. Es wurde bereits dunkel, der Abend begann.
Mir gegenüber saßen zwei hoch aufgeschossene Burschen, die über eine Tätowierung auf dem Rücken diskutierten. Was sollte es werden, ein Fisch oder ein Vogel? Der Kleinere der beiden sprach sich für einen Vogel aus.
»Und welchen Vogel willst du dir stechen lassen?«, fragte sein Kumpel.
»Einen orangefarbenen Stärling mit knallgelbem Schnabel.«
»Ach, ich nehme lieber einen Kreuzwels. Damit zeigt man zumindest, wofür man steht.«
»Schon, aber so ein Kreuzwels ist furchtbar teuer.«
»Ein Stärling etwa nicht? Allein der Scheißschnabel kostet dich jede Menge Kohle.«
»Beim Kreuzwels musst du für jede einzelne Schuppe blechen.«
»Und beim Stärling für jede Feder.«
So stritten sie sich in einem fort. Selten habe ich zwischen den Schienen ein so merkwürdiges Gespräch gehört.
Als die Mausenase ihre Fahrt wieder verlangsamte, standen etliche Fahrgäste plötzlich auf und machten sich auf den Weg zur Spitze des Zuges. Wollten die alle unbedingt vorne aussteigen? Aber wieso? Quietschend bremste die Mausenase. Nachdem wir an einem Friedhof vorbeigefahren waren, tauchte die Bedachung eines Bahnhofs auf. Wir schoben uns darunter, und die Mausenase kam knirschend zum Stehen. Die Fahrgäste rissen die Türen auf, sprangen hinaus und rannten davon. Ich beobachtete das Ganze und wunderte mich. Dass man rennt, um einen Zug noch zu bekommen, ja, das hat eine gewisse Logik. Aber dass man rennt, nachdem man aus einem Zug ausgestiegen ist … das war mir ein Rätsel. Dennoch hasteten diese Menschen davon, als würden sie verfolgt. Im wilden Galopp brausten sie den Bahnsteig entlang Richtung Ausgang. Ich verspürte eine Art Drang, ein Kribbeln mitzurennen, doch ich widerstand ihm. Solange nicht klar war, warum all die Leute, fast wie in blinder Panik, zum Ausgang flitzten, erschien es mir unsinnig, es ihnen gleichzutun. Es brannte doch nicht? Nein, es war kalt, und es regnete in Raten. Es herrschte trübes Wetter, und ein merkwürdiger, wenig angenehmer Geruch zog mir in die Nase. Dann senkten sich am Ausgang ganz langsam die Schranken, und etwa ebenso langsam dämmerte mir, warum die anderen Fahrgäste sich so beeilt hatten. Man wollte noch vor Schließung der Schranken vom Bahnsteig herunter sein. Denn sonst würde man warten müssen, bis der Zug, mit dem man gekommen war, seine Fahrt fortgesetzt hatte. Und das erforderte viel Geduld, wie sich nun zeigte, denn die elende Mausenase stand einfach da, ohne irgendwelche Anstalten zur Abfahrt zu machen. Der Schaffner schlenderte am Zug auf und ab, schloss hier und da eine Tür und wartete offenbar auf ein Zeichen des Stationsvorstehers, der aus dem grauen Bahnhofsgebäude getreten war.
So geschah es, dass ich mutterseelenallein unter einer dichten Wolkendecke im Nieselregen vor den geschlossenen Schranken stand. Auf der anderen Seite der Gleise war niemand mehr zu sehen, alle ausgestiegenen Fahrgäste hatten sich auf den drei Straßen, die zum Bahnhof führten, im Handumdrehen aus dem Staub gemacht.
Die schrille Pfeife des Schaffners ertönte. Wahrhaftig, es tat sich doch noch etwas, aber, ach, wie langsam rumpelte die Mausenase vorüber, und ebenso langsam hoben sich die Schranken. Ich überquerte die Gleise und betrat den Bahnhofsvorplatz. Wohin jetzt? Nach links, in die dunkle Platanenallee? Oder geradeaus, auf die schwarze Silhouette der Kokerwindmühle zu? Oder nach rechts zum Friedhof, an den Gleisen entlang? Es war niemand da, den ich nach dem Weg hätte fragen können. Wo ich hinmusste, hatte ich auf einen Zettel geschrieben, der längst wieder verloren gegangen war. Doch das war kein Problem. Weil ich es mir aufgeschrieben hatte, war es mir im Gedächtnis geblieben. Seemannsheim, auf der Wip. Die war in der kleinen Stadt ganz offenbar die einzige Übernachtungsmöglichkeit. Wieso aber gab es keinen ordentlichen Straßennamen? Wieso nur die vage Andeutung »auf der Wip«? Und was sollte das überhaupt bedeuten? War es möglich, dass es in der Stadt eine Straße namens Wip gab? Das erschien mir recht unwahrscheinlich. Und selbst wenn dem so war, wäre da doch niemand gewesen, den ich nach dem Weg hätte fragen können. In manchen Städten stehen Taxis am Bahnhof, oder es gibt einen spärlich beleuchteten und bewachten Fahrradunterstand, in den man hineingehen und eine Frage stellen kann. Hier jedoch konnte von Betriebsamkeit, von Taxis oder einem Fahrradunterstand gar keine Rede sein. Und es näherte sich auch niemand, um mit dem Zug zu fahren. Totenstille, wenn man einmal von dem trostlosen Geräusch absah, das ein Plastikkaffeebecher verursachte, der vom Wind über den Bahnhofsvorplatz geweht wurde. Gestank. Halbwüchsiger Regen. Zunehmende Dunkelheit.
Was tun? In der Ferne bemerkte ich einen Kirchturm. In diese Richtung also? Nach links, die unheimlich finstere Allee entlang? Ich ging los und sah rechts von mir die Rückseiten verfallener Häuser mitsamt ihren farblosen Veranden. Als ich am Ende der Allee angekommen war, stand dort ein Fahnenmast, der mit einer doppelten Schnur versehen war. Schon bei der sanftesten Brise schlägt ein solches Tau mit einem recht kläglichen, unheimlichen Geräusch gegen den hölzernen Mast und halst einem Gefühle der Trauer und Vergeblichkeit auf. Dort, wo ich am Fuße des Fahnenmasts stehen geblieben war, konnte man links abbiegen und erneut die Gleise überqueren, man konnte rechts eine Straße nehmen, die ein Stück weiter als Sackgasse zu enden schien, geradeaus musste man über eine Brücke gehen, oder man spazierte schräg rechts an einem Binnenhafen entlang in Richtung Kirche. Ich vermutete, dass die Kirche im Zentrum des Städtchens stand. Sollte ich mich also dorthin wenden? Ich ging am matt glänzenden Wasser entlang und stellte fest, dass der Gestank, der mir schon zuvor aufgefallen war, immer stärker wurde. Was für ein Mief! Lebte man hier denn immer in diesem widerlichen Gestank?
Als ich die Straße namens Haven halb durchschritten hatte, tauchte plötzlich aus einem Seitensträßchen, das laut einem an der Mauer befindlichen blauen Schild mit weißer Schrift Wijde Slop hieß, ein groß gewachsener Bursche auf.
»Kann ich dich etwas fragen?«, rief ich.
»Was gibt’s?«, erwiderte der schmierige Kerl.
»Wo ist das Seemannsheim?«
»Da«, sagte der Junge und deutete in die Richtung eines vornehmen, großen Hauses mit einem Türmchen.
»Ist das das Seemannshaus?«
»Hab ich das gesagt? Nein, Mann, das ist nicht das Seemannsheim, das ist das alte Rathaus, das Seemannsheim liegt dahinter, auf der Wip. Du findest es von selbst, wenn du vor deinem Arsch herläufst.«
Mir war nicht ganz klar, was der Bursche mit der rätselhaften Wendung »vor deinem Arsch herläufst« meinte (bedeutete sie so etwas wie »der Nase nach gehen«?), aber ich stiefelte los und sah, dass sich der Hafen links von mir zu einem großen Becken erweiterte. Am gegenüberliegenden Ufer ragte die Kirche empor, deren Turm schon vom Bahnhof aus zu sehen gewesen war. Was für ein imposanter Steinhaufen, dachte ich, und ging am alten Rathaus vorbei, überquerte die Straße und sah mit einem Mal auf einem kleinen Schild über dem Schaufenster einer Bäckerei »Wip« stehen. Ein Stück weiter bemerkte ich eine weiße Fassade, auf der mit großen Buchstaben das Wort »SEEMANNSHEIM« angebracht war. Neben der Eingangstür hing ein kleines Schild mit der Aufschrift »INHABER: J. BOETEKEES«. Was für ein sonderbarer Name, dachte ich.
Die Eselin des Bileam
Vorsichtig drückte ich gegen die Tür des Seemannsheims. Tatsächlich, sie war offen, ich brauchte nicht zu klingeln. Doch als ich, nachdem ich durch eine der Türen in der kleinen Eingangshalle, von der eine Treppe nach unten und eine nach oben führte, in den Schankraum des Seemannsheims gelangte – oder was immer es auch sein mochte –, da starrte mich von hinter der Zapfanlage ein mürrisch wirkender Mann misstrauisch an. Auf seinem Nasenrücken ruhte eine riesige Brille, in der die Gläser fehlten. War das der Inhaber J. Boetekees?
»Was willst du?«, schnauzte der Mann und wischte dabei, ohne seinen giftigen Blick durch das glaslose Brillengestell von mir zu wenden, heftig mit einem grauen Lappen die Zapfanlage ab.
»Ich bin hier …«
Ehe ich zu Ende sprechen konnte, tauchte eine kräftige rothaarige Frau mit einer geblümten Schürze auf.
»Das ist natürlich der Bekannte von Krijn, der hier übernachtet.«
»Ich weiß von nichts«, knurrte der Mann.
»Natürlich weißt du das, stell dich nicht so blöd an, Krijn Lagrauw war vorgestern hier, um uns noch einmal daran zu erinnern.«
»Halt, warte … Aber das sollte … das sollte doch …«
»Was willst du sagen? Das sollte doch ein feiner Herr sein, während dies eher ein netter Habenichts ist?«
»Nein, nein, ich habe nur einen Herrn mit Koffern erwartet … Woher soll ich …«
»Na, dieser Globetrotter hat doch eine Art Weekender dabei.«
»Weekender? Weekender, Mensch, Sjaan, wo hast du dieses Wort denn plötzlich her? Einen Seesack, willst du wohl sagen.«
»Krijn Lagrauw?«, fragte die Frau mich. »Sagt Ihnen das was?«
»Ja, das ist meine Kontaktperson hier«, erwiderte ich, »den hatte ich am Telefon.«
»Fein. Dann werde ich Ihnen sogleich Ihr Zimmer zeigen. Dort können Sie sich dann ein wenig frisch machen, denn Sie sehen aus, als hättest du den ganzen Tag hinter einem Müllwagen geschuftet.«
Es wunderte mich, dass ich plötzlich mitten im Satz geduzt wurde, doch ich ließ mir nichts anmerken. Stattdessen fragte ich: »Und kann ich hier dann auch eine Kleinigkeit essen?«
»Das ist nicht im Preis inbegriffen«, knurrte der Mann mit dem grauen Geschirrtuch.
»Wir können jederzeit einen Strammen Max für dich braten«, sagte die Frau, »mit einer Scheibe Brot oder, wenn du mehr willst, Kartoffeln mit einem Röschen Blumenkohl und einem Schnitzel zubereiten. Dann hole ich schnell was auf dem Zuidvliet, der Laden dort hat sowieso lang auf, und was das Geld angeht, das regle ich schon noch mit Krijn, das wird schon nicht so teuer werden. Du kannst auch zum Lunchroom Strijbos tappern, der ist hier um die Ecke, auf dem Markt, da gibt es eine Portion Pommes und dazu eine saftige Bulette.«
»Würde ich machen«, sagte der Mann hinter dem Tresen, »denn nachher haben wir alle Hände voll zu tun. Dann ist hier die Versammlung der Vereinigung Schrift und Bekenntnis.«
»Ja«, bestätigte die Frau, »die Herrschaften tagen einmal im Monat an einem Donnerstagabend bei uns.«
»Die machen Bibelstudien«, ergänzte der Mann, »und ganz ausnahmsweise treffen sie sich heute einmal nicht am Donnerstag. Das kann man im Kalender rot anstreichen …«
»Worüber die reden, ist oft total bekloppt«, sagte die Frau, »aber schaden tut es bestimmt nicht, wenn man ein offenes Ohr dafür hat, auch wenn es immer ziemlich bedeutungsvoll zugeht. Sie fangen schon um sieben an, denn unser alter Bürgermeister Schwarz nimmt stets an dieser Runde teil, und der will gerne beizeiten ins Bett. Gleich kommen sie. Doch mach du dich erst mal frisch, und dann brate ich dir zwei Spiegeleier mit zwei Scheiben Milchweißbrot dazu, und damit setzt du dich einfach in die hinterste Ecke … Da störst du nicht, und du kannst dennoch alles hören und genießen. Oder willst du vielleicht lieber FGK?«
»FGK, was ist das?«
»Kennst du das nicht? Wo kommst du denn her? Das ist gutbürgerliche Küche: Fleisch, Gemüse, Kartoffeln.«
»Wenn es nicht zu viele Umstände macht …«
»Ach was, das ist keine große Sache. Folge mir.«
Sie führte mich in ein unansehnliches Hinterzimmer mit Blick auf verwitterte Dächer und den kümmerlichen Turm einer anderen Kirche, dessen Kupferbeschlag sich grün gefärbt hatte. In dem Raum standen ein eisernes Bettgestell mit einer schmuddeligen Tagesdecke, eine Waschschüssel und eine mit Wasser gefüllte Kanne. Meine Werkzeugtasche legte ich auf die Tagesdecke. Ich spritzte mir ein wenig Wasser ins Gesicht und widerstand dem Drang, mich kurz aufs Bett zu legen. Sonst würde ich nach der langen Zugfahrt Schwierigkeiten haben, wieder aufzustehen. Außerdem musste ich unbedingt zur Toilette.
Als ich, durch einen unglaublich engen Flur, dort angelangt war, erinnerte ich mich, eben weil der Flur so eng war, an die Seitenstraße namens Wijde Slop. So etwas nannte man doch vornehm eine Contradictio in adiecto, denn per Definition war ein Slop, was nichts anderes als Gasse bedeutet, eng; eine weite Gasse, das war also ausgeschlossen, und die Seitenstraße war tatsächlich nicht breiter gewesen als eine normale Gasse. Also was nun, breit oder Gasse? Tja, wenn die Menschen hier nicht rannten, um den Zug zu erreichen, sondern im Gegenteil, um so schnell wie möglich vom Bahnsteig wegzukommen, und wenn man hier Brillen ohne Gläser trug, dann durfte man sich über ein Paradox wie Wijde Slop wohl nicht wundern.
Als ich zurück in den Schankraum kam, waren dort bereits rund zwanzig Männer versammelt, größtenteils, so mein Eindruck, einfache Handwerker, allerdings im Sonntagsanzug mit unlängst hineingebügelter Falte in den unförmigen Hosen und reihum mit Sicherheitskrawatten geschmückt. Es wunderte mich, dass man solche Krawatten, die auch Clipkrawatten genannt werden, überhaupt noch trug. Während die rothaarige Frau mich in einer Art Nische verbarg, hörte ich, wie die Versammlung eröffnet wurde. Ein Begrüßungswort, ein nicht gereimter Psalm aus der Bibel, feierlich vorgetragen von einem Mann mit schwarzen Bartstoppeln, der Bruder van Vuuren genannt wurde, ein Gebet, in dem der Segen des Allerhöchsten auf diese Versammlung herabgefleht wurde, gefolgt von Psalm 19, Vers 4 a cappella (mit ungewollten, kanonartigen Verzierungen), das Protokoll der letzten Versammlung, und dann erhielt Bruder Koevoet das Wort. Er werde, so kündigte er an, über den Esel des Bileam sprechen.
Und während mir die Frau ein wenig verstohlen einen Teller mit einem ziemlich großen Schnitzel, grünen Bohnen anstatt der versprochenen Blumenkohlröschen und merkwürdig blassen, fast weißen, auffällig mehligen Kartoffeln reichte, hörte ich einen ebenso unterhaltsamen wie geharnischten Vortrag über die Ungläubigen, die die Frechheit besaßen, am Wahrheitsgehalt der Geschichte über den Esel in Numeri 22 zu zweifeln – nein, nein, die Eselin, betonte Bruder Koevoet, die, wie er in Klammern hinzufügte, bereits auf die Eselin vorauswies, auf der Jesus beim Einzug in Jerusalem geritten war, kurzum, die, nachdem sie dreimal von Bileam geprügelt worden war, gesagt hatte: »Was habe ich dir getan, dass du mich nun geschlagen hast dreimal?«
Und ich saß da, in meiner Nische, schaute auf die fast durchsichtigen Kartoffeln, die so blass wie Briefpapier wirkten, und dachte: Was für ein Ort, wo bin ich hier in Gottes Namen bloß gelandet? Und das zudem noch mit einer Mausenase, wo die Mausenasen doch längst außer Dienst gestellt sind. Glauben all diese in ihre ordentlichen Sonntagsanzüge gesteckten Lohnabhängigen denn wirklich, dass es einst eine Eselin gab, die ihr Maul geöffnet hat, um eine – im Übrigen berechtigte – Frage zu stellen? Aber dann, nachdem Bruder Koevoet zu Ende gesprochen hatte, traute sich doch ein noch recht junger Mann, unverblümt zu bemerken: »Dieser Bileam war dort ganz allein mit seinem Esel. Niemand war dabei. Wer weiß, möglicherweise hat sich der sture Bileam die ganze Geschichte nur aus den Fingern gesogen. Niemand kann den Vorfall bestätigen, denn, wie schon gesagt, es war niemand dabei.«
Tumult im Saal. Was spiele das schon für eine Rolle? Es stehe in der Heiligen Schrift, der Heilige Geist sei schließlich zugegen gewesen, und der habe dafür gesorgt, dass die Ereignisse, inklusive des Engels des Herrn, der dabei eine so aufsehenerregende Rolle gespielt habe, wahrheitsgetreu im Bibelbuch Numeri festgehalten worden seien. Außerdem stehe in 2. Petrus 2, Vers 16, im Neuen Testament also, dass das stumme lastentragende Tier mit Menschenstimme geredet habe.
Hastig ein paar Bohnen aus der Konservendose herunterschluckend, dachte ich: Die sind verrückt, die Brüder, aber am verrücktesten ist immer noch, dass sie nicht einmal ihre Bibel genau kennen, denn in Kapitel 22 steht doch deutlich, dass Bileam in Begleitung von zwei Jungen war. Da konnte ich mich nicht mehr zurückhalten, trat also aus meiner Nische und sagte: »Nehmen Sie es mir nicht übel, werte Brüder, dass ich mir die Freiheit nehme, etwas beizutragen. Der junge Bruder von vorhin sagte, es sei niemand dabei gewesen, als die Eselin das Wort ergriff, doch in Numeri 21 steht glasklar: ›Er aber ritt auf seiner Eselin, und zwei Knechte waren mit ihm.‹«
Totenstille im großen Saal des Seemannsheims. Dann Rascheln und Blättern in den mitgebrachten Taschenbibeln. Schließlich erklang die Stimme des Mannes, der als Vorsitzender aufgetreten war.
»Ja, das steht dort. In Vers 22.«
»Numeri 22, Vers 22, leicht zu merken«, sagte Bruder Koevoet, »und vielen Dank, wer immer Sie sein mögen.«
Dies war, wie ich wohl wusste, eine Einladung, meinen Namen und meine Antezedenzien zu offenbaren und auch gleich zu verraten, warum ich dort, in diesem Seemannsheim, mit FGK bewirtet wurde. Doch ich hatte keine Lust, meinen Namen preiszugeben, denn ich weiß aus Erfahrung, dass der meist als Anlass zu heimlicher Heiterkeit aufgefasst wird.
Zum Glück stellte Bruder Koevoet eine weitere Frage: »Was führt Sie in unseren Ort? Wohnen Sie hier im Haus?«
»Ja, ich werde hier wohl einige Tage wohnen, denn ich habe den Auftrag, die Garrels-Orgel in der Groote Kerk zu stimmen. Ich vertrete den angestammten Stimmer der Firma Pels & Van Leeuwen, denn der ist offenbar schon seit einiger Zeit krank. Ich schätze, ich werde vier, fünf Tage damit zu tun haben, es sei denn, es gibt viele überfällige Wartungsarbeiten; dann wird es wohl etwas länger dauern.«
»Sie kommen wie gerufen«, sagte Bruder van Vuuren, »neulich war davon die Rede, dass jetzt, wo es so langsam anfängt, Winter zu werden, die Orgel in der Immanuëlkirche unbedingt durchgeschaut werden muss. Könnten Sie sich diese Orgel auch gleich mal vornehmen? Dann kümmere ich mich als Präses des Kirchenrats darum, dass Sie den Auftrag bekommen, jetzt, wo Sie schon mal da sind.«
»Was ist das für eine Orgel?«
»Tja, das kann ich so aus dem Stand nicht sagen, aber es handelt sich um die Orgel der orthodox-reformierten Immanuëlkirche, sie ist von nach dem Krieg und kommt aus Deutschland.«
»Es handelt sich um eine Seifert-Orgel mit dreiundvierzig sprechenden Stimmen«, warf einer der anderen Brüder ein.
»Das ist ein großes Instrument«, erwiderte ich, »und eigentlich stimme ich keine modernen Orgeln. Ich bin Spezialist für Schnitger-Orgeln, und für Orgeln von Schnitger-Schülern. Die Orgel hier in der Groote Kerk wurde von Rudolf Garrels gebaut, einem der besten Schüler Schnitgers.«
»Für jemanden, der jahrhundertealte Schnitger-Orgeln stimmen kann, ist so eine schöne, moderne Orgel doch eine Kleinigkeit, nicht?«
»O ja, ich bin absolut in der Lage, die Orgel kurz durchzusehen, und ich will das auch durchaus tun, wenn der Kirchenrat mir den Auftrag erteilt. Wenn ich schon einmal hier bin.«
»Wir bringen die Sache auf den Weg«, sagte Bruder van Vuuren begeistert. »Ich werde es gleich morgen Abend im Kirchenrat ansprechen. Und welchen Namen darf ich dann nennen?«
Der Augenblick war gekommen, jetzt musste ich und kam nicht länger darum herum:
»Gabriel Pottjewijd.«
Es hielt sich in Grenzen. Fand man ein »breites Töpfchen« hier nicht sonderbar? Oder wurde doch gelacht? Setzte das leise Kichern hier nur langsamer ein als anderswo? Ich tat so, als hörte ich nichts, und sagte: »Darf ich den Mitgliedern der Vereinigung, die, wie mir zu Ohren kam, Schrift und Bekenntnis heißt, noch etwas anderes im Hinblick auf Bileam vorlegen, das mich schon beschäftigt hat, als ich noch klein war?«
»Nur zu, Bruder Pottjewijd«, sagte van Vuuren.
»Bileam schlägt seine Eselin dreimal. Nachdem das arme Tier zum dritten Mal geschlagen wurde, fragt es: ›Was habe ich dir getan, dass du mich geschlagen hast nun dreimal?‹ Das Huftier kann also zählen. Und dann sagt Bileam: ›Dass du mich höhnest‹, und fügt noch hinzu: ›Ach, dass ich jetzt ein Schwert in der Hand hätte, ich wollte dich erwürgen!‹ Angenommen, man sitzt auf einem Esel oder einer Eselin, und man schlägt das Tier dreimal, und nach dem dritten Mal sagt das Tier: ›Was habe ich dir getan?‹ Wie würde man darauf zu allen Zeiten reagieren?«
An den sitzenden Brüdern vorbei ging ich durch den Schankraum nach vorne. Ich schaute in all die mir zugewandten treuherzigen Gesichter und fragte noch einmal: »Wie würde man reagieren, wenn ein Tier plötzlich mit einem spricht?«
Es wunderte mich, dass niemand antwortete. Offenbar hatte kein einziger dieser frommen Männer jemals über diese einfache Frage nachgedacht, auf die es offensichtlich nur eine Antwort geben konnte.
»Ich weiß ganz genau, wie ich reagieren würde«, sagte ich. »Ich wäre so erstaunt, dass es mir die Sprache verschlagen würde. Oder schlimmer noch, ich würde mich zu Tode erschrecken. Und ich kann mir keinen Menschen vorstellen, der nicht vollkommen perplex wäre. Ein Tier, das, wie sich plötzlich zeigt, sprechen und zählen kann! Das ist unglaublich! Das ist doch ein Weltwunder. Aber dieser Bileam findet es anscheinend völlig normal, dass seine Eselin sprechen und zählen kann. Er ist ganz und gar nicht verwundert, mehr noch, er sagt, hätte er ein Schwert, würde er seine Eselin – wohlgemerkt das Tier, das plötzlich sprechen kann – am liebsten töten. Ich weiß noch, dass ich als Kind unter den Zuhörern von Pastor Meijnen aus Utrecht war, einem orthodox-reformierten Prediger. Der predigte über Bileam, und er fand es offenbar auch nicht sonderbar, dass Bileam nicht verblüfft war, denn er sprach mit keinem Wort davon. Damals dachte ich – ich schätze, ich war etwa zehn Jahre alt –, eigentlich kann es nur einen einzigen Grund dafür geben, dass Bileam sich nicht darüber wundert, dass seine Eselin sprechen kann …«
Ich schaute in die Runde der ernst lauschenden Brüder und fragte mich: Wie ist es bloß möglich, dass all diese Männer dieses verrückte, unwahrscheinliche Bibelmärchen so widerstandslos akzeptieren? Wie kann das sein? Sprechende Schlangen, Wände aus Wasser, schwimmende Beile, sprechende Esel, mit einem Mal rückwärts laufende Uhren, Jona drei Tage im Bauch eines Fischs, Raben, die das Frühstück bringen, ja, sogar die ganze Welt, die einfach angehalten wird, als wäre es nichts, eine wundersame Speisung, Spaziergänge auf dem Wasser, die Auferstehung von den Toten – heiliger Bimbam, die ganze Bibel voller Unsinn und Ammenmärchen, und doch wird alles anstandslos geglaubt.
Ich wiederholte es noch einmal: »Dass Bileam sich nicht wundert, dass seine Eselin sprechen kann, und nicht erstaunt ist darüber, ja mehr noch, dass er sie sogleich töten will … Tja, das kann doch nur eins heißen: Er fand es vollkommen normal, dass sie das Wort ergriff, denn sie hatte ihn früher schon des Öfteren, wenn sie geschlagen worden war, gefragt: ›Warum schlägst du mich?‹«
Stabat Mater Dolorosa?
Vorsichtig schlug ich die Decke und das Laken beiseite und kroch ins Bett. Sofort kam es mir so vor, als würde ich versinken. Nicht die allerbeste Matratze, dachte ich. Ich sank tiefer und tiefer, es schien fast, als würde das Versinken nie ein Ende haben. Irgendwann war die Elastizität dann aber doch erschöpft, und die Kuhle in der Matratze war so tief, dass es tiefer nicht mehr ging. Doch die eigenartige Empfindung des Immer-tiefer-Sinkens blieb. Das muss wohl eine Art Sinnestäuschung sein, dachte ich. Aber egal, wie mies die Qualität einer Matratze ist, letztendlich ist am Boden, auf dem das Bett steht, Schluss. Dann kann man nicht noch tiefer sinken. Und dennoch – ich sank immer weiter, immer tiefer. Ich zog in Erwägung aufzustehen und nachzusehen, ob irgendwas mit der Matratze nicht stimmte, aber der mit Nichtstun verbrachte Tag hatte mich so ermüdet, dass ich es nicht über mich brachte, mich zu erheben. Also blieb ich liegen, sank tiefer und sagte mir: Ich sinke nicht mehr, es hat nur den Anschein, als würde ich sinken. In diesem fürchterlichen Ort ist schließlich nichts so wie sonst, hier rennen die Menschen nicht, um einen Zug zu erreichen, sondern sie laufen los, sobald sie ausgestiegen sind, hier kann man auf der Wippe übernachten, hier trägt man Brillen ohne Gläser, hier glaubt man noch uneingeschränkt an sprechende Eselinnen, die zählen können.
Nach meiner Bemerkung über das große Erstaunen, das einen erfüllen müsste, wenn ein Tier plötzlich zu sprechen begänne, und meiner These, dass Bileam deshalb nicht verwundert gewesen war, weil er schon öfter erlebt hatte, dass seine Eselin das Wort ergriff, hatte es eine heiße Diskussion über die Frage gegeben, ob man sich tatsächlich wundern würde, wenn ein Tier auf einmal mit einem spräche.
»Ich selbst habe zwei tolle Esel«, hatte einer der Brüder gesagt, »und ich verstehe immer, was sie wollen und was sie nicht wollen. Sie plappern mit ihren Ohren. Auch miteinander. Wenn man mit ihnen zugange ist und scharf auf den Stand der Ohren achtet, ist man so daran gewöhnt, genau zu wissen, was in ihnen vorgeht, dass man sich wirklich nicht wundern würde, wenn eines der Tiere plötzlich etwas sagte. Schließlich reden sie die ganze Zeit mit einem.«
Ein anderes Mitglied der Vereinigung hatte die Ansicht vertreten, dies gelte auch für Hunde. »Die sind ein offenes Buch für jeden, der genau hinschaut. Ein Hund sieht dich auf eine bestimmte Art und Weise an, und dann weißt du genau, was er meint: ›Herrchen, es ist Essenszeit, wo bleiben meine Hundebrocken?‹ Oder: ›Herrchen, ich will raus, nimm mich an die Leine und komm mit. Herrchen, halt dich zurück, lass deine Frau ruhig reden.‹ Und sie reden ja nicht nur mit den Augen, sondern auch mit ihrem Schwanz.« Diese Beobachtung erntete große Zustimmung.
Ein anderer Bruder hatte seine Erfahrungen mit Pferden ausführlich mit den Brüdern geteilt. Auch die kommunizierten offenbar mit den Ohren. Ohren weit nach vorn: in bester Laune. Ohren weit nach hinten: Angst und Verzweiflung. Wenn ein Pferd schnaubte, dann war es offenbar quietschvergnügt.
Und von Schnauben zu Sprechen sei es schließlich nur ein kleiner Schritt. Also, dass Bileam nicht erstaunt war – nicht der Rede wert.
Ein Bruder mit zwei metallenen Zangen anstelle von Händen hatte eingeworfen, Eva im Paradies sei auch überhaupt nicht verwundert gewesen, als die Schlange zu ihr gesprochen habe. Warum also hätte Bileam verwundert sein sollen?
Ein fünfter Bruder präsentierte keine eigenen Erfahrungen mit Tieren, sagte jedoch: »Dieser Bileam kannte seine Eselin gut, er wusste, wie sie dachte, und natürlich hatte er schon oft von ihr geträumt. Und in diesen Träumen hat sie immer wieder zu ihm gesprochen, sodass Bileam bereits daran gewöhnt war. Im Traum hat auch schon mal ein Tier mit mir geredet.« Daraufhin war ein etwas naiv aussehender, noch jüngerer Bruder aufgesprungen und hatte gestottert: »Ich … ich … hab auauau…auch mal ge…geträumt, dass ein Tier zu mir sagte: ›Job, du siehst sehr gut aus, aber ich selbst habe doch das schönere Gesicht.‹« Worauf ein alter Bruder erwidert hatte: »Von was für einem Tier hast du denn geträumt, Bruder Oosterlee? Von einem Krokodil?«
Und so war es also doch noch ein fröhlicher Abend geworden im Seemannsheim, mit all den Männern der Vereinigung Schrift und Bekenntnis, der schließlich mit einem Gebet und dem Singen von Psalm 19, Vers 6 endete. Auswendig hatte ich in den Psalm, komischerweise mit tränennassen Augen, eingestimmt:
Du gibst von meiner Pflicht,
O Gott, mir klar Bericht.
Ich kenn das Endziel schon:
Wer dir vertraut, Herr dieser Welt,
Und an dein Gebot sich hält,
Der findet großen Lohn.
Doch, Herr, nie kommt der Tag,
An dem man es vermag,
Sein Irren zu ergründen.
O, Bronn der höchsten Güte,
Was reinigt mein Gemüte
Von den verborg’nen Sünden.
Jetzt versank ich endgültig. Hatte ich vielleicht am Ende des Abends, inmitten dieser fröhlichen Brüderrunde, doch ein wenig zu viel jungen Genever getrunken? Wie eigenartig, dachte ich, dass diese strenggläubigen Calvinisten gegen alles Mögliche sind, Tanz, Theater, Kino, Kartenspiel, Kabarett. Bis vor Kurzem verlangten sie von ihren Frauen sogar noch, lange Röcke und beim Kirchgang Hüte zu tragen, und auch von der Sonntagsheiligung weichen sie um keinen Deut ab und spucken Feuer, wenn es um Abtreibung oder Sterbehilfe geht. Nur beim Alkohol pflegen sie eine lockere Moral, und das ist doch wirklich schwer nachzuvollziehen, gerade weil die Bibel recht oft vor Wein und Schnaps warnt. Auch mein Vater, seinerzeit Presbyter der orthodox-reformierten Gemeinde in Heiligerlee-Westerlee, war dem Alkohol durchaus zugetan. Ach, mein Vater! Steinalt jetzt und todunglücklich, weil seine fünf Kinder der Reihe nach vom Glauben abgefallen sind. Allerdings hielt ich, weil ich Orgelstimmer bin und damit auf kirchliche Aufträge angewiesen, ebenso wie viele Organisten (und wahrscheinlich auch nicht wenige Pastoren) den Schein aufrecht und tat so, als sei ich noch gläubig. Ich selbst wäre gern Organist geworden, doch es fehlte mir dazu an Talent, ungeachtet meines absoluten Gehörs, und deshalb habe ich mich für den Beruf des Orgelstimmers entschieden. Nun ja, entschieden, ich bin hineingerutscht. Ein schöner Beruf, man kommt ein bisschen herum, aber das bringt freilich auch mit sich, dass man ständig von zu Hause weg ist und in fremden Betten schlafen muss. Denn eine Orgel stimmt man in der Regel nicht an einem Tag, wenn es sich nicht gerade um so eine schöne kleine Schnitger-Orgel mit acht sprechenden Stimmen wie die in Nieuw-Scheemda handelt. Übrigens sind diese kleinen Instrumente oft derart kompakt gebaut, dass man nirgendwo rankommt.
Ich sank tiefer und hörte immer mehr Schiffshörner, ich hörte das leise Rasseln von Ankerketten, ich hörte Stimmen, und mir war schon klar, dass ich in dieser Nacht nicht allzu gut schlafen würde. Die erste Nacht in einem fremden Bett schlafe ich nie gut, und das seltsame Gefühl des Versinkens spielte mir weiterhin Streiche. Es war, als hätte ich einen Jetlag.
Wie merkwürdig doch, so eine Männervereinigung mit so vielen Mitgliedern, bestimmt dreißig Kerle hatten da am Ende im Schankraum gesessen, dreißig Männer, die offenbar alle – mit einer Ausnahme vielleicht – glaubten, dass eine Schlange und eine Eselin seinerzeit mit menschlicher Stimme gesprochen hatten. Nun ja, als Kind hatte ich auch daran geglaubt, und an all die anderen Dinge, an den feurigen Wagen und die Pferde des Propheten Elia, an die zehntausend Tiere in den Stapelkäfigen in Noahs Arche und sogar an das schwimmende Beil aus 2. Könige 6, über das mein Vater, der doch alles, was in der Bibel stand, mir nichts dir nichts glaubte, immer wieder gesagt hatte: »Ein schwimmendes Beil, nein, das kann nicht sein, da hat man sich verguckt, das war der weiße Bauch eines toten Fischs, der gleich unter der Wasseroberfläche trieb.«
Komischerweise hatte mich aber nicht derartiger Unsinn ins Zweifeln gebracht, sondern das Stabat Mater von Pergolesi. Wie schön hatte ich das gefunden, als ich es mit etwa fünfzehn zum ersten Mal hörte, bei einem Freund zu Hause, auf Schallplatte. Stabat mater dolorosa. Auf der Plattenhülle stand die Übersetzung: »Die zutiefst betrübte Mutter stand weinend beim Kreuz, als ihr Sohn dort hing.« Ja, alles schön und gut, aber wie war Maria so schnell aus Nazareth, wo sie schließlich immer noch wohnte, nach Jerusalem gekommen? Und wie hatte sie erfahren, dass ihr Sohn gekreuzigt werden würde? Wenn sie von Nazareth aus in aller Eile auf einem Esel nach Jerusalem geritten wäre, so hätte sie doch niemals rechtzeitig dort sein können, denn Nazareth liegt (ich habe das auf der Karte nachgemessen) Luftlinie einhundert Kilometer von Jerusalem entfernt, und wenn man der kurvigen Straße folgte (und was sonst hätte sie tun können?), dann waren es fast einhundertfünfzig Kilometer. Oder war sie bereits in Jerusalem? Wenn ja, warum? Und selbst wenn sie bereits in der Stadt war, wie hat sie dann erfahren, dass Jesus gekreuzigt werden sollte? Von wem? Von einem Jünger? Mutter Maria weinend am Fuß des Kreuzes – ach, wie tieftraurig. Aber war es auch wirklich so gewesen? Der einzige Evangelist, der explizit darüber berichtet, dass Mutter Maria am Fuß des Kreuzes gestanden hat, ist Johannes. Pastoren habe ich das Problem vorgelegt und immer dieselbe Antwort erhalten, nämlich dass im Matthäusevangelium gesagt wird: »Und es waren viele Weiber da, die von ferne zusahen, die da Jesu waren nachgefolgt aus Galiläa und hatten ihm gedient. Unter welchen war Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Josef, und die Mutter der Kinder des Zebedäus.«
Voilà, es war doch offensichtlich, Mutter Maria war ihrem Sohn aus Galiläa gefolgt. Befriedigt hatte mich das nicht. Die Mutter Jesu war doch nicht dieselbe Frau wie die Mutter der Kinder des Zebedäus? Nein, irgendwas stimmte da nicht. Stabat mater dolorosa – o, herrlich, und ein Quell der Inspiration für viele Komponisten, nicht nur für Pergolesi: Rossini (welch ein wunderbares Werk), Dvořák (siehe Rossini), Haydn, Vivaldi, Liszt, Rheinberger, Poulenc (auch so ein wunderschönes Stück), Boccherini, Szymanowski – aber es war vollkommen unerklärlich und unbegreiflich, wie Mutter Maria dort am Fuß des Kreuzes hatte stehen können.
Eigenartig, so hatte sich bei mir eine Schraube in der Metallkonstruktion des Glaubens gelöst, und diese lose Schraube hatte zu klappern angefangen, sie ließ sich nicht negieren, und danach hatten sich sukzessive andere Schrauben gelöst, und mit einem Mal war die stabile Metallkonstruktion in sich zusammengestürzt, und ich hatte bestürzt konstatiert: Ich glaube, ich glaube nicht mehr. Und das Merkwürdigste an alldem war noch, dass ich später oft dachte: Na ja, dass Maria am Fuße des Kreuzes gestanden hat, ist überhaupt nicht auszuschließen, jedenfalls ist es längst nicht so unmöglich wie sprechende Schlangen und Esel oder wie ein Spaziergang übers Wasser. Doch das änderte nichts, das gab mir meinen Glauben nicht zurück. Und das, obwohl der Glaube tatsächlich so etwas Unvergängliches in sich trug und den Bau von allerlei Kirchen zur Folge hatte, in denen nun die Orgeln von Arp Schnitger standen, jenes Arp Schnitger, von dem oft gesagt wurde, er sei der Stradivari unter den Orgelbauern gewesen. Nun, dem stimmte ich vollkommen zu, mein Gott, was für schöne Instrumente, selbst in Mariana in Brasilien standen sie. Was war das für eine Reise gewesen, einmal und nie wieder. Und wenn man sich vorstellt, dass Schnitger nicht einmal dort war, nein, die Orgel wurde in einundsechzig Kisten über den Ozean transportiert und von einem Lehrling zusammengebaut, ebenso wie die Schnitger-Orgeln in Porto und Faro.
Wieder hörte ich ein Schiff tuten. Was für Elend, so ein falsches, dumpfes, widerborstiges Geräusch mit so vielen schrillen Obertönen. Und stündlich schlug die Glocke der Kirche, in der mit Sicherheit die von mir zu stimmende Garrels-Orgel stand. Nein, aus dem Schlafen wurde nicht viel in dieser ersten Nacht im Seemannsheim auf der Wip, obwohl ich doch träumte, in der Morgendämmerung. Ich träumte von der riesigen Ziege unseres Nachbarn Ai Kack im Johannes Kerkhovenpolder am Dollart.