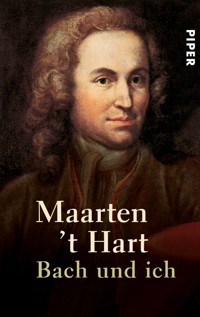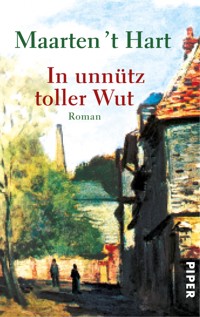9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Wissenschaftler hat er bereits eine steile Karriere hinter sich, aber in seinen Lebens- und Liebeserfahrungen ist Maarten gescheitert: ein Sehnsüchtiger, der seiner Kindheit noch nicht entwachsen ist. Ruhig und gelassen erzählt der Dreißigjährige seine bittere Geschichte, in immer neuen Erinnerungsbildern geht er den Ursachen seiner Einsamkeit und seiner Unfähigkeit zur Liebe nach.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Niederländischen von Waltraud Hüsmert Mit einem Nachwort von Carel ter Haar
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage September 2011
ISBN 978-3-492-95189-0
© Maarten 't Hart 1978 Titel der niederländischen Originalausgabe: »Een vlucht regenwulpen«, Verlag De Arbeiderspers, Amsterdam © der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 2005 Erstausgabe: Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1988 Umschlag: semper smile, München Umschlagmotiv: André Held / akg-images (Claude Monet, Landschaft bei Zaandam)
Der 10. Sonntag
27: Was verstehest du durch die Vorsehung Gottes?
Die allmächtige und allgegenwärtige Kraft Gottes, durch welche er Himmel und Erde samt allen Kreaturen, gleich als mit seiner Hand noch erhält, und also regieret, daß Laub und Gras, Regen und Dürre, fruchtbare und unfruchtbare Jahre, Essen und Trinken, Gesundheit und Krankheit, Reichtum und Armut, und alles nicht von ungefähr, sondern von seiner väterlichen Hand uns zukommt.
Mein Sommer
In diesem Raum habe ich den Sommer eingefangen. Insekten summen träge in der feuchten Wärme. Die Zeit verstreicht in ihrem Flügelschlag. Draußen, wo schon die Blätter fallen, wären die Hummeln und Schwebfliegen in den kalten Nächten längst umgekommen. Hier im Treibhaus zwischen den Weintrauben aber ist es noch Sommer, mein Sommer, meine verdiente Beute im Kampf gegen den Wechsel der Jahreszeiten, der Beweis, daß es mir gelungen ist, das Verrinnen der Zeit aufzuhalten. Und ich habe nicht nur meinen Sommer, sondern auch meine Jugend zurückgewinnen können. Es riecht hier nun genauso wie früher, bevor die Trauben durch Tomaten ersetzt wurden. Oh, dieser unvergleichliche Duft; wenn ich ihn ganz tief einatme, ist es, als ob ich erst vier Jahre bin, und jeden Augenblick kann meine Mutter hereinkommen und mir übers Haar streichen.
Behutsam schneide ich mit einer Schere einige Trauben ab und lege sie in einen mit blauem Papier ausgeschlagenen Korb. Heute abend werden sich die Gäste an den Trauben gütlich tun, und nur Jakob und ich werden wissen, welche Sorgfalt ich auf ihren Anbau verwendet habe. Es hat mich Jahre gekostet, die Rebstöcke wieder heranzuziehen, nachdem sie den Tomaten hatten weichen müssen. Ja, Jakob wird das Geschenk zu schätzen wissen; Jacqueline wird nur die Stirn runzeln. Ich kann nicht verstehen, daß er sie heiratet. Über die Jahre hin war er in sie verliebt und ist ihr so beharrlich nachgelaufen, daß er nun endlich mit ihr zum Standesamt gehen darf. Es ist unglaublich, was eine Frau einem Mann, der in sie verliebt ist, antun kann. Umgekehrt mag es genauso sein; ich glaube aber, daß Männer Frauen Kummer bereiten, nachdem eine Beziehung zustande gekommen ist, während Frauen Männern Kummer bereiten, bevor es soweit ist. Jakob hat hier oft übernachtet, wenn es zwischen beiden wieder einmal kriselte. Wir ruderten dann stundenlang durchs Reetland, zählten am frühen Morgen Vögel, er sprach pausenlos von ihr, und wenn er sich alles von der Seele geredet hatte, ging er wieder. Wird nun irgendwann sie kommen, um sich über ihn zu beklagen? Das scheint mir undenkbar.
Ich verlasse das Treibhaus und gehe über den Kiesweg zum Haus. Wie unter einem Zwang drehe ich mich noch einmal um und betrachte die gekalkten Scheiben meiner beiden Gewächshäuser. Sie stehen dort als Symbole unseres manischen Drangs zum Züchten. Ich stamme aus einer Familie, die sich der Vervollkommnung der Rebenzucht verschrieben hat. Meine Verwandten zogen Trollinger und Alicanter, köstliche Tafeltrauben, die für den Export bestimmt waren und auf den Versteigerungen hohe Preise erzielten. Das ist nun vorbei. Meine Onkel – die ohne Ausnahme Gärtner waren – haben alle anstelle der Reben Tomaten und Gurken gepflanzt, und sogar mein Vater hat schließlich aufgegeben und sich auf den Anbau von Nachtschattengewächsen verlegt. Warum? Manchmal glaube ich nur deshalb, weil die Fruchtansätze der Trauben während des Wachstums ausgedünnt werden müssen. Und dieses Ausdünnen gelingt eigentlich nur den feinen, schlanken Fingern von Frauen- und Kinderhänden. Sie waren einfach unentbehrlich. Vielleicht habe ich die Rebstöcke nur in der Hoffnung zurückgeholt, damit irgendwann Frauenhände – und möglicherweise sogar Kinderhände – zu verlocken, die heranreifenden Trauben auszudünnen.
Von Kindheit an habe ich den Beruf meines Vaters und meiner Onkel verachtet. Ich wollte kein Gärtner werden, ich wollte berühmt werden, auch wenn ich keine genauen Vorstellungen hatte, wie ich das schaffen sollte. Um überhaupt eine Chance zu haben, berühmt zu werden, mußte ich auf jeden Fall herausragende Leistungen aufweisen, und das tat ich auch, zuerst in der Volksschule, später im Gymnasium und danach als Student; aber bevor es soweit war, hatte ich mit meinem Vater zu kämpfen, der mich nach sechs Volksschuljahren in die Gärtnerei stecken wollte. Da kamen die Lehrer. Über die Wiesen fanden sie den Weg zu unserem Haus und redeten auf meinen Vater ein. Gegen seine Starrköpfigkeit kam keiner von ihnen an – bis auf den Rektor. Jedes Jahr nahm er sechs Wochen an Wehrübungen teil; er hatte den Rang eines Hauptmanns und trug die dazugehörige Uniform Tag für Tag auch in der Schule. Er führte die Klasse wie ein Regiment. Wenn er morgens hereinkam, rief er: »Habt … acht«, und sofort saßen wir kerzengerade, mit verschränkten Armen, in unseren Bänken. Dann ließ er einen Psalm singen, meistens Psalm 68: »Erhebet er sich, unser Gott, seht, wie verstummt der Frechen Spott, wie seine Feinde fliehen!« Anschließend sprach er jeden Tag dasselbe Gebet: »General im Himmel, zu Dir kommen wir am Morgen dieses Tages und erbitten Deinen Segen für unsere Arbeit. Oh, Du, Oberbefehlshaber der himmlischen Heerscharen, gib uns die Kampfeslust, auch heute zu rechnen, zu schreiben und zu lesen zu Deiner Ehre. Entzünde unseren Glauben wie Pulver in einer Kanone, die auf die Diener Satans abgefeuert wird. Bewahre uns vor Krieg. Nicht weil wir es verdienen, sondern nur aus Gnade. Amen. Rührt euch und holt die Bibeln hervor!«
Wir lasen das Alte Testament, Josua oder die Bücher der Könige, die Chroniken. Und danach, in der Geschichtsstunde, erzählte er von unserem Achtzigjährigen Krieg, damals im 17. Jahrhundert, vom Rauch der Kanonen und von wiehernden Pferden auf Schlachtfeldern. Dieser Mann redete mit meinem Vater. An einem Winternachmittag begleitete er mich nach Schulschluß über den schmalen Steinplattenweg quer durch die Wiesen zu unserem Haus. Meine Eltern waren beeindruckt von seiner riesenhaften Statur, seiner Uniform, seiner grauen, tadellos gekämmten lockigen Mähne, seiner donnernden Stimme. Er benutzte nur ein einziges Argument, verpackt in zwei Bibelzitate. Er sprach über das Gleichnis von den anvertrauten Talenten und vom Licht unter dem Scheffel. Mein Vater gab sich geschlagen, stellte aber eine Bedingung: während der großen Ferien sollte ich in der Gärtnerei arbeiten. So besiegte der Rektor meinen bibelfesten Vater mit Hilfe der Bibel.
Auf dem Gymnasium war ich selbstverständlich ein Musterschüler. Es war einfach undenkbar, daß ich faulenzte, den Lehrern das Leben schwermachte oder meine Hausaufgaben vergaß, denn ich wollte mein mühsam erworbenes Recht auf Weiterbildung nicht leichtsinnig verspielen. Wenn ich sitzengeblieben wäre oder wenn sich die Lehrer über mich beschwert hätten, wäre das für meinen Vater ein Beweis gewesen, daß ich die Talente nicht besaß, auf die der Rektor angespielt hatte, und er hätte mich von der Schule genommen. Die Gärtnerei war eine Drohung. Doch damit war es vorbei, als ich mein Abitur in der Tasche hatte. Mit dem Abitur in die Gärtnerei, das wäre eine Verschwendung von Talent gewesen. Aber was nun? Mein Vater wollte mich nur dann studieren lassen, wenn ich Arzt würde oder die Hochschule für Landwirtschaft in Wageningen besuchte. Diese praktischen Berufe reizten mich überhaupt nicht. Ich wollte Biologe werden. Nach längerem Hin und Her war er mit dem Studium der Biologie als minderwertige Alternative zur Medizin und Agrarwissenschaft einverstanden.
So wurde ich Biologe. Im September wurden wir zur Einführung in unser Studium durch die verschiedenen biologischen Institute geführt. Am letzten Nachmittag zeigte man uns auf dem Dachboden eines dieser Institute eine Gewebekultur. Eine Laborantin erzählte uns, daß die orangefarbenen Zellen, die wir sahen, aus einer einzigen Karottenzelle herangezogen waren. Diese primitive Züchtung machte einen überwältigenden Eindruck auf mich. Ich hatte eine Vision, sah eine schwindelerregende Perspektive vor mir. Ich erschauderte. Meine künftigen Kommilitonen stellten Fragen, lachten und plauderten. Der Blick durch die schmutzigen Fenster über den Botanischen Garten interessierte sie mehr als diese Züchtung. Ich starrte ängstlich auf das Reagenzglas. Ich durfte es halten und betrachtete den formlosen Zellhaufen. Den ganzen September über, als die meisten anderen ihre Einführungszeit bei den verschiedenen studentischen Vereinen verbrachten – ich nicht, ich war ein Einzelgänger –, dachte ich über die Gewebezüchtung nach. Ich half meinem Vater in der Gärtnerei. Morgens um fünf standen wir auf und pflückten Tomaten in den Treibhäusern, die sich nach und nach erwärmten. In der grüngelben Farbe der pflückreifen Tomate sah ich das fahle Orange der Zellen im Reagenzglas. Und auch wenn ich damals noch nicht wußte, warum, war ich mir ganz sicher, das gefunden zu haben, was ich tun und worüber ich mehr wissen wollte.
Das Studium war anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Jeden Vormittag mußte ich zu Seminaren in den Nebenfächern: Physik, Chemie und Geologie; nachmittags zeichnete ich Querschnitte von Plattwürmern und Seesternen, Süßwasserpolypen und Pantoffeltierchen. Ich wohnte bei Onkel und Tante. Der Onkel war angeheiratet, also kein Züchter. Aber auch er war ein Gezeichneter; er hatte sich nämlich vorgenommen, ein Perpetuum mobile zu erfinden. Nach dem Abendbrot verschwand er regelmäßig im Schuppen hinterm Haus, und zuweilen hörten wir, wie er Schreie ausstieß; eines Tages kam er am späten Abend ins Wohnzimmer gerannt und rief: »Ich hab's, ich hab's.«
Mein ungläubiges Lächeln beachtete er nicht.
»Kommt«, sagte er.
Wir folgten ihm in den Schuppen. Im Halbdunkel sahen wir eine kreisförmige Bahn, die dadurch entstanden war, daß mein Onkel eine Schüssel aus glänzendem, polierten Metall mit einem Außenring aus demselben Material versehen hatte, das in dem Raum funkelte. Der Rand der Schüssel und der sie umgebende Ring, beide mit messerscharf geschliffenen Kanten, bildeten eine schmale Schiene, in der die Kugeln friedlich ihre Runden drehten. Sie bewegten sich, ohne daß auch nur die geringste Verminderung ihrer Geschwindigkeit zu bemerken war. Es war gleichzeitig ergreifend einfach und zutiefst rätselhaft, weil man ja erwartete, daß die Kugeln allmählich langsamer wurden. Neben der genial ausgetüftelten Konstruktion lagen noch einige unbenutzte Kugeln; ich nahm eine, sie war federleicht. Ich ließ sie über meine Hand rollen. Die Schwerkraft schien keinen Einfluß auf sie zu haben. Gebannt schaute ich den unermüdlich kreisenden Kugeln zu. Durch die Art und Weise, wie der Rand der Schüssel und der Außenring nebeneinander standen und eine Bahn freiließen, erfuhren die Kugeln nur eine minimale Reibung durch die beiden Außenkanten, die sie an ihrem Platz hielten. Und doch konnte ich nicht glauben, daß sie ewig weiterkreisen würden; gerade weil die Kugeln so leicht waren, müßte der Luftwiderstand ihre Bewegung schon bald beenden.
»Die beiden Punkte, wo die Ränder die Kugeln berühren und an ihrem Platz halten, sind so glattgeschliffen, daß so gut wie keine Reibung entsteht«, sagte mein Onkel.
An den folgenden Tagen hörte ich ihn diesen Satz oft gegenüber Besuchern wiederholen, stets mit der Wendung »so gut wie«, die mich immer wieder zweifeln ließ, auch wenn die Kugeln vor den Blicken der erstaunten Verwandten und Freunde mühelos und ohne eine für das Auge sichtbare Verzögerung weiterrollten.
Doch das Sonderbarste an diesem Perpetuum mobile, das keines sein konnte, war nicht, daß es tatsächlich immerwährend schien, sondern daß es meinen Onkel zum Müßiggang verurteilte. Jetzt, nachdem das Ideal erreicht war, blieb ihm weder etwas zu wünschen noch zu konstruieren übrig, und so saß er, wenn er seine kreisenden Kugeln mangels Besuchern nicht vorführen konnte, im Wohnzimmer am Fenster, die Hände in rastloser Bewegung auf dem Schoß, als hätten sie teil an der Bewegung in dem Schuppen hinterm Haus. Er baute zusehends ab, verkümmerte, mein Onkel. Es war, als könnte er wie Simeon sagen: »Jetzt lässest du deinen Knecht, oh Herr, nach deinem Wort in Frieden dahingehen; denn meine Augen haben dein Heil gesehen.« Davon, ob es tatsächlich ein Heil war, war ich nicht so ganz überzeugt. Aber die Kugeln kreisten weiter. Bald glaubte ich, daß sie aufgrund ihres geringen Gewichts jedesmal einen kleinen Stoß durch den Luftzug bekamen, der beim Öffnen der Tür entstand, einen Schub, der einem nie auffiel, weil man ja in diesem Moment im fensterlosen Schuppen nach dem Lichtschalter tastete; bald hatte ich den Eindruck, daß die Konstruktion selbst einen gewissen Luftzug in der Bahn bewirkte, der die Kugeln vorantrieb. Aber ich wagte es nicht, meine Hypothese zu überprüfen, weil ich mich nicht traute, in diese fragile Bewegung einzugreifen. Ich hielt meinem Onkel vor, daß man aus diesem Kreislauf keine Energie gewinnen könne, daß es sich um eine Bewegung ohne Sinn und Ziel oder nachweisbaren Nutzen handle. Mein Onkel lächelte frohgemut, als ich das sagte; es machte ihm nichts aus, er hatte gefunden, was er gesucht hatte, und konnte nun in Frieden dahingehen. Er starb während seines Mittagsschlafs. Er wachte einfach nicht mehr auf. Der Zufall wollte, daß ich an diesem Nachmittag kein Praktikum hatte; nie hätte ich gedacht, daß der Tod so unauffällig und still eintreten könnte. Es war nichts, über das man betrübt oder unglücklich zu sein brauchte; es geschah, weil es irgendwann einmal geschehen mußte.
So wohnte ich bei meiner Tante in dem geräumigen Haus mit dem Schuppen, in dem die Kugeln gar nicht mehr zum Stillstand kommen wollten, besuchte fleißig und aufmerksam die Seminare, machte pünktlich meine Scheine und anschließend das Vordiplom, hatte mit fast niemandem Kontakt und las abends am liebsten philosophische und theologische Werke und Bücher über moderne Physik und Radioastronomie, die meinem Verlangen nach Mystik außerordentlich entgegenkamen. Ich hatte noch immer Angst davor, wieder in das angestammte Milieu zurückzufallen – nicht, weil ich mich dieses Milieus schämte, sondern eher aus Furcht, derselben geisttötenden und erstickenden Mentalität zu erliegen, einer Mentalität der Initiativlosigkeit, die sich zufriedengibt mit dem Erreichten und nicht nach Veränderungen strebt und deren geistiger Horizont von den Erlösen der Versteigerungen und den Zinsen der Hypotheken, die auf den Treibhäusern lasten, gebildet wird. Doch ich mußte entdecken, daß es an der Universität nicht viel anders war. Nach einer einzigen wissenschaftlichen Leistung, meistens einer Doktorarbeit, verschanzte man sich hinter bürokratischen Tätigkeiten.
Einige Tage nach meinem Vordiplom starb meine Tante. Thrombose im linken Bein, der Blutpfropf im Herzen. Sie starb gefaßt, im Vertrauen auf Gott, den sie sich nicht als einen General, sondern als einen freundlichen Großvater vorstellte, vor dessen Thron sie im weißen Brautkleid bis in alle Ewigkeit Psalmen singen würde. Ihr folgte einige Monate später ihr dickschädeliger Bruder, mein Vater. Ich war nach dem Tod der Tante wieder in mein Elternhaus gezogen. Eigentlich wollte ich mir ein Zimmer suchen, aber als ich entdeckte, daß ich mit dem Auto meines Vaters nur eine Dreiviertelstunde zum Labor für Gewebezüchtung brauchte, wo ich meine Diplomarbeit vorbereitete, entschloß ich mich, weiterhin bei meiner Mutter zu wohnen. Die Gärtnerei war unser Eigentum. Ich verkaufte die Gewächshäuser. An einem Wintermorgen wurden sie demontiert und abgeholt. Zwei Rebentreibhäuser ließ ich stehen. In einem brachte ich das Perpetuum mobile unter, das sich in diesem Treibhaus freilich nicht bewegte und auch nicht mehr in Gang zu setzen war, außer für kurze Zeit wie ein normales System in dieser Welt, in der die beiden Hauptsätze der Thermodynamik unumstößlich sind.
In der Abteilung für Gewebezüchtung hatte ich mich unterdessen unentbehrlich machen können. Die Gewebekultur entsprach genau meinen Erwartungen, sie faszinierte und beflügelte mich. Ich übte mich nicht nur in der Technik des Züchtens – wobei ich mich bei den Laborantinnen unbeliebt machte, in deren Domäne ich einbrach –, sondern sammelte auch fieberhaft Artikel aus wissenschaftlichen Zeitschriften über die Züchtung von Gewebekulturen. Nachdem ich mein Diplom gemacht hatte, starb meine Mutter an Kehlkopfkrebs. Jeden Tag wurde ihr die Luftröhre stärker abgeschnürt, so daß sie unendlich langsam erstickte. Während dieser schrecklichen und qualvollen Krankheit kehrte, weil ich Ihn hassen wollte, für einige Zeit mein Glaube an Gott zurück. Ich sah in Ihm einen Henker, der die Menschen verachtet. Im Grunde genommen kann ich das gut verstehen, und werde es Ihm doch immer übelnehmen, daß Er meiner Mutter ausgerechnet diese Krankheit zugedacht hatte, denn ich habe sie von ganzem Herzen geliebt.
Innerhalb kurzer Zeit wurde ich ein Experte auf dem Gebiet der Gewebezüchtung. Durch mehrere Publikationen machte ich auf mich aufmerksam. Die Universität sorgte für eine Unabkömmlichkeitserklärung, so daß mir das Soldatenleben erspart blieb, und nach dem Diplom setzte ich mich an meine Doktorarbeit. Drei Jahre nach der Diplomprüfung promovierte ich, und zwei Jahre später wurde ich außerplanmäßiger Professor und Leiter der Sektion für Gewebezüchtung. Bald wurden Stimmen laut, die ein eigenes Labor für die Abteilung forderten. Zu einem eigenen Labor gehört ein Lehrstuhl. Den bekam ich. Ich bin jetzt dreißig und ordentlicher Professor. Eine Blitzkarriere. Soweit mein bisheriges Leben. Weil ich dem Züchten entrinnen wollte, habe ich mich abgerackert, um Züchter zu werden.
Sonnenuhr
Auf dem Empfang versuchen die Kellner unentwegt, mir irgendwelche Getränke anzubieten, als ich nach den obligatorischen Höflichkeitsfloskeln einsam im großen Saal stehe und vor mich hinstarre. Wenn mich jemand anspricht, geht es fast immer darum, mich für eine Konferenz oder einen Kongreß zu ködern. Aber schon bald spricht mich keiner mehr an, denn ich habe sie alle abblitzen lassen, nachdem ich ihre von ständigem Lächeln begleiteten Fragen pflichtschuldig und mürrisch beantwortet habe. So kann ich unbehelligt durch den Raum schlendern. Es ist der Saal einer alten Burg, die zum Hotel-Restaurant umgebaut wurde. Durch die blauen Rauchschwaden gehe ich zu den Fenstern, die auf einen Innenhof, der von den Seitenflügeln der Burg umschlossen wird, hinausführen. Auf dem Hof spielen Kinder, die Kinder der Hochzeitsgäste. Sie rennen im Septembersonnenlicht umher, und ich höre ihre Stimmen. Unablässig fallen gelbe Blätter von den Kastanien und decken den friedlichen Platz zu. Er ist klein, zu klein für Platzangst, Gott sei Dank. In der Mitte ist ein Rasenfleck mit einer Sonnenuhr, auf der das Sonnenlicht auseinanderspritzt. Ich zähle die Kinder, es sind zwölf, die Mädchen in weißen Kleidchen, die Jungen in blauen Anzügen. Sie spielen ein Spiel, bei dem sie fortwährend von Baum zu Baum rennen. Es gibt zehn Bäume, so daß immer zwei Kinder ohne Baum sind, aber dem elften Kind dient die Sonnenuhr als Baum. Ich begreife, daß es darum geht, einen Baum zu haben. Immer ist ein anderes Kind ohne Baum, wenn sie herumgerannt sind und die Bäume gewechselt haben. Nie habe ich so ein Spiel gespielt. Aber vielleicht wäre ich immer ohne Baum gewesen. Die Gesichter der Kinder glühen. Bisweilen fallen Blätter auf sie, aber sie spüren es nicht, sie rennen über den Blätterteppich und langweilen sich nicht. Eigenartig, daß mich nichts so schmerzt wie der Anblick spielender Kinder! Ich trinke rasch meinen Portwein aus und wende mich ab, ich gehe zwischen den Menschen hindurch, nehme ein neues Glas und gehe zur anderen Seite des Saales. Auch hier ist ein großes Fenster, das durch schmale Holzleisten in kleine Scheiben unterteilt ist; man blickt auf eine kleine Insel mitten im Burggraben, ein Gärtchen im Wasser, wo Sträucher wachsen und Bläßrallen herumlaufen. Im Wasser zanken sich die Enten. Teichhühner laufen flügelschlagend über den Graben, quer über das sich im Wasser widerspiegelnde Sonnenlicht.
Ich leere rasch mein Glas, und mir wird die Gegenwart der vielen Menschen bewußt. Wie immer denke ich: Auch sie könnte hier sein. Ich denke es so oft, in überfüllten Zügen, auf Bahnhöfen und in Konzerten oder wie jetzt auf einem Empfang. Vielleicht ist Martha auch hier. Ich sehe mich um. Steht sie jetzt zwischen den Gästen? Plaudert sie mit einem von ihnen? Je mehr ich trinke, desto mehr Frauen und Mädchen gleichen ihr. Die Ähnlichkeit besteht meistens in einem Fältchen an derselben Stelle unter den Augen, in der gleichen Armbewegung, der gleichen Haarfarbe. Aber wenn ich etwas angetrunken bin, kann das genügen, um ein diffuses Glücksgefühl auszulösen, eine Art traurige Zufriedenheit über dieses schattenhafte Abbild von Anwesenheit. Ich muß hier so schnell wie möglich raus; ich habe dem Brautpaar gratuliert und meine Trauben abgeliefert. Was hält mich also noch? Jacqueline ist in der Tat sehr schön, und Jakob ist glücklich, wie mir scheint, obwohl er neben seiner prachtvollen Braut ein wenig verloren wirkt: eine Rohrdommel neben einem Purpurreiher. Plötzlich läßt er sie stehen, als beim Händeschütteln eine kurze Pause eingetreten ist, und windet sich durch die Menge. Er steht vor mir und sagt: »Heute abend feiern wir unsere Hochzeit in der Teestube beim Flugplatz. Du kommst doch auch?«
»So«, sage ich schroff, »du weißt doch, daß ich nie zu Festen gehe.«
»Ja, aber du weißt doch, wie oft ich dir schon gesagt habe, daß du auf diese Weise völlig vereinsamen wirst.«
»Das laß nur meine Sorge sein.«
»Maarten, was ist denn das für ein Fest, wenn meine besten Freunde nicht dabei sind?«
»Ich verspreche nichts«, sage ich.
»Du brauchst nichts zu versprechen, wenn du nur kommst.«
»Jakob, Jakob«, ruft Jacqueline.
»Ich muß zurück, bis heute abend.«
Eine junge Frau gratuliert dem Brautpaar; ich betrachte das dunkle Haar, ihr Gesicht kann ich nicht sehen. Aber ihre Figur, ihre Haltung kommen mir bekannt vor. Ob es jetzt doch endlich passiert, oder habe ich vielleicht nur zuviel getrunken? Ich muß unbedingt ihr Gesicht sehen, ich werde noch einen Augenblick bleiben. Aber sie schaut nicht zu mir her, sie redet ununterbrochen mit der Braut. So, jetzt geht sie weiter, jetzt sehe ich ihr Gesicht, nein, sie ist es nicht, sie kann es unmöglich sein. Aber welche. Ähnlichkeit! Ich versuche, mich so unauffällig wie möglich durch die Menge auf sie zuzubewegen. Sie steht allein bei einer halbgeöffneten Tür, hinter der schwitzende Menschen für den Nachschub an Speisen und Getränken sorgen. Ich kann sie nun sehr gut beobachten. Die Ähnlichkeit ist frappierend. Aber die Tatsache, daß ihr Gesicht nur ein ganz klein wenig anders und ihr Haar um eine- Nuance dunkler ist als das Marthas, stimmt mich mißmutig. Zwölf Jahre lang habe ich versucht, mich an das Gesicht zu erinnern, zwölf Jahre lang gelang es mir nicht, mußte ich mir zuerst die Gesichter ihrer Freundinnen vergegenwärtigen, und erst dann sah ich manchmal ein Fragment, einen kleinen Teil ihres Gesichts, ihren Mund oder ihre Augen, aber nie das Ganze. Manchmal träumte ich von ihr, und wenn ich erwachte, sah ich ihr Gesicht noch für einen kurzen Augenblick, aber sobald ich es festhalten wollte, zersprang es in Fragmente. Auch jetzt fühle ich die Bestürzung über meine Unfähigkeit, mich zu erinnern. Dieses Gesicht aber ist fast wie das ihrige. Die Augen sind etwas zu gewöhnlich, sie hat nicht diese merkwürdigen, beinahe mongolischen Augen Marthas, diese hohen Wangenknochen. Sie hat nicht dasselbe Haar, es ist länger, nicht so lockig.
Zurück im Labor esse ich ein paar Brote. Ich betrachte die Zellwucherungen, die sich hinter Glas in einem von mir eigens konstruierten Brutschrank befinden. Ich denke an den langen Weg, den ich zurückgelegt habe. Zuerst habe ich mit Süßwasserpolypen gearbeitet; dabei gelang es mir, mit relativ wenig Aufwand aus einer einzigen Polypenzelle einen neuen, vollständigen Organismus zu klonen. Damals war mir allerdings noch nicht klar gewesen, warum ich überhaupt klonen, warum ich aus einer einzigen Zelle einen ganzen Organismus heranwachsen lassen wollte; vielleicht war es mir auch deutlich, in diesem Fall aber hatten meine Versuche wahrscheinlich eher den Zweck gehabt, mir selbst zu beweisen, daß es nicht ging, daß es nie möglich wäre – zwar mit einem Polypen, auch noch mit einem höheren Organismus, vielleicht sogar mit einem Tintenfisch – aber niemals mit einem Säugetier. Und doch kann ich es mittlerweile bereits mit der Zelle einer Wüstenmaus, und wenn ich so weitermache, werde ich es vielleicht einmal schaffen. Ich weiß, daß ich weitermache, daß ich weiterhin zu beweisen versuchen werde, daß es nicht geht, aber eigenartigerweise ist nach dem Empfang von heute nachmittag ein neues Element zu jenem Ideal hinzugekommen, das ich um jeden Preis nicht erreichen will. Schuld daran ist dieses Mädchen auf dem Empfang. Sie sah ihr ähnlich, aber sie war es nicht. Dadurch ist mir deutlich geworden, daß die Qual der großen Ähnlichkeit beinahe schlimmer ist als die Qual des Niemehrwiedersehens. Weshalb sollte ich also noch weitermachen? Aber wollte ich denn nicht nachweisen, daß es unmöglich ist? Warum wollte ich das? Nachdem ich nun dieses Mädchen gesehen habe, scheint es, als hätte ich doch eine schwache Hoffnung, daß es gelingen könnte. Wann werde ich mich jemals auch nur ansatzweise verstehen?
Wenn alles klappt, werden sich die Zellwucherungen über komplizierte Zwischenstufen in Wüstenmäuse verwandeln, die jeden Morgen die eingegangenen Kommissionsberichte und Fachbereichsprotokolle, Strukturpläne und Verwaltungsrichtlinien, Gutachten und Enqueteformulare zu unleserlichen Schnipseln zernagen werden. Es brauchte übrigens nur bekannt zu werden, daß ich schon soweit bin, daß ich bereits aus einer Eizelle Wüstenmäuse züchten kann. Welch ein Wust von Papier würde darüber nicht vollgeschrieben werden! Dennoch neige ich nach dieser Begegnung auf Distanz von heute nachmittag dazu, den Brutschrank abzustellen. Es ist ja doch alles sinnlos. Aber es ist nicht meine Art, die Arbeit von Jahren in einem einzigen Augenblick zu vernichten.
Die Teestube liegt weit draußen vor dem Dorf in den Dünen. Um dorthin zu gelangen, muß ich einer kurvenreichen, spärlich beleuchteten Straße folgen und bei der Gaststätte Zum Flugplatz links abbiegen. Bevor ich jedoch an diesem Punkt bin, sehe ich gleich hinter dem Dorf ein Mädchen in der Dunkelheit. Sie geht mit schnellen Schritten. Ich erkenne ihre Gestalt wieder. Ich verlangsame meine Fahrt und kurbele das rechte Fenster herunter.
Sie erschrickt kurz, aber bevor sie wirklich Angst bekommen kann, sage ich: »Gehen Sie auch zum Fest von Jacqueline und Jakob?«
»Eh … ja, allerdings.«
»Kann ich Sie mitnehmen, ich bin auch auf dem Weg zur Teestube, und es ist noch eine ganze Strecke.«
»Oh … ja, sehr gern.«
Ich öffne die Beifahrertür, und sie steigt ein. Im Halbdunkel ähnelt sie ihr so sehr, daß ich für einen Moment denke: jetzt sitzt sie neben mir. Mein Glücksgefühl ist so groß, daß ich schnell fahren muß, um meine Rührung hinter verbissener Aufmerksamkeit für die Kurven zu verbergen.
»Danke schön«, sagt sie.
Sogar die Stimme gleicht ihrer Stimme, auch wenn sie etwas tiefer, etwas heiserer ist. Aber der melodiöse Klang ist der gleiche.
»Kennen Sie Jakob und Jacqueline schon lange?« frage ich.
»Ich kenne Jacqueline sehr gut, wir sind zusammen in einer Arbeitsgruppe.«
»Ich bin ein Studienkollege von Jakob, auch Biologe.«
»Ulkig«, sagt sie.
Was ich darauf erwidern soll, weiß ich nicht, und wir fahren schweigend zur Teestube. Jakob begrüßt uns, er ist überrascht.
»Ihr zusammen?« fragt er.
»Ich habe sie unterwegs gesehen und ihr angeboten, mitzufahren.«
Weil ich nicht weiß, wie sie heißt, stottere ich, als ich von »ihr« spreche. Jakob begreift.
»Ihr kennt euch noch gar nicht?«
»Nein«, sage ich.
Er macht uns miteinander bekannt, und als ich ihren Nachnamen höre, denselben Nachnamen wie Marthas, bin ich so aufgeregt, daß ich ihren Vornamen sofort wieder vergesse. Sie muß eine Schwester oder eine Kusine Marthas sein, fährt es mir durch den Kopf; möglich wäre es, denn sie hatte Schwestern, die viel jünger waren als sie. Obwohl ich an nichts anderes denken kann, traue ich mich nicht, dieses Thema anzuschneiden, und so gehen wir schweigend durch die Teestube. Genau wie ich scheint auch sie niemanden der anwesenden Gäste zu kennen, so daß wir dazu verurteilt sind, zusammenzubleiben.
Eine dienstfertige Dame serviert Kaffee.
»Sollen wir uns hinsetzen?« fragt sie.
»Gut«, sage ich.
»Was machst du? Bist du noch immer an der Universität?«
»Ja, ich beschäftige mich mit Gewebezüchtung.«
»Gewebezüchtung? Aber dann bist du … dann sind Sie …« Sie schweigt verwirrt.
»Ja, ich bin Prof, ich kann auch nichts dafür, aber laß uns doch bitte schön beim Du bleiben.«
»Verrückt, einen Prof mit du anzureden.«
»Woher weißt du eigentlich, daß ich das bin?«
»Eine Freundin von mir hat gerade die Zwischenprüfung in der Gewebezüchtung gemacht, und sie hat mir erzählt, daß sie von einem noch sehr jungen Prof geprüft worden ist, und sie hat auch gesagt …«
Sie schweigt plötzlich und blickt beschämt zu Boden.
»Was hat sie noch gesagt?«.
»Nein, das darfst du mich nicht fragen, das kann ich dir nicht erzählen.«
»Vielleicht darf ich dann etwas anderes fragen. Hast du eine Schwester, die Martha heißt? Du siehst einem Mädchen sehr ähnlich, mit dem ich zur Schule gegangen bin.«
»Ja, ich habe eine Schwester, die Martha heißt, sie ist fünf Jahre älter als ich, die zweitälteste.«
»Das muß dann dieselbe Martha sein. Du siehst ihr wirklich sehr ähnlich.«
»Das höre ich öfter, als mir lieb ist.«
»Wie geht es ihr denn?«
»Sehr gut, sie hat zwei goldige Kinder, einen Jungen und ein Mädchen.«
»Spielt sie noch immer so gut Klavier?«
»Ja, aber sie ist vom Konservatorium abgegangen, danach hat sie eine Zeitlang im Büro gearbeitet, aber sie spielt noch immer fabelhaft.«
»Spielt sie noch immer Haydn? Das spielte sie damals nämlich häufig.«
»Nein, sie spielt immer Brahms, jedenfalls … oft. Sie spielt wirklich sehr gut, viel besser, als ich es jemals könnte. Schade, daß sie nicht weitergemacht hat, nun ja, sie wollte heiraten. Blöd, zu heiraten, wirklich blöd. Ich möchte nie heiraten, höchstens mit jemandem zusammenleben. Mit einem Mal hat man für immer jemanden am Hals.«
Sie redet schneller als ihre Schwester. Ihre Gesten sind lebendiger, direkter. Als sähe ich ihre Schwester in einem Film, der etwas zu schnell abgespielt wird, und mich stört das zu große Tempo. Dennoch ist sie, vor allem, wenn sie die Augenlider niederschlägt, ganz Martha, und ich warte auf die Momente, die meinen Ärger in kurzzeitige Glücksgefühle verwandeln. Ich trinke mehr von der Oppenheimer Spätlese – Jakob weiß wenigstens, was er seinen Gästen schuldet –, als mir guttut. Als ob die Trunkenheit die Unterschiede zwischen ihr und ihrer Schwester auslöscht, als ob ich mit Martha rede und ihre gelassene Anmut bewundere.
»Man kann doch nicht mit einem Menschen für immer glücklich werden«, sagt sie.
»Muß das denn sein«, frage ich, »glücklich werden?«
»Ja, natürlich, was denn sonst?«
»Ich weiß überhaupt nicht, was das ist: glücklich sein. Ich weiß nur, daß ich es sehr wichtig finde, soviel wie möglich hören und sehen und riechen zu können, daß meine Sinnesorgane möglichst gut funktionieren.«
»Wie meinst du das?«
»In diesem Frühjahr ging ich an einer ungemähten Straßenböschung entlang. Ganz hohes Gras. In der Spitze einer fast ausgewachsenen Segge sang ein Feldschwirl. Ich konnte ihn sehr gut sehen, meistens sieht man sie nämlich nicht, sondern hört sie nur. Aber das Verrückte war, daß ich ihn zwar sah und auch sah, daß er sang, denn er sperrte seinen Schnabel weit auf, aber ihn nicht hören konnte. Sein Gesang ist sehr hoch, wie das Zirpen einer Grille, und mein Gehör hat mittlerweile so nachgelassen, daß ich ihn nicht mehr hören kann. Siehst du, damals fühlte ich mich wirklich unglücklich – weil mir eine Möglichkeit der Wahrnehmung abgeschnitten war.«
»Könnte ich den Feldschwirl noch hören?«
»Bestimmt, aber verstehst du, worauf ich hinauswill? Eigentlich lebt man immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft, nie in der Gegenwart, nie im Augenblick selbst. Der Moment muß Größe bekommen, man muß sehen können, daß die Schatten der Morgensonne anders sind als die der Mittagssonne, hören können, daß Insekten im Frühling anders summen als im Herbst, schmecken können, daß in Holzfässern gelagerter Wein anders schmeckt als Wein aus der Flasche.«
»Mir scheint, du hältst eine Vorlesung«, sagt sie etwas spöttisch, »meine Vorstellung vom Glücklichsein ist das jedenfalls nicht. Ich weiß auch nicht so genau, was zum Glücklichsein gehört, aber für mich hat es etwas damit zu tun, mit jemandem spazierenzugehen, nach dem man verrückt ist, oder zu spüren, wie einem der Wind durchs Haar streicht, oder Musik zu hören, die man mag, aber dann vor allem auch zusammen mit jemandem, in den man ein bißchen verschossen ist.«
So unterhalten wir uns den ganzen Abend, mal, um keine Stille aufkommen zu lassen, dann wieder, weil das Gespräch ganz von selbst einigermaßen im Fluß ist. Hin und wieder trennen wir uns kurz, aber es ist niemand da, mit dem ich länger als ein paar Minuten reden kann, und ihr geht es offensichtlich genauso; deshalb ist es fast selbstverständlich, daß ich sie später am Abend nach Hause bringe und mich, nicht zuletzt dank dem Oppenheimer, beim Abschied fragen höre: »Hättest du Lust, im Frühjahr einmal zu kommen und zu lauschen, ob du den Feldschwirl wirklich hören kannst?«
»Das würde mir gefallen.«
Sie sieht mich an, und ihre Augen zeigen etwas, das einem Lächeln gleicht, obwohl ihre Mundwinkel sich nicht daran beteiligen. Dennoch wage ich, wegen dieses Lächelns, noch eine zweite Bemerkung.
»Bis zum Frühjahr dauert es noch.«
Jetzt machen die Mundwinkel mit, aber das Lächeln hat auch etwas Spöttisches.
»Singt der Feldschwirl denn nur im Frühjahr?«
»Im Herbst und im Winter ist er nicht da, er ist ein Zugvogel.«
»Dann werden wir eben bis zum Frühjahr warten müssen.«
»Es gibt auch noch andere Vögel«, sage ich vorsichtig, »oder wenn du Lust hast, könnten wir auch zusammen in ein Konzert gehen. Ich habe ja nun mal das Auto, es ist eine Kleinigkeit für mich, dich abzuholen.«
»Nun, wenn es kein zu großer Umweg für dich ist, wäre es schon ganz praktisch.«
»Sollen wir dann etwas verabreden?«
»Weißt du etwas?«
»Ich muß in den nächsten Tagen nach Bern, zu einem Kongreß über Gewebezüchtung, aber danach vielleicht. Am Donnerstag, dem 15. Oktober, spielt zum Beispiel das Concertgebouw-Orchester, das weiß ich. Ich hole dich dann um halb sechs ab, zuerst essen wir etwas, und danach gehen wir ins Concertgebouw.«
»Das Concertgebouw, wie toll, dort war ich noch nie, ja gern, tschüs dann, mach's gut!«
Ich gehe zum Auto zurück, und sie steht in der Türöffnung des Hauses, in dem sie offenbar zur Untermiete wohnt. Während ich einsteige und meine Hand hebe und verwundert konstatiere, daß ich ihr zuwinke, sehe ich auf einmal die Mitglieder des Concertgebouw-Orchesters vor mir. Ich sehe vor allem die schwarzen Fräcke, nein, es sind keine Fräcke, es sind schwarze Überzieher, die Überzieher von Leichenbittern. Seltsam eigentlich, denke ich, daß ich immer, wenn etwas Besonderes passiert, unter Zwangsvorstellungen leide und daß sie immer durch eine Art Vision eingeleitet werden, durch ein Phantasie-Bild. Am Donnerstag, dem 15. Oktober, lebe ich nicht mehr, ich werde nicht mit ihr ausgehen können. Ich bin mir dessen plötzlich so sicher, daß ich viel vorsichtiger als sonst fahre, obwohl ich weiß, daß es eine Zwangsvorstellung ist, eine geistige Barriere gegen den Gedanken, mit einem Mädchen ausgehen zu müssen. Wenn ich tot bin, kann ich auch nicht mehr mit ihr ausgehen; ein beruhigender Gedanke. Gleich vor der Stadt parke ich bei einer Gaststätte, die glücklicherweise noch geöffnet hat. Ich trinke ein paar Tassen Kaffee und habe die Illusion, wieder etwas nüchterner zu werden. Warum sollte ich in vierzehn Tagen tot sein? Ich bin gesund. Werde ich vielleicht verunglücken? Ich werde vorsichtig sein. Nächsten Montag reise ich nach Bern. Ob ich dort sterben muß? Ich bin dreißig, ich habe mich zum ersten Mal mit einem Mädchen verabredet, mit Marthas Schwester. Wirft mich das so aus der Bahn, daß mein Unterbewußtsein nicht anders reagieren kann als mit der Zwangsvorstellung: du wirst bald sterben? Sich im Alter von dreißig mit einem Mädchen zu verabreden, ist noch merkwürdiger, als es nie zu tun. Im letzteren Fall erweckt man den Eindruck, man habe kein Interesse an Frauen. Aber wenn man sich mit dreißig zum ersten Mal verabredet, wird unmißverständlich klar, daß man eigentlich ein Trottel ist, ein schüchterner Tölpel. Und warum müssen zu alledem noch Zwangsvorstellungen hinzukommen? Ich hatte sie schon öfter, und soweit sie sich auf die Zukunft bezogen, sind es eigentlich fast immer Prophezeiungen gewesen, die sich erfüllt haben.
Ich zahle und fahre in südlicher Richtung. Noch immer beschäftigt mich der Gedanke des nahen Todes, er wird sogar fortwährend stärker. Bei einem Unfall, denke ich nicht ohne Ironie, hat man noch ein paar Augenblicke, in denen man sein Leben wie in einem Film an sich vorüberziehen sieht. Aber das ist mir ja heute bereits passiert! Heute nachmittag auf dem Gartenweg bin ich, mit den Trauben in der Hand, einen Augenblick stehengeblieben und habe mein Leben an mir vorüberziehen sehen. Doch das war nur der Teil meines Lebens, der im Grunde wenig oder nichts mit mir selbst zu tun hat. Nein, ich werde nicht sterben, so ohne weiteres stirbt man nicht. Aber wenn ich auch im Auto laut rufe: Es ist nicht wahr, ich werde nicht sterben, so bleibt dennoch diese unumstößliche Gewißheit: In vierzehn Tagen lebst du nicht mehr.
Ich versuche, an etwas anderes zu denken, an Marthas Schwester. »Ich weiß nicht einmal ihren Namen«, rufe ich plötzlich. Das Auto ist das einzige Beförderungsmittel, vielleicht sogar der einzige Ort, an dem man ohne Hemmungen laute Selbstgespräche führen kann. Obendrein ist man nie einsamer als allein in einem Auto, man ist sogar nicht einmal an einem bestimmten Ort; man bewegt sich fort, von Metall umschlossen, und führt vielleicht deswegen so oft laute Selbstgespräche. »Du hast sie nicht nach ihrem Namen gefragt«, sage ich zu mir selber, »du hast nicht einmal gefragt, was sie studiert, hast dich überhaupt nicht für sie interessiert, nur nach ihrer Schwester hast du sie gefragt. Du hast auf täppische Weise über deine unsinnigen Ideen zur Funktion der Sinnesorgane philosophiert.« Ich schweige, damit meine Worte wirken. Dann sage ich, nicht laut, aber mit großem Nachdruck: »Du bist ein egozentrischer Armleuchter.«
Ich bin zu Hause. Ich liege im Bett und kann nicht schlafen. Ich lausche den Geräuschen im Schilf. Außer dem Quaken der Enten und dem Rascheln des Rieds ist nicht viel zu hören. Ich kann nicht schlafen, weil ich fortwährend ans Sterben denken muß und an einen Satz aus einem Gedicht, von dem ich weder Titel noch Autor behalten habe: Wir leben unser ganzes Leben falsch. Falsch? Habe ich mein Leben bis jetzt falsch gelebt? Warum? Warum bin ich so geworden? Oder bin ich schon immer so gewesen? Liegt es an meiner Mutter und meinem Vater?
Meine Mutter
Sie beginnt ihren Tag auf dem Fußboden vor dem alten, dunkelroten Ofen mit geborstenen Glimmerscheiben und einem erstaunlich großen Aschenkasten, den sie herauszieht; jedesmal fällt dabei Asche auf den Boden, und sie brummelt dann etwas vor sich hin, nein, sie flucht nicht, fluchen könnte sie gar nicht. Sie steht auf und trägt den Aschenkasten durchs Zimmer, und während mein Vater und ich allein zurückbleiben, hören wir, wie die Schlacke, die vom Koks übriggeblieben ist, in den Mülleimer prasselt. Wenn sie aus der Waschküche wiederkommt, höre ich ihre ersten Worte. Aber bevor sie etwas sagt, ist die Stimme meines Vaters da: »Heute in den Blumenkohl«, und die Stimme meiner Mutter ist still, sanft und langsam: »Wann gehen wir hacken?«
»Nach dem Mittagessen.«
Während dieser Unterhaltung hat sie sich wieder vor den Ofen gekniet, in dessen geöffneten Bauch sie eine Zeitung stopft. Auf die Zeitung legt sie Holzscheite, und dann stemmt sie die schwere Petroleumkanne hoch; ein heller Strahl spritzt über Zeitung und Holz, und ich sehe dunkle Flecken auf dem Papier. Sie hält ein Streichholz daran. Sie steht auf und holt Kohlen aus der Waschküche. Ich denke nicht an sie, ich vergesse sie, weil ich die Flammen betrachte, wilde, gierige, launenhafte Flammen, feurige Zungen: der Heilige Geist im Ofen. Das Holz knistert. Manchmal ist es naß, und dann kräuseln sich dünne Rauchfäden hinter den Glimmerfenstern nach oben; durch die Risse in den Scheiben treten sie aus, so daß mein Vater hustet und sagt: »Schlechte Luft heute.«
Meine Mutter sorgt für die erste Enttäuschung des Tages, weil sie Koks auf die Flammen wirft, die dadurch zusammenschrumpfen. Meine Mutter setzt sich an den Tisch, und mein Vater steht auf und sagt: »So, ich gehe.«
Ende der Leseprobe