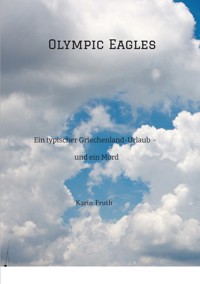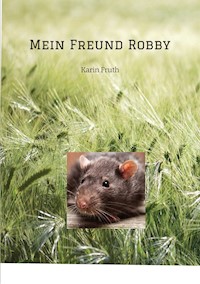8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Elitesoldat Marc wird im "Stahlmann-Projekt" mit übermenschlichen Kräften ausgestattet, das hat auch körperliche Nachteile für ihn. Das Projekt scheitert und die Regierung will ihn nun eliminieren, damit sein Körper nicht als "Geheimwaffe" weiter benutzt werden kann. Erst die Minerin Rachel erlöst ihn und ermöglicht ihm eine glückliche Beziehung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Karin Fruth
Guten Tag, ich heiße Karin Fruth und lebe schon seit vielen Jahren in Köln.
Mit meinem Mann, dem Archäologen, war ich viele Jahre mit dem VW-Bus in Europa unterwegs gewesen und habe dort Land und Leute kennengelernt.
Auch heute noch interessieren mich menschliche Schicksale, die ich in meinen Büchern verarbeite.
Dieses Buch ist meinem Mann gewidmet, der trotz aller Widrigkeiten und Krankheiten viel zu früh gestorben ist.
Er hatte immer an mich geglaubt und viele Jahre immer fest zu mir gestanden. Ich vermisse ihn sehr.
© 2023 Fruth Karin
Umschlag, Illustration: Karin Fruth
Druck und Distribution im Auftrag der Autorin Karin Fruth
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland
ISBN
Paperback
978-3-384-04248-4
Hardcover
978-3-384-04249-1
e-Book
978-3-384-04250-7
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Für die Inhalte ist die Autorin Karin Fruth verantwortlich.
Jede Verwertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig.
Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag Karin Fruths, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Inhalt
Cover
Urheberrechte
Der letzte seiner Art
Teil 2
Literaturliste Karin Fruth
Das Stahlmann-Projekt
Cover
Urheberrechte
Der letzte seiner Art
LiteraturlisteKarin Fruth
Das Stahlmann-Projekt
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
Das Stahlmann Projekt
Der letzte seiner Art
Guten Tag, ich heiße Marc Marin, ich bin inzwischen 22 Jahre alt, und ich wurde am 10.01.2019 in Düren geboren.
Ich war ein durchschnittlich begabtes Kind und meine schulischen Leistungen waren nicht besonders gut. Nur Sport mochte ich besonders gern und ich übte schon früh an den verschiedenen Trimm-Dich-Geräten, um meine Fitness zu erhöhen und einen gestählten Körper zu bekommen, auf den ich stolz sein konnte.
Der größte Teil meiner Erinnerungen an meine Kindheit ist daher unscharf und verwaschen, und ich brauchte lange, um mir die Einzelheiten ins Gedächtnis zu rufen, aber einige Szenen stehen mir auch heute noch hell leuchtend und überwältigend vor Augen.
Geblieben ist nur ein Foto, das ich meine Kindheit und Jugend hindurch in der Nachttischschublade verwahrt habe wie einen Schatz. Es war ein Foto von meiner Mutter und mir, aufgenommen kurz nach meiner Geburt. Sie hielt mich großäugigen Sohn Marc auf dem Arm und lächelt versonnen und nachdenklich in die Kamera. Was mochte sie damals wohl gedacht haben?
Ich versuchte mich an so viele Dinge wie möglich zu erinnern, aber das gelang mir kaum. Sie musste mich wohl doch ein wenig geliebt haben, so intensiv erschien mir ihr Blick. An meine Kindheit und an meine Jugend erinnere ich mich so, als ob es die Erinnerung aus dem Leben eines anderen gewesen wäre.
Ich war immer noch der kleine Junge, der in der geräuschvollen Dunkelheit des Schlafsaals liegt, todmüde und doch hellwach, der an die Decke starrt und sich fragt, ob er mit dieser Entscheidung wirklich das Richtige getan hat, immer bei dieser lieblosen Familie zu bleiben. Das schien alles tausend Jahre her zu sein und das Ganze war bestimmt jemandem ganz anderen passiert.
Ich war gerade sieben Jahre alt und kam abends vom Spielen dreckig nach Hause. Wir hatten auf einer verlassenen Baustelle gespielt, ein herrliches, aber natürlich verbotenes Spielgelände. Ich zog die Haustür hinter mir zu und hoffte, dass es mir gelingen würde, unbemerkt nach oben zu schleichen.
Vor der Küche blieb ich erschrocken stehen, denn in der Küche stand plötzlich nicht meine Mutter, sondern mein Vater am Herd und briet Steaks, das hatte er ja noch nie getan. Auf dem Tisch standen zwei Teller, große Gläser und eine große Flasche Cola, drei Flaschen Steaksoße und eine Plastikbox mit Salat. Es roch lecker nach Steaks und Backkartoffeln.
Während des Essens fragte er mehrmals, ob es mir auch wirklich schmeckt, ich nickte nur und kaute begeistert. Dann erklärt er mir, dass meine Mutter plötzlich weggegangen war, und dass wir jetzt ein Männerhaushalt waren und nun miteinander zurechtkommen müssten und dass ich ihn dabei unterstützen muss, damit es klappt. Es klang irgendwie toll, wie er das sagte. Zum Schluss setzte er zögernd hinzu: Kann sein, es ist für immer.
Gehen, um nie mehr wiederzukommen, schien ein zentrales Thema in meiner Familie zu sein. Meine Mutter hatte einfach die Wohnung verlassen, um nie mehr zurückzukommen, nicht einmal für fünf Minuten, und ihre Sachen hatte sie auch aus dieser Wohnung nie abgeholt. Sie wurde einfach ausradiert und verschwand ganz aus meinem Leben und aus meinem Gedächtnis.
Meine Mutter war gegangen und kam nicht wieder und es dauerte lange, bis ich mich endlich damit abgefunden hatte. Über meine Erinnerungen an die weitere Kindheit liegt eine Art Nebel.
Erst mit siebzehn Jahren fand ich zufällig die Telefonnummer und die Adresse meiner Mutter im Telefonbuch. Spontan hatte ich zum ersten Mal wieder meine Mutter besucht, und es war mir entsetzlich peinlich und ich fand anfangs keine Worte.
Sie lebte in Frankfurt, arbeitete bei einer Versicherung und wirkte noch genauso unglücklich wie in meiner Kindheit, wie ich sie in Erinnerung hatte. Wir gingen in ein italienisches Restaurant essen, wo wir einen Tisch direkt an der Straße bekamen, die Pizza war viel zu fettig und eiskalt.
Das Schlimmste war, dass wir uns praktisch gar nichts zu sagen hatten. Sie fragte belanglos, wie es mir in der Schule ginge, was ich danach machen wollte. Ich sagte, dass ich später zur Marine werden wollte, da hob sie leicht die Augenbrauen und meinte lapidar: „Ah.“ Weiter nichts.
Sie redete langatmig über ihre Arbeit, die sie langweilig und furchtbar ungerecht fand. Sie war viel kleiner als ich sie in Erinnerung hatte, und sie hielt ihre große schwarze Handtasche ständig dicht am Körper, auch während des Essens. Dabei tat sie, als ob sie schon mindestens hundertmal ausgeraubt worden wäre.
Sie wohnte in einer Einzimmerwohnung am Main in einem hohen, alten Ziegelbau, und dort tranken wir noch einen Kaffee. Von ihrem einzigen Fenster aus sah man hauptsächlich den Main und vorbei rasselnde S-Bahn-Züge. Ihre Kaffeetassen trugen das Logo der Versicherung, bei der sie arbeitete.
Während wir da saßen, Kaffee tranken und beim besten Willen nicht mehr wussten, worüber wir noch reden sollten, sagte sie plötzlich: „Nun bist du endlich groß genug, um mich richtig zu verstehen. Ich wollte immer in die Großstadt. Bei unserer Hochzeit hatte mir dein Vater fest versprochen, dass wir eines Tages aus diesem blöden Dorf wegziehen würden. Aber es war nur eine Lüge, wie Männer eben lügen, um Frauen herumzukriegen. Er hatte gedacht, ich würde mir das schon aus dem Kopf schlagen.
Ich musste einfach gehen, sonst wäre ich nie im Leben nach Frankfurt gekommen. Verstehst du mich jetzt?“ Sie sagte es so, als ob sie die ganze Zeit auf eine Gelegenheit gewartet hätte, es endlich mal loszuwerden. Ich nickte nur, und das genügte ihr anscheinend. Wenig später brachte sie mich zum Zug, und das war das letzte Mal, dass ich sie lebend gesehen hatte.
Mit 18 ging ich zum Militär, dort wurde ich wegen meiner guten körperlichen Kondition Teilnehmer eines gigantischen militärischen Geheimprojektes „Stahlmann“, dass aus mir einen optimierten Krieger mit übermenschlichen Kräften und zahlreichen Features formte und ich war damals verdammt stolz darauf.
Dann folgte eine harte Zeit, die vielen notwendigen Operationen, über die man uns nicht viel erzählte, und eigentlich wollten wir es auch gar nicht so genau wissen. Wir brannten für diese Idee, wir waren jung und ehrgeizig, mit dem Ziel, ein echter Stahlmann mit Riesenkräften zu werden, dafür nahmen wir alle Unannehmlichkeiten stoisch auf uns.
Fieberhaft warteten wir auf den ersten Einsatz, aber er wurde immer wieder verschoben, schließlich auf unbestimmte Zeit. Als wir immer wieder ungeduldig bei den Vorgesetzten nachfragten, wichen die uns mit der Erklärung aus, dass es inzwischen einen Organisationswechsel in der Führungsetage gegeben hatte und die neue Führung würde an einer neuen Strategie arbeiten. Was das für uns bedeutete, ließ man offen. Eventuell würde man uns bald in die reguläre Militärtruppe integrieren, aber wir sollten einfach mal abwarten.
Die Zeit wurde ziemlich langweilig und frustrierend, Streit brach wegen der geringsten Kleinigkeiten unter uns aus, und schließlich entschlossen wir uns zu einer Meuterei, wir fühlten uns betrogen und um die besten Jahre unseres Lebens gebracht.
Irgendwie bekamen wir den Eindruck, dass jeder der neu hinzukommenden Wissenschaftler mehr oder weniger das machte, was ihm gerade einfiel. Neue OP-Termine wurden völlig kurzfristig bekannt gegeben, manchmal erst am Abend vorher, und oft genauso überraschend wieder abgesagt. Man führte nur noch kleinere Eingriffe bei uns durch, angeblich nur noch um die Maßnahmen, die ein Systemversagen ausschließen sollen.
Der medizinische Leiter des Projekts, Professor Stewart, wurde überraschend ausgewechselt, nun saß ein neuer Mann in seinem Zimmer, diesmal war es ein Zivilist, kein Mediziner, sondern ein Geheimdienstmann, munkelte man.
Bei meiner ersten Begegnung mit ihm traf ich auf einen kleinwüchsigen Mann mit einem hässlichen, schiefen Eierkopf und auffallend vielen Muttermalen im Gesicht. Er sprang auf, als ich hereinkam, schüttelte mir die Hand, bot mir Platz und etwas zu trinken an. Dann stellte er sich mit so belanglosen Worten vor, dass mir nichts davon im Gedächtnis haften blieb. Trotz aller Scheißfreundlichkeit war er mir auf Anhieb unsympathisch.
Mitten in unserem belanglosen Gespräch klingelte das Telefon und er brach seine Erklärung mitten im Satz ab. Als er den Hörer ans Ohr nahm merkte ich sofort, dass er mit einem hohen Tier telefonierte, der ihm wohlgesonnen war, denn er durfte sich dabei sogar Vertraulichkeiten erlauben.
„Maxwell!“, trompetete er mit geheuchelter Begeisterung. „Was! Klar doch, jederzeit. Auf Hirsche? Bis jetzt noch nie, aber einmal ist immer das erste Mal, sage ich …“
Dann drehte sich stirnrunzelnd zu mir um und bedeutete mir mit einem ungeduldigen Wedeln seiner Hand, endlich hinauszugehen, so als würde man ein lästiges Insekten verscheuchte.
Ich ging und wartete eine Weile in seinem Vorzimmer, wo seine Sekretärin mich stoisch ignorierte. Nach einer Viertelstunde Wartezeit fiel mir auf, dass das Signallämpchen an der Telefonanlage seit einiger Zeit erloschen war, der Herr schien aber nicht im Traum daran zu denken, mich wieder hereinzubitten.
Ich ging betont langsam aus dem Zimmer und damit war die Sache für mich erledigt. Mir war schnell klar, dass man von dieser Seite wohl nichts mehr zu erwarten hatte.
Nach einem Jahr in diesem vermaledeiten Camp gab es plötzlich Tage, an denen wir nichts mehr zu tun hatten. Es existierte auf einmal kein Trainingsplan mehr, obwohl ab und zu angekündigt wurde, es sollte demnächst wieder einen geben. Wieso war unsere Fitness plötzlich nicht mehr so wichtig geworden?
Ich ahnte es schon irgendwie, das war der Anfang vom Ende für das Stahlmann-Projekt. Andauernd wechselten die Projektleiter, mit ihnen folgten viele endlose Gespräche über unsere Zukunft, wir sollten Pläne machen, aufschreiben, was wir uns für die Zukunft wünschen oder vorstellen würden. Aber trotzdem wurden alle unsere Ideen fast alle rigoros abgelehnt.
Wir sagten dann, na ja, wir würden gerne das tun, wofür wir geplant wurden: Wann würde es endlich losgehen? Wann würde endlich der erste große Einsatz für die Stahlmann-Truppe sein?
Bis jetzt: No chance, hieß es lapidar. Aber eine Rückkehr zu den regulären Streitkräften kam gleichfalls wegen der Geheimhaltungsprobleme nicht infrage. Diese ganzen sinnlosen Gespräche verunsicherten uns sehr. Diese ganzen Diskussionen und das Verhalten der Vorgesetzten atmeten Verfall, Unruhe, Auflösung, unsere Welt verändert sich in atemberaubendem Tempo und auch das Stahlmann-Projekt war irgendwie immer davon mit betroffen, sogar das ganze Gebäude war betroffen. Offiziell fand eine seit langem geplante technische Umstrukturierung statt, aber warum wurden sogar neue Leuchtstoffröhren von der Decke genommen?
Und es wurden immer weniger Leute im Stützpunkt. Als ich eines Tages an der Kantine für die Mannschaften vorbeikam, sah ich, dass man sie mit einem Raumteiler halbiert hatte, um die gähnende Leere zu vertuschen. Man hatte auch schon drei Labore leer geräumt und abgeschlossen; durch die Glasscheiben sah man nur noch leere, dunkle Räume.
Schließlich fiel die offizielle Entscheidung von ganz oben, das Stahlmann-Projekt ganz einzustellen und uns kommentarlos in den vorzeitigen Ruhestand zu versetzen.
Innerhalb von einigen Tagen gingen die Lichter im ganzen Stützpunkt aus. Schnell wurde es zur Gewissheit, dass sich mein Leben zukünftig radikal ändern würde. Wir waren ratlos und niemand erklärte uns, wie unser Leben in Zukunft nun weitergehen sollte. Wir wurden schließlich fortgebracht, durften uns auf einem Parkplatz vor der Stadt voneinander verabschieden und unsere Seesäcke dann in bereitstehende Autos laden, jeder in ein anderes und niemand wusste, wohin der andere ging. Es sollte ein Abschied für immer sein.
Der Umzug in eine eigene Wohnung in Köln war ziemlich einfach. Da lebte ich nun eine Weile ohne die geringste Ahnung, was ich dort eigentlich tun sollte, wochenlang war ich nur noch in der Gegend herumgelaufen. Ich kam mir langsam wie ein weggeworfenes Stück Abfall vor. Und ich konnte mich wegen meiner speziellen Körperkonstitution noch nicht einmal betrinken!
Trotzdem lebte ich mich irgendwie in Köln ein, bekam wöchentlich mein Kraftnahrungspaket, saß auf dem Balkon in der Sonne und beobachtete meine Umgebung. Sonst hatte ich nichts zu tun, außer im Netz irgendwelche langweiligen Nachrichten oder Computerspiele zu daddeln.
Langsam begann ich mich zu langweilen, und mir gingen die blödesten Gedanken durch den Kopf. Wer war ich und warum war ich überhaupt auf dieser Welt? Was sollte das Ganze? Es muss doch eine Zukunft für mich geben, nur was hatten die Vorgesetzten mit uns vor? Wie soll es nun weitergehen?
Ein unbändiges Hungergefühl unterbricht plötzlich meine Erinnerungen, es trieb mich zum Küchenschrank, aber meine Euphorie ließ schlagartig nach, als ich die letzte Dose Nahrungskonzentrat sah. Das bedeutete konkret, dass ich also gerade noch vier Henkersmahlzeiten hatte.
Langsam wurde ich unruhig. Wo blieb nur mein Nachschub, er war seit vier Tagen ausgeblieben. Ich war schließlich dringend auf das Zeug angewiesen, denn man hatte mir den Darm stark verkürzt, um Platz für Zusatzgeräte zu schaffen. Das bedeutete konkret, dass ich seitdem keinerlei normale Nahrung mehr aufnehmen oder verdauen konnte.
Schlagartig begriff ich, wie mein ganzes Leben, jede einzelne Entscheidung, die ich getroffen hatte, mich jetzt hierher geführt hatte, an diesen Ort, an diesen Tisch, vor diesen Teller. Mich beschlich eine merkwürdige Sentimentalität, was wäre gewesen, wenn ich damals nein zu dem Projekt gesagt hätte?
Wenn wir es doch vorher gewusst hätten. Man hatte uns einfach keine Wahl gelassen und uns über die weitreichenden Folgen nicht aufgeklärt. Ach, ich kann niemals wieder einen saftigen Braten mit Backpflaumen essen oder ein Stück ofenwarme Pizza, noch nicht einmal mehr einen simplen Apfel konnte ich ohne Probleme verdauen.
Ich öffnete die unbeschriftete Dose, leerte die schleimige, fahlweiße Masse in einen Teller und überlegte, ob ich das Ganze besser mit Minzsoße oder mit höllenscharfem Tabasco runterwürgen sollte.
Meine Gedanken kreisten dabei immer wieder um das Stahlmann-Projekt. Was hatte damals die Zentrale bloß mit uns vorgehabt? Und vor allen Dingen: Wie soll es jetzt mit mir weitergehen? Nichts passierte, es kam einfach keine Antwort von den Typen und niemand hatte sich seitdem mehr bei mir gemeldet.
Noch reichte der Karton für vier Mahlzeiten, aber was passierte, wenn der Nachschub für immer ausblieb? Ich war vollkommen abhängig von der Zentrale , und wie sollte ich mich demnächst ernähren? Oder war es Absicht des Militärs, uns auf diese Weise klammheimlich verhungern, also problemlos beseitigen zu lassen? Die Typen brauchten einfach gar nichts mehr zu tun und ich war ihnen vollkommen ausgeliefert.
Nach dieser faden Einheitsmahlzeit saß ich grübelnd am Küchentisch und mein Hirn ratterte auf Hochtouren, ich konnte mich einfach zu gar nichts aufrappeln.
Draußen war es längst Nachmittag geworden, ich stand am Fenster und sah draußen milchig-graue Wolken über den Himmel zogen, und es nieselte wie immer im Spätherbst. Ein gelber Blätterregen tanzte im plötzlich aufbrausenden Wind. Irgendwie fühlte ich mich einsam.
Ich ließ wieder und wieder die uralte leierige Kassette der Dubliners aus den 80-iger Jahren laufen: „Don’t give up til ist over,…“ Jetzt nur nicht melancholisch werden und über den Sinn des Lebens und den Tod nachdenken.
Wozu hatte man eigentlich uns Supertypen gebaut, gestylt und uns mit den tollsten Features versehen, wenn wir doch nicht zum Einsatz kommen würden? Wir sind ein Staatsgeheimnis, aber warum sagte uns niemand etwas? Wie sollte es mit dem geheimen Militärprojekt „Stahlmann“ überhaupt weitergehen? Man kann doch nicht so hungrig weiterleben?
Irgendetwas war faul an der Sache. Wenn das Projekt so ein durchschlagender Erfolg gewesen wäre, hätte man bestimmt schon eine ganze Division Stahlmänner geschaffen, und es wäre nicht bei uns zehn Vorzeige-Pappkameraden geblieben.
Wo blieb der vielbeschworene geheime Kriegseinsatz, bei dem wir endlich unsere außergewöhnlichen Leistungen beweisen konnten? Die ganzen Quälereien können doch nicht umsonst gewesen sein? Soll ich jetzt einfach so vor mich hinleben, ohne größere Hoffnung als der auf Hunger, oder auf einen gnädigen und schmerzlosen Tod? Ob es wohl in meinem Körper einen Modus zum Abschalten gibt? An mir war kein Gramm überflüssiges Fett und mein ganzer Körper schrie nach Verbrennungsenergie.
Ich bombardierte die Zentrale telefonisch in Boston, und zum Glück kam gestern eine dürre Nachricht per SMS. Ich soll mich heute Abend um acht Uhr am Hafen im Zentralbüro einfinden. Unterschrift: Commander Capoczinski. Der Typ ist mir vollkommen unbekannt, der muss endlich entscheiden, wie es mit mir und dem Projekt weitergehen soll.
Mir ist zwar jetzt schon übel von diesem ganzen sinnlosen Geschwafel, aber ich hoffe, dass wenigstens eine halbwegs geartete Kommunikation zwischen ihm und mir möglich sein wird. Ich will endlich aus ihm rausquetschen, was mich in den nächsten zwei Jahren erwartet, denn langsam ging mir dieser Einheitsfraß und meine erzwungene Einsamkeit auf die Nerven, zu der ich wegen meines Soseins verurteilt war.
Ich musste einfach raus aus der Wohnung, und mir den Wind um die Nase wehen zu lassen, ich schaltete meinen lockeren Joggingmodus an, und lief eine schlappe Stunde am Kanal entlang. Draußen ging ein sanfter Nieselregen nieder und die Strecke hinunter zum Rhein kannte ich inzwischen im Schlaf.
Plötzlich hatte ich die Idee, zwischendurch meinen alten Kumpel Joel Hornburg zu besuchen, der im vornehmen Stadtteil Hahnwald in einer Villa residierte. Vielleicht hatte der mehr Kraftnahrung vorrätig als ich und konnte mir etwas davon abgeben, wer weiß?
Ich hatte ihn eigentlich schon aus den Augen verloren, aber vielleicht hat der mehr nützliche Informationen über die zukünftigen Planungen der Regierung über unser Stahlmann-Projekt erhalten, denn diese ganze jahrelange Quälerei konnte doch nicht umsonst gewesen sein.
Ich schlich mich zum beleuchteten Fenster an seiner Villa, er war also zu Hause, ich klingelte mehrfach, bis ich feststellte, dass die Klingel abgestellt war. Irgendeine seltsame Neugier trieb mich, über den Balkon durch das Wohnzimmerfenster herein zu gucken, vielleicht hatte er ja Besuch.
Ich stand gebannt vor dem Fenster. Was ich sah, erfüllte mich mit nacktem Grauen, denn ich sah in ein Krankenzimmer. Da lag mein armer Kumpel Joel, gestützt von einer enormen Rollstuhl-Konstruktion von Kissen und Matratzenteilen im Rücken, die seinen Oberkörper in Schräglage aufrichteten.
Er ruderte kraftlos mit den Händen, sein Gesicht war blau angelaufen, während eine Krankenpflegerin sich über ihn beugte und ihm eine Pflegerin eine Atemmaske auf, ich hörte ihn durch das Fenster lautstark schnaufen und röcheln, aber durch den Sauerstoff wurde seine Gesichtsfarbe wieder einigermaßen normalbleich. Obwohl sie ernst dreinblickte, wirkte die ganze Prozedur wie ein eingespielter Vorgang.
Mein Gott, jetzt hatte es auch meinen Kumpel Joel erwischt, hoffentlich überlebte er das auch. Wenn nicht, gäbe es einen schon wieder einen Stahlmann-Krieger weniger auf der Welt. Mir graute es langsam vor der Zukunft. Was hatten die Typen mit uns vor? Was sollte nur aus mir werden?
Warum musste ausgerechnet jetzt mein bester Freund Jordans sterben? Eigentlich müsste ich an seinem Bett sitzen und Totenwache halten, die ganze Nacht durch bis zur letzten Stunde, das hatten wir uns damals in einer Geheimabsprache geschworen.
Da stand ich nun am Fenster und sah traurig sein graues, wächsernes Gesicht an, in dem nichts mehr zu sehen war von seinen heimlichen Wünschen und nichts mehr zu spüren von seiner Dickköpfigkeit, die er manchmal an den Tag legen konnte. Ach, mein bester Kumpel Jordan, bald bist du nicht mehr da, und unter dem Laken liegt dann nur noch dein Körper, der einige ausgefallene technische Geräte enthält. Und ich musste also hier unfreiwillig die Totenwache halten. Ich beugte mich gerade vor, um ihn zum Abschied noch mal anzusehen.
Panik erfasste mich und kopflos rannte ich nach Hause, zu Glück hatte ich sogar den Haustürschlüssel in der Tasche, denn ich hatte gar nicht daran gedacht, ihn einzustecken. Ich schloss auf, schleppte mich aufs Sofa, schaltete meine Sedierung ein, aber ich fand keinen Schlaf mehr und grübelte vor mich hin. Irgendwann musste ich doch wohl eingeschlafen sein.
In dieser Nacht schlief ich tief und fest, und kein hässlicher Gedanke störte mich. Am frühen Morgen wurde ich durch unsanft vom Briefträger geweckt, der aufdringlich wieder und wieder klingelte. Er hielt ein Paket in der Hand, ob das wohl endlich meine Konzentrat-Lieferung war?
Mit einem einzigen Satz sprang ich halbnackt zur Haustür. „Ah, hallo, Mister Marin“, meinte der Briefträger erleichtert und grinste, „Hier ist ein Paket für Sie. Ich war mir nicht sicher, ob Sie zu Hause sind, denn ich darf es nur mit einer unterschriebenen Quittung ausliefern.“