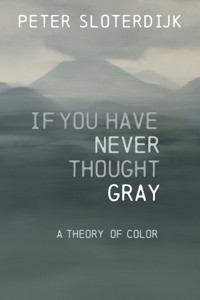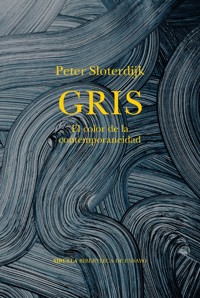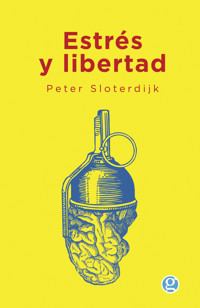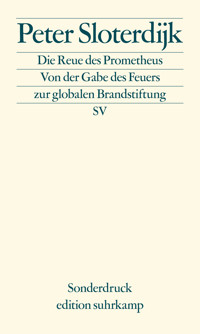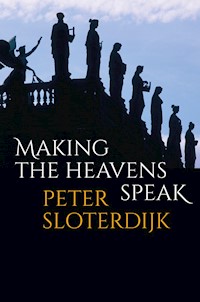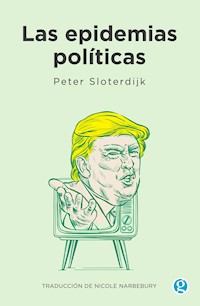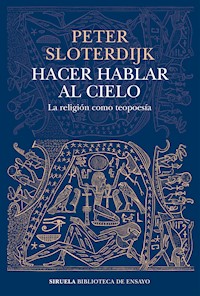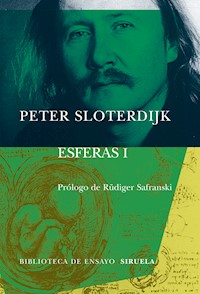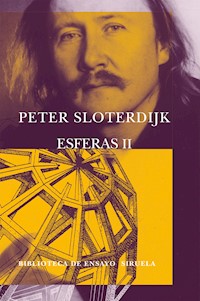15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Umwege sind die direktesten Wege zum Zentrum. Das neue Werk von Peter Sloterdijk ist ein Beleg für diese These: Außerhalb der Aktualität angesiedelt, handelt Theopoesie, auf den ersten Blick betrachtet, von den in der Bibliothek der Menschheit gespeicherten Versuchen, Gott oder die Götter zum Sprechen zu bringen: entweder reden sie unmittelbar selbst oder sie werden von den Dichtern mittelbar in ihrem Tun und Denken wiedergegeben. Damit ist für Sloterdijk die Einsicht unausweichlich: Religionen berufen sich in ihren theopoetischen Gründungsdokumenten auf mehr oder weniger elaborierte literarische Verfahren, auch wenn die begleitende Dogmatik dazu dient, diese Tatsache vergessen zu machen. Religionen sind »literarische Produkte, mit deren Hilfe die Autoren um Klienten auf dem engen Markt der Aufmerksamkeit von Gebildeten konkurrieren«.
Ein Studium der poetischen Stilmittel, deren sich die Religionen in ihren Narrativen bedienen, erfordert eine Neubewertung der Religionen, die die Karl Marx’schen Thesen hinter sich lässt. Elemente einer Kritik literarischer Darstellungsformen als Kritik dogmatischer wie theologischer Dokumente im Durchgang durch die Geschichte trägt Sloterdijk also mit seiner stupenden Belesenheit zusammen – und gelangt so in den Glutkern der Gegenwart, in der Narrative oder Fakten und alternative Fakten einander bekämpfen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Peter Sloterdijk
Den Himmel zum Sprechen bringen
Über Theopoesie
Suhrkamp
In Erinnerung an Raimund Fellinger
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Vorbemerkung
I
Deus ex machina, Deus ex cathedra
1 Götter auf dem Theater
2 Platons Einspruch
3 Von der wahren Religion
4 Gott darstellen, Gott sein: Eine ägyptische Lösung
5 Vom besten aller möglichen Himmelsbewohner
6 Poesien der Kraft
7 In Plausibilitäten wohnen
8 Die theopoetische Differenz
9 Offenbarung woher?
10 Göttersterben
11 »Religion ist Unglaube«: Karl Barths Intervention
12 Im Garten der Unfehlbarkeit: Denzingers Welt
II
Unter hohen Himmeln
13 Erdichtetes Zusammengehören
14 Götterdämmerung und Soziophanie
15 Herrlichkeit: Poesien des Lobs
16 Poesie der Geduld
17 Poesien der Übertreibung: Die religiösen Virtuosen und ihre Exzesse
18 Kerygma, Propaganda, Angebotsoffensiven oder: Wenn die Fiktion nicht mit sich spaßen läßt
19 Von Prosa und Poesie der Suche
20 Religionsfreiheit
Statt eines Nachworts
Grußworte
Fußnoten
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Vorbemerkung
Da der Titel dieses Buchs mehrdeutig klingt, soll darauf hingewiesen werden, daß im folgenden weder vom Himmel der Astrologen noch von dem der Astronomen die Rede sein wird, auch nicht von dem der Raumfahrer. Der zum Sprechen gebrachte Himmel ist kein möglicher Gegenstand visueller Wahrnehmung. Doch drängten sich beim Blick nach oben von alters her bildliche Vorstellungen auf, von vokalen Phänomenen begleitet: das Zelt, die Höhle, das Gewölbe; im Zelt tönen die Stimmen des Alltags, die Höhlenwände werfen alte Zaubergesänge zurück, im Gewölbe hallen die Kantilenen zu Ehren des Herrn in der Höhe wider.
Aus dem Gesamt von Tag- und Nachthimmel ergab sich seit je ein archaisches Konzept des Umfassenden. In ihm ließ sich das Ungeheure, Offene, Weite mit dem Beschützenden, Häuslichen in einem Symbol kosmischer und moralischer Integrität zusammendenken. Das Bild der ägyptischen Himmelsgöttin Nut, die, sternenbesetzt, über der Erde eine vorwärtsgewandte Brücke macht, bietet das schönste aus dem Altertum überlieferte Emblem eines Schutzes durch das Umgreifende. Dank ihres Abbilds ist der Himmel auch an den Innenseiten von Särgen gegenwärtig. Ein Toter, der im Sarg die Augen öffnete, würde durch den Anblick der Göttin in eine wohltuende Offenheit begleitet.
Als der Himmel im Gang der Säkularisation seine Bedeutung als kosmisches Immunitätssymbol verloren hatte, wandelte er sich zum Inbegriff der Beliebigkeit, in der menschliche Absichten verhallen. Nun ruft das Schweigen der unendlichen Räume bei Denkern, die in die Leere horchen, metaphysischen Schrecken hervor. Heinrich Heine hatte die Tendenz noch mit milder Ironie übermalt, als er in seiner Verserzählung Deutschland. Ein Wintermärchen (1844) beschloß, den Himmel, von dem ein Mädchen zur Harfe das »alte Entsagungslied« sang, den Engeln und den Spatzen zu überlassen. Charles Baudelaire hingegen hat in den Blumen des Bösen (1857) eine neognostische Gefangenenpanik ins Bild gebracht, als er den Himmel als einen schwarzen Deckel auf dem großen Topf beschrieb, in dem die weite unsichtbare Menschheit kocht.
Detail des Greenfield-Papyrus (10. Jahrhundert v. u. Z.). Die Himmelsgöttin Nut beugt sich über den Erdgott Geb (liegend) und den Luftgott Schu (kniend). Ägyptische Darstellung von Himmel und Erde, Illustration nach einem alten ägyptischen Papyrus, in: The Popular Science Monthly, Band 10., 1877, S. 546, Foto: Wikimedia Commons
Nach den konträren Diagnosen der Dichter ist es ratsam, dritte und weitere Meinungen zu hören. Im folgenden soll vorwiegend von mitteilsamen, hellen und zu Aufschwüngen einladenden Himmeln die Rede sein, weil sie, dem Auftrag poetologischer Aufklärung entsprechend, gemeinsame Herkunftszonen von Göttern, Versen und Aufheiterungen bilden.
IDeus ex machina, Deus ex cathedra
… und er sprach zu ihnen nicht, es sei denn in Gleichnissen Matthäus 13,34
1 Götter auf dem Theater
Die Verknüpfung der Vorstellungen von Götterwelt und Dichtung ist so alt wie die früheuropäische Überlieferung; ja, sie reicht bis in die ältesten schriftlichen Quellen der Zivilisationen in aller Welt zurück. Wer sich an den zeitlosen Wellenschlag der Verse Homers erinnert, wird noch wissen, wie der Dichter die olympischen Götter über die Schicksale der Kämpfer in der Ebene vor Troja sich beratschlagen läßt. Er bringt die Himmlischen ohne Umschweife zum Reden, nicht immer mit der bei Wesen ihres Ranges angebrachten Gravität.
Auch am Beginn der Odyssee ist zu hören, wie Zeus das Wort nimmt, um die eigenwilligen Äußerungen seiner Tochter Athene zu mißbilligen. Er redet hoheitlich auf sie ein: »Mein Kind, welch Wort ist dem Gehege deiner Zähne entflohen!«[1] Selbst der Erste unter den Bewohnern des Olymps kann einer für Weisheit zuständigen Göttin nicht umstandslos den Mund verbieten. Der Göttervater ist, um seinen Unmut zu äußern, zu rhetorischem Aufwand angehalten, sogar zum Gebrauch poetischer Formeln.
Darf man behaupten, Homer sei der Dichter gewesen, der dichtende Götter in die Welt setzte? Wie auch immer man auf die anzügliche Frage antwortete, als Dichter wären die Götter Homers nur im dilettantischen Modus tätig gewesen, sofern Dichtung ein Metier ist, das studiert werden will, dem Gerücht von den Wundertaten der ungelernten Inspiration zum Trotz. Das Beharren auf dem Standpunkt des diletto zeugte für die olympische Aristokratie. Keine Macht der Welt hätte einen amtierenden Gott nötigen können, ein Handwerk bis zur Stufe der Meisterschaft zu erlernen.
Die Götter altgriechisch-olympischen Typs verhalten sich zur Welt meistens als losgelöste Zuschauer. In irdische Handlungen greifen sie nicht weiter ein, als Schlachtenbummler es zu tun pflegen; bei Kriegen sitzen sie in ihren Logen wie Besucher, die auf Favoriten wetten. Verstrickungen sind ihre Sache nicht. Sie gleichen Zauberern, die das plötzliche Erscheinen wie das Verschwinden gleich gut beherrschen. Selbst wenn sie nicht mehr bloß diffuse Naturgewalten, meteorologische Phänomene und Triebkräfte botanischer und animalischer Fruchtbarkeit verkörpern, sondern abstrakteren ethischen, kognitiven, auch politischen Prinzipien zur Personifikation verhelfen, behalten sie einen leichtgewichtigen Zug. Man könnte die Olympier für eine society von Oligarchen halten, die sich zublinzeln, sobald der Duft der Opferfeuer zu ihnen aufsteigt.
Die Wahl ihrer Residenz verrät, sie sind Geschöpfe der Antigravitation. Sie haben das Existieren, den Aufenthalt im Feld der Schwerkraft verlernt, mit der ihre Vorgänger aus der titanischen Göttergeneration sich plagten. Den amorphen Krafttitanen war vorherbestimmt, im Dunkeln zu versinken, als die Wohlgestalteten die Oberhand gewannen – Hephaistos ausgenommen, der Mobilitätsbeschränkte unter den Göttern, der als Schmied und hinkendes Werkstattgewächs nie ganz gesellschaftsfähig wurde. Die olympische Korona, Göttervolk zweiter Generation, wird seit dem Untergang ihrer Vorläufer von der Vorahnung beunruhigt, das Besiegte könne irgendwann wiederkehren. Götter dieser Stufe wissen, alle Siege sind vorläufig. Hätten Götter ein Unbewußtes, wäre in ihm eingraviert: Wir sind Totengeister, die es weit gebracht haben.[2] Unseren Aufstieg verdanken wir einem namenlosen Lebensschwung, von dem nicht auszuschließen ist, er werde eines Tages über uns hinausführen.
Hieran ist für das Weitere vor allem ein Aspekt von Bedeutung: daß Homers Götter sprechende Götter gewesen sind. Auch sie waren, wie Aristoteles von den Menschen sagte, Lebewesen, »die die Sprache haben«. Durch Dichtung wurden sie in die Hörweite von Menschen gebracht. Mögen die höheren Wesen zumeist nur untereinander sich ausgetauscht haben, die Konversationen der Unsterblichen wurden zuweilen von Sterblichen mitgehört – als würden Pferde vor dem Rennen die Wetten der Zuschauer belauschen.
Das Phänomen der sprechenden Götter wurde Jahrhunderte nach Homer in die griechische Theaterkultur aufgenommen. Das Bühnenspiel Athens setzte vor der versammelten Bürgerschaft Handlungen in Gang, die durch ihre allgemeine Verständlichkeit der emotionalen Synchronisierung des städtischen Publikums zugute kamen. Demokratie begann als affektiver Populismus; sie machte sich von Anfang an die infektiöse Wirkung von Emotionen zunutze. Wie Aristoteles später resümierte, empfand das Zuschauervolk im Theater »Furcht und Mitleid«, phobos und eleos, besser: Schauder und Jammer, zumeist an denselben Passagen der tragischen Stücke. Die von den Schauspielern dargestellten Erschütterungen wurden von der Mehrheit der Besucher, den Männern wie den Frauen, im Gleichtakt durchlebt; sie reinigten sich von ihren Spannungen durch nahezu distanzlose Anteilnahme an den Leiden der Zerrissenen auf der Bühne. Das Griechische besaß für diesen Effekt ein spezifisches Verbum: synhomoiopathein,[3] gleichzeitig das gleiche Leid empfinden. Auch in den Komödien, die auf die Tragödien folgten, lachte das Volk in der Regel an denselben Stellen. Für die erbauliche Wirkung des Dramas war entscheidend, daß man bei der Betrachtung der Schicksalswendungen auf der Bühne gemeinsam an die Grenze geriet, von der an man aufhörte, weitere Fragen zu stellen. Das Verhüllte, das Übervernünftige, man sagt auch: das Numinose, erfüllte in realer Gegenwart die Szene. Da dieser Effekt selten eintrat und in den mediokren Stücken der nachklassischen Zeit unterging, verlor das athenische Publikum sein Interesse. Im 4. Jahrhundert v. u. Z. wurden die Zuschauer, die einen Tag für die ermatteten Darbietungen der Dionysos-Bühne geopfert hatten, mit einem Theaterobolus entschädigt.
Vor diesem Hintergrund ist auf eine ingeniöse Erfindung der attischen Bühnenkunst näher einzugehen. Die Dramaturgen (»Ereignismacher«) – noch weitgehend identisch mit den Dichtern – hatten verstanden, daß Konflikte zwischen Menschen, die für Unvereinbares streiten, dazu neigen, an einen toten Punkt zu gelangen. Mit menschlichen Mitteln steht dann kein Ausgang offen. Solche Momente wurden vom antiken Theater als Vorwände für die Einführung eines Gottesschauspielers begriffen. Weil ein Gott nicht einfach wie ein Bote von der Seite her auftreten durfte, war es nötig, ein Verfahren zu ersinnen, wie man ihn aus der Höhe einschweben lassen konnte. Zu diesem Zweck erbauten athenische Theateringenieure eine Maschine, die Göttererscheinungen von oben ermöglichte. Apo mechanes theos: Ein Kran schwenkte über die Szene, an dessen Ausleger eine Plattform, ein Pult befestigt war – von dort her redete der Gott in die Menschenszene hinab. Das Gerät trug bei den Athenern den Namen theologeion.
Wer auf dem staunenerregenden Kran agierte, war naturgemäß kein Priester, der Theologie studiert hatte – eine solche gab es nicht, und ihr Begriff war noch nicht geprägt –, sondern ein Schauspieler unter einer erhabenen Maske. Er hatte den Gott, die Göttin als gebietend-problemlösende Instanz darzustellen. Offensichtlich empfanden die Dramaturgen keine Scheu, »theurgisch« tätig zu werden – Göttererscheinungen galten für sie als machbare Effekte, so wie später manche Kabbalisten überzeugt waren, theotechnische Prozeduren ausüben zu können, indem sie die Buchstabentricks des Schöpfers wiederholten. Andere hellenische Spielorte begnügten sich damit, das theologeion als eine Art von Empore oder als erhöhten Balkon an der Rückwand des Theaters einzurichten, dann unter Verzicht auf die faszinierende Dynamik des Hereinschwebens.
Die stärkste Bühnen-Epiphanie geschieht, wenn Athene in den Eumeniden des Aischylos (in Athen aufgeführt 458 v. u. Z.) gegen Ende des Dramas auftritt, um in der Sache des Muttermörders Orest die Pattsituation zwischen der Rachepartei und der Verzeihungspartei zugunsten der versöhnenden Option aufzulösen – wodurch die rächerischen Erinnyen sich zu den »Wohlmeinenden« wandeln. Analoges wird inszeniert, wenn im Philoktet des alten Sophokles (aufgeführt 409 v. u. Z.) der vergöttlichte Herakles einschwebt, um den trotzigen, auf seinem Leid beharrenden Griechenfeind umzustimmen, bis er den Bogen herausgibt, ohne den der Krieg vor Troja dem Willen der Götter gemäß nicht zugunsten der Hellenen enden kann.
Das theologeion ist kein Rednerpult, keine Predigtkanzel, sondern eine durchaus Theater-eigene Vorrichtung. Es stellt eine triviale »Maschine« im ursprünglichen Wortsinn dar, einen Spezialeffekt, der die Aufmerksamkeit des Zuschauervolks bannen soll. Ihre Funktion ist nicht trivial: einen Gott aus dem Zustand der Nicht-Sichtbarkeit in den der Sichtbarkeit zu versetzen. Man sieht überdies den Gott, die Göttin nicht nur über der Szene schweben, man hört ihn – oder sie – sprechen und Weisungen erteilen. Ohne Zweifel ist es »bloßes Theater«, doch gäbe es das anfängliche Theater nicht, wären nicht alle Handelnden, Sterbliche wie Unsterbliche, zeitweilig von der Annahme der Darstellbarkeit erfaßt worden. Zeigen die Götter sich nicht von selbst, bringt man ihnen das Erscheinen bei. Von Effekten dieses Typs handelt der spätere lateinische Terminus deus ex machina, dessen dramentechnischer Sinn sich etwa so auf den Punkt bringen ließe: Nur eine von außen eingreifende Figur kann in einem aussichtslos verknoteten Konflikt die befreiende Wendung aufzeigen. Daß der Gott, die Göttin am Wendepunkt der Handlung coram publico auftaucht, ist zunächst nicht mehr als ein dramaturgisches Erfordernis; jedoch bedeutet ihre Erscheinung auch ein moralisches Postulat, ja geradezu die Pflicht des Theaters. Man könnte es den »dramaturgischen Gottesbeweis« nennen: Gott wird für die Lösung des Knotens im Drama gebraucht, also gibt es ihn. Es wäre respektlos, doch nicht ganz falsch, den Gott, der plötzlich auftaucht, als Happy-end-provider zu bezeichnen. Wünschbare Lösungen, gleich auf welchem Gebiet, sind oft nur mit Hilfe höherer Mächte zu erreichen, und wären es nur geistesgegenwärtige Einfälle. »Lösungen« werden als Dienstleistungen des Himmels denkwürdig[4] – lange bevor sie als Antworten auf mathematische Aufgaben und unternehmerische Probleme in den Verkehr gelangen. Fügen wir die Beobachtung an, daß zahlreiche Opernlibretti des der Tragödie abgeneigten 18. Jahrhunderts ohne den Gott aus der Maschine nicht zu denken gewesen wären.
Vor dem Hintergrund griechischer Theodramatik läßt sich die Frage aufwerfen, ob nicht die meisten entwickelteren »Religionen« ein Äquivalent zu dem Theaterkran bzw. zu dem Balkon für die höheren Wesen besaßen? Ich nehme mit dem unheilvollen Ausdruck »Religion« bis auf weiteres vorlieb, obwohl er von Konfusionen, Spekulationen und Unterstellungen überfrachtet ist – vor allem seit Tertullian in seinem Apologeticum (197) die Ausdrücke Aberglaube (superstitio) und religio gegen den römischen Sprachgebrauch umkehrte: Aberglauben nannte er die herkömmliche religio der Römer, indes das Christentum »die wahre Religion des wahren Gottes« heißen sollte. Damit gab er Augustinus die Vorlage zu dessen epochemachendem Traktat De vera religione (390), mit dem der römische Begriff definitiv durch das Christentum appropriiert wurde. Inzwischen steht er für alles Mögliche, was den Tagesverstand mit Suggestionen aus Zwielicht und dunkler Materie außer Kraft setzt,[5] obgleich es auch nicht an Bemühungen fehlt, die mögliche Kongruenz von Rationalität und Offenbarung zu demonstrieren, um den Religionsbegriff zu retten.[6] Gewiß wurde das theologeion im engeren Sinn des Worts nur einmal erfunden und ein einziges Mal so benannt. In einem erweiterten Sinn und unter anderen Namen sind die Verfahren, die oberen Götter zum Erscheinen zu drängen und zum Sprechen zu bringen, wenn nicht allgegenwärtig, so doch vielfach nachweisbar.
Was auf der attischen Bühne dramaturgisch verhandelt wurde, quasi stellvertretend für alle anderen Kulturen, war nicht weniger als die Frage, ob die Zuschauer einer feierlichen Handlung sich immer nur mit theotechnischen Effekten zufriedengeben mußten oder ob nicht »letztlich doch die Götter selbst« hinter dem Zauber des Schauspiels ihre Gegenwart erwiesen. Von alters her teilen Schamanen, Priester und Theaterleute die Beobachtung, wonach auch die tiefere Ergriffenheit im Bereich des Machbaren liegt. Jedoch: Sofern sie nicht dem latenten Zynismus ihres Metiers erlagen, glaubten sie selber, das Ergreifende als solches gewinne im Gang der heiligen Prozedur eine dichtere Präsenz. Rituellen Handlungen wohnt wie allen »tiefen Spielen« die Möglichkeit inne, daß das Dargestellte als das Darstellende zum Leben erwacht. Wenn der Gott auch »nah ist und schwer zu fassen«, schließt seine Undeutlichkeit den Ernst unserer Zuwendung zu ihm und unseres Eintauchens in seine atmosphärische Präsenz nicht aus.[7]
Gegenstücke zur hellenischen Bühnenmaschine entstehen, wo Götter diversester Herkunft, auch solche von monotheistischer Konstitution und mit starken Höhe-Prädikaten ausgestattete, beginnen, ihrer Erscheinungspflicht, sprich: ihrem Ruf zur Herablassung in die Wahrnehmbarkeit für menschliche Sensorien, zu gehorchen. Im Prinzip hätten die Götter so gut wie ganz verborgen bleiben können, da sie ihrem Wesen nach latent, transzendent und der mundanen Wahrnehmung entzogen sind. Nicht ohne Grund nennt man sie die Unsichtbaren. Vor allem die Unterirdischen hatten die Diskretion geliebt; sie gaben sich mit der jährlichen Machtprobe des Frühlings zufrieden; die wurde besonders bei den mittelmeerischen Völkern in kultischer Verstärkung nachgespielt, etwa bei den athenischen Phallophorien, das heißt den Erektionsparaden, die den Matronen der Stadt anläßlich des Dionysoskults im Frühjahr Gelegenheit boten, riesige Phalloi, aus rotem Leder genäht, in einem Zustand anbetender Verspottung durch die Stadt zu tragen.
Für die Bewohner des Jenseits von einst kann das »Erscheinen« nicht mehr als eine Nebentätigkeit bedeutet haben; Epikur traf den wesentlichen Punkt, als er bemerkte, Götter seien zu selig, um sich für die Angelegenheiten der Menschen zu interessieren. Sein Vorgänger Thales hatte zwar behauptet: »Alles ist voll von Göttern« – doch konnte dies sehr Verschiedenes bedeuten: entweder daß von den Hunderten griechischer Gottheiten immer eine die an der Übergangsstelle zur Menschenwelt diensthabende sei, einer himmlischen Ambulanz vergleichbar, oder daß wir vom Göttlichen allseits und ständig umgeben sind, ohne daß wir, alltagstaub, ihre Gegenwart bemerkten. Homer hatte en passant notiert, die Götter liebten es, unerkannt an menschlichen Gelagen teilzunehmen und einsamen Wanderern zu begegnen[8] – sie werden erst nachträglich an ihrem rätselhaften Leuchten erkannt.
Aus epiphanischen Episoden, wie auch immer man sie deuten wollte, ergaben sich mit der Zeit kultische Verbindlichkeiten. Sobald Kulte stabil wurden, fügten die Götter sich in das Ökosystem der Evidenzen ein, das ihren Erscheinungsraum umschrieb. Götter sind Vagheiten, die durch Kult präzisiert werden. In alter Zeit wurden sie fast überall zum »Erscheinen« eingeladen, um nicht zu sagen genötigt, zumeist an eigens hierfür eingerichteten Orten, den Epiphanie-tauglichen Räumen, die man ihnen als Tempel (lateinisch: templum, ausgeschnittenes Gebiet) zuordnete, und zu festgelegten Zeiten, die darum die »Feste« hießen. Sie erfüllten ihre Erscheinungs- oder Offenbarungsaufgaben bevorzugt dank menschlicher Orakelmedien, die Sinnsprüche oder mehrdeutige Prophezeiungen äußern, oder mit Hilfe von Mitteilungen im Medium von Schriften, die eine Aura der Heiligkeit umgab; nicht ungern erschienen einige von ihnen in luziden Träumen, während des Tempelschlafs oder am Vorabend wichtiger Entscheidungen.
Ihr bevorzugter Zustand war die an Gleichgültigkeit grenzende Geduld, mit welcher sie ihre Anrufungen durch die Sterblichen ertrugen. Man durfte zu ihnen beten, sie mit Großopfern beschämen, sie anklagen, sie der Ungerechtigkeit bezichtigen, ihre Weisheit in Frage stellen, ja sogar sie beschimpfen und verfluchen, ohne sofortige Antworten zu riskieren.[9] Die Götter konnten es sich leisten, so zu tun, als gäbe es sie nicht. Dank ihrer Abstinenz wanderte der überangerufene Himmel durch die Zeiten.
Schließlich gaben sie sich, die zu sehr Angerufenen, auch im Medium personaler Verkörperung zu erkennen: Sie nahmen sich nicht selten die Freiheit, Scheinkörper einzusetzen, die gingen und kamen, wie es ihnen beliebte. Oder sie verdichteten sich, »als die Zeit erfüllt war«, in einem erlösungbringenden Menschensohn, einem Messias. Nachdem Kyros II., der für seine religiöse Toleranz berühmte König der Perser, im Jahr 539 v. u. Z. den nach Babylon überführten Juden am Ende eines fast sechzigjährigen Exils die Rückkehr nach Palästina gestattet hatte, war deren geistliche Elite für messianische Botschaften erhöht empfänglich – der zweite Jesaja setzte hierfür den Ton. Aus Lobreden auf Kyros, das Werkzeug Gottes, gingen Messias-Ideen hervor, die über zweieinhalbtausend Jahre hinweg wirksam blieben. Für ein ganzes Weltalter wird zutreffen, was Adolf von Harnack über Marcion, den Verkünder der Lehre vom unbekannten Gott, bemerkte: »Religion ist Erlösung – der Zeiger der Religionsgeschichte stand im 1. und 2. Jahrhundert an dieser Stelle; niemand konnte mehr ein Gott sein, der nicht ein Heiland war.«[10] Der Beiname »Heiland« oder »Retter« (soter) war bereits von Ptolemäus I. verwendet worden, der sich nach dem Tod Alexanders des Großen zum Herrscher Ägyptens aufgeschwungen hatte; er setzte den Kult der »rettenden Götter« in Kraft. Sein Sohn Ptolemäus II. trug den einem Pharao zustehenden »Goldnamen«: »Sein Vater hat ihn erscheinen lassen.«
Erscheinende Götter gaben ihrer Klientel so viel zu sehen, zu hören, gelegentlich zu lesen, wie zu deren Lenkung, Bindung und Belehrung geboten schien – in der Regel genug, um die »Plausibilitätsstruktur« aufrechtzuerhalten, durch welche die Anhänglichkeit einer rituell geprägten Gemeinschaft an ihre kultischen Vorstellungen (antik: das Bleiben bei den Sitten der Alten, patrioi nomoi, mos maiorum; christlich: fides, »Treue im Festhalten an dem, was Halt gibt«) gesichert wurde. Plausibilität meint hier: theorieloses Geltenlassen von Üblichkeiten, auch von solchen mit Bezug zu jenseitigen Dingen.
Die Erfindung des theologeion bei den Griechen machte mit Hilfe einer mechanischen Innovation eine Verlegenheit explizit, mit der sich alle höheren religioiden Gebilde auseinanderzusetzen hatten. Es verdeutlichte die Aufgabe, dem Jenseits, dem Höheren, dem Anderen – oder wie immer man den überempirischen, von machtgeladenen Vagheiten besiedelten Raum sonst bezeichnen möchte – zu einer hinreichend evidenten Manifestation in der menschlichen Lebenswelt zu verhelfen. Das älteste Stadium von Evidenz aus sinnlich-übersinnlichen Quellen zeigte sich als Ergriffenheit der Teilnehmer, die von einem »Schauspiel«, einem feierlichen Ritus, einer faszinatorischen Opferschlachtung ausging. Frühe Kulturen bedienten sich zur Hervorrufung solcher Effekte häufig mediumistischer Prozeduren und mantischer Verfahren – beide eröffneten den okkulten Größen Gelegenheiten, ihre Intentionen kundzugeben.
In der Regel gingen die Jenseitigen auf die angebotenen Möglichkeiten des Erscheinens in Trance-induzierten Präsenzen ein, gelegentlich nach Rasereien, bei denen die Empfänger die Grenzen zur freiwilligen Selbstverletzung überschritten. Die Absender von drüben schienen ihre Kultmedien zu Botschaftern auf der Schwelle zwischen den Sphären zu berufen. Sie ließen sich gelegentlich durch in den Zelebranten ertönende Stimmen vernehmen; später wurde das Stammeln der Medien durch die beruhigte Lesung von Stellen aus heiligen Schriften ersetzt. Die Götter gaben Weisungen aus der Gestalt einer Schafleber oder aus der Richtung von Vogelflügen – Vorspielen der Künste, die man Zeichenlese und Lektüre nennt. Einen frühen Triumph des Lesens feierte die mesopotamische Astrologie, als sie die Fähigkeit erwarb, die Stellungen von Himmelskörpern zueinander als Texte und Einflußmächte in bezug auf menschliche Schicksale zu entziffern. Die Zeichenzone wächst parallel mit der Auslegungskunst.[11] Daß sie nicht allen zugänglich ist, erklärt sich aus ihrer halbesoterischen Natur: Schon Jesus macht seinen Jüngern den Vorwurf, sie verstünden die »Zeichen der Zeit« (semaia ton kairon) nicht.[12] Er selber war gewiß mehr als ein Sternbild, und doch soll der Stern von Bethlehem, sofern Matthäus nicht nur phantasierte,[13] bei seiner Geburt ein Zeichen am Himmel gesetzt haben, das den bis heute populären Sterndeutern aus dem Osten als Wegweiser diente.[14]
Ekstasepraktiken und mantische Abfragemethoden bildeten Verfahren, dem Jenseits Fragen vorzulegen, die es nicht ganz unbeantwortet lassen konnte. In der Regel war davon auszugehen, es würden sich Dolmetscher finden, die den verschlüsselten Symbolen einen praktischen Sinn zuordneten. Wie neuere Forschung zeigt, wurde im okzidentalen Altertum politische Zeichenkunde auf hochelaborierter Stufe betrieben – vor allem bei den Griechen und Römern.[15] Noch war von »politischer Theologie« nicht ausdrücklich die Rede. Doch daß Götter Meinungen zu menschlichen Angelegenheiten haben und darin Partei ergreifen, ja daß sie in Einzelfällen langfristige politische Unternehmungen planen, bei denen die Mitarbeit irdischer Akteure unentbehrlich ist – wie bei der mittelbaren Gründung Roms durch den Trojanerprinzen Aeneas –, das stand für die Zeichenkundigen außer Zweifel. Kein Imperialismus steigt auf, ohne daß Konstellationen am Zeithimmel in aktuelle Lagen hineingedeutet würden, bei Machthabern wie Aspiranten. Ratschläge aus der Unterwelt kommen hinzu: Tu regere imperio populos, Romane, memento.[16] Aus dem Mund des toten Vaters hört Aeneas die an ihn, den Vorläufer der Römer, gerichtete Mahnung, den Völkern sein wohltätiges Regime aufzuerlegen. Vergil, der Zeitgenosse und Verklärungsbeauftragte des Augustus, schuf mit diesem Herrschaftsbefehl ein Muster der Weissagung nach dem Ereignis. Die modernen Nachfolger der Auguren, die die »Geschichtszeichen« entziffern, sind die überblickmächtigen Historiker, die sich der Aufgabe widmen, das scheinblinde Nacheinander von Ereignissen als sinnerfüllte Sequenzen einer »Weltgeschichte« vorzuführen.
Den Erfindern des theologeion kommt das Verdienst zu, den Epiphaniedruck zu verdeutlichen, unter dem die Überwelt stand, seit sie die Aufgabe wahrnahm, bei der symbolischen bzw. »religiösen« und emotionalen Integration größerer sozialer Einheiten: von Ethnien, Städten, Imperien und überethnischen Kultgemeinschaften mitzuwirken – wobei die letzteren auch metapolitischen, besser gegenpolitischen Charakter annehmen konnten, wie er sich bei christlichen Gemeinden der vorkonstantinischen Jahrhunderte zeigte. Die frühen christlich animierten Kommunen wären ins Gewirr privater Zusatzinspirationen zerfallen und unregierbar geblieben, hätten die ersten Bistümer sich nicht um ein gewisses Maß an liturgischer und theologischer Kohärenz bemüht und sich territorial und personaltechnisch an die römischen Provinz- und Militärverwaltungen angelehnt. Die Bischöfe (episcopoi: Nachseher) waren der Sache nach so etwas wie religiös umgekleidete praefecti (Kommandanten, Statthalter); ihre Diözesen (griechisch: dioikesis, Verwaltung) glichen den vormaligen Reichsbezirken nach der diokletianischen Neueinteilung um das Jahr 300; nicht zuletzt durch sie gelangte das Prinzip der Hierarchie in die heranwachsende kirchliche Organisation. Mit ihr kam die Haute Couture der Sakralgewänder, die zuvor Beamtenkostüme gewesen waren.
Das bühnentechnische bzw. religionsdramaturgische und mediologische Prinzip apo mechanes theos alias deus ex machina war faktisch schon in manchen Ritualen des Nahen Orients in Gebrauch, lange bevor das athenische Theater entstand. Um das bekannteste Beispiel anzuführen: Die altisraelische Bundeslade (Aron habrit), die bei den Wanderungen des Volks mitgetragen und in der Stiftshütte beherbergt wurde, bis sie im Innersten des ersten Jerusalemer Tempels einen festen Platz fand (der nur einmal im Jahr, an Jom Kippur, dem nachexilischen Versöhnungsfest, betreten werden durfte), bedeutete aus offenbarungstechnischer Sicht eine klassische sakrale mechane zur Vergegenwärtigung eines sprach- und schriftfähigen Gottes. Ihrer funktionellen Bestimmung gemäß war die Bundeslade ein theologeion ante litteram. Sie enthielt dem Vernehmen nach die beiden Tafeln, die Moses auf dem umwölkten Berg Sinai empfangen hatte: »die waren beschrieben von dem Finger Gottes«.[17] Später soll in ihr die Torah, die heilige Schrift Israels, aufbewahrt worden sein, besser bekannt unter dem Namen Pentateuch (Fünfbuch) bzw. fünf Bücher Mose.
Ein Mehr an Epiphanie war der altjüdischen Monolatrie weder erlaubt noch möglich: Vorderhand galt das Gesetz, wer Gott, den verheerenden Feuer- und Wetterfürsten, in realer Gegenwart sieht, verliert sein Leben. Die Präsenz des Gottes machte sich numinos bemerkbar, doch war sie in keiner Weise theatralisch zu übersetzen. In puncto Erscheinen beschränkten sich JHWH bzw. die Elohim auf die Schrift und die »Natur« – beide im Zeichen der Urheberschaft verstanden und beide nur als ständige Reaktualisierung des Geschriebenen und Geschaffenen zu begreifen. Die im Inneren des aus Akazienholz gefertigten vergoldeten Kastens aufbewahrten Schriftzeichen machten seine Nähe heilig und gefährlich; wer die Bundeslade aus Versehen berührte, den sollte man töten – ein Hinweis darauf, daß die Funktion des Tabus, das von europäischen Ethnologen des 19. Jahrhunderts in Polynesien beobachtet worden war, auch bei semitischen Völkern, wie bei vielen anderen, von alters her existierte. »Von alters her« meint: seit »heiligend-verfluchende« Verbote von den archaischen Kultgruppen blutig ernstgenommen wurden. Die frühe religio, sollte man den römischen Begriff ausweiten dürfen, betraf seit je die Vorgänge an der Schwelle von lebensspendenden und todbringenden Dingen. Hier rührt, religionstypisch, das Undeutliche an das völlig Ernste.
Die Schriften des alten Israel entsprachen dem Schema eines deus in machina; ein solches kam im 17. Jahrhundert bei der Suche christlicher Ingenieure nach dem perpetuum mobile zu neuen Ehren, als man den Gottesbeweis aus der Mechanik für erreichbar hielt. Mit der mythischen Tafelübergabe am Sinai hatte der Gott Israels seiner Erscheinungspflicht genügt. Die auf den Tafeln niedergelegten Gebote wurden zunächst mündlich wiederholt, da von Abschrift, Lektüre, Studium und Kommentar erst viel später die Rede war. Der Gott des Exodusvolks war offensichtlich disponiert, während der Wüstenwanderjahre bei Nacht als Feuersäule, bei Tag als Rauchsäule am Horizont vor den Seinen herzuziehen. Daß die Wandergruppe vor der »Landnahme« in ihrem versprochenen Siedlungsgebiet vierzig Jahre auf Wüstenpfaden unterwegs gewesen sein soll, bringt ein bedeutungsschweres Zögern vor dem Erfolg zum Ausdruck. Nur als Bußgang ist die lange Irre begreiflich zu machen: Der zügige Weg ins Gelobte Land wäre bei mäßiger Gangart in vierzig Tagen oder wenig mehr zu bewältigen gewesen, dürfte man die Logik zielbewußten Wanderns voraussetzen. Die kann hier nicht veranschlagt werden; das Konzept der zügigen Wege zählt nicht zu den terms of trade zwischen Israel und seinem Herrn in der Höhe.
Aus Ägypten auswandern, das impliziert, in den Bereich von JHWHs Strafmacht einwandern. Weg und Irrweg werden nun synonym. Eines Tages würde Augustinus, im Vollbesitz seiner rhetorischen Mittel, behaupten, Gott schreibe gerade auf krummen Zeilen. Der Herr, den man nicht beim Namen nennen durfte, bekundete sich in den militärischen und häuslichen Erfolgen seiner Anhänger, im Geburtenreichtum der Viehherden und im kurzen Glanz der Königshäuser Davids und Salomos. Es fehlte nicht viel, und JHWH wäre ein Reichsgott geworden, mit sekundären Tempeln und zahlreichen tributpflichtigen Völkern ringsum; daß es anders kam – das erzeugte die unlösbare Spannung zwischen dem nie aufgegebenen suprematistischen Anspruch des Gottes Israels und der permanent prekären Lage seines kleinen, nach der Diaspora des Jahres 135 auch landlosen und entwaffneten Volks. Kaum nötig zu betonen, daß er sich bei den Seinen auch in Niederlage, Seuche, Deportation und Depression manifestierte. Von den Schriftexperten wurden die dunklen Ereignisse lege artis als verdiente Strafen an dem notorisch ungehorsamen Volk gedeutet, in manchen Fällen als Prüfungsleiden der Gerechten. Die archetypischen Figuren von Strafe und Prüfung dienten den Juden in Zeiten des Leidens, der Verachtung und der Zerstreuung, um sich als boat people im Meer der Geschichte zu behaupten, so viele auch namenlos und in unbesuchbaren Gräbern untergingen.
Das aus dem Judentum abgezweigte Christentum mußte die Dramatisierung des Fingerzeigs von oben auf seine eigene Weise erwerben. Es machte schon in seinen frühen Schriften von dem Schema des theologeion einen verblüffenden Gebrauch, als es die Erscheinung Jesu, als die des von den Juden erwarteten Messias, geradezu mit dem »Wort Gottes« gleichsetzte. Hierdurch ging die christliche Botschaft über die Beispiele der griechischen Theaterpoesie für sprechende Götter entschieden hinaus. Es dramatisierte zugleich die Idee einer Torah, die vom Geschriebenen ins Lebende zurückkehrt. Die »Quellen«, die den Unterschied markierten, finden sich vor allem in den jesuanischen Ich-bin-Aussagen (ego eimy) des Johannesevangeliums und in der Du-bist-Aussage des Petrus nach Matthäus 16,16: »Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn.« Daß diese Wendungen »sekundäre«, den Sprechern Jesus und Petrus nachträglich in den Mund gelegte Formulierungen darstellten, tut hier wenig zur Sache.[18] Entscheidend war: Sie erlaubten die schon beim Evangelisten Johannes (um das Jahr 100, vielleicht früher) in Anspruch genommene Verbindung des jüdischen Messiasmotivs mit der Logoslehre mittelplatonischer Herkunft. Dank dieser Annäherung, die später bis zur Gleichsetzung reichte, ging der Gott bzw. Gott ganz in seine menschliche Erscheinung und in deren sprachliche Äußerungen ein. Jesus wurde demnach nicht nur zu einem theologeion in Person, das heißt dem Woher der Rede von oben auf einer irdischen Bühne, er war, zumindest aus nachträglicher Sicht, auch der redende Gott selbst, nicht als Schauspieler, der Rollenprosa vorträgt, sondern als Performer, dem es gelingt, seinen Text ex tempore zu sprechen. Als die Theologie anfing, Jesus Autorschaft im metaphysischen Sinn nachzusagen, sollte seine irdische Präsenz nicht nur eine Erscheinung Gottes in Menschengestalt bezeugen – dergleichen galt als religiöses Standardereignis im Raum zwischen Nil und Ganges, wenn dort auch mit anderem Sinn –, sie wollte nicht weniger darstellen als den Abstieg des schlechthin transzendenten Logos in die Immanenz, mithin den Akt einer singulären ontologischen Herablassung.
Das theo-anthropologische Großereignis, von dem die Evangelien des Neuen Testaments berichten, zeigte sich an erster Stelle darin, daß der erschienene Gottmensch sich auf eine Epiphanie ohne Rückzugsoption eingelassen hatte. Jesus hatte keinen Dramaturgen, keinen Tragödiendichter an seiner Seite, der ihm die Worte vorgab, die zu seiner »Rolle« gehörten. Er konnte nicht hinter der Bühne die Maske absetzen. Zu seinen Dichtern wurden die Evangelisten, die seine Geschichte vom Ende her erzählten. Sie zögerten nicht, ihren Lehrer, dessen Worte vor den fatalen Ereignissen nach seinem Einzug in Jerusalem bei ihnen nachhallten, sagen zu lassen, was er gesagt haben müßte, sollte seine irdische Erscheinung den Sinn haben, ohne den sie nur der Stoff zum Bericht eines Scheiterns wäre.[19]
Dreihundert Jahre nach dem Tod des Mannes, den seine Anhänger als den gekommenen Messias verehrten, errichtete das Konzil von Nicäa den Glaubenssatz, der Herr Jesus Christus sei Gott von Gott und Licht vom Lichte, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen – was immer das bedeuten sollte. Dem folgte im nicänischen Credo eine Zeile weiter die Wendung: et homo factus est. Erst hier wurde die metaphysische Fallhöhe des jesuanischen Zur-Welt-Kommens explizit zum Ausdruck gebracht: In einem einzigen Fall sollte ein wirklicher Mensch entstehen, ohne seines Menschseins wegen aufzuhören, Licht vom Licht zu sein. Was man in gewöhnlicher Sprache »Menschwerden« nennt, bezeichnet, nach Abzug der Überhöhungen, einen Sachverhalt, den der mit Jesus (4 v. u. Z.-30 u. Z.) teilweise gleichzeitige römische Philosoph Seneca (1-65), zeitweilig des jungen Neros Mentor,[20] später sein zum Selbstmord gedrängtes Opfer, in dem Satz offenlegte: Sine missione nascimur – sinngemäß: Wir werden in sicherer Aussicht auf den Tod geboren.[21]
Die missio ist die Entlassungsgeste, die aus den Arenen stammt: Durch Daumenheben zeigte der Pöbel an, ein Gladiator, der sich tapfer geschlagen hatte, solle seinen Kampf ausnahmsweise nicht bis zum letzten, für ihn tödlichen Hieb ausfechten müssen. Sine missione existieren will sagen: Wer zur Welt gekommen ist, dem kann kein Zeichen einer launischen Menge das Ende ersparen. Daß das keine Trivialität sei, belegt der Philosoph mit Hinweisen auf die Todesvergessenheit des Alltagsdaseins. Verhalten sich die Sterblichen nicht zunächst und zumeist so unbesonnen und ins Flüchtige verliebt, als sollten sie endlos leben? Glauben sie nicht häufig, wenn es aufs Letzte zugeht, doch irgendwie davonzukommen?[22] Was Seneca und Jesus gemeinsam haben, ist die Überzeugung, es sei an der Zeit, den Ernst des Lebens: seine Endgültigkeit, seinen Lastcharakter, seine Kürze und seine Abhängigkeit von Entscheidungen zu begreifen. Der alltägliche Leichtsinn ist eine Maske des zeitenthobenen Phantasmas der Unzerstörbarkeit; der Prediger in Palästina und der Philosoph in Rom legen diese Maske ab, um zu bezeugen, es gebe etwas Unzerstörbares, das nicht phantastisch-leichtsinniger Natur sei.
Der Gottmensch, der sich unter Anregungen aus persischen und jüdischen Quellen den »Menschensohn« nannte – möglicherweise ein messianischer Titel, vielleicht aber auch nur eine façon de parler für »ich« –, war, wie man ihn sagen ließ, zur Welt gekommen, um seine Lehre mit seinem Leben zu unterschreiben. Dies traf auch auf Philosophen wie Sokrates, Seneca und zahlreiche Zeugen (martyroi) unaufgebbarer Überzeugungen zu. Die Unterschrift durch den Tod ist von alters her nicht fälschungssicher. Manche stürzten sich in ihn, um vorzutäuschen, sie erlitten ihn um eines höchsten Gutes willen – haben nicht schon Bischöfe der Spätantike ihre Schutzbefohlenen ermahnen müssen, sich nicht als Nachahmungstäter der heiligen Märtyrer hervorzutun? Noch viel mehr Menschen erlitten in allen folgenden Jahrhunderten Zeugentode, ohne Zeugen sein zu wollen. Wer das 20. Jahrhundert studiert, wird entdecken, daß in großen Zahlen gefälschte und verzerrte Martyrien zu seinen Signaturen gehören.
Im Fall des Christus wird das Theologeion-Schema in mehrfacher Weise aufgerufen. Der Mann, der sich als der »Menschensohn« bezeichnet hatte, sprach wesentliche Elemente seiner Botschaft vom Kreuz herab, an dem er als deus fixus ad machinam endete. Seine Erzähler und seine Theologen ließen diesen Tod nachträglich die Bedeutung eines Gottesbeweises durch Gott annehmen – dabei drang der Zug zur freiwilligen Schwächung, unter dem Titel des »stellvertretenden Leidens«, in das Bild des Höchsten ein.
Bezeichnenderweise wies Ignatius von Loyola seine Praktikanden bei den exercitia spiritualia (zwischen 1522 und 1524 fixiert) an, namentlich in der dritten Woche, das Mitsterben an der Seite des Herrn einzuüben; was klingt, als ob Christen sich dafür qualifizieren sollten, das Sterben vom Müssen ins Können, sogar ins Wollen zu übersetzen, die Auferstehung des ersten Siegers über den Tod vor Augen. Hegel – der vom Berliner Katheder aus alternative Exerzitien entwarf – verlangte von dem Menschen, der das Curriculum des Zu-sich-Kommens als Geist bis ans Ende durchläuft, den »unendliche[n] Schmerz über sich selbst« zu empfinden, weil er, als hinfällige Individualität, eine Stelle im dialektischen Prozeß-Ganzen auszufüllen hat – so wie die Menschwerdung im kon-absoluten Sohn für die Vermittlung Gottes mit sich selbst als geistige Individualität notwendig war – andernfalls Gott nur ein Inbegriff von leerer Erhabenheit und orientalischer Machtpopanzerei hätte bleiben müssen.[23] Es scheint, als habe Hegel mit dem unendlichen Schmerz im Menschen gerechnet wie Mathematiker nach Leibniz mit infinitesimalen Verfahren rechnen.
Es waren nicht nur die am Kreuz gesprochenen Worte, die den jesuanischen Mitteilungen ihre Höhe verschafften. Es kam die Tatsache hinzu, daß die theophanische Prozedur bis zum Moment der Kreuzabnahme durchgehalten wurde, von keinem Wunder, keinem rettenden Zwischenfall unterbrochen. Dieser Gott hatte sich das Erscheinen nicht leichtgemacht. »Erscheinen«, sagt Hegel, »ist Sein für Anderes.«[24] Die Epiphanie Jesu nahm mehr in Kauf, als bei einem »Gott von oben« zu erwarten gewesen wäre. Hier bliebe zu bedenken, daß das Sterben und Auferstehen bei tellurischen, der Großen Mutter (Demeter, Isis, Kybele u. v. a.) zugeordneten Gottheiten der unteren Sphäre wie Attis oder Osiris als ein feststehendes Motiv in das mythologische Skript des Jahreslaufs eingezeichnet waren; solche Gottheiten sind Schemata der Vitalität, Umrisse für mögliche Personen, keine Individuen. Die Auferstehung des Gekreuzigten wollte mehr bedeuten als die Regeneration der vegetativen Welt und ihr unverwüstliches Undsoweiter. Die Botschaft vom Ostermorgen sagte, von nun an habe die Vergänglichkeit auch bei Subjekten mit geistiger Individualität nie mehr das letzte Wort. Die Wege der Seele trennten sich von denen der animalischen und pflanzlichen Welt und von den Kreisläufen der Dinge, die ihres immer erneuten Grünens gewiß sind.
Ein drittes Mal statuierte der Gott-Mensch das Seine vom leeren Grab aus. Dessen Höhlenausgang, mit dem zur Seite gewälzten Stein, avancierte zu einem theologeion höherer Stufe. Daß kein Leichnam lag, wo er nach menschlichem Ermessen hätte liegen müssen, wirkte von der Jerusalemer Bühne aus als eine schockierende Aussage.[25] Was kann eine abwesende Leiche bedeuten? Was wird durch ihr Fehlen bewiesen? Dürfte man sagen, das Christentum beginne als Kriminalroman, in dem das negative corpus delicti in diversen Versionen wiederauftauchte, zuerst als spukender Ätherkörper am Rand von Jerusalem, dann als Hostie, als Fronleichnamskörper und allenthalben als Kruzifixus?[26] Der Schluß von der Leere des Grabes auf die Auferstehung war sachlich und methodisch übereilt. Paulus, der Eilige, lieferte hierzu die »Begründung«: Jesus muß auferstanden sein, weil unser Glaube sonst vergeblich wäre. Der Heidenapostel wäre nicht der Stifter des Extremismus, hätte er hier nicht in den Abgrund geblickt: Wir wären die elendesten der Menschen, sollten wir in diesem Punkt irren.[27] Ist er aber auferstanden, und das zu behaupten ist das einzige Motiv unseres Aufbruchs, sind wir berechtigt zu verkünden, die alte Welt des Gesetzes, der Sünde und des Todes sei aus den Angeln gehoben. Was zwischen dem Ostermorgen und dem Himmelfahrtstag liegt, falls es einen solchen Tag gab, bildet das dunkle Intervall in der jesuanischen Biographie, dem Karsamstag analog. In diesen vierzig Tagen überstürzen sich die Gerüchte, die Delirien, die Überhöhungen.
Doch was ist Christentum, wenn nicht eine Übereilung, die sich schließlich mehr Zeit nehmen mußte, als anfangs vorgesehen? War es nicht zu Beginn nur eine Wanderkarte für Entwurzelte und Hinüberstrebende, die in Gebrauch blieb, bis die Kirche vor den Zwängen der Bodenhaftung kapitulierte und sich lieber über Apostelgräbern in einer imperialen Metropole festsetzte, als an den Wurzeln des Himmels zu hängen?[28]
2 Platons Einspruch
Nach dem Gesagten ist von einem Ereignis zu reden, das hier der »platonische Einspruch« heißen soll. Den erwähnten Geschichten aus dem alten Palästina und ihren diversen Niederschriften – ob man sie als mythische Erfindungen versteht oder als historische Berichte oder als Hybride aus beidem deutet – ging die bezeichnete Intervention um vierhundert Jahre voraus. Mit einer Analogie aus der Kunstgeschichte dürfte man über eine »Sezession« der Philosophie von der Dichtung sprechen. In aktueller Terminologie wäre der Vorgang als die Ausbettung der Poesie aus dem philosophischen Wahrheitsraum zu beschreiben. Da die Poesie ihre Verwandtschaft mit dem lebensweltlichen Denken cum grano salis bewahrt, obschon sie oft das Wunderbare ins Spiel bringt, mit sprechenden Pferden, lebenden Statuen, fliegenden Teppichen und Elefanten, die auf Schildkröten balancieren, könnte analog dazu von der Ausbettung der philosophischen und wissenschaftsförmigen Aussagen aus den Alltagswendungen die Rede sein.
Das gegenseitige disembedding – die Entkopplung von Dichtung und Wahrheit – verbindet sich im alteuropäischen Gedächtnis mit Platons Namen. Er war der Schulestifter par excellence, der in der Nachfolge von Denkern wie Parmenides, Heraklit und Xenophanes es wagte, die Lehrbefugnis der götterdichtenden Alten, ob sie Homer oder Hesiod hießen, in Frage zu stellen. Als klassischer Antiautoritärer mit autoritären Neigungen wollte Platon einen Neustart des Wahrheitsgeschehens in Gang bringen, bei dem das Bewahrenswerte sein Recht behielte, während das Unpassende – das macht das Gros der alten Geschichten aus – mit Hilfe von logischen und ethischen Argumenten auszuscheiden wäre. Platons didaktische Strategie bestand darin, den Meisterfragesteller Sokrates als mutwilligen Erzeuger auswegloser Schwierigkeiten zu präsentieren: Was immer der Lehrer mit den Kontrahenten besprach, es mündete zumeist in Aporien oder Nullpunkt-Situationen. Der Schüler ließ den Lehrer »Dekonstruktion« betreiben, um für die Aufrichtung der zu ihrer Zeit neuartigen Ideenlehre Raum zu schaffen. Sie sollte ganz aus der Selbstbeobachtung des Denkens bei seiner inneren Bewegung hervorgehen: Dabei wird entdeckt, daß das Denken über Begriffe weiterschreitet wie der Fußgänger im Regen über Trittsteine auf einem sumpfigen Weg. Begriffe geben Trittsicherheit, wenn die nächsten Schritte auf ihre logischen Implikationen, die im Begriff mitgesetzten Inhalte, gelenkt werden – bei noch so unsicheren Umständen. Sind alle Menschen sterblich und ist Sokrates ein Mensch, gehe ich trockenen Fußes auf dem Methodenpfad, wenn ich behaupte, daß Sokrates sterblich ist. Der Wendung des »Geistes« (nous) zu sich selbst entsprang die Idee der Ideen mitsamt ihren intellekttheoretischen und ontologischen Folgen.
Das Resultat aus Platons Intervention war die Entfremdung des Göttlichen von Mythos, Epos und Theater und seine Neudarstellung als mentale bzw. noetische, diskursive, in letzter Instanz nur kontemplativ berührbare Größe. Da auch die neu zu gründende, anhand philosophischer Leitgedanken zu verfassende polis, Platons Überzeugung gemäß, eine durch das Göttliche (to theion) integrierte Gesamtheit sein sollte, und dies in noch höherem Maß als die bisherige, durften im idealen Gemeinwesen – einer Art von logokratischem Gottesstaat – die altehrwürdigen Erfindungen der Gottesmärchen-Sänger nicht unzensiert weitererzählt werden. Viele von den alten Geschichten ließen die Götter in einem mehr als dubiosen Licht erscheinen; zu oft legten die Himmlischen wie die primitivsten Sterblichen krude Rachegelüste, vulgäres Machtstreben und ihrem Stand nicht angemessene erotische Triebhaftigkeiten an den Tag. Als Vorbild für eine nachplatonische Jugend war die olympische Korruptionsgemeinschaft nicht mehr geeignet.
Eine reformierte Pädagogik drängte in der Folge darauf, mit der noch nicht konturscharfen, doch schon polemisch einsetzbaren neuen Rede vom Göttlichen ein Bündnis zu schließen. Aristoteles, ansonsten nicht selten mit seinem Meister uneins, greift die akademische Zurückweisung der Alten auf, indem er sie spöttisch als theologoi oder mythologoi bezeichnet – Leute, die kognitiv invalide Geschichten von Göttern und Heroen erzählen, als ob es sich bei diesen um eine Korona von unbeherrschten Prominenten handelte. Aristoteles ordnete die theologoi den Sophisten zu, die Platon als Verbreiter von effektvollen Lügen denunziert hatte. Authentische Lehrbefugnis in Fragen dieser Höhenlage ist künftig nur noch den Philosophen zuzubilligen.
Ein solcher Stilwandel des Redens von göttlichen Dingen muß in seiner Zeit skandalös gewirkt haben. Nach der Ausbreitung der klassenübergreifenden, vorwiegend für die Oberschicht attraktiven Philosophie-Mode im hellenistisch-römischen Raum wurde der sublimierte god-talk zum Erfolgsmuster mit hohem Expansionspotential. Um vor Gebildeten von Göttlichem plausibel zu reden, mußte es in absoluten Komparativen lokalisiert werden: excelsior, superior, interior – hervorragender als hervorragend, höher als hoch, innerlicher als innen. Die Sprache der abstrakten Vertikalität kam dennoch nicht umhin, sich weiterhin auf die Anschaulichkeiten von Berg, Wolke und Vogel, Himmel, Sonne, Blitz und Stern zu stützen.
Seit dem Auftauchen der akademischen Philosophie war die bessere theologia – Platon verwendet den Begriff ein einziges Mal im zweiten Buch der Politeia[29] – nur noch als Lehre von den ersten Qualitäten vorzutragen. Da Gutsein das erste Prädikat Gottes darstellt, mußte vom Göttlichen nach Platon durchwegs agathologisch gehandelt werden. Gut ist, was von sich her Gutes verbreitet: bonum diffusum sui. Das Gute, das sich mitteilt, lädt zu Anschlüssen an seine Vorzüge ein. Nicht alles jedoch, was sich mitteilt, ist gut. Die übrigen Autoren, die von göttlichen Dingen (to theion) herkömmlich reden, vermenschlichend im epischen Format und deklamatorisch im dramatischen oder lyrischen Register, metaphorisierend im Rahmen der populären Anschauungen von Majestät und Höhe, sie alle mögen bisher ihr Bestes gegeben haben, doch sie verstehen von der angemessenen »Behandlung« des Höchsten nicht genug. Seit je schaut man irgendwie hinauf – den guten Willen zur Erhebung kann man den Alten nicht absprechen. Doch was »oben« bedeutet, hat noch keiner verstanden, und wie das Innen an ihm andockt, ist bisher niemandem klargeworden.
Die ausschließliche Zuschreibung von Gutheit zum Göttlichen sollte nach einer längeren Inkubationszeit fatale Folgen zeitigen: Sie lud das Un-Gute, das Böse ein, in nahezu allen irdischen Dingen die Hauptrolle zu spielen, obschon es zunächst nur als eine Folge der Abwesenheit des Guten gedeutet worden war. Als leere Negativität beginnend, wandelte es sich im Lauf der Zeit zu einer furchteinflößenden Gegenmacht. Wie anders hätte der Teufel im okzidentalen Mittelalter zum »Fürsten dieser Welt« aufsteigen können, ein Titel, der an sporadische jesuanische Wendungen des Evangeliums nach Johannes (archon tou kosmou) anknüpfte – wobei man sich fragen darf, wie Jesus von der Existenz der Archonten (der durchs Los bestimmten Stadtverwalter Athens, später allgemein »Machthaber«) gewußt haben könnte? Daß die Erhebung des Bösen zu einer Macht eigenen Rechts auf Figuren der indoiranischen Weltdeutung zurückging, war den frühen Theologen griechischer Inspiration, auch Johannes, falls man ihn schon einen Theologen nennen dürfte, nicht mehr bewußt. Sie bewegten sich im Tunnel ihrer terminologischen Vorentscheidungen, an dessen zurückgelassenem Ende nur noch ein schwaches Licht von Osten sichtbar blieb.
Die Gebietsabtretung an das Böse bot den Vorzug, zu erklären, wie Gott allmächtig und zugleich unwillens sein konnte, den Übeln der Welt direkt entgegenzuwirken. Daher die fragwürdige »Erlaubnis-Theorie«, der zufolge der Satan quasi einen lizenzierten Subunternehmer des guten Schöpfers darstellte. Fragwürdig blieb sie, weil sie Gott auf Makellosigkeit und Leidlosigkeit festlegte. Das outsourcing des Bösen trieb die Menschen einem Guten, Allzuguten in die Arme, das für seine Kehrseite nicht verantwortlich sein sollte. Lieber legte man die Welt in die Hand des Teufels, als daß die Idee eines Mangels, ja eines Leidensdrucks in Gott erwogen werden durfte.[30]
In Platons Dialog Euthyphron (vermutlich um 388 v. u. Z.) tauchte der Ausdruck therapeia theon auf, um etwas zu bezeichnen, was dem lateinischen Konzept der religio nahekam. Sokrates gebrauchte ihn, um das Gebiet zu umschreiben, auf dem sein Gesprächspartner Euthyphron, den er auf dem Weg zum Gericht zufällig auf der Straße trifft, sich seiner Reputation zufolge gut auskennt, das der »Frömmigkeit« (eusebeia) und ihrer Handhabung. Tatsächlich erweist sich das Göttliche, in älterer wie neuerer Auffassung, von sich her durchwegs als eine Behandlungs- und Umgangsfrage. Es bezeichnete eine Sache der Sorgfalt, der scheuen Besinnung und der skrupulösen Beachtung des Protokolls, das im Umgang mit den höheren Mächten zu respektieren ist. Waren diese Mächte erst soweit vergeistigt, wie die platonische Intervention es verlangte, fielen die grobstofflichen Transaktionen zwischen Hüben und Drüben, die Blutopfer und Holokauste beiseite – jene erhaben-frustrierenden Feueropfer, die das Tier als ganzes einäscherten, ohne daß es zum Verzehr der gegarten Teile kommen durfte.
Sobald die sublimeren Ansprüche deutlich artikuliert waren, wurde fraglich, ob ein Adorant sich noch ernsthaft dem spirituellen Zielraum nähern konnte, der weiterhin dem Faszinosum beiwohnen wollte, wie bei der Opferung eines geweihten Rinds die Blutschwälle aus seiner durchschnittenen Kehle hervorschossen, zuerst in hohem Bogen, dann ermattend. Für die neuen Einsichtigen sollte evident geworden sein, daß der Herzstillstand bei dem Opfertier (hostia) nach seinem Verbluten hinsichtlich der jenseitigen Sphäre nicht das Geringste bewies.
3 Von der wahren Religion
Siebenhundertfünfzig Jahre nach Platons Intervention ergab sich aus Hinweisen dieser Tendenz bei dem jungen Aurelius Augustinus – zu jener Zeit noch von neoplatonischen Euphorien erfüllt – das Konzept der vera religio, so der Titel seines in der Muße von Thagaste verfaßten apologetischen Traktats von 390. In der augustinischen religio ist ein ferner, doch deutlicher Nachklang der griechischen »Therapie« (Dienst, Pflege, Behandlung, Kult, Verehrung) zu vernehmen.
Auch Cicero (106-43 v. u. Z.), auf halbem Weg zwischen Platon und Augustinus, setzte religio mit dem cultus deorum gleich. Nicht zufällig heißen christliche Kulthandlungen bis heute »Gottesdienste« – in sinngerechter Weiterbildung der Sorge um die angemessene therapeia theon. Kult ist, was keine Abweichung, keine Improvisation erlaubt. Daß Behandlungsfehler teuer zu stehen kommen können, wußte man überall, seit es Spezialisten für den Umgang mit Jenseitigem und Unberechenbarem gab – von den ältesten Zauberern und Heilern bis zu den Wahrsagern und Wesiren. Erst die Unternehmensberater unserer Tage predigen den Mut zum Fehler. Das Abenteuer christlicher Dogmatik begann damit, daß man, unter griechischem Einfluß, von der herkömmlichen Ritual-Korrektheit zu einem Wahrheitsanspruch im weiteren, ja im allgemeinsten Sinn überging; er sollte kosmologische, ontologische und ethische Doktrinen umschließen, weit über den konventionellen Sinn für Gesetzesgeltung, Kultrichtigkeit und Schriftverständnis hinaus.
Wenn der frühe Augustinus von »wahrer Religion« dozierte, begegnete man noch einem juvenilen Eiferer bei philosophischen Exerzitien. Sie sollten die Vorstellung einüben, die Wahrheit habe im »inneren Menschen« ihr Domizil. Offensichtlich gab es schon gegen Ende des 4. Jahrhunderts genügend Personen, die mit dem halbesoterischen Ausdruck »innerer Mensch« (der mit dem Platonismus und seinen Derivaten die spätantike Runde machte) einen Sinn verbinden konnten; er bezeichnete jenes Innere, in dem ein individualisiertes Bewußtsein von Schuld und Reue, von Erlösungshoffnung und Dankbarkeit, vor allem aber von Teilhabe an der Sphäre wahrer Ideen lokalisiert werden konnte. Noch behält »wahr« überwiegend eine adjektivische Bedeutung, indes das Nomen religio das sorgsam zu beachtende Regelwerk einer die Götter respektierenden Lebensweise bezeichnet. »Wahre Religion« meint fürs erste einen modus vivendi, bei dem die christlichen Grundsätze zum Tragen kommen. Die fordern vor allem anderen: Abstand vom toxischen Realismus »dieser Welt«. Die »Welt« erkennt man daran, daß sie ständig Einladungen zum Mitmachen beim Bösen versendet.
Unter dem Dach des lateinischen Christentums blieb der Ausdruck religio weithin für das Leben unter einer Klosterregel reserviert; entrare in religionem meinte im Mittelalter einem Orden beitreten. Noch gegen Ende des 18. Jahrhunderts hieß bei Diderot die Nonne la religieuse. Wo die »wahre Religion« praktisch werden sollte, legte sich die Spezialisierung des Glaubens zu einem eigenen Stand nahe. Nur im Ordensleben konnte die altchristliche Sorge um die Gefahr sittlicher Verfehlungen bis zur vollständigen Trennung von der »Welt« vorangetrieben werden; die Summe der Versuchungen, die zum Unheil einladen, ergab sich aus der allegorischen Gleichung von Welt und Frau. »Wahres Leben« meinte: Vorwegnahme des ewigen Lebens unter irdischen Bedingungen – am besten in monastischer Absonderung, gelegentlich in extremen Klausuren, die in einer zugemauerten Zelle das Vorlaufen in den ersehnten Tod aktiv symbolisierten.[31]
Solange das Gesicht der religio durch die klösterliche Option und die Existenz des Berufsklerus als Erster Stand geprägt war, ließ sich das moralische Hauptproblem der bipolaren Welterzeugung jener Zeit unsichtbar machen: wie denn der »Christenmensch« – Luthers Wort – sich anzustellen habe, um für die Praxis in dieser Welt Verantwortung zu übernehmen. Weltflucht ist gut, Gestaltung der Verhältnisse besser. Eintausend Jahre nachdem das Christentum durch seine Allianz mit den Thronen an die Macht gekommen war, konnte der Rückzug in die Wüste auf Dauer nicht die allgemeine Lösung bleiben. Die christliche Monarchie alteuropäischen Typs hatte einen ersten Schritt ins pragmatische Feld getan; der Ultramontanismus des 19. Jahrhunderts einen zweiten; die democrazia cristiana des 20. Jahrhunderts vollzog den dritten. Bei ihnen allen konnte es nicht ausbleiben, daß die christliche Realpolitik als situationssensible Heuchelei ihre Liaisons mit den machthabenden und machtgebenden Verhältnissen knüpfte.
Man mußte das Ende des Mittelalters abwarten, bevor die »Religion« zu der vom Atlantik her sich auftürmenden Gewitterwolke anschwoll, die das mentale Klima des nach der Kolumbusfahrt sich profilierenden Kontinents namens »Europa« – bis dahin: das Abendland – verdüstern sollte. Sie wuchs heran, als mit den heimkehrenden Schiffen von überall die Nachrichten über Hunderte und Tausende von Völkern eintrafen, deren bizarre Umgangsformen mit ihren Göttern zuweilen wie Karikaturen des europäischen Glaubenslebens zu lesen waren. Die Wolke entlud sich in Gestalt der christlichen Konfessionskriege zum Ringen um Heilsgewißheit unter Waffen. Nach dem langen 16. Jahrhundert – das von 1517 bis 1648 dauerte – gelang es der eben damals entstehenden »politischen Klasse«, die Kriege der religiös codierten Staaten mit dem Westfälischen Frieden zu beenden, den man als erste Konzession an den von Rom bis heute beklagten »Relativismus« zu deuten hat.
Um diese Zeit wurde erkennbar, was der unaufhaltsame Struktur- und Sinnwandel des Religio-Konzepts mit sich brachte. Die Wolkenfront »Religion« driftete nicht nur über die Kriegslandschaften der europäischen Mächte, die unter katholischen und protestantischen Bekenntnisbannern gegeneinander rüsteten und marschierten, sie machte auch zahllose Spielarten des Ahnenglaubens und lokaler Bündnisse mit jenseitigen Größen sichtbar, wie europäische Seefahrer, Händler, Missionare, Ethnographen sie aus allen Himmelsrichtungen zusammentrugen. Sie eröffnete den Europäern die so erschreckende wie subversive Erkenntnis, die Erde sei von bizarren Kulten übersät, die sich, ohne es zu wissen, gegenseitig parodieren. Der Begriff »Religion« als solcher wurde latent ironisch. In den Augen der Entdecker war der Planet Terra nicht nur der von Menschen des priesterlich-kranken Typs besiedelte »asketische Stern«, von dem Nietzsche in seiner polemischen Ableitung der selbstquälerischen Ideale sprach;[32] viel mehr noch schien er der abergläubische Stern zu sein, auf dem es keine Fabulation gab, die nicht von irgendwem geglaubt wurde.
An manchen Orten im Alten Reich wurde die Vorstellung überliefert, man könne ins Paradies schauen, wenn man sich in der Christnacht unter einen Apfelbaum stelle; im frühen Tibet soll es den Glauben gegeben haben, wonach sich die Affen in die Tibeter verwandelt hätten, nachdem sie die Gewohnheit angenommen hatten, das vom heiligen Berg Sumeru herabfallende Getreide zu verzehren. Die Armen Haitis glauben bis heute, Baron Samedi verlasse am Allerseelentag den Friedhof und treibe sich mit seinem Anhang rauchend und prassend in den Straßen herum, wobei er mit androgyner Fistelstimme anzügliche Couplets zum besten gibt. Bei den südäthiopischen Dorze soll der Glaube bestehen, die Leoparden besäßen Fastentage und hielten sie in der Regel ein, dennoch sei es klug, alle Tage auf der Hut zu bleiben. Bei den Blackfoot gab es den Brauch, daß ein Krieger in einer Notlage sich einen Finger der linken Hand abschnitt und ihn dem Morgenstern darbrachte. Die Barasana vom Rio Uaupés im nördlichen Amazonien glaubten, der Mond bestehe aus geronnenem Blut, er steige in manchen Nächten zur Erde herab, um die Knochen der Männer zu verzehren, die mit menstruierenden Frauen verkehrt hatten. Im Jahr 1615 trennten Jesuiten den rechten Arm Francisco Xaviers von seinem in einer Kirche nahe Panjim in Goa aufbewahrten Leichnam ab und übersandten ihn nach Rom, wo er als Werkzeug Gottes bei der Taufe zahlreicher Heiden in Asien in der Kirche Il Gesù in einen Schrein aus Glas und Gold gefaßt und ausgestellt wurde; er soll dem Missionar beinahe abgestorben sein, nachdem er 1544 in einem Monat zehntausend Perlenfischer an der Küste Goas getauft hatte; im Januar 2018 kauften Gläubige für diesen Reliquienschrein einen Sitzplatz an Bord einer Air-Canada-Maschine und begleiteten ihn einen Monat lang von einer kanadischen katholischen Kirche zur nächsten, in der Hoffnung, die Nähe des heilmächtigen Arms werde so viele Menschen wie möglich »berühren«.
Paul Valéry mag recht gehabt haben, als er bemerkte, unsere Vorfahren hätten sich im Dunklen mit jeder Art von Rätsel gepaart und ihm fremd anmutende Kinder gemacht.[33] Er hat sich nur darin geirrt, daß es nicht bloß unsere Vorfahren, sondern ebenso unsere Zeitgenossen sind, die Rätsel umarmen, um Phantome zu zeugen.
Was Augustinus (354-430) angeht, so hatte er zunächst nur im Sinn, was zu seiner Zeit in der Luft lag: Er nahm, um mit Adolf von Harnack zu reden, an der »allmählichen Gräcisierung des Christentums« teil,[34] obschon für ihn, den römischen Rhetor, das Koine-Griechisch des Neuen Testaments zeitlebens eine Fremdsprache blieb. Ihm schien offenkundig zu sein, wieso die christliche Botschaft von sich her nach Übersetzungen verlangte – deswegen durfte es aus seiner Sicht bei der Graecophonie nicht bleiben. Augustinus ahnte nicht, daß er mit seiner theologisch ausgedachten, schwer verkraftbaren Lehre von der Prädestination zum Heil wie zur Verdammnis eine Lawine auslöste, die große Teile der alt- und neueuropäischen Psychosphären für anderthalb Jahrtausende unter sich begrub: die Lawine des ontologischen Masochismus.[35] Von diesem und seinen mystisch extremistischen Derivaten ging die Forderung aus, mein Eigenwille müsse zunichte werden, wenn wirklich Gott alles in allem sein solle. Solange ich noch ich sagen kann, bin ich vermutlich einer der rebellischen Geister, die aus Stolz und Vorurteil an der Verfestigung der widergöttlichen Welt mitwirken.
Infolgedessen wollten die unbedingt Gläubigen – die Mütter der radikalen Minderheiten – durch forcierte Unterwerfung unter die absolute Übermacht ihre Auslieferung an die Souveränität des »Anderen« erreichen. Man hat Gründe, die Sucht nach Prostration als falsche Entselbstung zu kritisieren, ja, sie als camouflierte Form des Selbstmords zu verwerfen – doch ließe die Geste der Selbstaufhebung ins Ganze sich auch als Hingabe an das Gefühl der schlechthinnigen Abhängigkeit vom Umfassenden oder der Einbettung ins heile kosmische Ganze feiern. Bei den Gründern des Jesuitenordens, namentlich Ignatius und Francisco Xavier, zeigte sich, wie die radikalisierte Gehorsams- und Dienstethik in die Mobilmachung des Willens zur Expansion überging. Im Kreis der jüngeren Idealisten, Fichte und Schleiermacher an der Spitze, wurde das Durchdrungensein vom Unbedingten als mit dem aufrechten Stand verträglich erklärt – Fichte begründete die Möglichkeit von aufrechtem Gang und Stand radikal offensiv, indem er der tätigen Selbstverwirklichung antiontologische Argumente an die Hand gab: Für den Tatmenschen verdiene die äußere Wirklichkeit als eben bloß äußere und vom Ich vorgestellte keinen Respekt; wer sich von ihr einschüchtern läßt, hat sich selbst nicht verstanden. Sofern das Äußere relevant bleibt, so nur als Material, das zum Nachgeben unter dem Druck der vom Sollen gesteuerten Aggression gezwungen werden muß.
Die religiös Musikalischen unter den ontologischen Masochisten fieberten von alters her ihrer Auslöschung wie dem endgültigen Sieg über sich selbst entgegen. Sie neigten zu der Überzeugung, bei gleichzeitigem Auftreten von Gott und Ich sei einer zuviel. Die Lösung konnte vorerst nur darin bestehen, das Ich zu streichen.[36] Dabei wurde das Verfahren entdeckt, sich totzustellen, um den nächsten Schritt als Marionette des göttlichen Willens zu tun, der mystischen Devise gemäß: »Wo ich nichts für mich will, da will Gott für mich.«
Bei den Griechen des Altertums war das Dilemma der Koexistenz von Göttern und Menschen durch eine klare Stufenordnung aufgelöst worden. Kam ein Mensch der Göttersphäre zu nahe, sprach man von Hybris, der Überhebungskrankheit. Sie wurde durch Abstürze kuriert. Für die mediterranen Alten war die Welt alles, was nach gescheiterten Höhenflügen der Fall ist. Wer sich im Mittleren hielt – schlichter gesagt: wer im Alltäglichen verankert blieb –, widerstand der gottlosen Versuchung zu fliegen. Dem Grad der Verblendung nach war Ikarus, der Versuchspilot der Weltflucht nach oben, des Ödipus' nächster Verwandter.
4 Gott darstellen, Gott sein: Eine ägyptische Lösung
Wer fliegt, der fliegt; dieser König Phiops fliegt hinweg von euch, ihr Sterblichen. Er gehört nicht zur Erde, er gehört zum Himmel.