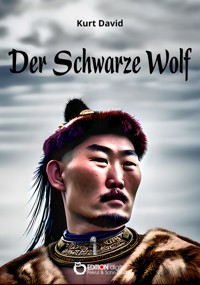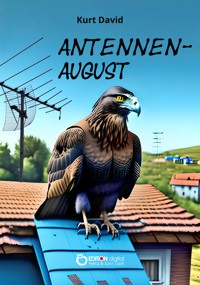6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Maler und ein Schriftsteller sind in die Mongolei gereist. Dies geschah zu unterschiedlichen Zeiten und ohne dass der eine vom anderen wusste. Der Maler malte, was er sah, der Schriftsteller schrieb, was er erlebte. Später hängte der Maler seine Bilder in einer Ausstellung auf und traf dort den Schriftsteller. Am Ende des langen Gesprächs über ihre Reisen in das Land des blauen Himmels sagte der Maler: „Du könntest den Kindern etwas von dem erzählen, was auf meinen Bildern nicht zu sehen ist!“ „Das werde ich“, antwortete der Schriftsteller, „und was ich mit Worten allein nicht erzählen kann, das werden die Kinder auf deinen Bildern sehen“. Entstanden sind spannende Geschichten, auch für Erwachsene, über eine Bären- und Fuchsjagd, über das gefährliche Zureiten von Pferden, über Hunde und Wölfe, und immer über die wunderbare Gastfreundschaft der Mongolen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 110
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impressum
Kurt David
Der Bär mit dem Vogel auf dem Kopf
Geschichten aus der Mongolei
ISBN 978-3-96521-916-8 (E-Book)
Das Buch erschien erstmals 1977 in Der Kinderbuchverlag Berlin.
Für Leser von 10 Jahren an.
© 2023 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Hunde ohne Ohren?
Tagebuch: 23. Mai
Heut Morgen versperrten mir acht Wolfshunde den Rückweg vom Fluss. Sie hatten keine Ohren. Das war etwa 200 km westlich Ulan-Bators in einem Steppendorf mit achtzehn Jurten.
Ich erwachte, und mir fiel sofort wieder ein, was in der Nacht geschehen war und weshalb ich schlecht geschlafen hatte.
Die Wölfe waren von den Bergen herabgekommen!
Ich hatte ihr Heulen und Winseln in den Schluchten gehört und mir vorgestellt, wie sie auf den Ail (dörfliche Ansiedlung) zuschlichen, sich dem Pferch näherten, in dem sechshundert aufgeschreckte Schafe blökten. Später rannte die Herde sogar gegen die Holzstangen der Einzäunung. Unser Jurtenboden hatte gebebt. Die Hunde bellten, jagten mit wütendem Gekläff auf die Wölfe zu. Eine Weile danach vernahm ich ganz deutlich das Gebalge draußen vor den Bergen, hörte das Schnaufen und Knurren der Tiere und wie sie aufeinander losgingen, sich im Steppengras wälzten, überschlugen. Die Felswände warfen jedes Geräusch zurück. Dann wurden zwei Schüsse aus dem Ail abgefeuert, und es hatte elfmal in den Steinschluchten geknallt. Mit dem letzten Echo verlosch der Lärm. Lediglich die Hunde nahm ich noch wahr, als sie erschöpft heimtrabten, zwischen den Filzzelten umherkeuchten und ihre Schlafplätze aufsuchten. Sie schüttelten sich, japsten nach Luft, und ein Mann redete mit ihnen; vielleicht lobte er sie, weil sie sich so tapfer geschlagen hatten. Nachher war ich erneut eingeschlafen, ohne zu ahnen, dass zwei Stunden darauf der nächtliche Kampf zwischen Ail und Bergen von neuem beginnen würde.
Nun war ich also wach und müde.
Von meinem Bett aus blickte ich hoch zum hölzernen Dachkranz, sah den klaren Morgenhimmel über mir und wie die Sonne schon an das rotbemalte Gebälk schien. In der Mitte des runden Raumes hockte eine kleine, alte Frau. Sie hatte das eiserne Öfchen die Nacht hindurch mit getrocknetem Schafdung beheizt, damit ich nicht friere. Auf der dicken Matte am Boden lagen ein Mann, seine Frau und fünf Kinder unter einem großen Bärenfell, das sich hob und senkte. Nur gut, dass die sieben Köpfe am oberen Rand des zottigen Pelzes herausguckten, sonst hätte man wirklich denken können, ein Bär habe sich ausgestreckt und sein Atem würde das Auf und Nieder des braunen Felles hervorrufen.
Ich verließ das Bett.
Die alte Frau am Öfchen sah mich sofort an, lächelte, rieb ihre Hände, ihre Wangen, ihren Nacken, fragte also mit diesen Gesten, ob ich mich jetzt waschen wolle. Ich nickte. Sie bedeutete mir, dass sie sofort Wasser hole, und lief gebückt unter der Schräge des Jurtendaches zu den zwei hohen Blechkannen, die links von der niedrigen Holztür standen.
„Ich gehe mich waschen“, sagte ich und wusste, dass sie meine Worte nicht verstehen konnte.
Dafür hatte sie mein Dolmetscher gehört, der mir gegenüber im Bett lag. „Gehen?“, sagte er. „Wohin willst du gehen?“
„Natürlich zum Fluss.“
„Der Fluss ist weit!“
„Für die alte Frau auch“, antwortete ich und zog mir schnell die Stiefel über. Wirklich, es hätte mir Spaß gemacht, jetzt in der Frühe zum Fluss zu laufen.
„Lass mal, sie holt dir schon Wasser“, sagte Sodnom. So hieß mein Dolmetscher.
Die Frau stand etwas unentschlossen mit den Kannen in der Hand nahe der Tür. Sie schien nicht schlau aus unserem Gespräch zu werden. „Sag ihr, ich gehe mich waschen, und die Kannen nehme ich selbstverständlich mit.“
„Das versteht sie nicht“, Sodnom richtete sich auf und blickte zu der Frau, die ihn hilflos ansah.
„Versteht sie nicht? Du sollst es ihr doch mongolisch erklären.“
„Mongolisch versteht sie das erst recht nicht“, Sodnom lachte ein wenig, „weißt du, mongolisch ist in diesem Fall, wenn sie dir das Wasser vom Fluss holt. Du bist Gast.“ Ziemlich ausführlich erläuterte er mir, was man in seinem Land unter Gastfreundschaft verstünde. Doch das wusste ich schon.
„Aber wenn ich gern gehe? Wenn es mir Spaß macht?“
Sodnom guckte ganz verdattert. „Hast du Spaß gesagt? Spaß?“ Er verzog den Mund, als habe er Zahnschmerzen.
„Ja, Spaß“, wiederholte ich, „oder sagen wir’s mongolisch: Darf man denn einem Gast abschlagen, was ihn erfreut?“
Mein Dolmetscher kicherte, ließ sich ins Bett zurückfallen und rief: „Spaß ist herrlich! Das nennt der Spaß! Hier gibt’s bestimmt keinen Menschen, dem es auch noch Spaß macht, zum Fluss nach Wasser zu laufen und die schweren Kannen zu schleppen.“
„Mehr wollte ich ja gar nicht wissen!“
Die kleine, schwächliche Frau blickte zu ihm und mal zu mir und hatte nichts begriffen. Mir tat sie einfach leid. Sollte sie vielleicht für mich das Wasser vom Fluss zum Ail tragen? Also lächelte ich ihr noch einmal freundlich zu, nahm die hohen Kannen, wogegen sie sich anfangs ein wenig wehrte, und trat aus der Jurte.
Sodnom schrie mir hinterher: „Du, der Fluss ist aber viel, viel weiter, als du denkst!“
Das beunruhigte mich nicht mehr. Hier war alles viel, viel weiter, als man dachte und überhaupt denken konnte. Ein anderes Wort hätte man erfinden müssen für „weit“. Vielleicht gab es das in ihrer Sprache?
Vor mir war nichts als die unendlich wirkende Steppe, eine helle Hochebene mit gelben Gräsern. Kein Baum, kein Strauch. Fern ragte eine schneeweiße Hügelkette in den Himmel hinein. Wenn ich mich umdrehte, sah ich die weißen Filzjurten vor den dunklen Felswänden der Berge. Die Sonne schien auf meinen Rücken, was mir sehr angenehm war. Ich hatte nämlich am Morgen fünf Grad minus gemessen und am späten Abend elf. Ich maß jeden Tag mehrmals die Temperatur, trug sie in mein Tagebuch ein. Wir hatten Mai, und ich fror.
Den Fluss erkannte ich noch nicht, aber ich wusste, wo er langlief und dass es eine breite Senke war, die seine Wasser in die Steppe gegraben hatten. Übrigens hatte ich schon herausgefunden, dass die Jurten in diesen Ails meist ein beträchtliches Stück abseits der Flüsse standen, um den Überschwemmungen zu entgehen, die nach einem heftigen Regenguss die anderthalbtausend Meter hoch liegende Ebene in Minuten überfluteten.
Hinter mir hörte ich jetzt Pferdegetrappel und Hundegebell und ein dumpf klingendes Wummern des Steppenbodens. Ich schaute zurück und sah berittene Hirten die Schafherde zu den Berghängen treiben, also entgegengesetzt der Richtung, in die ich ging. Ich hörte die Männer sogar miteinander reden und wunderte mich erneut, über welche Entfernungen der geringste Laut zu vernehmen war.
Plötzlich stieg ein Fischreiher vor mir auf, zeigte an, wie nahe ich dem Fluss war. Der Reiher flog stromaufwärts. Ihm folgte geraume Zeit danach ein zweiter, und ich sah die Wassertropfen von seinen Füßen herabfallen.
Der Fluss war breit und wie alle Flüsse dieses Landes sehr flach und schnell. Nur an den Uferrändern war er mit Eis bedeckt, durch das man hindurchsehen konnte bis auf den steinigen Grund.
Ich stieg die Böschung hinab, die voller Steine war. Zwischen diesen Steinen blühten Edelweiße und zitterten im Wind, als wäre ihnen kalt.
Mit dem Stiefel trat ich das dünne Eis vom Uferrand ab, verfolgte eine Weile die Schollen auf dem klaren Wasser. Wie blitzende Glasscheiben trieben sie den Fluss hinab. Dann suchte ich mir einen besonders schönen, flachen Stein, auf den ich Seife, Zahnbürste und Rasierzeug legte.
Das Wasser war ungeheuer kalt. Trotzdem kann ich nicht sagen, dass mir die Prozedur missfiel; im Gegenteil, sie verscheuchte mein Nichtausgeschlafensein, so dass ich mich frisch fühlte und nicht mehr fror, als ich mit dem Waschen fertig war.
Plötzlich klirrten hinter mir einige Steinchen im Geröll. Erschreckt wandte ich mich um. Oben auf dem Rand der Böschung stand ein großer Hund im grellen Gegenlicht der Morgensonne und schaute zu mir herunter. Er stand ganz still; wie aus Stein stand er dort oben, nur die Haare seines Felles bewegte der Wind; natürlich verhielt auch ich mich so, indem ich wie zu Stein geworden am Wasser kniete, wenngleich auch ich es nicht vermeiden konnte, dass der Wind mein Haar bewegte. Der Hund war schwarz und hatte eine ziemlich spitz auslaufende Schnauze, mit der er schnüffelte und alles einsog, was er brauchte, um dahinterzukommen, wen er vor sich hatte. Dass seine Studien nicht zu meinen Gunsten verlaufen würden, hatte ich erwartet, aber bestätigt fand ich meine Befürchtung in der Art, mit der er seinen Schweif bewegte. Als er sich restlos klar war, einen Fremden vor sich zu haben, setzte er sich auf die Hinterpfoten und bellte, bellte in jene Richtung, wo der Ail war, den ich von hier unten allerdings nicht sehen konnte. Ich sah nur den oberen Rand der Böschung, das hohe Gras, den schwarzen Hund und den schönen, blauen Himmel dahinter. Zugegeben, mir war die Sache nicht ganz einerlei; denn wir kannten uns nicht, also wusste ich auch nicht, wie sich das Tier weiterhin verhalten würde. Und neugierig war ich auch: Wer würde zuerst am Fluss erscheinen? Seine Verstärkung oder meine Rettung?
Zunächst geschah lange gar nichts. Er starrte unablässig auf mich herab, ich unablässig zu ihm hinauf. Freilich: Während er auf dem weichen Steppengras saß, kniete ich auf dem harten Uferstein. So betrachtet, arbeitete die Zeit für ihn. Als dann der Moment eintrat, wo meine Unterschenkel und Füße abzusterben drohten und die gleiche Gefühllosigkeit meine Oberschenkel beschlich, entschloss ich mich, wenigstens ein Bein hervorzuziehen. Eine andere Wahl hatte ich nicht. Mir wäre es wirklich albern und lächerlich (vor Sodnom!) vorgekommen, nach Hilfe zu schreien. Um den Hund nicht zu erschrecken oder ihn gar zu reizen, begann ich sehr, sehr langsam, meine geplante Lageveränderung behutsam einzuleiten und das Bein Zentimeterchen um Zentimeterchen anzuziehen. Dabei hatte ich leider nicht bedacht, längere Zeit auf einem Knie knien zu müssen, was den quälenden Schmerz natürlich noch erhöhte. Dieser furchtbaren Qual machte der Hund ein jähes Ende: Mit einem Satz sprang er oben von der Böschung wie aus dem Himmel herab, so dass ich vor Entsetzen das Bein blitzschnell hervorriss und vor Schreck auch sofort das zweite nachgeholt hatte.
Zwei Schritt entfernt hockte jetzt der Hund, knurrte böse. Er hatte einen roten Rachen und herrliche, weiße Zähne.
Als ich mich wieder gefangen hatte, murmelte ich etwas, um ihn zu beruhigen. Ich weiß heut nicht mehr genau, was ich gesagt habe, möglich ist, dass ich flüsterte: „Bist du aber ein guter Hund! Sei schön brav, du, guter Hund, du, schön brav! Du bist doch brav, ja?“ Wie gesagt, ich erinnere mich nicht mehr genau meiner Worte, jedoch war es bestimmt das Gegenteil zu seinem tatsächlichen Verhalten. Deutsch verstand er sowieso nicht, aber die sanfte Art, mit der ich auf ihn einflüsterte, kam ihm vielleicht nicht so fremd vor. Jedenfalls hörte er bald auf zu knurren. Nachher sollte ich merken, dass ich mich geirrt hatte, wenn ich seine jetzige Friedfertigkeit als Ergebnis meines guten Zuredens deutete. In Wirklichkeit schien er seine Verstärkung erschnuppert zu haben; denn dass die im Anmarsch war, ahnte ich, und dass sie zu diesem Zeitpunkt bereits nah gewesen sein muss, bewies mir der nächste Augenblick: Am Böschungsrand tauchten sieben Hunde auf. Sie allerdings benahmen sich nicht so zurückhaltend wie ihr Vorgänger, der zumindest oben gewartet hatte, bis ich mich rührte, nein, sie trabten mit heraushängenden Zungen in breiter Front den steinigen Hang hinunter. Die Hunde am linken und rechten Flügel stießen zielstrebig an mir vorbei, rückten bis zum Flussufer vor, und alle schlossen nun einen ordentlichen Halbkreis um mich, aus dem es kein Entrinnen gab. Den Fluss im Rücken, blickten wir uns reihum in die Augen.
Wenn ich auch ihre weiteren Absichten nicht kannte, genügte es mir, zu wissen, dass um mich die Helden der vergangenen Nacht saßen. So sahen also die Hunde aus, die mit einem Rudel blutrünstiger Wölfe fertiggeworden waren.
Während sieben von ihnen einen recht ausgewachsenen Eindruck machten, war der achte noch sehr klein und jung und nicht viel größer als ein prächtiger, dickschädliger Kater. Sie hatten ihn wohl nur mitgenommen, um ihm beizeiten vorzuführen, wie man sich einem Fremden gegenüber verhält. Und wenn mich an dieser schauerlichen Runde überhaupt etwas erheiterte, dann der kleine Hund. Im Gegensatz zu seinen Lehrmeistern, die aufrecht und selbstbewusst auf ihren Plätzen hockten und mich nicht aus den Augen ließen, lag er, die Vorderpfoten ausgestreckt, auf dem Gestein und alberte mit einem Wermutzweig herum, den der Wind von Zeit zu Zeit gegen seine winzige Schnauze drückte. Zudem war er noch bestechlich; denn als ich mit der Zunge schnalzte und freundlich sagte: „Na, komm mal zu mir, na, komm schon!“, guckte er mich zutraulich an und kam prompt zu mir gelaufen. Ich glaube fest, er hätte sich von mir streicheln lassen, doch sein Nebenmann, besser, sein Nebenhund, folgte dem Überläufer knurrend und schnappte ihn im Genick, packte ihn beim Fell und trug den Kleinen zurück zu seinem Platz, wo er ihn unsanft auf die Steine fallen ließ. Dort blieb er dann platt zwischen dem Geröll liegen, blickte unruhig und traurig umher, seufzte. Übrigens war er auch der schönste von allen. Den anderen hatte man die Ohren abgeschnitten, damit sich des Nachts die Wölfe nicht in ihnen festbeißen konnten, eine Maßnahme, die ihm noch bevorstand.
Wie lange ich gefangengehalten worden bin, weiß ich nicht mehr. In mein Tagebuch habe ich es nicht geschrieben. Jedenfalls vertrieb ich mir die Zeit manchmal damit, dass ich einen Finger rührte oder einen Fuß bewegte. Einmal schlug ich nach einem Insekt auf meiner Stirn. In solchen Momenten erhoben sich zwei oder drei Hunde, bellten wütend vor meinem Gesicht und wiesen mich unmissverständlich darauf hin, dass jegliche Bewegung verboten sei.
Als ich später das erlösende Pferdegetrappel in der Steppe vernahm, sprang ein Hund sofort aus dem Halbkreis die Böschung hinauf. Dort erschienen Sodnom und der Vorsitzende der Genossenschaft. Mir kam es vor, als melde der Hund kläffend den Vorfall seinem Vorgesetzten. Ein Pfiff ertönte, ein Kommando erscholl, ein Schuss knallte in den Himmel. Sofort jagten alle Hunde den Hang hoch, nur der Kleine watschelte unlustig hinterher und sah sich noch einmal nach mir um, als dächte er genauso wie ich: Wir beide hätten uns schon verstanden, nicht?
Oben die zwei Männer lachten laut.
Ich lächelte.
Es war das erste und letzte Mal, dass ich allein zu einem Fluss gegangen bin, um mich zu waschen.
Der erste Ritt
Tagebuch: 2. Juni
Essen: Wie immer, zu reichlich und zu fett.