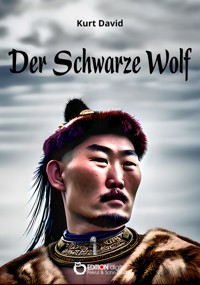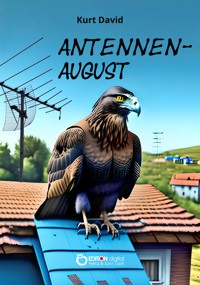6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
An einem Frühlingsabend stehen sie sich auf dem verschneiten Bahnsteig gegenüber: ein deutscher Schriftsteller und eine polnische Frau. Er ist ein wenig unsicher. Wird sie ihm sagen, was er wissen will? Was nur sie ihm sagen kann? Was sie noch niemandem erzählt hat? Sie bleiben nur wenige Tage zusammen. Als sie sich trennen, weiß er: Nie wird er ihre Geschichte vergessen, die Geschichte einer großen Liebe im besetzten Polen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impressum
Kurt David
Die Überlebende
Novelle
ISBN 978-3-96521-918-2 (E-Book)
Das Buch erschien erstmals 1972 im Verlag Neues Leben Berlin.
© 2023 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Ich glaube, der Mensch wird nicht nur durchhalten: Er wird als Sieger hervorgehen. Er ist unsterblich, nicht nur, weil er allein von allen Geschöpfen eine unermüdliche Stimme hat, sondern weil er eine Seele hat, einen Geist, der des Mitgefühls, des Opfers und des Duldens fähig ist.
William Faulkner
1
Sie hatte mir telegrafiert: „Ich komme am einundzwanzigsten März achtzehnuhrfünfzig zum Bahnhof stop Es grüßt Sie Danuta Gadomska.“ Den Hörer ans Ohr gepresst, hatte ich der Nachricht ungläubig hinterhergehorcht. Mein erstauntes Schweigen musste das Telegramm-Fräulein irritiert haben. Es hatte gefragt: „Haben Sie vielleicht nicht alles verstanden?“
Ich hätte zumindest danke schön sagen sollen. Aber ich antwortete: „Doch, doch, verstanden habe ich alles.“
„Dann können Sie ja auflegen!“
Das war vor elf Tagen gewesen, und während mich der Zug zu ihr hinfuhr, erinnerte ich mich recht genau, wie ich mir eine Zigarette anbrannte, das Fenster öffnete, den Rauch gegen die hereinschwebenden Schneeflocken blies. Danuta, hatte ich gedacht, und mir war schon nicht mehr aufgefallen, dass ich Gadomska weggelassen hatte. Nachher war meine Frau leise ins Zimmer getreten (ich höre noch heut das Knacken des Dielenbrettes vorn an der Tür) und hatte mit leiser, ängstlicher Stimme gesagt: „Ist etwas passiert?“ Mein Anblick muss danach gewesen sein. Ich hatte eben erfahren: Die Totgeglaubte lebt! Sicher, ein Irrtum war nicht ausgeschlossen. Zwar konnte sich die Richtigkeit meiner Vermutung erst heut am einundzwanzigsten März erweisen. Damals hatte ich jedoch erwidert: „Sie grüßt mich, und sie holt mich sogar vom Bahnhof ab.“ Meine Frau konnte beim besten Willen nicht sofort wissen, wen ich meinte. Zu weit waren meine Gedanken vorausgeeilt. Ich erklärte es ihr, vielleicht ein wenig gereizt.
Sie sagte: „Ich begreife dich nicht ganz!“
In diesem Augenblick, so erinnerte ich mich, hatte ich zu van Goghs Briefträger Roulin über dem Bücherregal geschaut und gedacht: Er blickt auf mich herab, als begreife auch er etwas nicht.
Meine Frau riet mir dann, alles ruhig zu überdenken, und schien nicht zu verstehen, dass mir die Telegramm-Nachricht den Boden unter den Füßen weggerissen hatte. Und als sie später sagte, sie könnte sich sogar vorstellen, dass ich Grund hätte, mich zu freuen, sah ich sie fassungslos an. Ehefrauen von Schriftstellern haben manchmal verblüffend einfache Gedanken. In jenem Moment war ich solch einer schlichten Äußerung nicht gewachsen gewesen. Ich hatte nämlich in elf Monaten einen halben „Roman, frei nach Tatsachen“ geschrieben, und mit meinem Haupthelden sowie den drei Nebenfiguren hatte ich über dreihundert Tage und manche Nacht gelebt. Den Vorgang entnahm ich einer Dokumentation. In meinem Buch benutzte ich die Vornamen, die ich dort gefunden hatte, Land und Orte. Je länger ich schrieb, desto mehr quälte mich der Gedanke, es könnte vieles von mir schrecklich schlecht erfunden worden sein. Die Toten schauten immerzu auf meine schreibenden Finger, verwundert und manchmal verletzt darüber, wie ich sie reden und denken ließ, wie sie handelten, wann sie traurig waren oder zweifelten, wie ich ihren Tod (literarisch) vorbereitete. Ich wusste nicht viel vom tatsächlichen Hergang, denn die Dokumentation war keinesfalls ausführlich und ging auf Einzelheiten nicht ein. Ich hätte mich natürlich herausreden können. Mit dem Begriff „Roman“ etwa (schließlich wollte ich keine Reportage schreiben!). Aber eben nur herausreden; ich war nicht überzeugt, dass mein Buch die Wirklichkeit wahrheitsgetreu widerspiegelte.
Also schrieb ich einer Organisation in der Stadt, wo mein Roman spielte, und fragte, ob sie noch etwas erforscht hätte, was über beiliegende Dokumentation hinausgehe; denn die Dokumentation war alt und vielleicht schon überholt. Ferner bat ich um ein Gespräch sowie um Erlaubnis, das Gehöft aufsuchen zu dürfen, in dem die Leute den Tod gefunden hatten. Ich träfe am einundzwanzigsten März achtzehn Uhr fünfzig mit dem Zug ein und würde mir gestatten, Montag früh bei ihnen vorzusprechen. Darauf kam das Telegramm.
Ich vermutete, dass Danuta Gadomska jene Nebenfigur in meinem Manuskript war, die in der Dokumentation nur am Rande mit dem Decknamen „Danuta“ genannt wurde. Vorher hatte ich geglaubt, sie sei mit den drei Männern umgekommen.
Sie musste schon auf dem Bahnhof warten, als mein Zug nicht mehr weit vom Zielort entfernt in einem verschneiten Birkenwäldchen hielt. Katowice hatten wir bereits verspätet passiert. Sicher war an allem der Schnee schuld.
Ich wischte mir ein Loch in die angelaufene Fensterscheibe und sah das hinausfallende Abteillicht auf dem Schnee und an den Stämmen der Birken gelb leuchten. Zu allem Überdruss wehte auch noch Wind. Ich hörte die Lokomotive einen grellen Pfiff ausstoßen und dachte, wem pfeift sie in dieser Einsamkeit? Nichts geschah. Der Zug blieb wie an die Gleise gefroren stehen; die Mitreisenden guckten wieder in die Zeitungen oder schliefen weiter.
Zum was weiß ich wievielten Male versuchte ich mir vorzustellen, wie Danuta Gadomska aussehen könnte. Obwohl diese Überlegungen unsinnig waren, ließ ich nicht ab davon. In meinem Manuskript war Danuta, wie in der Dokumentation, ein zwanzigjähriges Mädchen. Und jetzt sollte sie siebenundvierzig sein? Mir erging es mit ihr wie mit Toten: Sie altern nicht.
Ich überlegte: Den kurzen Bericht hatte ich vor einem Jahr in einer Sammlung gedruckter Dokumentationen gefunden. Sofort hatte ich gedacht: So etwas hast du gesucht. Hatte ich das wirklich? Man sucht manchmal, ohne genau zu wissen, was man sucht, und findet man etwas, glaubt man, gerade das gesucht zu haben. Nur ein Fünkchen springt auf dich über, und doch ist es Minuten später ein starkes Gefühl, das in dir brennt, das dich treibt, fortreißt und mitnimmt zu dem Plätzchen, wo deine Fantasie darauf lauert, herausgelassen zu werden. So ähnlich hatte ich das auch meiner Frau erläutert.
Was hatte sie geantwortet? „Komm, wir gehen mal ins Kino!“
Ich war betroffen gewesen von der abrupten Art ihres Vorschlages und hatte nicht zu widersprechen vermocht. Ich fragte nicht einmal, was sie denn spielten (wie sich später herausstellte, hatte sie es auch nicht gewusst!) und dachte, schon möglich, dass du sie nicht überzeugt hast. Sie wollte mir Ablenkung verschaffen. Na gut, dachte ich, aber ich glaubte nicht daran, dass jetzt irgendetwas stärker war als meine Gedanken. Wie es manchmal so ist: Zum Unglück erwischten wir auch noch einen schlechten Film und verließen das Kino, wie wir es betreten hatten. Von dem Telegramm sprachen wir nicht mehr. Am nächsten Morgen fuhren wir mit den Rädern in den nahen Kiefernwald, und abends besuchten wir das Theater. Sie spielten ein nettes Stück mit einem biblischen Titel, und es war wirklich manchmal zum Lachen, sogar für mich, und das nicht nur, weil ich den Autor kannte. Anderntags war ich genauso unruhig wie am Abend vor dem Theaterstück oder wie vor dem Film oder wie vor der Fahrt in den Kiefernwald, und so hatte mich diese Unruhe in mehrere Sitzungen getrieben; zwischendurch war ich zum Zahnarzt gegangen (eine Sache, die ich sonst aufschiebe, bis es nicht mehr erträglich ist), hatte anstelle meiner Frau eingekauft, meine Schreibtischschübe endlich in Ordnung gebracht, alle Bücher und Literaturgespräche gemieden und auch später bis zum zwanzigsten März fast alles getan, was ich sonst selten oder gar nicht tue.
Heute Mittag war ich dann losgefahren.
Jetzt blickte ich abermals durch das Fenster in das verschneite Birkenwäldchen hinein. Mit den Händen schirmte ich das Licht des Abteils ab. Ich sah den Wind die Bäume schütteln und den Schnee von den Zweigen blasen. Vielleicht war Danuta (nein, nicht die Gadomska!) vor siebenundzwanzig Jahren auch in diesem Wäldchen gewesen.
Das vermochte ich mir vorzustellen!
Wo der Lampenschein des Eisenbahnwaggons nicht mehr hinreichte und es dunkel war, konnte sie gestanden haben in ihrer dicken Steppjacke, den Stepphosen, den hohen Filzstiefeln. Ein weißes Wolltuch verbarg Stirn und Kinn und ihr langes schwarzes Haar. Ich sah sie auf die Gleise zu kriechen, auf dem Bauch durch den tiefen Schnee rutschen, die Beine bewegen wie einer, der schwimmen lernt. Sie schob etwas vor sich her und kroch immer näher auf mich zu. Das hinausfallende gelbe Licht lag schon auf ihren Händen, die ganz rot waren, und auf dem weißen Wollkopftuch, von dem winzige Eiszapfen herabhingen. Die Augen schauten mich an.
Plötzlich donnerte auf dem Nebengleis ein Gegenzug vorbei. Erschrocken riss ich meinen Kopf vom kalten Fensterglas zurück, und der Zug nahm alles mit, was ich eben noch gesehen hatte.
Die Lokomotive pfiff wieder.
Wir fuhren weiter.
Ich blickte auf meine Uhr: Achtzehn Uhr fünfundfünfzig.
Hoffentlich sagen sie dort auf dem Bahnhof die Verspätung durch, dachte ich, und kurz darauf, es ist doch nicht schlimm, wenn sie es nicht getan haben: Danuta Gadomska wird selbstverständlich nach dem Zug fragen.
Ich gestehe auch: Mir kamen erneut heftige Zweifel. Auf dem Bahnhof erwartete mich jemand, über den ich viele Mutmaßungen angestellt hatte. Sie wurden sofort hinfällig, wenn sie mir sagte: „Ich heiße zwar auch Danuta, aber ich bin nicht jene, die …“ Das Telegramm hatte doch nur deshalb so viele Gedanken ausgelöst, weil mir die Unzulänglichkeit meiner Arbeit schon vorher bewusst gewesen war, nur dass ich es mir da noch nicht eingestanden hatte.
„Wegschmeißen kann ich meine hundertachtzig Seiten“, hatte ich meiner Frau in der Erregung gesagt. „Es gibt jetzt jemanden, der alles, aber auch alles genau weiß.“ Und ein paar Tage später sagte ich sogar: „Ich werde wohl von vorn anfangen müssen. – Vielleicht von vorn anfangen müssen“, schränkte ich schon wieder ein. „Manchmal denke ich, ich habe die hundertachtzig Seiten schreiben müssen, um dahinterzukommen, was mir wirklich fehlt. Vorher sieht so was immer alles ganz anders aus, nicht?“
Meine Frau hatte erwidert: „Du hättest eben schon viel früher an diese Organisation schreiben sollen.“ Und weiter: „Du hättest doch gleich wissen müssen, dass die Dokumentation nicht genügt.“
Aber ich hatte ja nicht nur den Bericht in der Dokumentation gelesen. So war es nun auch nicht. Ich hatte zum Beispiel mit Menschen gesprochen, die sich in ähnlichen Situationen wie die vier befunden hatten.
In der Erinnerung sah ich sie noch. Ich sah ihre Gesichter, ich hörte sie reden. Einen sah ich sogar ganz deutlich vor mir: Er hatte eine rote Narbe am Hals gehabt, kirschgroß, genau neben der Schlagader. Damals während des Gesprächs hatte ich gedacht: Hattest du aber Glück! Doch sonst? Sie hatten alle so brav ausgesehen, waren Großväter und mit ihren Erlebnissen alt geworden. Sie hatten mir von ihren Heldentaten berichtet (und das waren wirklich welche!), doch nichts, fast nichts von ihren Ängsten, Zweifeln, Fehlern, Schwächen, wenngleich sie so nebenher und pauschal zugegeben hatten, auch das habe es gegeben, natürlich. Natürlich? Und konkret? Es hätte sie doch nur noch größer gemacht! Oder vergaß man so etwas in den Jahren, hielt es für unwichtig, weil man siegend überlebt hatte?
Ich wusste nur eins mit Sicherheit: Die nach ihnen gekommen sind, müssen es genau erfahren. Man kann sich hier nicht einfach etwas ausdenken. Deshalb hatte ich dann an die Organisation geschrieben.
Tatsache ist, sann ich weiter, du wolltest vom Dokumentarischen los und dich frei im Stoff bewegen. Das Gegenteil trat ein: Du kamst nicht weg davon; die vier Menschen haben dir auf jede deiner Seiten geblickt, als misstrauten sie deinem Können. Das schmerzte, das beschämte dich.
Aus einer großen Kurve sah ich nun bereits die abendliche Stadt mit ihren Türmen und Lichtern. Die Lokomotive fuhr zu auf einen Wald von Eisenstämmen mit roten, grünen, weißen Lampen, in den es in langen, schrägen Fäden hineinschneite.
Und da ich hier manches eingestanden habe, auch dies: Mein Herz war an der Geschichte so stark beteiligt, dass ich es fühlte, als der Zug unter dem hell erleuchteten Bahnhofsdach bremste und hielt.
2
Ich trat auf den Bahnsteig und stellte meinen kleinen Koffer ab. Sollten sich die Leute erst ein wenig verlaufen.
Nachher ging ich als letzter hinter zwei in Pelze gehüllten Frauen und einem jungen Mann mit einer schweren braunen Reisetasche, der immerzu zum Ausgang blickte, selbst dann, wenn er seine große Tasche vor dem Bauch in die andere Hand hinüberwechselte. Zwischen ihm und den Frauen war so viel Raum, dass ich den Bahnsteigausgang gut sehen konnte.
Dort erblickte ich einen alten Mann mit einem Kind auf dem Arm sowie eine Frau in einem wadenlangen schwarzen Mantel, die unentwegt zu uns herschaute. Eben dachte ich, bestimmt ist sie es, da ging sie entschlossen auf den jungen Mann mit der schweren Reisetasche zu und sagte freundlich lächelnd meinen Namen, worauf der Mann kopfschüttelnd weiterhastete. Und nun stand ich vor ihr.
„Frau Gadomska?“
Überrascht sah sie mich an. Vielleicht nur drei Sekunden oder auch fünf, jedenfalls lange genug, dass ich zu fühlen glaubte, was sie dachte.
„Ja, ich bin Frau Gadomska“, sagte sie, hielt mir ihre Hand hin, lächelte etwas, allerdings nicht so ungezwungen, wie sie dem jungen Mann zugelächelt hatte, der mein Sohn hätte sein können. Ich stellte mich vor, und sie sagte: „Da haben Sie sich aber nicht das schönste Wetter ausgesucht!“
„Nein“, antwortete ich, „nur das schönste Datum.“
Sie betrachtete mich im Gehen flüchtig von der Seite und stieß in der Halle des Bahnhofs mit einer alten Frau zusammen, die aus einem Korb kleine Schneeglöckchensträuße zum Kauf anbot.
„Es tut mir leid, dass der Zug solche Verspätung hatte“, sagte ich.
„Das braucht Ihnen aber nicht leid zu tun“, erwiderte sie, „das beste am Moskwitsch ist die Heizung. Ich habe also im Wagen gewartet und nicht gefroren.“
Ihr vorzügliches Deutsch erstaunte mich, ließ jedoch erneut in mir Zweifel aufkommen, ob sie jene Danuta sei. Vielleicht war Frau Gadomska nur Dolmetscherin?
Sie ließ mich vorn Platz nehmen und sagte, sie werde mich zum Hotel fahren.
Noch immer fiel dicker Pappschnee auf die matschigen Straßen. Ich merkte, wie es sie anstrengte, den Wagen durch den dichten Abendverkehr zu steuern. Auf das Lenkrad gebeugt, starrte sie schweigend durch die Windschutzscheibe, an der die summenden Wischer den nassen Schnee zur Seite drückten. Unter einer Ampel mit Rotlicht sagte sie: „Wenn es Ihnen recht ist und Sie nicht zu müde sind, könnten wir zusammen essen und uns noch etwas über Ihre Absichten und Wünsche unterhalten.“
Ich sagte, ich sei gar nicht müde – was allerdings nicht stimmte – und unterhalten würde ich mich sehr gern – was der Wahrheit entsprach.
Sie fuhr den Wagen über die Kreuzung.
Im Hotel ging ich auf mein Zimmer, um mich etwas frisch zu machen. Als ich den Toilettenbeutel aus dem Koffer nahm, sah ich den Klemmrücken mit meinem Manuskript zwischen Anzug und Hemden. Er schaute mich an, als wolle er fragen: Was wird nun aus mir?
Das war zum Teil vom Gespräch der nächsten Stunde abhängig. Aber ich hatte jetzt bereits das Gefühl, als läge da in meinem Koffer etwas, das ich nicht mehr anrühren wollte.
Sie saß an einem Tisch in der Ecke des Restaurants und winkte. Die Zigarettenpackung herüberschiebend, meinte sie: „Sie rauchen doch?“ Es war einer der seltenen Augenblicke, in dem ich einen Hauch von Stolz empfand, diesem Laster unterworfen zu sein.
„Und was trinken Sie?“, fragte Frau Gadomska.
„Einen Juice oder etwas ähnliches.“
Etwas verblüfft sah sie zu mir. „Solidarität ist nicht nötig. Ich lass den Wagen am Hotel stehen. Ich wohne in der Nähe. Wein, Wodka?“
„Wein, bitte.“
„Süß, herb?“
„Was Ihnen zusagt.“ Ihr sagte herb zu.
Wir wählten dann jeder ein warmes Gericht. Ich hatte mich für Kaukasisches Reiterfleisch entschieden, sie bevorzugte javanischen Nassy Goreng.
„Wie weit sind Sie mit dem Buch?“
Ja, wie weit war ich denn? War das im Moment überhaupt zu beantworten? Ich sann nach, suchte nach Worten, die den Stand meiner Arbeit andeuten, aber nicht exakt verraten sollten. Schließlich war es für mich der ungünstigste Augenblick. Ich sagte: „Mittendrin bin ich oder erst am Anfang. Offen gesagt: Ich weiß das selbst nicht.“ Die Antwort gefiel mir nun sogar, stimmte obendrein auch. Ich brachte es einfach nicht fertig, sie auf den Kopf zu zu fragen, ob sie Danuta sei oder nicht.
„Und Sie meinen, wir könnten Ihnen helfen?“
Wir? Ich stutzte. Vorsichtig sagte ich: „Mir fehlen Fakten und Details. Das hat mich unsicher gemacht; denn in der Dokumentation, die ich Ihnen zusandte und …“
„Ja, die ist wirklich zu mager für Ihre Zwecke“, unterbrach sie mich. „Die genügt wohl an dem Platz, wo sie steht, aber sonst … Übrigens: Wunderten Sie sich nicht, dass ich Ihnen telegrafierte, nicht unsere Organisation, der Sie schrieben?“
Ich spürte sofort wieder mein Herz schlagen. Sollte ich ihr von dem Durcheinander berichten, das ihr Telegramm ausgelöst hatte? „Doch, ich habe mich sehr gewundert“, begann ich zögernd.
„Wollen wir nicht trinken?“, fragte sie lächelnd.
Ich musste einen zerstreuten Eindruck auf sie machen.
Frau Gadomska erhob ihr Glas und hielt es mir entgegen. Wir tranken, blickten uns dabei an. Danach war es eine Weile still, fast feierlich still. Nervös spielte ich mit einem Streichholz und sah auf meiner Innenhandfläche Schweiß glitzern. An den Tischen hinter meinem Rücken hörte ich undeutlich die übrigen Gäste reden. Irgendwo weit weg hörte ich jemanden auf einem Flügel spielen.
Mir war ganz heiß im Kopf. So ergeht es mir immer, wenn das Gespräch stockt. Ich ärgere mich dann, dass ich nicht imstande bin, etwas zu sagen, obwohl mir doch so viel einfällt. Aber immer, wenn ich nicht genau weiß, wer vor mir sitzt, ergeht es mir wieder so.
„Ist es für einen Schriftsteller nicht eigenartig, wenn er über Tote schreibt, und plötzlich meldet sich einer von ihnen?“, fragte sie.
Ich wachte auf. „Sie? Sie sind?“
„Natürlich, ich bin es!“
Ich starrte sie an, erschreckt, erregt, verwirrt. Das war Danuta? Sie? Diese Danuta? Die mir jetzt gegenübersaß? Die da sitzt in ihrem dunkelblauen Wollkleid mit dem hellgrauen Pelzröllchen um den Hals?
„Wie Sie mich ansehen!“ Sie machte einen tiefen Zug aus ihrer Zigarette und blies den Rauch zur Lampe hoch. „Haben Sie denn das nicht gewusst?“
„Gewusst und nicht gewusst“, antwortete ich hastig. „Mal waren Sie es für mich, mal nicht.“
„Wieso?“, fragte sie.
„Na, manchmal glaubte ich, dass Sie es sein könnten, zum Beispiel weil Ihnen die Organisation meinen Brief zur Beantwortung übergeben hat und weil er Ihren Vornamen enthielt …“
„Genauso aber war es doch auch“, sagte sie.
„Aber es gab auch viele Gründe zu zweifeln. Und dieser Dokumentation nach …“ Ich schwieg.
„Konnten Sie kaum annehmen, dass ich überlebt habe“, meinte sie. „Aber mein Telegramm! Ich hatte doch mit Danuta unterzeichnet. Sie sollten gleich wissen, dass ich es bin.“
Das fand ich seltsam. Wenn man Danuta heißt, ist es nichts Außergewöhnliches, mit Danuta zu unterschreiben.
Sie betrachtete mich verwirrt, erwartete eine Antwort.
Ich sagte: „In der Dokumentation stand ‚Danuta, in Klammern Deckname‘. Also brauchte es nicht der richtige Vorname zu sein. Im Gegenteil.“
„Deshalb unterzeichnete ich ja mit Danuta.“ Ich begriff wirklich nicht.
„Mit meinem Decknamen von damals unterzeichnete ich. Ich heiße doch nicht Danuta, sondern“, sie schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn, „mein Gott, das können Sie freilich nicht wissen. Sie sehen, ich habe mich selbst verhäkelt. Ich heiße Teresa, Teresa Gadomska.“
„Sind aber Danuta“, sagte ich, als müsste ich es mir noch einmal bestätigen lassen, „die Danuta von damals, von vor siebenundzwanzig Jahren, diese Danuta sind Sie doch?“ Und während ich das sagte, nickte sie immer wieder und sagte zwischendurch mehrmals „Ja“ und „Ja doch“.
Und ich dachte nun: Sie damals, ich damals, wir beide heute? Ein wenig erschöpft lehnte ich mich in den weichen Sessel zurück und ließ die Arme an den Seitenlehnen herabhängen, sah die Frau an, die Danuta war, jene Danuta in meinem Hundertachtzigseitenmanuskript. Am liebsten wäre ich ans Telefon gelaufen, meiner Frau das zu sagen.
Der Ober trat an unseren Tisch und servierte ihr das Nassy Goreng und mir das Kaukasische Reiterfleisch. Frau Gadomska unterhielt sich leise mit ihm, und ich merkte, es machte ihm offenbar Freude, sie als Gast zu haben; er bediente sie mit respektvoller Achtung. Zum Schluss füllte er unsere Gläser erneut, verbeugte sich, und dann verließ der weißhaarige würdige Herr wieder unseren Tisch.
Während des Essens erzählte sie mir, erst Tage später habe sie sich überlegt, dass es für mich nicht unkompliziert gewesen sein könnte, wenn sich plötzlich einer der vier (sie vermied hier das Wort „Toten“) meldete. Die Arbeit war eventuell schon weit vorangeschritten? „Vielleicht haben Sie sich anfangs gar nicht gefreut über mein Telegramm?“
Das einzugestehen, fehlte mir der Mut, obwohl gerade ihre Frage bewies, dass ich von ihr keine falsche Reaktion hätte fürchten müssen. „Ich bin sehr froh, dass Sie mir jetzt gegenübersitzen“, sagte ich.
Sie lächelte nachsichtig und trank einen Schluck Wein. „Haben Sie das Manuskript mit?“
„Ja, oben im Koffer. Nur meine Handschrift, wissen Sie, ist vom vielen Schreiben für andere so unlesbar, dass ich sie Ihnen nicht zumuten kann.“ Das war glatt gelogen. Zwischen dem Klemmrücken steckte eine einwandfreie Maschinenreinschrift.
Sie nickte, blickte auf ihre Armbanduhr. „Viertel nach zehn“, sagte sie. „Haben Sie einen Plan für morgen und die nächsten Tage?“
Ich hatte keinen. Ich musste es schon ihr überlassen, zumal ich nicht wusste, wie viel Zeit sie für mich aufbringen konnte. Da sie nun wirklich Danuta war, konnte sie mir die Fakten und Details geben, die mir fehlten, aber ich hatte wohl kaum das Recht, sie darum zu bitten. „Sagen Sie mir, wie Sie es sich vorstellen. Ich werde einverstanden sein.“
Sie hatte nicht auf meine Antwort geachtet, sondern dem Ober, der an den Tisch getreten war, gesagt, sie wünsche die Rechnung. Zu mir meinte sie: „Ich werde mit Ihnen morgen früh hinausfahren und mit Ihnen die Wege gehen, die wir vier vor siebenundzwanzig Jahren gegangen sind. Dazu benötigen wir drei oder vier Tage. Das habe ich mir sorgfältig überlegt, nicht nur, weil es so lange her ist, sondern auch, weil es mir wie der gestrige Tag vorkommen wird.“ Sie erhob sich und fragte lächelnd: „Ist es Ihnen um acht recht?“
„Einverstanden.“
Ich begleitete sie zur Tür und die Stufen zum Gehsteig hinab. Es hatte aufgehört zu schneien. Die Straße war voller Matsch. In den Pfützen spiegelte sich die grüne Leuchtschrift des Hotels. Sie wies auf meine Halbschuhe. „Haben Sie nur die mit?“
Ich nickte.
„Das wird kaum gehen. Ihre Schuhgröße?“ Verlegen nannte ich sie ihr.
„Ich werde mal sehen.“ Sie lief den Gehsteig hinunter, ohne sich umzuschauen. Von einem Dach rutschte Schnee und fiel kurz vor ihr auf den Weg. Sie blickte hoch, schüttelte den Kopf, raffte den wadenlangen schwarzen Mantel vorn zusammen und stieg über den Schnee.
Oben in meinem Zimmer setzte ich mich auf den Rand des Bettes und sah mein Gesicht im großen Schrankspiegel. Sie damals, ich damals, wir beide heut, dachte ich erneut. Deine Geschichte hat also bereits angefangen. Wie wird das Ende sein? Ich ahnte, dass der nächste Tag nicht leicht sein würde. Ihr Vorschlag, gemeinsam diesen Weg zu gehen, war im Hinblick auf meine Arbeit ausgezeichnet. Aber eines war gewiss: Das würde kein Ausflug, keine Besichtigungsfahrt werden. Jeder Weg wird zu ihr sprechen, jeder Baum hinter ihr her schreien, jedes Haus, das damals brannte, wird wieder brennen. Die Toten werden noch einmal leben und ein zweites Mal sterben!
Ich holte aus meinem Koffer das Manuskript hervor und las den ersten Absatz:
„Eine Viertelstunde vor Mitternacht näherte sich das Flugzeug dem Platz mit den Signalfeuern, die in einem Dreieck auf einer Waldlichtung brannten. Die Maschine flog nur noch tausend Meter hoch. Als sie die Feuer genau unter sich hatten, sprangen zwei Männer aus der Luke. Wind wehte keiner, und die Seidenschirme sanken im hellen Mondlicht ruhig vom Himmel.“
Na schön, dachte ich, klappte den Klemmrücken zu, legte wieder den Anzug darauf, und mir war, als hätte ich endgültig Abschied genommen. Ich kam mir plötzlich sehr einsam vor. Frau Gadomska gegenüber war ich im Nachteil. Wo sie litt, konnte ich nur mitfühlen. Das sah immer nach zu spät aus. In den nächsten Tagen würde es Minuten geben, in denen die siebenundzwanzig Jahre danach für sie aufhörten zu existieren. Auf dem Hotelflur hörte ich Schritte, kleine, trippelnde Schritte. Ich nahm den Telefonhörer ab und diktierte der Dame in der Zentrale ein Telegramm an meine Frau: Sie war am Bahnhof und ist wirklich Danuta stopp Herzliche Grüße und so weiter.
Lange stand ich dann vor dem offenen Fenster, sah hinab auf die nasse Straße, die stummen Häuser und die vorbeisummenden Autos. Als ich mich hingelegt hatte, vernahm ich zu jeder vollen Stunde die fremden Glockenschläge von den Türmen dieser fremden Stadt.
3
Sie kam am Morgen nicht um acht, sie kam erst kurz vor neun, und sie sagte nicht, warum sie sich verspätet hatte. Vielleicht hatte sie ebenfalls nicht einschlafen können, vielleicht hatte sie überhaupt nicht geschlafen, und es war auch möglich, dass sie am Morgen zu Haus noch gezögert hatte, mit mir diese Fahrt zu machen.
Sie überreichte mir ein Paar in Zeitungspapier gewickelte Schuhe, hohe Schuhe, und sagte: „Ich muss tanken fahren und hole Sie dann vom Hotel ab.“
Später, auf der Fahrt durch die Stadt, redete ich von Dingen, die nicht unbedingt eine Antwort erforderten; dass mir die Schuhe gut passten, sagte ich, dass es heut wohl nicht mehr schneien würde, da doch der Himmel etwas netter aussähe, und dass die Sonne nun schon beträchtlich wärmer scheine. Während wir über eine Brücke fuhren, erkundigte ich mich sogar, ob die Warta im letzten Winter zugefroren sei.
„Lieben Sie Musik?“, fragte sie plötzlich. Sie hatte das über das Lenkrad hinweg gesagt, mit dem Blick auf die Straße.
Ich empfand das wie einen Schlag gegen mein Geschwätz, fühlte aber auch, dass sie es nicht nur gefragt hatte, um dem Verlegenheitsgerede, das ihr Zuspätkommen und ihre Wortkargheit bei mir ausgelöst hatten, ein Ende zu bereiten. Sie dachte über mich nach.
„Ich liebe Musik“, erwiderte ich.
„Und spielen auch selbst?“
„Nicht mehr“, sagte ich.
Sie blickte kurz zu mir herüber und meinte: „Keine Zeit, was?“
Widerwillig hielt ich ihr meine linke Hand hin. „Kriegsverletzung“, sagte ich so gleichgültig, wie es nur irgend ging.
„Ach“, sie guckte einen Moment auf die Hand und sah mir dann so ins Gesicht, dass ich an unsere erste Begegnung auf dem Bahnsteig erinnert wurde. „Sie waren also Soldat?“