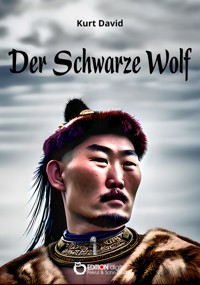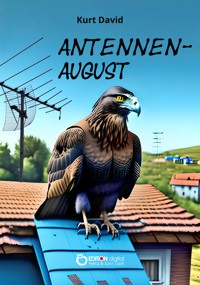4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als die Russen kurz vor der Stadt stehen, werden die 14- bis 16-jährigen Jungen zum Volkssturm eingezogen. Peter und IMI-Max waren früher Freunde. Doch Peters Vater ist mitschuldig daran, dass Max' Vater hingerichtet wurde. Peter schämt sich dafür, aber Max sorgt dafür, dass die Freundschaft wieder auflebt. Doch Peter kneift schließlich, als beide zu den Russen fliehen wollen. Aber Peter muss sich entscheiden, als der Hauptmann mit der Pistole auf Max' Mutter zielt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impressum
Kurt David
Der erste Schuss
ISBN 978-3-96521-898-7 (E-Book)
Das Buch erschien erstmals 1959 im Kinderbuchverlag Berlin.
© 2023 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Für Leser von 12 Jahren an.
Peter muss ins Schützenhaus – Und was ihm die Mutter alles mitgibt – Bei IMI-Max ist es anders
Frau Rentsch stopfte ihrem Jungen so viel Taschentücher, Socken, Unterhosen und Unterhemden in den Koffer hinein, als würde der Krieg mit Wäschestücken geführt.
„Die Hausschuhe quetsch ich hier in die rechte Kofferecke, gleich unter die Strümpfe, Peter.“
„Mutter! Hausschuhe! Ich brauch doch keine Hausschuhe.“ Während Frau Rentsch die Hausschuhe an der Absatzseite festhielt, zerrte Peter an den Spitzen.
„Die werden mitgenommen!“ Die Mutter riss sie ihm aus den Händen.
Peter konnte sich einen Soldaten in Hausschuhen nicht vorstellen. Das sähe genauso albern aus, als wenn unser Pastor in Stiefeln in die Kirche käme, dachte er. Hausschuhe – puh, wie die Mutter sich das vorstellt. Hausschuhe haben etwas Sanftes, Weiches, Schleichendes an sich – Stiefel dagegen …
„Wenn ihr mal einen langen Marsch gemacht habt, brauchst du die Hausschuhe nachher. Wirst an mich denken, Junge.“ Peter tröstete sich. Vater hatte, als er eingezogen wurde, auch Hausschuhe mitgenommen. Allerdings hatte der Vater vor einem Jahr den rechten nach Hause geschickt, aus dem Lazarett. Der rechte Hausschuh lag im Schuhputzschränkchen. Unlängst hatte die Mutter einen neuen linken Hausschuh nach Sankt Pölten ins Lazarett gesandt, nur einen linken, und so lagen draußen im Schuhputzschränkchen ein alter, abgetretener rechter und ein ladenneuer rechter Hausschuh. Die lagen so da, so herum, ungenutzt und weggeworfen, weil der Vater in seinem Leben nie mehr einen rechten Schuh brauchen wird …
Peter guckte zu, wie die Mutter in seine Schuhe Garn, Wolle, Knöpfe und ein Kärtchen Nadeln steckte. „Mein Gott – du und Strümpfe stopfen!“ Danach meinte Frau Rentsch: „Den Speck und die gekochten Eier habe ich in die Socken gewickelt. Dass du mir das nicht vergisst.“
Frau Rentsch schlug den Kofferdeckel zu. Er wippte auf und nieder, sie musste sich auf ihn knien, um ihn gewaltsam zu schließen. Gleich darauf öffnete sie den Koffer abermals. „Soll ich dir noch ein Fläschchen Hoffmannstropfen mitgeben?“, fragte sie. „Falls dir mal schlecht wird und so.“
Peter erschlug die Frage mit einer abweisenden Handbewegung. Die Mutter rannte in die Küche. Peter, lang und dürr, stand unruhig in der kleinen Stube. Wenn ich bloß erst raus wäre, dachte er.
„Für alle Fälle, weißt du“, sagte die Mutter und drückte das Arzneifläschchen in einen Winkel des Koffers. Dieses „Für alle Fälle“ ist eine leere Redensart; denn jeder Mensch weiß, dass es Fälle gibt, wo Hoffmannstropfen versagen. Schon in der eigenen Familie gab es dafür ein Beispiel: Peters Vater war ein Bein abgeschossen worden … Na, und das Denken, das konnte durch Hoffmannstropfen auch nicht angeregt werden.
Peter blickte auf die Uhr an der Wand. Einundzwanziguhrdreißig!
Auf dem Tisch lag eine weiße Postkarte, darauf stand: Sie haben sich am 14. April 1945, 22 Uhr, im hiesigen Schützenhaus zwecks Eingliederung in den Volkssturm zu melden.
„So“, sagte die Mutter und fuhr sich mit den Fingern durch die Haare. Sie band ihre Schürze ab. „Haben wir alles, Peter?“
„Natürlich“, sagte der Junge gereizt, griff nach der Karte und steckte sie in die Tasche seines Jacketts.
„Du denkst an gar nichts. Wenn es nach dir ginge, liefst du los, wie du da stehst. Eine Mutter denkt weiter. Die sorgt sich um alles, die grübelt: Ob der Junge dies noch brauchen wird und jenes? Und ob er mit den Taschentüchern langt? So denkt sie. Du würdest einfach loslaufen.“
Frau Rentsch sah sich in der Stube um, ob sie nicht etwas entdecken könnte, was Peter mitnehmen müsste.
„Mein Rasierzeug, Mutter“, sagte der Junge entsetzt – Tante Milli hatte ihm eins zum Weihnachtsfest geschenkt – und er war froh, dass er der Mutter noch etwas sagen konnte, was ihm fehlte.
„Sieh mal einer an“, meinte Frau Rentsch und plusterte sich auf wie ein Spatz, der den Staub aus den Federn schüttelt, „rasieren will er sich. Rasiiierzeug! Willst du damit auch schon anfangen – bei deinen paar Flaumfedern, die sich um den Schnabel ringeln? Hat dir Vater nicht immer gesagt, vor sechzehn Jahren wird überhaupt nicht rasiert, weil sonst das Gestoppel noch schneller ans Licht treibt und wuchert? Also: In fünf Wochen bist du sechzehn – und bis dahin kann der Krieg aus sein – dann hat das immer noch Zeit. Und mit den Klingen, dem scharfen Zeug – wo sich Vater mit vierzig sogar manchmal das Gesicht zerschnitten hat, als würde er etwas dafür kriegen, nein, nichts gibt’s!“
Da muss ich mir’s bei anderen borgen, dachte Peter.
Er kniete auf dem Deckel, um den Koffer endgültig zu schließen. Die Mutter schnappte die blitzblanken Schlösser zu, stand auf und meinte: „Nein, dass sie dich auch noch holen, das hätte ich nicht gedacht. Pass bloß auf, Peter, dass dir nichts passiert. Ich hab mit Vaters abgenommenem Bein schon genug Sorgen auf dem Halse.“
Frau Rentsch griff nach ihrer Handtasche, stellte sich vor den Spiegel und begann sich zu kämmen, puderte die Nase, tupfte Parfüm auf ein Taschentuch und sah im Spiegel, wie Peter bereits den Koffer zur Tür schleppte. Der Junge hatte ein Gefühl, als müsse er ganz schnell das Haus verlassen.
„Benimm dich anständig“, redete Frau Rentsch in den Spiegel hinein. Sie redete, als ginge Peter nicht in den Krieg, sondern in Urlaub oder in die Schule. „Vater hat auch immer gesagt, wen sie mal auf dem Korn haben, den machen sie fertig. Und red‘ mir nichts Politisches herum. Vater hat immer gesagt: Politik verdirbt den Charakter. Das ist auch wahr. Vater hat immer gesagt: Aus politischen Geschichten muss man sich raushalten, denn wer zu nahe ans Feuer tritt, der verbrennt. Und denk immer daran, in der Bibel steht: Wer nichts Böses tut, dem widerfährt nichts Böses.“
Während die Mutter Kamm, Parfüm und Puderdose in der Handtasche verstaute, dachte Peter: Raushalten, raushalten, Vater hat sich immer rausgehalten und dabei ein Bein eingebüßt. Das soll einer verstehen. Aber Peter versteckte die Gedanken vor seiner Mutter. Er sagte selten, was er dachte und fühlte. Er wusste nicht, warum es so war. Ihn beschäftigten andere Dinge, die seine Fragen, die er an die Mutter hatte, zurückdrängten.
Da sprach schon wieder die Mutter: „Ich hab dir’s nie gesagt, weil du noch zu klein warst, aber heut wird‘ ich dir’s mal erzählen. Ich vergess‘ nie die Geschichte, die Vater vor drei Jahren passiert ist, in der Fabrik. Die Sache mit dem Brendel …“
Aha, jetzt kommt das, dachte Peter. Kenn ich schon, das haben die Leute in der Stadt geflüstert.
„Vater kam damals, im März waren’s drei Jahre, früh in die Schlosserei, und als er seinen Werkzeugkasten aufmacht, liegt ein Flugblatt drin und guckt ihn verführerisch an. Weißt du, Flugblätter, die haben so etwas Abenteuerliches an sich. Da denkt man: Ah, jetzt erfahre ich was, was mir sonst keiner sagt. Aber Vater hat sich nicht verführen lassen. Nein, mit so was wollte er nichts zu tun haben. Das war Politik. Und was machte er? Er nimmt den Handwerkskasten und läuft schnell zum Werkschutzleiter, knallt den Kasten auf den Tisch und sagt: Hier! Ich hab’s weder gelesen noch angefasst, nehmt das sofort weg.“ Und jetzt steht Frau Rentsch mitten in der Stube, streckt die Arme aus, schließt die Augen, steht da wie eine Nachtwandlerin und sagt: „Blind hat er vor den Leuten gestanden, blind, und da konnten sie ihm auch nichts anhaben, gar nichts. Mit einer Pinzette haben sie das Flugblatt herausgenommen, um es nicht mit den Fingern berühren zu müssen …“
„… und an den Fingerabdrücken haben sie IMI-Maxens Vater, Herrn Brendel, erkannt“, fällt Peter ein.
„Jawohl. Übrigens, woher weißt du das?“
„Die Leute haben’s geflüstert.“
Frau Rentsch macht ein betroffenes Gesicht.
„Siehst du, sogar den Täter haben sie durch Vaters Vorsicht erwischt.“ Sie hat sich sehr ereifert bei der Geschichte.
„Und dann haben sie IMI-Maxens Vater hingerichtet, Mutti“, sagt Peter.
„Ja, also das ist … hm, das mit dem Hinrichten hätten die natürlich nicht machen sollen. Der Brendel soll sonst ein prima Mensch gewesen sein, bloß hat er schon oft mit Flugblättern und so ’nem verbotenen Zeug zu tun gehabt. Wie gesagt, hätte sich Vater nicht herausgehalten, wie leicht hätte es auch ihn den Kopf kosten können, siehst du. Da kommt nie was bei raus.“ Peters Mutter zog den Mantel über, lief noch mal in die Küche und biss in ein Stück trockenes Brot.
„Was hat eigentlich auf dem Flugblatt gestanden?“
„Hör auf! Ich weiß es nicht.“
Für einen Augenblick dachte Peter daran, wie schlimm und gefährlich ein Flugblatt sein muss, um einen Mann zum Tode zu verurteilen. Peter dachte aber nur flüchtig so; ganz andere Dinge beschäftigten ihn. Er überlegte: Hoffentlich komme ich noch zurecht … Die Leute tun alle, als sei der Krieg bald zu Ende. Und die Russen, die sind tatsächlich schon hundert Kilometer vor der Stadt. Die Amerikaner haben vor vier Wochen den Rhein überschritten. Hatten Peter und die anderen Jungen in der Hitlerjugend nicht oft das Lied gesungen: Fest steht die Wacht am Rhein?
Peter hatte es sehr eilig. Peter wollte schießen. Auf wen? Egal, einfach schießen. Auf den „Feind“ natürlich, auf die Russen. Peter wollte endlich ein richtiges Gewehr in der Hand halten oder eine Pistole. Schon als kleiner Junge hatte er Revolver und Gewehre aufs Papier gemalt. Und wie schön er das gemacht hatte, ganz genau hatte er sie aufgezeichnet. Flitzbögen und Armbrüste hatte er gebastelt. Bei der Hitlerjugend lernten sie schießen, aber nur mit einem Kleinkalibergewehr. Nein, das war nichts.
Seit die Karte mit den Worten „Sie haben sich“ im Hause war, träumte er oft vom Obersteiner Kiefernwald. Von dort werden die Russen, der „Feind“, kommen, wir werden in einem Schützengraben liegen, ich hinter einem Gewehr, und ich werde in sie hineinschießen – ich werde ballern und knallen. Immer hinein, genauso wie Lehrer Schneidt; als er im Urlaub war, hat er’s erzählt. Er sagte, dass sie bei Kiew haufenweise angerannt kamen, und er hat sie mit einem Maschinengewehr niedergemäht. Frauen sollen auch darunter gewesen sein. Auf Frauen würde ich natürlich nicht schießen. Krieg ist für Männer – wie bei den Indianern. Krieg ist Männersache.
So sah Peter die Russen in seinen Vorstellungen aus dem Walde stürmen – er schoss, und er sah, wie sie ins hohe Gras fielen, zwischen die Butterblumen und Margeriten.
Daran dachte Peter auch jetzt in der Stube. Woran er nicht dachte, das war die Frage nach dem Warum. Und wer auf einen anderen Menschen schießt, ohne seine Heimat zu verteidigen, der ist ein Mörder.
Peter verteidigte keine Heimat. Die Russen verteidigten sie; denn sie waren es, die überfallen worden waren … Und der Vater sagt immer: Ein Soldat hat nicht zu denken. Wer dachte denn da für ihn – für seinen Kopf, den er hinhalten musste für die, die für ihn dachten?
Nein, das wusste Peter nicht, das überlegte er nicht, und auch die Mutter hatte nicht solche Ideen, obwohl sie an den Kopf dachte – allerdings an Peters Kopf. Sie sagte nämlich: „Ich verstehe nicht viel davon, ich weiß nicht, wie das dort draußen zugeht, Peter, aber ich meine, steck nie den Kopf hoch raus, immer vorsichtig sein, mein Junge.“
Peter lächelte, lächelte, als wüsste er, wie es draußen zuging. „Lach nicht, Dummkopf! Meinst, ich hab dich aufgezogen zum Abschießen? Wie viele Leute haben Briefe bekommen, wo drin stand: Ihr Mann erhielt einen Kopfschuss – oder wie beim Speckertfleischer in der Fischgasse: Ihr Sohn Fritz fiel durch einen Kopfschuss und war sofort tot. Immer Kopf, nur Kopf.“ Die Mutter hatte die Schlüssel in der Hand. An der Tür sagte sie feierlich: „Gott segne deinen Ausgang und deine gesunde Rückkehr.“ Sie schloss die Stuben ab, Peter dachte: Endlich.
Die Mutter: „Wir tragen den Koffer abwechselnd bis zum Schützenhaus.“
Peter stieg die Holztreppe hinunter, übersprang die vierte Stufe, weil sie immer so quietschte und er nicht wollte, dass Ludwigs unten ihn weggehen hörten. Am Ende kämen sie noch heraus und jammerten, so wie es seiner Meinung nach die Mutter tat.
Sie standen auf der finsteren Straße.
Regen fiel schläfrig vom Himmel. Über dem Rathaus schwamm die Mondsichel, trüb und welk, und es sah aus, als weine der Mond. Bald stieß eine Wolke über sein Halbgesicht und dunkelte die Stadt vollends ein.
„Komm doch“, drängte Peter.
„Du weißt nicht, in was für eine Gefahr du reinrennst“, sagte Frau Rentsch, klemmte die Handtasche unter den Arm und fuhr sich mit dem Taschentuch über die Augen.
Mein Gott, dachte Peter, jetzt fängt sie schon wieder an. „Bei Gräbers hat gestern der Hund Junge gekriegt, gleich drei Stück“, meinte er, um die Mutter abzulenken.
„Bei Gräbers? Gut, dass du mich daran erinnerst, was der Frau Gräber ihr Bruder ist, der Felix, der hat auch Kopfschuss gehabt, der mit dem Friseurladen auf dem Untermarkt …“ Peter seufzte und lief schneller. Der Regen wehte sprühig von vorn. In Dachrinnen winselte leise das Wasser.
Es war still, ganz still. Überall waren die Fenster verdunkelt, wegen der Flieger. Aus weiter Ferne, weit weit hinter dem Stadtwald, drang ein drohendes Gerumpel durch die Nacht. Die Front. In der Nachbarstadt knallte plötzlich eine Flak. Und als sie später beim Bäckermeister Plunsch vorbeikamen, bubberte die große Schaufensterscheibe von den Bombeneinschlägen, die in der anderen Stadt die Nacht zerfetzten.
Die Mutter fasste mit an den Koffergriff. Sie spürte so die Hand ihres Sohnes, und ihr war dabei, als führe sie ihn – wie in den Tagen, als Peter ein kleiner Junge gewesen war.
Nachdem sie eine Zeit gegangen waren, stumm und sinnend, hörten sie Gesprächsfetzen. Söhne und Mütter. Aus einem Fenster heraus sagte eine Frau: „Nein, nun treiben sie auch noch die Kinder in den Krieg.“
„Halt deine Klappe!“, sagte ein junger Kerl mit einem Karton an der Hand. „Sonst lassen wir dich von der SS abholen, die hängt dich auf.“
Die Frau schlug krachend das Fenster zu.
„So frech bist du mal nicht, Peter, verstanden?“
„Nein“, sagte er artig.
„Wir haben dich anständig erzogen.“
Die Frau dort oben braucht uns auch nicht als Kinder zu bezeichnen, dachte Peter. Jetzt, wo wir ein Gewehr kriegen, ein richtiges Gewehr, da sind wir keine Kinder mehr, da sind wir Männer. Das war natürlich dumm gedacht. Wird ein Baby fünf Jahre älter, nur weil es einen Roller geschenkt bekommt?
Peter wusste schon, wen er im Schützenhaus treffen würde. Da war Dieter Worm, und da war Heinz Pahl. Sie kannten sich aus der Schulzeit und aus der Hitlerjugend. Während Peter Rentsch als Lehrling in einem Lebensmittelgeschäft arbeitete, gingen Worm und Pahl auf die Oberschule. Und Peter dachte wieder an IMI-Max. Der war irgendwo bei einem Klempner in der Lehre. Und immer, wenn Peter den IMI-Max traf, hatte er ein Gefühl, als müsste Max denken: Aha, du Lump, dein Vater hat meinen Vater umgebracht. Und sofort ging Peter schneller. Ihm war, als trüge er die Schuld seines Vaters durch die Stadt. In solchen Augenblicken überlegte er: Vater hätte das Flugblatt zusammenknüllen und wegwerfen können. Nichts wäre herausgekommen.
Früher war er mit Max Brendel manchmal draußen im Stadtwald gewesen. Dort hatten sie eine Höhle gehabt, Indianer gespielt, geraucht und nach Vögeln mit Flitzbogen geschossen. Aber durch die Hitlerjugend hatte er ihn verloren – Max gehörte nicht dazu – und später, als das mit dem Vater passierte, da mied er ihn, obwohl Peter auch dachte: Ich kann ja nichts dafür.
Als sie das Schützenhaus erreicht hatten, nahm die Mutter das Taschentuch wieder heraus. „Nun wird es ernst, Junge“, sagte sie, „jetzt müssen wir uns ganz auf den lieben Gott verlassen …“
Bei Brendels verließ man sich nicht auf den lieben Gott. Das war zu unzuverlässig und unsichtbar. Sie hatten es bisher meist mit sehr handgreiflichen und sichtbaren Dingen zu tun gehabt. Bei IMI-Max zu Hause geisterte kein lieber Gott durch die Gespräche, es sei denn, dass Frau Brendel, diese kleine, rothaarige Frau, mal „Gott sei Dank“ oder „Mein Gott“ sagte. Das war bedeutungslos, das taten und tun viele Leute. Sie dachte sich nicht mehr dabei, als wenn sie „Wolke sei Dank“ oder „Mein Nebel“ gesagt hätte. Nein, sie hatten keine Lust, sich auf jemanden zu verlassen, den sie noch nie gesehen hatten. Brendels waren überzeugt, dass nicht einmal auf alle Erdenbewohner, die sie täglich zu Gesicht bekamen, Verlass war. Und IMI-Max dachte: Gäb’s so einen lieben Gott, so hätte er an dem Tage, an dem mein Vater hingerichtet wurde, das Fallbeil auf die stürzen lassen müssen, die ihn hinrichteten, die ihn verurteilten; denn mein Vater war ein anständiger und gerechter Mensch. Er wollte durch sein Flugblatt mit verhindern, dass noch Hunderttausende mehr unschuldig im Kriege umkommen. Und die Karte, die auf dem Küchentisch lag und ihn ins Schützenhaus zum Volkssturm verlangte, die war auch von keinem lieben Gott unterschrieben, sondern von einem sehr irdischen Obersteiner Hauptmann.
Der Abschied bei Brendels sah also ganz anders aus als bei Rentschs.
Auf der Diele stand ein Pappkarton, drin lagen zwei blaue Taschentücher, ein Schal, Sicherheitsnadeln, ein Paar Socken, Briefpapier, ein Brot und ein Stück Speck, das Frau Brendel sich bei einem Bauern erarbeitet hatte. „Mehr geb ich dir nicht mit, Max. Wenn sie dich haben wollen, sollen sie dir’s Zeug dazu geben“, sagte die kleine Frau.
Max: „Sowieso.“
IMI-Max verdankte den Spitznamen seiner Mutter, die seit Jahrzehnten für die Nachbarschaft und seit Kriegsbeginn draußen im Stadtkrankenhaus die Wäsche wusch. Nun wäscht man die Wäsche zwar nicht mit IMI, sondern mit Persil, und Max hätte eigentlich Persil-Max heißen müssen. Aber das schien seiner Umgebung nicht zu gefallen, und so nannten sie ihn eben IMI-Max.
In dieser Abschiedsstunde sprach Frau Brendel auch nicht von Hoffmannstropfen, die, wie bei Rentschs, „für alle Fälle“ gut sein sollten, nein, Frau Brendel meinte zu ihrem Jungen: „Nun sieh dir noch mal das Bild von Vater an, Max.“