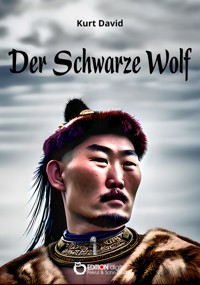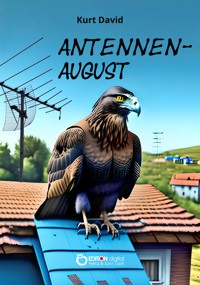8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Tenggeri ist ein Krieger im Heer des Dschingis-Chan. Seine Feldzüge führen ihn weit, er nimmt an der Erstürmung der Großen Mauer teil und durchquert das Reich Chin bis an den Rand der Welt, ans Meer. Er sieht viel Interessantes, schließt sogar Freundschaft mit den Einheimischen. Doch alle neuen Eindrücke können die Frage nicht verdrängen, warum der Schwarze Wolf, Tenggeris Ziehvater, einst von seinem Freund, dem Chan, getötet wurde. Auf den Höhen des Tienschan, während des Angriffs auf das Reich der Choresm, erzählt ihm Bat vom Tod seines Vaters; Bat, der jeden Feldzug mitgemacht hat und einer derjenigen war, die den Schwarzen Wolf angegriffen haben. Als der Chan die Eroberung Bucharas feiert, flieht Tenggeri mit seinem Mädchen Saran aus dem Heer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impressum
Kurt David
Tenggeri, Sohn des Schwarzen Wolfs
ISBN 978-3-96521-930-4 (E-Book)
Das Buch erschien erstmals 1968 im Verlag Neues Leben Berlin (Band 83 der Reihe „Spannend erzählt“).
© 2023 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Der Schimmelhengst
Zehntausend nachtschwarze Leibwächter bewachten den Schlaf des großen Chans, Männer, stumm und unzerbrechlich wie die Felswände am Onon-Fluss. Aus der Mitte des Hauptlagers ragte die mächtige Palastjurte, um sie duckten sich die vielen Gemächer der Nebenfrauen und die noch zahlreicheren Filzzelte der Diener.
Die Spätsommernacht hatte eiskalte Hände, und aus hunderttausend Dachluken stiegen feine Rauchsäulchen.
Es war still.
Kein Wind.
Kein Vogelschrei.
Nur der Mond schien, klar und hell, und die goldene Spitze auf dem Palast strahlte wie ein Stern.
Als erste wurden die Pferde unruhig, ihnen folgten die Schafe, und dann schreckten auch die Hirten auf. Tenggeri blickte zum Hauptlager, das in der Ferne wie ein unendlicher See im fahlen Nachtlicht schimmerte. Er bestieg seinen Hengst, streckte sich, und plötzlich schmeckte er die frostige Luft und schrie: „Sturm! Sturm! Sturm!“ Und auch die anderen Hirten schrien jetzt: „Sturm!“ Und die Herden gerieten durcheinander, rasten wild in die eine und danach in die andere Richtung. Ihr Ziel war das Hauptlager. Noch bevor sie es erreicht hatten, war das Unwetter da, warf Mann und Tier ins Gras und auf die Steine. Es regnete Eisstücke. Am Ordurand brannten Jurten; die lodernden Filzwände schossen wie feuerspeiende Drachen über den Himmel.
Tenggeri lag hinter seinem gestürzten Pferd, er hatte sich den Zügel um die Handgelenke gewickelt. Für einen Augenblick dachte er: Der große Chan gewinnt alle Schlachten, der große Chan zwingt alle Feinde zu Boden, aber der große Chan ist machtlos, wenn die Götter den bösen Sturm senden. Ob er wenigstens weiß, weshalb uns der Ewig blaue Himmel so straft?
Der Eisregen hatte nachgelassen. Als auch der Sturm etwas an Kraft verlor, stand Tenggeri auf und sprang in den Sattel, versuchte die Herde zusammenzutreiben. Aber die Pferde brachen immer wieder aus, voran die Hengste. Sie galoppierten bis dicht zu den brennenden Jurten, verhielten erschreckt, wendeten und jagten wie besessen zurück in die Finsternis, hinein in die Steppe. Nur den Schimmel des Chans nicht aus dem Auge verlieren, dachte Tenggeri, das edelste Tier der Herde, das feurigste, das wertvollste. Er folgte dem weißen Hengst, der ganz gemächlich mit seinen Stuten über die Ebene trabte. Dann schlug noch einmal der Sturm zu. Wieder warf er Tenggeri ins Gras, aber die Angst riss ihn wieder hoch. Und da war der Weiße fort. Ausgebrochen!
„Der Schimmelhengst flieht!“, schrie Tenggeri, „der Schimmelhengst flieht!“ O Sturm, habe Erbarmen, flehte er, aber der Sturm hatte kein Erbarmen, sondern erdrosselte alle Schreie schon vor dem Mund des jungen Hirten. Er peitschte sein Pferd und trieb es durch die Herde. Der Chan wird mich hinrichten lassen; denn des Chans Befehl lautete: Für den Verlust eines meiner edelsten Tiere sollen drei Hirten sterben.
Tenggeri ritt zum Ufer des Onon-Flusses, und als er es erreicht hatte, sprengte er im Zickzack stromaufwärts, getrieben von der Angst und Furcht, sein Leben zu verlieren, wenn es ihm nicht gelänge, den Schimmel des Chans wieder einzufangen. Einmal war ihm, als tauche der Weiße plötzlich vor ihm auf. Doch es war nur ein Fels gewesen, den für einen Moment der Mondschein getroffen hatte. Und je länger er durch Sturm und Nacht und Regen jagte, ohne zu finden, was er suchte, desto schärfer sah er die Bilder vor seinen Augen und desto eindringlicher bohrten die Gedanken in seinem Kopf:
Der Chan befahl ihn zu sich. Das war am Morgen. Die Sonne schien, und die Sonne schien natürlich noch schöner als sonst, und die Sonne schien so prächtig, dass er sich vorwarf, sie in den vorangegangenen Jahren so wenig beachtet zu haben. Aber das kam nur daher, weil er wusste, dass er nun diese Sonne zum letzten Mal scheinen sah; denn der Chan hatte gerufen.
Der Herrscher saß vor seinem Palast auf einer seidenen Matte mit mürrischem Gesicht, umstanden von Wächtern mit Wolfsaugen und blitzenden Schwertern. Obgleich Tenggeri vor dem sitzenden Dschingis-Chan stand und groß von Gestalt war, kam er sich klein wie eine Zieselmaus vor, die ängstlich um eine Jurte huschte.
Der Chan sagte: „Wo ist das edelste meiner Pferde, der Schimmelhengst?“
Und seine Lippen würden zuerst nicht auseinandergehen wollen, weil er sich schämte, das zu sagen, was er bereits wusste.
„Wo ist mein Lieblingspferd?“
„O Chan, ausgebrochen mit den Stuten. Das Unwetter hat mich ins Gras geworfen, der Eisregen schloss mir die Augen, ich glaubte, der Himmel wäre auf uns herabgestürzt und die Götter hätten uns für ewig verdammt.“
„Ich sitze hier in der Sonne, also sind die Götter mit mir, aber du bist einer von den Schwachen, schwächer als das Borstengras am Fluss, das der Sturm zwar zu beugen, doch nicht zu zerbrechen vermag.“ Dschingis gab den Wächtern ein Zeichen und sagte dann: „Die schwachen Schafe in der Herde verderben auch die starken, verfahrt also mit ihm wie mit den schwachen Schafen: Erwürgt ihn!“
Und jedes Mal, wenn dieses „Erwürgt ihn!“ in Tenggeris Gedanken gesprochen wurde, fiel die Sonne wie eine schwarze Kugel vom Himmel.
Als diese Sonne aber rot und groß aus dem Fluss stieg, glaubte er zu träumen. Er hatte gar nicht bemerkt, dass der Sturm vorüber und die Nacht vorbei war, und er hetzte voller Angst auf das Ufer zu und sah den Weißen mit seinen Stuten, und er wollte es nicht glauben, dass es der Schimmelhengst war, der da morgengrau vor der roten Scheibe stand und behaglich das Flusswasser soff.
Tenggeri sprang von seinem Braunen sofort auf den Rücken des edlen Chan-Pferdes. Er lachte und er weinte, und er wischte sich den Regen, den Schweiß und die Angst aus dem Gesicht, riss die Zobelfellmütze vom Kopf und warf sie vor Freude in den Himmel. Sie schwebte in den Fluss und trieb mit den Wellen davon, und ihm war, als hätte er den Tod fortgeworfen; denn ehe ihn die Wächter erwürgt hätten, hätten sie, dem Brauche nach, Mütze und Gürtel verlangt.
Langsam ritt er auf dem Schimmelhengst das Ufer entlang, jetzt stromabwärts, unter den von der Nacht zerzausten Ulmen. Sein Brauner und die Stuten des Weißen trabten gehorsam hinterher. Die Morgensonne färbte das Wasser des Onon rot. Erste Möwen krächzten, frühe Kraniche stelzten durchs nasse Gras.
Der schönste Morgen seines Lebens!
Tenggeri lächelte, tätschelte dem Weißen den Hals und sagte: „Solange ich dich sehe, lebe ich!“
Im Hauptlager warteten sie bereits auf ihn.
Oschab, ein Hirt, sagte: „Wir haben für dich schon gebetet, Tenggeri! Wo ein Tier mehr wert ist als ein Hirt, wird der Hirt nicht alt!“
Und Gärel, Oschabs Frau, meinte: „Dschingis-Chan wird wissen, weshalb er gerade dir sein edelstes Pferd anvertraut hat, er ist listig.“
Bei allen Göttern, dachte Tenggeri, er weiß es wirklich, der Chan, so, wie ich es weiß.
„Du solltest unseren Freund nicht immer wieder daran erinnern, Gärel“, tadelte Oschab und reichte Tenggeri ein Stück Schaffleisch sowie eine Schale voll Milch. „Wenn Wunden aufbrechen, heilen sie nie.“
Leise fragte Tenggeri: „Hat der Chan vielleicht damals doch nicht nach der Gerechtigkeit gehandelt?“
„Oh“, Oschab hob beschwörend die Hände und schaute ängstlich nach allen Seiten. Ein Stück ab schlug der Schmied auf glühende Pfeilspitzen; Funken sprühten, der Blasebalg fauchte wie ein großmäuliges Ungeheuer. Also sagte Oschab, nachdem er sich überzeugt hatte, dass es der Schmied nicht hören konnte: „Oh, Tenggeri, schon für diese Frage könntest du zweimal getötet werden; denn der Chan sagt von sich, dass er nichts tut, ohne die Götter befragt zu haben, also handelt er im Namen der Götter. Können aber die Götter von einem Herrscher Ungerechtigkeit verlangen? Und ein Chan, der gegen die Götter handelt, muss der nicht die Götter gegen sich haben?“ Oschab ließ die Hände wieder sinken, lächelte und sagte: „Nein, nein, Tenggeri, die Götter sind mit unserem Chan und seinem Volk. Nur mit ihrer Hilfe vermochte der Herrscher alle Feldzüge zu gewinnen und das große Reich aller in Filzjurten lebenden Stämme zu gründen.“
„Vergiss den Schmerz“, sagte Gärel und füllte Milch nach. Dann schwiegen sie, Oschab und Gärel, weil sie wussten, dass Tenggeri den Schmerz nicht mit der Milch hinunterzuschlucken vermochte, und Tenggeri schwieg, weil er sich zurückerinnerte an die Zeit, als er noch Knabe war. Sein Vater, genannt Chara Tschono – Der Schwarze Wolf – kämpfte damals im Heer des Chans gegen das ferne und große Reich von Hsi-Hsia, von dem man gesagt hatte, dass es in ihm Städte aus Steinen geben solle, Paläste mit goldenen Säulen und goldbelegten Dächern. Aber der Vater war plötzlich in einer Nacht zurückgekehrt, allein und ohne dass der Krieg zu Ende gewesen wäre. Heimlich schlich er in die Jurte, weckte Mutter Goldblume und Tenggeri. Sie packten schnell das Notwendigste zusammen, ließen die Filzjurte am Platz und flohen mit den Pferden nach Norden, Tage und Nächte ritten sie, Nächte und Tage, bei Regen, bei Sonne, und dann mussten sie vor Erschöpfung rasten. Das war an einem Bach mit drei Zedern.
„Ihr müsst wissen“, sagte Tenggeri leise zu Oschab und Gärel, „dass mein Vater die Zedern liebte. Er sagte von ihnen: ,Zedern sterben nicht, sie wachsen aus Vergangenem ins Künftige, sie leben wie stumme Riesen unter uns, sind Zeugen der Zeiten. Und wenn sie der Wind zerzaust, beginnen sie zu erzählen wie die weißbärtigen alten Männer. Wer ihnen lauscht, wird weise, mein Sohn.‘ Ja, so sagte mein Vater.“
Oschab und Gärel nickten verlegen, und die Frau rührte mit einem Knochenstab in dem brodelnden Topf mit Schaffleisch, und sie rührte viel länger, als es nötig gewesen wäre. Der Mann hingegen untersuchte seine Stiefel, obgleich er wusste, dass sie ganz neu waren. Aber sie kannten das schreckliche Ende der Geschichte: Zehn Reiter des Chans hatten sie eingeholt, Chara Tschono und Goldblume am Bach getötet, Tenggeri mit ins Hauptlager genommen.
„Und keiner vermag mir zu sagen, weshalb Vater und Mutter in dieser Nacht geflohen sind!“
„Ich möchte nicht zu denen gehören, die es gewusst haben könnten“, sagte Oschab und schürte sorgfältig das Feuer. „Übrigens: Wer sagt es schon dem Nächsten, wenn er aus dem Heere fliehen will? Und wer sagt gar noch, warum er es tun möchte? Der Chan ist streng, der Chan hat Zehntausende Ohren und Zehntausende Augen, die für ihn hören und sehen. Man sagt, er bezahle solche Dienste nicht schlecht.“
Unweit der Jurte grasten die Pferde, unter ihnen der Schimmelhengst. Beauftragte des Herrschers umritten die Herden und zählten die Tiere. Am längsten hielten sie sich beim Lieblingspferd des Chans auf; sie betrachteten den Weißen aufmerksam, blickten in sein Maul und ließen ihn einige Schritte gehen.
„Dein Vater war sogar einmal der Oberste der Leibwache“, sagte Gärel. „Du bist still“, schimpfte Oschab, „bei euch Frauen sitzen die Worte zu locker. Ich kannte eine, die ist an einem einzigen Wort gestorben, an einem einzigen! Sie hatte vor dem Chan statt Ja ihr Nein gesagt!“
Gärel griff sofort wieder zu dem Knochenstab und rührte in dem Topf. Oschab stand auf und lief zu den Pferden.
Tenggeri wusste, dass sein Vater Chara Tschono der Oberste der Leibwache gewesen war, er wusste jedoch auch, dass er es später nicht mehr gewesen sein konnte. Nur die Gründe, die zur Absetzung geführt hatten, kannte er nicht. Und er dachte jetzt: Der Schimmelhengst ist schuld, dass ich wieder daran denke. Tenggeri blickte hinüber zum Lieblingspferd des Chans. Ein einzelner Reiter ritt heran, hielt vor Oschab und sprach mit ihm. Eine Weile darauf wies Oschab mit ausgestrecktem Arm zu Tenggeri.
„Er will zu mir“, sagte Tenggeri. „Seinem vornehmen Gewande nach ist er ein Bote des Chans.“
Gärel sprang erschreckt auf. „Zu dir? Vielleicht will er zu mir? Oh, was habe ich vorhin erst geredet. Der Schmied wird etwas gehört haben und …“
„Ach was, Gärel, der Bote lächelt!“
„Lächelt, lächelt“, erregte sich die Frau, „soll er seine böse Kunde schon im Gesichte tragen?“
Der Reiter kam näher und sagte freundlich vom Pferd herab: „Ihr seid Tenggeri?“
„So ist es, Herr!“
„Der Stiefsohn des einstigen Chara Tschono?“
„Ja, Herr!“
Das Pferd des Boten tänzelte ungeduldig. „Der große Chan lässt Euch rufen!“ Die Peitsche sauste hernieder, der Rappe machte einen Satz und verschwand mit dem Reiter zwischen den Zelten.
Mit einem Mal merkte Tenggeri, dass er ganz allein vor der Jurte stand; Gärel war weggelaufen, wohl aus Furcht, und Oschab hantierte weit draußen an einer zerbrochenen Hürde, ohne sich umzusehen. Wie klein sie doch sind, wenn sie ein Schatten des Chans streift, dachte Tenggeri. In der vergangenen Nacht, als ich nach dem ausgebrochenen Schimmelhengst jagte, war ich in meinen schrecklichen Gedanken auch so winzig, winzig wie eine Zieselmaus, die um eine große Jurte huscht.
Ruhig stieg er in den Sattel und lachte. Ja, lachen musst du, Tenggeri, und du musst so groß bleiben wie du bist, lachen; denn du hast ein reines Herz und keine schlechten Gedanken, du bist stark und keiner von denen, die liegenbleiben, wenn sie gefallen sind.
„He, Schmied! Ihr müsst schneller auf die glühenden Spitzen schlagen. Der Chan hat mehr Feinde als Pfeile!“
„Es war wohl eine frohe Botschaft, die Euch vom Herrscher überbracht wurde?“
„Woher wisst Ihr?“
„Na, ich merke es an Eurem Spaß, den Ihr mit mir treibt!“
„Spaß? Ein Pfeil zu viel ist besser als ein Pfeil zu wenig. Das nennt Ihr Spaß?“
„O nein, o nein“, jammerte plötzlich der Schmied, trieb sofort seine Leute an, und nun hämmerte es wie wild, und der Blasebalg fauchte so kurzatmig wie die Lunge eines durstigen Hundes in der Hitze.
Froh darüber, die Angst des Schmiedes hervorgezaubert zu haben, ritt Tenggeri die breite Lagerstraße hinauf; er ritt gemächlich und lächelnd und nicht wie einer, den der Chan gerufen hatte. Unterwegs begegneten ihm schwankende Kamele mit schweren Lasten, Frauen mit Krügen und Karren mit Wasserfässern, die von mächtigen Yaks gezogen wurden. Einzelne Hammel, Ziegen und Hunde lagen im Staub und im Schatten der Jurten. Mit dem Rücken an einen warmen Stein gelehnt, hockte ein blinder alter Mann am Rande der Lagerstraße. Er sah aus wie ein Toter. Mit den Fetzen seiner Kleider spielte der Wind. Hinter ihm klapperten Kinder mit Schafsknochen.
„Wo habt Ihr Euer Augenlicht verloren, Alter?“, fragte Tenggeri.
Der Mann hob ein wenig den Kopf. „In der Schlacht gegen die Merkiten, oben am Kilcho-Fluss.“
„Es ist schlimm, nichts zu sehen“, sagte Tenggeri und vergaß sein Lächeln.
„Schlimm? Es ist gut so, sehr gut; seitdem brauche ich nicht mehr zu sehen, was ich bis dahin sehen musste. Schlimm ist nur, dass mich die Götter lange warten lassen, bis ich zu ihnen aufsteigen kann.“
„Und der Chan hat Euch auch vergessen?“
Der Blinde fuhr erschreckt zusammen, zitterte und sagte: „Wer seid Ihr, dass Ihr so fragen dürft?“
„Ich bin der Stiefsohn des einstigen Chara Tschono, Alter!“
„Sagtet Ihr Chara Tschono?“
„Ja.“
Der Blinde ließ sich seitwärts fallen und rief im Staube kriechend nach den Kindern. „Verrätersöhnchen, sollen mich deinetwegen die Wächter des Chans umbringen? Du zwitscherst hier sorglos wie ein Vogel herum, nur – fliegen kannst du nicht. Nein, nein, dann will ich lieber solange warten, bis mich die Götter holen.“ Die Kinder hoben den Alten auf und führten ihn zu seiner Jurte.
Er ist kaum noch am Leben, dachte Tenggeri, aber die Angst schleppt er in seinen Tod hinüber. Und meinen Vater hat er gekannt. Wenn der Blinde nicht so feig wäre, könnte er mir von Vater vielleicht erzählen.
Inzwischen hatte Tenggeri das Haupttor erreicht, durch das die Straße in die Mitte des Lagers führte. Von nun an begleiteten ihn zwei Wächter, stumm und würdig, die ihn später, als er die große Palastjurte sah, zwei ebenso stummen und würdigen Wächtern übergaben. Aber auch sie geleiteten ihn nicht bis zum Herrscher, sondern nur zu einer kleineren Jurte, wo er von einem Diener in blauem Gewande empfangen wurde.
„Steigt ab!“, sagte der Bedienstete. Ein anderer übernahm das Pferd und führte es weg.
Der Diener fragte: „Haltet Ihr in Euren Kleidern einen Dolch, eine Nadel oder einen ähnlichen Gegenstand verborgen?“
„Nein.“
„Dann kommt herein und legt die Kleider ab, damit ich Eure Worte nachprüfen kann!“
„Oh, Ihr misstraut mir?“
„Ich tue, was der Chan befiehlt.“
„Und mir gegenüber befahl er Misstrauen, weil mein Stiefvater eines …“
„… Der Chan befiehlt kein Misstrauen, sondern Sicherheit!“
„Von allen?“
„Von vielen!“
„Also misstraut er den meisten!“
Der Diener blickte Tenggeri vorwurfsvoll an und sagte ruhig: „Wenn Ihr tausend Hühnereier vor Euch liegen habt und damit rechnen müsst, dass drei davon schlecht sind, wie viel müsst Ihr untersuchen, um die drei zu finden?“
Natürlich alle, dachte Tenggeri, schwieg lächelnd und zog sich gehorsam aus.
„Ich danke Euch für das Schweigen“, sagte der Diener, „denn schweigend sagt Ihr mehr als redend!“ Bedächtig griff er die Kleider ab, und seine Finger liefen geschickt die Nähte entlang, schlüpften in Falten, verschwanden in Taschen. „Was ich nicht finde, sehen nur noch die Götter! – Ihr dürft Euch wieder anziehen!“
Er ist glitschig wie ein Fisch, dachte Tenggeri und trat aus der Jurte. „Kommt!“, sagte ein anderer Diener und führte ihn zum Palastzelt des Chans. Und tatsächlich, anfangs sah es aus, wie es sich Tenggeri in der vergangenen Nacht vorgestellt hatte: Dschingis saß vor seinem Palast auf einer seidenen Matte, allerdings umstanden ihn keine Wächter mit Wolfsaugen und blitzenden Schwertern – die hielten sich abseits –, sondern seine Gemahlin Borte weilte bei ihm und reichte dem Herrscher mit beiden Händen eine große goldene Schale voll Kumys. Er trank hastig, und es sah unbeherrscht und gierig aus; auf seiner breiten Stirn glänzten viele Schweißperlen im Sonnenlicht. Als er die Schale keuchend absetzte, wischte er sich mit dem himmelblauen Rockärmel den Schaum der Stutenmilch aus seinem rötlichem Bart und erblickte Tenggeri: „Ah, da ist er, den ich fast vergessen hatte.“ Dschingis gab seiner Gemahlin Borte die leere goldene Schale zurück.
„Ihr habt mich rufen lassen, mein Chan!“
„Und Ihr seid sofort gekommen!“
„Muss man es nicht, wenn der Chan ruft?“
„Doch doch, die ich zweimal rief, sind nicht mehr am Leben. Es geschah nur einmal, dass ich mich an dieses Gesetz nicht hielt, und weil ich diesen Mann schonte, straften mich die Götter, indem sie diesen Mann verleiteten, später aus meinem Heer zu fliehen. Dabei war er mein bester Freund gewesen; wir hatten in unserer Jugend, als ich nicht mehr besaß als neun Pferde, sechs Hammel und eine traurige Mutter, kostbare Dolche getauscht und uns geschworen, dass der eine den andern töte, falls der andre dem einen untreu werde.“
„Sprecht Ihr von meinem Vater, mein Chan?“
Dschingis erhob sich und trat einige Schritte auf Tenggeri zu. „Dass Ihr lebt, verdankt Ihr jener Tatsache, dass er nicht der Vater Eures Blutes gewesen ist. Dieser Mann hatte Euch als elternlosen Knaben nach der großen Schlacht am oberen Onon zwischen den Toten und Sterbenden gefunden und mit in seine Jurte genommen. Wäre er hingegen der Vater Eures Blutes gewesen, hättet Ihr mit ihm und der Frau, die Ihr Mutter nanntet, sterben müssen, und zwar nach dem Gesetz und der Kraft des Ewig blauen Himmels.“
Der Chan flüsterte mit seiner Gemahlin, worauf Borte den Platz verließ und im Palastzelt verschwand.
Aus der Runde der Heerführer, die einige Schritte hinter dem Herrscher um einen Weintrog hockten, rief Dschutschi: „Mein Vater, weshalb redet Ihr von einem, der nichts als einen schwarzen Fleck in der Steppe hinterließ, einen Fleck, den der Regen längst fortspülte?“
Der Chan setzte sich wieder auf die seidene Matte.
Tenggeri hatte den Mund offen, und er wollte etwas sagen, aber er wusste nicht, wie er die Worte wählen sollte, ohne Dschingis zu reizen.
„Sprecht“, forderte der Herrscher, „ich liebe die offene Rede. Nur was ich nicht höre und nicht sehe, vermag mir gefährlich zu werden.“
„Mein Stiefvater und meine Stiefmutter waren gut zu mir, und sie ernährten mich auch, mein Chan“, sagte Tenggeri laut.
Der Herrscher antwortete sanft:
„Ernährt nicht auch der gelbe Schakal seine Jungen? Er sorgt und sorgt für sie, bis sie so stark sind, dass sie an seinen hinterlistigen Raubzügen teilnehmen können.“
Tenggeri überlegte blitzschnell und sagte: „Ernährt der gelbe Schakal aber auch Junge, die nicht seines Blutes sind, mein Chan?“
„Oh“, rief Dschutschi, „er weiß auch klug zu reden, mein Vater! Lasst endlich den Schmutz und sagt ihm, weshalb Ihr ihn habt rufen lassen. Er verdient die Freude!“ Der Heerführer erhob sich und kam mit einem silbernen Becher voll Wein zu Tenggeri. „Trinkt! Ich habe es gern, wenn einer den klugen Worten meines Vater noch klügere entgegensetzt!“
Tenggeri verneigte sich dem Brauche nach und sagte: „Ich trinke auf Eure Gerechtigkeit!“
„Ich habe Euch rufen lassen“, begann der Chan, „um dies zu sagen: Vor Jahren befahl ich, den Schimmelhengst, mein Lieblingspferd, der Herde zuzuführen, die Ihr zu beschützen habt. Diese List sollte mir meine Frage beantworten: Was ist jener für ein Mensch, der einst aus der Schale eines Verräters gegessen hat? Musste ich nicht fürchten, dass er mit den Speisen, die der Verräter mit ihm teilte, auch dessen Gedanken aufnahm? Musste ich nicht fürchten, dass er mit den Getränken, die der Verräter ihm vorsetzte, auch dessen Gift trank? Und jetzt weiß ich dies: Ihr habt meinen Schimmelhengst bewacht, wie Ihr mich bewacht hättet, also seid Ihr mir treu geblieben, wie Ihr ihm treu geblieben seid. In tausenden Nächten habt Ihr mit ihm gefroren und mit ihm vor Kälte gezittert, Ihr habt die tückischen Wölfe von ihm abgehalten, wie meine Krieger die Feinde von mir abhalten. Und als in der vergangenen Nacht der eisige Sturm über uns herfiel und alles zu Boden warf, seid Ihr, Tenggeri, so lange geritten, bis Ihr den ausgebrochenen Weißen wiedergefunden und gefangen hattet. Also seid Ihr tapfer und zäh.“ Der Chan rief nach Dschutschi und verlangte einen neuen Becher voll Wein.
Er nennt mich tapfer, dachte Tenggeri, dabei war es nur die Angst, die mich tapfer sein ließ, so, wie es nur die Angst war, die den Schmied zur Eile antrieb und den Blinden in den Staub drückte.
Dschutschi brachte lächelnd den Wein.
Dann sagte der Herrscher: „Den Oberbefehl über die Heere gebe ich denen, die weise sind, die Tapferen mache ich zu Kriegern, den Schlauen und Listigen vertraue ich das Gepäck an, und die Unwissenden bleiben meine Hirten. Ihr aber, Tenggeri, seid die Jahre über tapfer gewesen, aus dem Knaben ist ein Jüngling geworden, also mache ich Euch zu einem meiner Krieger. Tretet in die Zehnerreihe!“
„Ich danke Euch, mein Chan!“
Dschingis gab einem Diener ein Zeichen, worauf dieser einem zweiten Diener winkte, der ein prächtiges Pferd heranführte.
„Ihr dürft Euch entfernen!“, sagte Dschutschi.
Tenggeri zögerte einen Augenblick und sagte entsetzt: „Das ist nicht mein Pferd, nein, dieses Pferd gehört mir nicht, man hat es verwechselt.“
„Es ist das Geschenk des Chans!“, antwortete Dschutschi. „Ich sehe Euch sehr erstaunt! Habt Ihr es nicht verdient nach den Jahren der Treue?“
Tenggeri blickte sich um, aber der Herrscher war gegangen, und der Platz mit der seidenen Matte, auf der er gesessen hatte, lag bereits im Schatten. „Als ich hierher kam“, sagte Tenggeri, „sprach ich mit einem Blinden, der traurig und wie ein Toter an einem warmen Stein lehnte. Er erzählte mir, dass er sein Augenlicht während der Schlacht am Kilcho verloren hätte. Mein Verdienst, gemessen an dem seinen, ist also viel zu gering, als dass es belohnt werden müsste; ich meine, der Chan sollte ihn beschenken!“
„Das wäre den Toten gegenüber ungerecht“, antwortete Dschutschi. „Tausende Krieger gaben für den Chan ihr Leben. Vermag er sie noch zu beschenken? Und dann: Betreut der Hirt ein Pferd, das nur noch drei Beine hat und nicht mehr geritten werden kann? Soll er es füttern, weil es ihn einst trug, oder soll er nicht lieber denen mehr Futter geben, die ihn jetzt tragen?“ Dschutschi hatte die letzten Worte laut und im Weggehen gesprochen, und er drehte sich auch nicht mehr um, als Tenggeri auf das Pferd stieg und über den Platz ritt. Vor der kleinen Jurte, in der er sich vorhin hatte entkleiden müssen, stand wieder der Diener im blauen Gewande. „Ich sehe, der gütige Herrscher hat Euch beschenkt?“
„Ja, für meine Verdienste“, antwortete Tenggeri lachend.
Der Diener, durch das Wort „Verdienste“ aus Tenggeris Mund etwas gekränkt, antwortete: „Auch mich hat er neulich wegen meiner Verdienste beschenkt. Er schickte mir zum Vollmondsfest eine fette Ziege, damit wir es feiern konnten!“
„Eine Ziege? Sonderbar“, antwortete Tenggeri, „mich beschenkte er mit einem kostbaren Pferd, weil ich seinen Schimmelhengst schützte; Ihr aber, der Ihr mit Euren flinken Händen täglich in fremden Kleidern wühlen müsst und damit das goldene Leben des Herrschers schützt, belohnt er nur mit einer fetten Ziege.“
„Was der Chan tut, ist gerecht“, verteidigte sich der Diener.
„Ich habe nicht daran gezweifelt“, erwiderte Tenggeri spöttisch und ritt hinunter zum Tor. Nun trabte er auf seinem kostbaren Pferd die Lagerstraße entlang, nebenher lief sein alter Brauner. Als er bei dem Stein anlangte, vor dem der Blinde gesessen hatte, stieg er ab und ging zur Jurte des Mannes. „He, schlaft Ihr oder verkriecht Ihr Euch noch immer aus Angst vor meinen Worten?“
„Seid Ihr schon wieder da?“
„Ja, mit einem Pferd ritt ich zum Chan, mit zwei Pferden komme ich zurück!“
„Ihr lügt! Ihr wollt mich ins Unglück stoßen mit Eurem Geschwätz“, flüsterte der Alte ängstlich.
„Im Gegenteil, Väterchen, ich will Euch meinen Braunen bringen; tauscht ihn gegen einige Hammel, und Ihr habt ein Jahr lang keine Sorgen.“
Der Blinde kroch aus der Jurte und sagte: „Also hat mich der Chan doch nicht vergessen! Er schickt mir das Pferd! Und Ihr habt mit ihm über mich gesprochen! Ist es so, Bruder?“
„Nein, ich schenke Euch mein Pferd; der Chan gab mir ein besseres. Und gesprochen habe ich auch nicht mit dem Herrscher über Euch, nur seinem Sohn, dem Dschutschi, erzählte ich, was Euch widerfahren ist.“
„Und was antwortete Dschutschi?“
„Das: ,Betreut der Hirt ein Pferd, das nur noch drei Beine hat und nicht mehr geritten werden kann? Soll er es füttern, weil es ihn einst trug, oder soll er nicht lieber denen mehr Futter geben, die ihn jetzt tragen?‘“
Schweigend rutschte der Blinde zurück ins Dunkel und dachte: Mein Vater, der noch Jessughei diente, erzählte mir oft, wie zu jener Zeit das Alter, der Brauch und die Sitte geachtet waren. Jessugheis Sohn aber, Dschingis, hat die Gesetze der Vorzeit vergessen und neue geschaffen.
„Wollt Ihr mir nicht etwas sagen?“, fragte Tenggeri. „Ihr kanntet meinen Vater?“
„Ich danke Euch für das Pferd! Wenn Ihr wollt, dass ich dafür rede, nehmt es wieder mit!“
Die Sonne war inzwischen untergegangen. Vor dem Onon hing ein dünner Nebelstreifen, aus dem die mächtigen Uferbäume ragten. Schafe und Ziegen standen dicht aneiriandergedrängt bei den Zelten, schwarze Hunde umkreisten sie.
Oschab und Gärel saßen vor dem Feuer, und als sie Tenggeri mit dem prächtigen Pferd kommen sahen, rief Gärel: „Nun brauchen wir uns wohl nicht mehr zu fürchten?“
„Ihr meint wegen des Geschenkes?“
„Ein solch kostbares Pferd!“, betonte Oschab und betrachtete das Tier, prüfte seine Zähne, strich lächelnd über den gebogenen Schweif. „Komm in die Jurte und iss mit uns!“
„Und beim nächsten Boten lauft ihr wieder fort“, sagte Tenggeri scherzhaft.
„Kommt noch einer?“ Gärel stand vor der kleinen Tür, als wolle sie Tenggeri jetzt nicht mehr hereinlassen.
„Weiß ich’s? Weshalb sollte es der letzte gewesen sein! Wer schenkt, fordert manchmal auch!“ Gebückt schlüpften sie nacheinander in die Filzjurte. Neugierig lauschten sie den Worten Tenggeris, und er vergaß nichts zu erzählen, nicht die Begegnung mit dem Blinden, nicht die Gespräche mit dem Diener.
„Und du hast richtigen Chan-Wein getrunken?“, fragte Gärel.
„Ja, einen ganzen Trog voll hatten die Heerführer um Dschutschi vor sich stehen.“
Als Oschab behauptete, dieser Wein schmecke besser als die Stutenmilch und würde viel lustiger machen, so sagten wenigstens die Diener, meinte Tenggeri: „Er sieht aus wie das Wasser des Onon, aber er schmeckt nicht so gut.“
Gärel und Oschab lachten, und Gärel sagte: „Ach was, das kommt daher, weil wir den Wein nicht gewohnt sind. Das ist wie mit den Süßigkeiten, die die chinesischen Händler immer verteilen. Als ich das erste Mal solch einen Würfel in den Mund warf, spuckte ich ihn gleich wieder aus, so ekelte ich mich. Und heut? Einen Seidenbeutel voll könnte ich lutschen!“
Plötzlich öffnete sich die kleine Jurtentür, und der Schmied schob seinen Kopf durch den Spalt: „Ich sah Euch mit dem edlen Pferd zurückkehren, Jüngling, und ich …“
„Setzt Euch zu uns, Schmied!“
„Gern, gern, Oschab. Der Jüngling erzählt von seinem Besuch im Palast des Herrschers?“
Tenggeri nickte und dachte: Die Furcht treibt ihn her. „Ihr habt heut sicher mehr Spitzen geschlagen als gestern?“
„Viel mehr, viel, viel mehr“, antwortete der Schmied und schnaufte dabei wie sein Blasebalg. „Hat der Herrscher vielleicht nach mir gefragt?“
„Ja“, log Tenggeri, „so ganz beiläufig erkundigte er sich nach Euch, und ich sagte ihm, dass Ihr sehr fleißig seid.“
„Dafür danke ich. Die Götter mögen Euch auch wohlgesinnt sein.“
„Ihr wollt schon wieder gehen?“, fragte Gärel.
„Meine Frau wartet; ich will sie mit der Kunde erfreuen; wir werden dann gut schlafen!“ Geduckt schlich er wieder nach draußen. Ein Mondstrahl fiel schräg durch die Tür und machte die Gesichter bleich.
Einem die Angst zu nehmen ist ebenso leicht, wie sie ihm einzuflößen, dachte Tenggeri. Eine Weile darauf verließ auch er die Jurte. Das Gras war schon feucht und der Abend kühl. In Pelze gehüllt, hockten die Hirten bei den Herden, und es war seit langen Jahren die erste Nacht, die Tenggeri nicht mit den Tieren in der Steppe verbrachte.
Ein Mann trat aus dem Mondschatten auf ihn zu und sagte: „Erschreckt nicht. Ich wusste ja, dass Ihr hier vorbeikommen müsst, und da habe ich gewartet!“
„Ihr seid doch wieder der Schmied!“
„Ja, ich schämte mich vorhin, zweimal zu fragen, weil ich vor den anderen nicht den Eindruck erwecken wollte, dass ich Euch misstraue, aber sagt mir, habt Ihr auch wirklich dem Chan berichtet, dass ich sehr fleißig bin?“
„Wirklich!“
„Ich dachte, wenn man so jung ist, wie Ihr es seid, treibt man mit dem Alter gern Spaß.“
„Nein, ich habe es ihm wirklich gesagt!“
„Dann ist es gut!“
Während der Alte wieder verschwand, dachte Tenggeri, meine Lüge bringt ihm keinen Schaden, sondern Ruhe und Glück. Und er wird nie erfahren, dass ich log; denn Schmiede gibt’s im Hauptlager mehr, als sich der Chan merken könnte.
Der Sohn des Himmels
irmala UI",sans-serif'>Einen halben Tagesritt vom Hauptlager entfernt erhebt sich am Ostufer des Onon eine hohe Felswand, die dem Strom bis zur nächsten Biegung folgt und dann sanft in die Steppe abfällt. Dort, wo sie dem blauen Himmel am nächsten ist, umkreisen Adler die schroffen Gipfel und fallen wie große schwere Tropfen in ihre Horste herab.
Dschingis-Chan erinnerte sich dieser seltsamen Wand aus Stein, als ihm Boten meldeten, eine Gesandtschaft aus dem Reiche Chin wäre zu ihm unterwegs, um eine bedeutende Nachricht zu überbringen. Er befahl den Handwerkern, lange Sturmleitern anzufertigen, und als das geschehen war, sah man Tag für Tag eine andere Tausendschaft zum Flusse reiten und wieder zurückkehren.
Bald ritt auch Tenggeri, nun vom Hirt zum Krieger erhoben, mit zum Onon. Er war weder traurig noch froh, eher neugierig darauf, wie ihm das Leben in der Zehnerreihe gefallen würde.
Manchmal neckten sie ihn wegen seines kostbaren Pferdes, und sie sagten: „Er dient nur in der Reihe, aber sein Rappe ist mehr wert als alle neun andern zusammen.“
Der Zehnerführer hingegen, er hieß Bat und war immer darauf bedacht, keine Uneinigkeit aufkommen zu lassen, meinte dann freundlich: „Er hat dem Chan gedient und ist belohnt worden, und er hat ihm so gut gedient, dass er auch so gut belohnt werden konnte. Wer hindert Euch also, ihm nachzueifern?“ Der Zehnerführer trat an Tenggeri heran und sagte nachdenklich: „Übrigens, wie war doch dein Name?“
„Tenggeri!“
„Tenggeri!“, wiederholte Bat. „Du kommst mir bekannt vor. Warte mal, gleich hat es der alte Bat“, murmelte er. „Und das Pferd hast du doch wirklich vom Chan geschenkt bekommen?“
„Aber ja, Bat!“
„Schon gut! Wenn du das Pferd wirklich vom Chan geschenkt bekommen hast, kannst du nicht der sein, an den ich dachte, denn ihm würde er kein Pferd schenken.“
„Mein Name ist selten, Bat!“
„Ebendeshalb erinnerte ich mich!“
„Und an was?“
„O nichts, gar nichts“, der Zehnerführer wandte sich um, „man hat so Erinnerungen, nicht wahr?“
Am Westufer des Stroms wucherte dorniges Gestrüpp. Hier saßen sie ab, und auf ein Kommando hin durchwateten sie den an dieser Stelle sehr breiten, aber seichten Fluss, lehnten die Sturmleitern an die Felswand und kletterten hinauf. Von der letzten Sprosse sprangen sie ins zerklüftete Gestein und stürmten mit drohendem Feldgeschrei die Gipfel, ohne von einem Feind aufgehalten zu werden; lediglich die erschreckten Adler stiegen mit gebreiteten Schwingen und vorgestrecktem Kopf aus ihren Horsten, flatterten wütend zum Himmel auf, kreisten über den Kriegern des Chans, ließen sich plötzlich fallen, griffen an, wichen zurück, um an anderer Stelle erneut anzugreifen. Es war schwer, den Tieren mit Pfeilen beizukommen, und es war noch schwerer für jene, die schon auf der Sturmleiter von den Adlern überrascht wurden. Schreiend stürzte manch Krieger hinab in den Fluss, und das Wasser des Onon floss still dahin, über die Toten hinweg, über die Toten ohne Augen. Und alles war nur ein Spiel des Chans, bloß die Toten waren richtig tot, und die Adler waren wirklich da, und unten floss der Fluss wie eh und je an der langen Wand aus Stein entlang.
Bat lachte. Der Zehnerführer Bat lachte oben hinter dem Gipfel und sagte: „Fliegende Chinesen! Ein prächtiges Spiel des Chans!“
„Chinesen?“, fragte Tenggeri.
Bat stieg auf einen Stein und sagte zu seinen neun Kriegern: „Zwischen dem Reich der Mongolen und dem Reiche Chin erhebt sich eine große Mauer, welche die Chinesen zu ihrem Schutze erbaut haben. Falls es mit ihnen zum Kriege kommt, müssen wir diese Mauer stürmen. Um nun aber vorbereitet zu sein, lässt uns der Chan hier an der Felswand diese Kampfesweise erproben. Na, und als Feind dienen uns die fliegenden Chinesen, also die Adler; denn eins wird dort wie hier von Bedeutung sein: Nur wer auf der Sturmleiter unverletzt die oberste Sprosse erreicht, wird den Feind auf und hinter der Mauer bekämpfen können.“ Bat sprang von dem Stein und befahl seinen Soldaten, ans jenseitige Ufer des Onon zurückzukehren. Auch die neunundneunzig übrigen Zehnergruppen kehrten zurück, und alle warteten auf das Kommando des Tausendschaftsführers. Als dieser das Zeichen gab und der Donner der Pauken erklang, durchquerten sie wieder den Fluss, stürmten wieder die Leitern hoch, kämpften wieder gegen die zornigen Adler und gewannen diesmal schon schneller die Gipfel.
„Seht ihn euch an“, rief Bat und zeigte auf Tenggeri, „er ist der Jüngste unter uns. Als letzter wurde er in unsere Reihe aufgenommen, und als erster erreichte er jetzt die oberste Sprosse. Er war also der schnellste!“
Tenggeri aber, beschämt über dieses Lob, sagte: „Die Angst verlieh mir Flügel.“
„Die Angst?“ Bat blickte drohend. „Wenn dich der Wolf angreift, triffst du dann auch nur aus Furcht, oder läufst du gar aus Furcht davon und glaubst, schneller als der Wolf zu sein?“
„Ich war Hirt, lieber Bat! Habt Ihr schon einmal von einem Hirten gehört, der vor Wölfen davonläuft? Aber auf der Sturmleiter ist das anders: Ich dachte plötzlich an einen Blinden, den ich kenne, und an die Soldaten ohne Augen, die unten im Flusse liegen, und deshalb war ich der Schnellste!“
Bat lachte wieder. „Gut, sehr gut, Tenggeri, diese Art von Angst ist nützlich, sie dient dem Chan; es gibt aber noch eine zweite Angst, nämlich jene, die dich zurückhält, überhaupt auf die Leiter zu steigen, und diese Angst ist tödlich!“
„Oh, ich bin nicht feige, Bat, ich diene dem Chan, auch wenn mich manchmal die Furcht plagt!“
Nachdem sie abermals und immer wieder ans jenseitige Ufer zurückgekehrt waren und jedes Mal von neuem auf den Sturmleitern die steinerne Wand überwunden hatten, versank die Sonne in der Steppe, und bald darauf stieg der volle Mond aus einem Busch junger Lärchen, die am Eingang einer Schlucht im Windschatten wuchsen. Auf den Gipfeln loderten hundert Feuer, um sie saßen die Zehnerführer mit ihren Soldaten, essend und trinkend, schwatzend und singend.
In Tenggeris Gruppe war Bat der Älteste. Er hatte alle Kriege mitgemacht und vermochte jede Schlacht mit einer Narbe zu belegen. Stolz zeigte er sie am Feuer, und er saß dann nackt da. Die übrigen neun Krieger bestaunten die Male der Tapferkeit, manche mitleidig, manche neidvoll; denn keiner hatte bisher an einem Kampf teilgenommen. Am Ende von Bats Erzählen stand immer der Satz: „Ja, ja, ich reite jetzt schon das neunzehnte Pferd; die vorangegangenen achtzehn sind mit den toten Kriegern des Chans zu den Göttern geritten. Nachts jagen sie über den Himmel und begleiten unsere Gedanken.“ Danach hielt er für gewöhnlich noch seine Hände hin und fragte: „Seht ihr was?“
Aber es war nichts zu sehen, und alle schüttelten die Köpfe, um zu bestätigen, dass sie nichts sahen. Und manche untersuchten die Hände ganz genau, da Bat genussvoll eine Weile schwieg, aber auch sie fanden nichts, gar nichts. Bat lachte. „Da ist nichts zu sehen! Doch die Merkiten hatten mich mal gefangen genommen. Sie steckten mir Schafsmist zwischen die Hände und banden sie fest und stellten mich in die Sonne. Aber“, und Bat streckte sich, drückte die Brust hervor, „noch bevor die Würmer mir das Fleisch von den Knochen fraßen, wurde ich von des Chans Leuten befreit. Und deshalb, Krieger, ist an meinen Händen nichts zu sehen.“
„Und Ihr hattet keine Angst, Bat?“, fragte Tenggeri.
„Nie hatte ich Angst! Nie!“, schrie Bat.
„Nie?“
„Nie!“ Bat sprang auf. „Du zweifelst an meinen Worten? Willst du sagen, ich lüge?“ Erregt riss der Zehnerführer seinen Dolch aus der Scheide. „Du wärst der erste, der das zu behaupten wagt.“
„Ich habe gefragt, ob Ihr Angst hattet, und ich habe zweimal gefragt, ob Ihr Angst hattet, Bat, aber ich habe nicht gesagt, dass Ihr lügt! Mich wundert nur, dass Ihr so unmäßig schreit, wenn es die Wahrheit ist.“
„Euer Zweifel trieb mir das Blut in den Kopf.“ Er setzte sich wieder in die Runde und sah in die Gesichter der anderen, aber in ihnen fand er nicht den Zweifel Tenggeris, höchstens Gleichgültigkeit und bei einigen Erstaunen über den Wortwechsel.
Und er lügt doch, dachte Tenggeri, seine Stimme verrät ihn. Ich werde aber schweigen; Schweigen kann in solch einem Augenblick wie eine Anklage sein. Tenggeri schürte das Feuer, warf den Dung wilder Schafe in die Glut und zerbrach die dürren Stängel des Gestrüpps, das hier oben in der Sonne ausgedörrt war. Und da die übrigen auch schwiegen, war nur das Zerbrechen der dürren Stängel zu hören oder das Lachen und Singen von den Nachbarfeuern. Einige Soldaten waren sogar eingeschlafen.
Diese vorwurfsvolle Stille zwang Bat, etwas zu sagen, und er sagte lauernd: „Du hast heut schon einmal von Angst gesprochen, und vorhin hast du wieder davon geredet. Redest du nicht etwas zu viel von Angst, anstatt die Tapferkeit zu loben?“
„Meine Angst hat noch keinem geschadet, Bat. Und dann: Meint Ihr vielleicht, der Chan hätte mir das Pferd geschenkt, weil ich ein Feigling bin?“
Die Erwähnung des Chan-Geschenks hieß Bat vorsichtig sein. Er sagte leise: „Schon gut, schon gut, Tenggeri; mit meinen hitzigen Worten ist es mir wie einem Hammel ergangen, der erschrickt, losläuft, stehenbleibt und gar nicht weiß, wovor er erschrocken ist!“ Nun legte sich auch Bat und deckte sein Gesicht mit der spitzen Mütze zu.
Über die Gipfel kroch Nachtkühle. Der Mond schwebte hoch dahin, und die Steppe erbleichte unter seinem fahlen Licht. Nur das Platschen des Flusswassers hörte Tenggeri, und er dachte, das Wasser ist so kalt wie die Toten darin. Sie waren zu langsam auf der Sturmleiter und hatten nicht mit der Schnelligkeit der Adler und der List des Chans gerechnet. Und Bat lügt. So zerdachte Tenggeri die Nacht, schlief nicht, starrte in den Himmel, lächelte über einen Gedanken, der ihm eben gekommen war.
Eine Weile darauf schrie Bat aus dem Schlaf: „Die Chinesen sind da! Die Chinesen!“
„Ihr träumt, Zehnerführer“, sagte ein anderer, während sich Tenggeri schlafend stellte.
„Ich brenne! Die Chinesen …!“
Bat tanzte und hüpfte auf den Steinen, schlug auf die kleinen Flammen, die an seinen Kleidern züngelten.
„Er brennt wirklich!“ Die Krieger sprangen auf, und auch Tenggeri rief jetzt: „Vielleicht sind es doch die Chinesen. Man sagt, sie werfen mit Feuer nach den Feinden!“
„Die Chinesen sind da!“, schrie Bat. „Weckt die andern! Die Chinesen sind da!“ Bald danach schwärmte die Tausendschaft aus, durchsuchte Mulden und Schluchten, fand überall nur Steine, Gras und Büsche, aber keine Chinesen. Lachend kehrten die Soldaten zurück, und viele spotteten über den Zehnerführer Bat, sagten: „Er hat die Angst mit in seinen Schlaf genommen. Das ist alles.“
„So, und meine Kleider, die brannten dann wohl vor Angst? Habt ihr schon einmal erlebt, dass man mit Angst etwas anzünden kann, na?“
Die anderen erklärten reihum, es könnte nur der Gipfelwind gewesen sein, der einige Funken auf die Kleidung von Bat geblasen habe.
„Aber man erzählt, die Chinesen werfen wirklich mit Feuer nach den Feinden“, sagte Tenggeri und verbarg sein Lächeln hinter einem ernsten Gesicht.
„Nun sind jedoch keine Chinesen da, also ist es der Wind gewesen. Und wer kann schon für seine Träume?“
Bat machte ein zufriedenes Gesicht, und die Krieger entfernten sich wieder,liefen zu ihren Feuern. Von Zeit zu Zeit erklang noch ihr spöttisches Lachen, und jedes Mal, wenn es erscholl, zuckte Bat zusammen und schaute verlegen zu Tenggeri.
„Lasst ihnen den Spott“, sagte Tenggeri sanft, „sie lachen nur über Eure Angst, mit der Ihr aus dem Traum hochgefahren seid.“
„Angst?“, schrie Bat erregt.
„Wollt Ihr sagen, Zehnerführer“, antwortete Tenggeri ganz leise, „dass es in der Macht des einzelnen steht, die Angst im Traum zu verjagen?“
„Natürlich nicht! Da hast du recht. Man kann da gar nichts gegen tun, gar nichts!“
„Seht Ihr!“ Tenggeri legte sich hin, und Bat tat es ihm gleich. Nur ihre Gedanken waren verschieden. Während Bat dachte, ich glaube, dieser Tenggeri hat mich eben überlistet, indem er seine Worte so lange wendete, bis sie das sagten, was er sich von Anfang an vorgenommen hatte, dachte Tenggeri, dieser Bat wird nie erfahren, dass ich es war, der mit dem Dolch die Glut aus dem Feuer riss und sie ihm auf die Kleider warf.
Am Morgen stieß ein Bote zu der heimkehrenden Tausendschaft und meldete, dass die chinesischen Gesandten bald das Hauptlager erreichen würden und der Chan befohlen habe, die Sturmleitern sofort zu verstecken, damit die Leute aus dem Reiche Chin keinen Verdacht schöpften.
Dschingis selbst hatte mit seinem Gefolge die Zeltstadt inzwischen verlassen und sich in die westliche Steppe begeben, an einen Platz mit magerem Gras und verwittertem Gestein. Das war kein Ort, hohe Gesandte zu empfangen, aber der Chan sagte lächelnd: „Ich will sie erschrecken, und erniedrigen will ich sie, noch bevor wir auch nur ein einziges Wort gewechselt haben.“
„Sollen wir nicht wenigstens eine Jurte aufstellen lassen, Vater?“, fragte Dschutschi.
„Ja, eine Jurte, eine gewöhnliche, enge, rauchgeschwärzte Jurte mit vom Wind zerfressenen Filzdecken. Halten die Chinesen uns nicht für Barbaren? Blicken sie nicht geringschätzig auf uns herab, weil wir in Zelten wohnen und Nomaden sind? Also werde ich sie nicht in meinem goldenen Palast, sondern hier auf diesem schmucklosen Platz empfangen, mitten im Dung von Schafen und Pferden.“
Die Heerführer nickten beifällig, und Dschutschi sagte: „Sollen wir dir, Vater, die rote Seidenmatte auslegen lassen oder die blaue?“
„Seide? Wie nennen sie mich im Reiche Chin insgeheim? Den Barbarenhäuptling! Thront aber ein Barbarenhäuptling auf seidenen Matten? Legt mir das gewöhnlichste Yakfell hin, damit ich mich darauf setze wie ein Hirt, wenn die Erde hart gefroren ist. Für die Chinesen haltet ärmliche Ziegenfelle bereit, denen die Haare ausgehen, damit der Kaiser in Yenping (das spätere Peking) nach ihrer Heimkehr noch sieht, worauf ich sie sitzen ließ.“
Die Gesandten aus dem Reiche Chin näherten sich vom Südosten her jenem Platz, den Dschingis-Chan zu diesem Zweck gewählt hatte; sie ritten auf Kamelen und Pferden, und auf dem weiten Weg durch Wüste und Steppe hatten sie ihren Stolz verloren. So standen sie ermattet vor dem Chan, und der Chan lächelte triumphierend, blickte in die staubigen Gesichter, in die entzündeten Augen, auf die salzweißen Lippen.
Dschingis gab seinem Sohn Dschutschi ein Zeichen, worauf dieser sich an die Gesandten wandte und sagte: „Ihr dürft sprechen!“
Der Älteste der Abordnung, ein Mann im roten Gewand, das mit goldenen Fäden bestickt war, trat vor, und er tat es so feierlich, als wolle er zeigen, dass er immerhin noch soviel Kraft besaß, auch im Unglück ein gewisses Maß an Würde zu wahren. Ruhig sagte er: „Der Norden unseres großen Reiches Chin hat einen neuen Kaiser erhalten. Dieser SOHN DES HIMMELS verlangt von Euch, der Ihr, Häuptling über verschiedene Stämme in der Steppe …“
„… Häuptling?“, brüllte Dschingis drohend.
„Ja, er hat Häuptling gesagt“, rief ein mongolischer Heerführer aus dem Gefolge.
Der chinesische Gesandte schwieg. Ihm war verboten, etwas anderes zu sagen, als ihm sein Kaiser aufgetragen hatte.
„Mein Vater ist Cha-Chan“, sagte Dschutschi, „Oberhaupt über alle in der Steppe lebenden Stämme, die er zu einem großen Volk vereint hat, dem Volk der Mongolen!“
Da der chinesische Gesandte noch immer schwieg und damit dem Zeremoniell gehorchte, sagte der Chan lauernd: „Und was verlangt Euer Häuptling von mir?“
Diese Erniedrigung hatte der Gesandte zwar gehört und ebenso gut verstanden, wie er sie nicht mehr vergessen würde, aber er tat so, als wäre sie gar nicht bis an sein Ohr gedrungen. Ruhig sagte er: „Dieser SOHN DES HIMMELS verlangt also von Euch, der Ihr – wie mir der Kaiser aufgegeben hat zu sagen – Häuptling über verschiedene Stämme in der Steppe seid, dass Ihr Euer Antlitz nach Süden wendet und ihm, dem SOHN DES HIMMELS, kniend die Huldigung leistet!“
Durch das Gefolge des Chans lief ein erregtes Flüstern.
„Kniend“, sagte jemand und lachte.
„Sohn des Himmels“, murrte einer und griff nach seinem Schwert.
Doch der Chan gebot Stille. „Setzt Euch“, sagte er zu den Chinesen, und es klang sogar freundlich. Während sich die kaiserliche Abordnung auf die kleinen minderwertigen Ziegenfelle niederließ, ohne darüber so verwundert zu sein, dass man es ihnen ansah, blieb der Chan stehen und sagte: „Wer ist denn jetzt eigentlich Kaiser im Reiche Chin?“ Diese Frage stellte der Herrscher, obgleich ihm seine Kundschafter bereits vor Tagen den Thronwechsel und Namen des neuen Kaisers mitgeteilt hatten.
„Kaiser Wai-wang“, sagte der Älteste der Gesandtschaft, „und Kaiser Wai- wang ist der frühere Fürst Yün-chi!“
„So!“ Der Chan trat einen Schritt vor, nahm die Mütze vom Kopf und schaute nach Süden.
Die chinesische Abordnung, erstaunt über die freundliche Wende, erhob sich ehrfürchtig von den kleinen Ziegenfellen und begab sich, dem Brauche entsprechend, hinter den Chan.
„Fürst Yün-chi?“, fragte Dschingis noch einmal.
„Ja“, antwortete der Älteste der Gesandten, „er ist der SOHN DES HIMMELS.“
„Wie kann solch ein Schwachsinniger nur Kaiser werden, und: Wie kann er sich gar noch SOHN DES HIMMELS nennen, wo er nicht einmal ein Mensch ist!“ Wütend spuckte Dschingis dreimal gen Süden, danach verlangte er sein Pferd, und als er den Schimmelhengst bestiegen hatte, rief er aus: „Sagt diesem Wai-wang, der vorgibt, ein SOHN DES HIMMELS zu sein, dass ich Himmel und Götter befragen werde, ob ich vor ihm oder er vor mir niederzuknien hat.“
„Für das, was hier geschehen ist, und für die Kunde, die ich dem Kaiser zu überbringen habe“, sagte der Älteste, „wird mich der Kaiser strafen und in den Kerker werfen lassen.“
Belustigt über die Klage des Alten, meinte der Chan: „Habt Ihr von einem Schwachsinnigen Besseres erwartet? Ich würde Euch für diese Kunde belohnen, weil sie die Wahrheit ist und mir als Herrscher aufgibt, daraus Schlüsse zu ziehen. Oder meint Euer SOHN DES HIMMELS“, Dschingis beugte sich tief vom Pferd herab und flüsterte, „der Himmel habe Grenzen?“
Ein zweiter Chinese, der bisher still hinter seinem Gesandten gestanden hatte, rief: „Er will den Krieg!“ Dabei stieß er den Alten beiseite, und an seiner Stelle stehend, sagte er zu ihm: „Ihr jammert und zetert vor denen, die unseren Kaiser beleidigen. Löscht die Schande aus, damit der SOHN DES HIMMELS wieder zu lächeln vermag.“ Mit einer fast unmerklichen Kopfbewegung befahl er einem Begleitwächter aus der Abordnung, den Ältesten zu töten. Blitzschnell fuhr der kurze Dolch durch das rote Gewand in das alte Herz des Gesandten.
„Ihr gefallt mir schon besser“, sagte Dschingis-Chan, peitschte den Schimmelhengst und ritt mit seinem Gefolge hinüber zum Hauptlager. Noch bevor er es erreicht hatte, fiel Regen, dichter, kalter Regen. Der Herrscher wandte sich um, beobachtete die nach Südosten ziehende Chinesenkarawane und meinte: „Seht sie euch an: Wie eine Schlange windet sie sich unterm Regen dahin. Als sie mich vorhin aufforderte niederzuknien, spuckte ich sie an und trat ihr auf den Kopf, worauf sie ihr Gift gegen jenen spie, der dort tot im Steppengrase liegt. Nun kriecht sie geschwächt in ihren Unterschlupf zurück, um sich vom SOHN DES HIMMELS mit frischem Gift stärken zu lassen.“
„Aber zuvor muss sie noch durch die heiße Wüste, mein Vater“, sagte Dschutschi.
Und ein Heerführer rief: „Ja, durch die Gobi muss sie, großer Chan. Die Hitze wird sie auszehren. Sie wird verdorren!“
„Oder“, bemerkte der oberste Schamane, „die Götter werden sie in magere Salzbüschel verwandeln.“ Er breitete die Arme aus und schaute dabei den grauen Himmel an. Das Regenwasser lief über sein braunes Gesicht, und es sah aus, als weine der Zauberpriester.
Indessen zog die Karawane weiter und weiter und verschwand bald am Horizont; zurück blieb nur der Tote im roten Gewand, der gekrümmt im Grase lag. Der glutrote Fleck wirkte wie ein Feuer inmitten der Steppe, das kein Regen zu löschen vermochte.
Entgegen allen Vermutungen und Wünschen gelangte die chinesische Abordnung doch bis Yenping und berichtete dem SOHN DES HIMMELS, was geschehen war, obgleich sie wusste, was dem Überbringer schlechter Nachrichten drohte.
„Ihr lebt?“, schrie der Kaiser und sprang auf. Erregt lief er bis zu einem seidenen Wandschirm mit blühenden Blumen und Sträuchern, und er machte eine zornige Handbewegung, als wolle er die gemalten Blumen ausreißen. Der Schirm zitterte, das sonnengelbe Gewand des Kaisers zitterte, und der gestickte Drache darauf zitterte auch, lief mit hin und lief mit her, duckte sich, wenn sich der Herrscher duckte, richtete sich drohend auf, wenn sich der Kaiser aufrichtete, sprang blitzschnell vor, wenn der SOHN DES HIMMELS einen schnellen Schritt tat. „Ihr lebt?“, rief er ein zweites Mal, blieb plötzlich stehen und drehte den Kopf zu der Abordnung, die nun in die Augen des Drachen wie des Kaisers blickte.
„Wir töteten den einen um unserer Ehre willen“, verteidigte sich der Sprecher.
Der Kaiser lachte bitter, griff nach einem wasserblauen Jadeschälchen und entnahm ihm gezuckerte Walnüsse, die er flink in den Mund warf. Kauend sagte er: „Ist die schlechte Nachricht dadurch gut geworden? Wozu taugen Botschafter, die nicht einmal einen Barbarenhäuptling mittels kluger Rede zwingen können, sich vor mir zu verneigen?“
„Er nennt sich Cha-Chan!“
„Ja, nennt er sich! Er ist ein Wolf, ein Steppenwolf, der raubt und seinem Instinkt folgt, aber deswegen noch lange kein stolzer Löwe!“ Der SOHN DES HIMMELS läutete mit einem silbernen Glöckchen. Die Palastwache trat ein. „Ins Gefängnis mit ihnen!“ Wieder langte er in das wasserblaue Jadeschälchen und speiste gezuckerte Walnüsse. Auf ein zweites Läuten erschien ein Mandarin; lautlos ging er über den weichen Teppich und näherte sich halb gebeugt dem Kaiser. „Ladet für den Abend den Großen Rat zu einem Festmahl ein!“
Als die Sonne hinter den Blütenbüschen versank und letzte Schwalben den rotschimmernden Spiegel des Sees zerkratzten, schritten die Träger der Würden, Generale und Mandarine, die duftenden Päonienterrassen hinauf. Oben stand ein wachender Jüngling vor dem Palast und sang:
„Verstummt im Geäst ist das Vogellied,
das letzte Wölkchen am Himmel verstrich.
Doch wir beide werden einander nicht müd,
wir sehen uns an - die Berge und ich.“
Der SOHN DES HIMMELS thronte vor einem Bassin mit Lotosblumen und sah interessiert zu, wie sich die zarten rosa Kelche langsam schlossen und das sanfte Abendlicht die samtenen Blätter dunkelte. Nachdem der Große Rat sich niedergelassen hatte, klatschte der Kaiser in die Hände.
Ein seidener Vorhang teilte sich. Musik erklang. Ein Mädchen sprang tanzend über das Parkett aus reinem Gold. Das Mädchen war schön wie der junge Mond, und in der Anmut ihres Leibes glich sie einer schlanken Zypresse.
„Sie tanzt, wie einst die sagenumwobene Dame Pan getanzt hat“, rief der SOHN DES HIMMELS aus. „Ist es nicht auch, als öffne sich der Lotos wieder, wenn ihre zarten Füße ihn berühren?“ Die Träger der Würden starrten auf das goldene Parkett mit den eingelegten Lotosblüten, nickten ehrfurchtsvoll, neigten die weißen Häupter, doch als der Kaiser ein zweites Mal in die Hände klatschte, hoben sie schnell wieder die Köpfe: Das Mädchen warf ihr Perlencape, das wie ein Netz ihren Leib geschmückt hatte, beiseite, lachte, sprang leichtfüßig über Gold, Lotos und edle Steine.
Endlich, nach Mahl und Tanz, forderte der SOHN DES HIMMELS die Männer des Großen Rates auf, ihm vorzuschlagen, wie er den mongolischen Barbarenhäuptling, der ihn, statt zu huldigen, geschmäht hatte, strafen solle.
Zuerst meldete sich der General der Großen Mauer. Er forderte Krieg und Rache.
Der zweite General hingegen meinte, man solle abwarten und beobachten, was die Barbaren weiterhin tun würden. Ferner verlangte er den Bau einer neuen Festung beim nächstliegenden Tor der Großen Mauer.
Einen dritten Vorschlag unterbreitete der höchste Mandarin. Er sagte: „Laden wir den Barbarenhäuptling, der sich Dschingis-Chan nennt und über alle in Filzzelten lebenden Stämme herrschen will, an unseren Hof ein, damit er auf die Knie falle und unseren Kaiser um Gnade bitte!“
Der SOHN DES HIMMELS saß gleichmütigen Gesichtes vor seinem Bassin mit Lotos und hörte zu oder hörte auch nicht zu, wenn ihm ein Rat missfiel. Als die Männer gar zu streiten begannen und manche Rede mehr laut als klug war, wandte sich der Kaiser ab, trat an eins der hohen Fenster, deren Reispapier vom Geschrei erzitterte. Der Herrscher schaute nach einem Diener. Der Diener eilte herbei, öffnete das Fenster. Am Fuße der Päonienterrassen lag schweigend der See. Süßer Blütenduft wehte herein. Vor dem Portal stand der Wächter, starr wie eine Säule aus Stein. Hinter den fernen Bergen rollte ein Sommergewitter über den Himmel. Plötzlich trat der Kaiser vom Fenster weg, schritt zum Bassin zurück und sagte, als wolle er diesem Geschwätz ein Ende bereiten: „Der Gelehrte Jung Lu soll sprechen, damit wir die Weisheit vernehmen!“
Der alte Jung Lu erhob sich, blickte zum Thron und danach zu dem offenen Fenster. „Meine Worte“, begann er, „die ich Euch verkünden werde, sind so alt wie die Wurzeln der Päonien dort in den Terrassen. Die Blumen blühen noch immer, warum sollten es die Worte nicht mehr? So hört, was man uns aus der Han-Zeit überliefert:
Wenn der Kaiser sich der Treue anderer Länder versichern will, muss er ihre Herrscher davon überzeugen, dass er die drei Haupttugenden eines Fürsten besitzt und über die fünf Lockmittel verfügt.
Die drei Haupttugenden eines Fürsten sind: Zuneigung heucheln, honigsüße Gefühle ausdrücken und Untergebene wie Gleichgestellte behandeln.
Die fünf Lockmittel sind: Geschenke von Sänften und reicher Gewandung, um das Auge zu verführen, üppige Speisen und Feste, um den Gaumen zu verführen, musizierende Mädchen, um das Ohr zu verführen, prächtige Häuser und schöne Frauen, um zum Luxus zu verführen, und die Anwesenheit des Kaisers am Tisch des fremden Herrschers, um dessen Stolz zu verführen.“
Vom Thron des Kaisers erscholl lautes Lachen. „Jung Lu, Ihr werdet alt. Wir sprechen von einem Barbarenhäuptling und von keinem edlen Herrscher eines fremden Landes. Hat aber ein Barbar, der mit seinem Zelt von Weideplatz zu Weideplatz zieht, einen Tisch, an den ich mich setzen könnte? Wollt Ihr, dass ich mich auf Ziegenfellen niederlasse? Wollt Ihr, dass ich mit einem spreche, der mit den Wölfen aufgewachsen ist und ihre Tugenden zu den seinen macht, während ich von Gelehrten erzogen wurde und mir ihre Moral und Weisheit aneignete? Oh, Jung Lu, Ihr werdet alt! Pflückt Blumen, aber lasst die Worte in Eurem Halse. Die Irrtümer der klugen Leute sind die schlimmsten!“
Traurig ließ sich der alte Gelehrte Jung Lu wieder auf seinem Sitz nieder, in den Ohren das Spottgelächter der Generale, die dem Kaiser zum Krieg gegen Dschingis-Chan rieten.
„Hört und gehorcht!“, rief der SOHN DES HIMMELS, und sofort erlosch jeder Laut in der Runde des Großen Rates. Alle standen auf und erwarteten die Entscheidung ihres Herrschers. „Mein General der Großen Mauer rät mir zum Krieg gegen den Barbaren, damit wir ihn strafen und uns für seine Beleidigung rächen. Ich befehle also den Krieg gegen den mongolischen Barbarenhäuptling, der wie ein Wolf lebt, raubt, umherzieht, der wie ein Wolf rohes Fleisch isst und nur seiner Unwissenheit folgt. Dieser Barbar weiß nicht, was rein und was unrein ist, also ist er niedriger Natur.“ Der Kaiser klatschte abermals in die Hände, und abermals erschien das Mädchen, aber es war nicht gekommen, um zu tanzen, sondern um dem Herrscher das zu antworten, was er befohlen hatte. „Sag mir, Schönheit“, fragte der SOHN DES HIMMELS, „soll ich gegen den Barbarenhäuptling Krieg führen und ihn strafen, oder soll ich mit ihm reden wie mit einem, der aus fürstlichem Geschlecht stammt?“
„Krieg! Krieg! Krieg!“, flüsterte das Mädchen hinter seinem himmelblauen Fächer.
„Du hörst, Jung Lu: Krieg! Merke dir, Gelehrter: Nur wenn der Baum fällt, schwindet auch der Schatten!“ Der Kaiser winkte das Mädchen zu sich und bot ihm einen Platz auf dem Rande des Bassins. Der Lotos hatte sich inzwischen geschlossen. Die Mitglieder des Großen Rates verließen den Palast.
Die Männer stiegen wieder die Terrassen hinab, schritten durch die duftenden Päonien. Der Mond schien. Der warme Wind spielte mit zarten Zweigen und bunten Lampions. Ihre Schritte knirschten auf dem Ufersand am schweigenden See. Keiner sprach, niemand sang, alle schauten geradeaus; denn es wäre keinem eingefallen, die Ordnung zu verletzen und sich auch nur einmal umzuwenden. So gingen sie, die Träger der Würden, Generale und Mandarine, in einer langen Reihe, einer hinter dem andern, und stumm; das nächtliche Dunkel ließ sie alle gleich aussehen: zweiundfünfzig Köpfe, darauf zweiundfünfzig Flachhüte mit stumpfer Spitze, zweiundfünfzig fast reglos herabhängende Zöpfe, zweiundfünfzig nachtdunkle Gewänder und hundertvier lautlose Ziegenlederschuhe mit Korksohlen.
Trotzdem: Als die Sonne wieder über die Bergrücken schaute und die lieblichen Terrassen wie eh und je verschönte, sah sie inmitten der blühenden Päonien auch einen Toten: den alten Gelehrten Jung Lu. Ihr Licht blitzte aber auch auf einigen daneben liegenden Perlen, die aus einem Cape stammten, das zu dieser Stunde im SCHOSS DER ERFÜLLTEN WÜNSCHE, dem kaiserlichen Schlafgemach, lag. Obgleich die Perlen vermisst wurden, betrauerte die Tänzerin sie nicht als Verlust. Der SOHN DES HIMMELS, der gern die sagenumwobene Dame Pan zitierte, sprach:
„Daheim wie draußen bist du mir Gefährte,
kaum regst du dich, schaffst du ersehnte Kühle.
Und doch - ich ahn’s, wenn einst des Herbstes Schauer
verdorrten Sommers Glut allmählich löschen,
dann liegst du ungenützt in dumpfem Fache –
ein Stück Vergangenheit vergangner Tage.“
Dabei überreichte er ihr einen Ballen roter Seide sowie ein neues Cape, doppelt so kostbar wie das alte. Zudem war es mit den winzigen Brustfedern des Eisvogels und den durchsichtigen Flügeln bunter Schmetterlinge verziert. „Erlaubt mir eine Frage“, sagte das Mädchen.
„Oh, sehr gern, Schöne! Vor dem Rat war ich es, der Euch fragte, und da Ihr so brav geantwortet habt, dürft Ihr jetzt, wo der Rat gegangen ist, mich fragen!“
„Wen meintet Ihr vorhin in dem Gedicht?“
„Wen? Ihr fragt, wen?“ Der Kaiser lachte, schüttelte sich vor Lachen.
„Mich vielleicht?“, flüsterte das Mädchen und war plötzlich ganz traurig, und damit es der Herrscher nicht sähe, hielt es sich wieder den himmelblauen Fächer vor das Gesicht.
„Wie kommt Ihr darauf? Hört noch einmal: ‚Daheim wie draußen bist du mir Gefährte‘ …“
„Ja.“
„‘Kaum regst du dich, schaffst du ersehnte Kühle!‘ – Schafft Ihr Kühle, Schönheit? Und weiter: ,Und doch – ich ahn’s, wenn einst des Herbstes Schauer verdorrten Sommers Glut allmählich löschen‘ …“
„Ja, das!“
„… ‚dann liegst du ungenützt in dumpfem Fache!‘ – Wollt Ihr, Schönheit, ungenutzt in dumpfem Fache liegen?“ Wieder erscholl sein Gelächter.
„Ihr verspottet mich!“
„Aber nein, überlegt doch, was ich meinen könnte.“ Sie ist schön wie dumm, dachte er, und er frohlockte darüber, dass sie so dumm war.
„Ich weiß es nicht, was Ihr meint!“, sagte sie und trat verschämt einen Schritt zurück.
„Es genügt, dass Ihr schön seid.“ Der Kaiser öffnete das Morgenfenster, blickte auf die Päonien und flüsterte geheimnisvoll: „Die Klugen müssen manchmal schnell sterben, nicht, meine Schönheit?“
Des Mädchens Kopf verschwand nun völlig hinter dem Fächer.
„Geh jetzt“, befahl er schroff. „Übrigens, mit dem Gedicht ist die Seide gemeint.“
*** Ende der Demo-Version, siehe auch http://www.edition-digital.de/David/Tengerri/ ***
Kurt David
Am 13. Juli 1924 in Reichenau in Sachsen geboren. Kurt David absolvierte nach dem Besuch der Handelsschule eine kaufmännische Ausbildung. Von 1942 bis 1945 nahm er als Soldat der Wehrmacht am Zweiten Weltkrieg teil. Von 1945 bis 1946 war er in sowjetischer Kriegsgefangenschaft. Den Plan einer Ausbildung zum Musiker musste er wegen einer Kriegsverwundung aufgeben. David gehörte vier Jahre der Volkspolizei der DDR an und war anschließend zwei Jahre lang Kreissekretär beim Kulturbund der DDR. Seit 1954 lebte er als freier Schriftsteller zuerst in Oberseifersdorf/Zittau, danach bis zu seinem Tod in Oybin. In den 1960er Jahren unternahm er mehrfach Reisen in die Mongolei und durch Polen. 1970 erhielt er den Alex-Wedding-Preis, 1973 den Nationalpreis, 1980 den Vaterländischen Verdienstorden und 1984 den Lion-Feuchtwanger-Preis. Er starb am 2. Februar 1994 in Görlitz.
Davids frühe Werke haben die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit unter dem Nationalsozialismus und im Zweiten Weltkrieg zum Thema. Es folgten Bände mit Reiseberichten. Den größten Teil in Davids Werk bilden die Kinder- und Jugendbücher, von denen vor allem der humoristische Band „Freitags wird gebadet“ in der DDR ein großer Publikumserfolg, auch in der Fassung als Fernsehserie, war. Eine weitere Facette in Davids Schaffen bilden historische Romane, die Themen aus der Geschichte der Mongolen behandeln. Außerdem schrieb David Biografien über die Komponisten Beethoven und Schubert.
Werke
Die Verführten, Halle (Saale) 1956
Gegenstoß ins Nichts, Berlin 1957
Befehl ausgeführt, Berlin 1958
Michael und sein schwarzer Engel, Berlin 1958
Briefe an den lieben Gott, Berlin 1959
Der erste Schuß, Berlin 1959
Zwei Uhr am roten Turm, Berlin 1959
Der goldene Rachen, Berlin 1960
Der Granitschädel, Halle (Saale) 1960
Sechs Stare saßen auf der Mauer, Berlin 1961
Im Land der Bogenschützen, Berlin 1962
Der singende Pfeil, Berlin 1962
Polnische Etüden, Berlin 1963
Beenschäfer, Berlin 1964
Freitags wird gebadet, Berlin 1964
Das Haus im Park, Berlin 1964
Der Spielmann vom Himmelpfortgrund, Berlin 1964
Die goldene Maske, Berlin 1966
Der Schwarze Wolf, Berlin 1966
Tenggeri, Berlin 1968
Bärenjagd im Chentei, Berlin 1970
Begegnung mit der Unsterblichkeit, Berlin 1970
Die Überlebende, Berlin 1972
Antennenaugust, Berlin 1975
Der Bär mit dem Vogel auf dem Kopf, Berlin 1977 (zusammen mit Gerhard Gossmann)
Was sich die schönste aller Wolken wünschte, Berlin 1977 (zusammen mit Karl-Heinz Appelmann)
Der Löwe mit der besonders schönen langen Mähne, Berlin 1978 (zusammen mit Horst Bartsch)
Der Khan mit den Eselsohren, Berlin 1981 (zusammen mit Waltraut Fischer)
Goldwurm und Amurtiger, Berlin 1982 (zusammen mit Gerhard Gossmann)
Rosamunde, aber nicht von Schubert, Berlin 1982
Das weiße Pony, Berlin 1989
Verfilmungen
Aus dem Tagebuch eines Minderjährigen, siebenteilige Fernsehserie des DFF nach Freitags wird gebadet, 1965, Regie: Klaus Gendries
Die Überlebende (Film), DFF 1975, Regie: Christian Steinke
Quelle: Wikipedia
E-Books von Kurt David
Antennenaugust
„Ich hab was für dich!
Du wirst staunen, Junge!“, sagte Herr Buchholz. Er faltete behutsam das graublaue Tuch auseinander. Da hockte ein Tier, das noch gar nicht wie ein Tier aussah, eher einer Kugel braunweißgesprenkelter, flauschiger Wolle ähnelte. - In diesem Moment ahnte noch keiner, welche Probleme der kleine Bussard einmal in das Dorf bringen würde; vorerst brauchte er Schutz und Hilfe.
Bärenjagd im Chentei
Ein Deutscher fliegt mit der AN-2, auch „Posthummel“ genannt, von Ulan Bator in den Nordosten der Mongolei. Es ist ein abenteuerlicher Flug, für die 600 Kilometer brauchen sie fast einen ganzen Tag. Im Sturzflug nähern sie sich kleinen Dörfern und Siedlungen, um die Post abzuwerfen und dann im Steilflug wieder an Höhe zu gewinnen. Aber das ist nichts gegen das Sturmgebiet, durch das sie fliegen. Endlich in Dadala gelandet, freut sich der Deutsche schon auf den nächsten Tag, an dem es auf Bärenjagd gehen soll. Als sie endlich einen Bären sehen, erinnert er sie an einen tollpatschigen Teddybären, nicht ahnend, welche Gefahren auf ihn warten.
Beenschäfer
Peter ärgert sich wieder einmal über die großen Jungs auf dem Rodelberg. Peterchen oder Peterlein wird er genannt. Dabei ist er ganz mutig und rodelt sogar den Steinbruch hinunter. Aber das erkennen die Jungen nicht an, es sei denn, er ruft ganz laut „Humpelheinrich“ zu Herrn Schäfer mit dem steifen Bein.
Die Erwachsenen nennen ihn Beenschäfer, aber nur, um ihn von den anderen Schäfers im Dorf zu unterscheiden. Beenschäfer ist ein freundlicher alter Mann, der ehrenamtlich Bäume pflanzt und pflegt. Er wohnt direkt neben Peter und ihn soll er so ärgern!
Schließlich ruft er das Schimpfwort zweimal und kann sich gar nicht freuen. Nun versucht er, dem Alten aus dem Weg zu gehen, aber einmal gelingt es ihm nicht.
Befehl ausgeführt