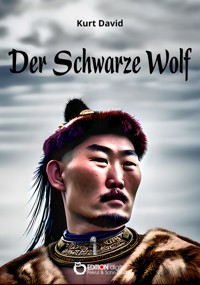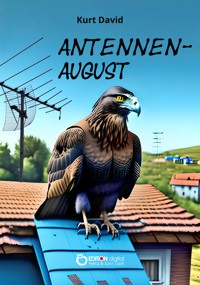6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Und lass dir gesagt sein“ - die Mutter steht ganz nah bei Michael - „und lass dir gesagt sein: Herr Lange hat auch kein Interesse an dieser Verbindung. Seine Tochter soll einen Schlosser heiraten.“ Michael weiß nicht, was er der Mutter antworten soll. So vieles trennt sie. Sie will ihm verbieten, Hannchen zu lieben, weil Hannchen ungläubig ist, und sie will eine gute Katholikin als Schwiegertochter, so wie Hannchens Vater einen Schlosser für seine Autowerkstatt will. Michael spürt, dass er ohne Hannchen sehr einsam wäre. Sein Vater ist auf dem Feld geblieben. Lena Blaschke hat den letzten Brief ihres Mannes vernichtet. Der Sohn ahnt es, die Mutter schweigt. Michaels Glaube ist erschüttert. Das Leben fordert mehr als fromme Sprüche und Bibelverse. Doch die Liebe zu Hannchen gibt ihm die Kraft, die schweren Nachkriegsjahre durchzustehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impressum
Kurt David
Michael und sein schwarzer Engel
ISBN 978-3-96521-938-0 (E-Book)
Das Buch erschien erstmals 1958 im Verlag Neues Leben Berlin.
© 2023 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Liebe ist wie Frühlingsregen
An gebirgigem Ort,
Tut ein Schrittlein,
Reißt ein Gräblein –
Und eilt weiter fort.
JULIUS FUCIK
I. KAPITEL
Der Krieg ist aus – Ein Brief müsste kommen. Der Einbeinige
Lena lag wach im Bett. Kirschblütenduft wehte zu den Fenstern herein. Auf dem Dach des gegenüberliegenden Hauses saß ein Star und pfiff. Für Sekunden war es ihr, als sei alles noch so wie früher, und doch …
Das Haus, in dem Blaschkes wohnten, stand dicht an der Hauptstraße, die mitten durch Steinbach führte. An diesem Maiabend hörte Lena draußen das Trampsen und Trapsen von Stiefeln.
Russischer Stiefel.
Der Krieg war aus.
Von ihrem Mann hatte Lena seit März nichts mehr gehört. Sie weinte nicht, sie suchte Trost im Gebet. Auch an diesem Abend griff sie hinüber auf den Nachttisch, um sich den Rosenkranz zu nehmen. Er lag auf Erichs Tischchen, ihre Hand glitt über das Bett des Mannes. Sie spürte die Kühle des Oberbettes, ließ ihre Hand darauf ruhen, streichelte es und flüsterte: „Erich –.“ Ein wenig erhob sie sich und blickte auf die leeren Kissen, und plötzlich warf sie sich mit dem Kopf in Erichs Bett und seufzte leise vor sich hin. Ihre Gedanken waren wie Feuer, brannten, schmerzten. Und sie träumte sich Bilder zurecht, Bilder, die in der Vergangenheit ihr Glück gewesen waren. Und sie hielt einen Menschen umschlungen, den sie nur mit geschlossenen Augen sehen konnte.
Michael erwachte. Angsterfüllt blickte er zu seiner Mutter. Er sah, wie ihr Leib zitterte, wie er von Stößen tiefer Erregung geschüttelt wurde. Und er sah auch den Rosenkranz, der unberührt auf dem Nachttisch lag.
Später war die Mutter eingeschlafen. Sie lag zur Hälfte auf Vaters Bett, die Schultern entblößt.
Lena hatte sich unter Tränen in den Schlaf geträumt.
Vorsichtig kletterte der Junge aus seinem Bett, schlich zur Mutter und deckte behutsam ein Kissen über ihre Schultern.
Am Morgen ging alles sehr schnell. „Komm, komm, Michael“, sagte Lena. „Komm, ich will noch zur Beichte!“ Und wie jeden Tag gingen sie zur Frühmesse. Michael sah die Mutter im Beichtstuhl knien. Es dauerte an diesem Morgen sehr lange. Ob das mit ihrem Weinen von gestern Abend zusammenhing?
„Aber wie konnten Sie denn auf solch sündige Gedanken kommen, liebe Frau?“, fragte Pfarrer Toberlog durch das Strohsieb des Beichtstuhles.
Und Lena erzählte, wie sie nach dem Rosenkranz habe langen wollen und wie sie dabei mit dem Bett ihres Mannes in Berührung gekommen sei.
Toberlog schwieg.
Lena schämte sich. Verstand der Pfarrer nicht? Musste sie ihm erst all ihre Gedanken und Wünsche vom Vorabend durch das Strohsieb zuflüstern?
„Wir hatten uns so lieb … Herr Pfarrer!“
„Und doch, und doch!“, flüsterte der Geistliche. „Mit solchen Gedanken beleidigen Sie unseren Heiland zutiefst, liebe Frau, den Heiland, den Sie täglich bitten, dass er Ihren Mann gesund nach Hause schickt.“
Lena schluchzte.
„Beten Sie zur Buße drei Lauretanische Litaneien zur Jungfrau Maria!“, sagte der Pfarrer.
Und noch, bevor die Frühmesse begann, kniete Lena ganz allein vor der Muttergottesstatue, tat Buße.
Heilige Jungfrau aller Jungfrauen – erbarme dich unser!
Du keusche Mutter – erbarme dich unser!
Du unbefleckte Mutter – erbarme dich unser!
Auf die kalkweiße Wand hinter der Statue waren mit Bleistift Sätze gekritzelt: „Heilige Maria, schick unseren Jungen gesund nach Hause!“ – „Liebe Maria, bitte für meinen Oskar im Felde!“ An die hundert Inschriften standen hier, hundert Bitten, hundert Namen. Der Name Erich Blaschke war nicht darunter. Die Heilige Jungfrau wisse auch so, dass sie für den Vater beteten, hatte Lena zu Michael gesagt.
Auf dem Nachhauseweg schien die Mutter fast heiter.
„Vielleicht kommt heut Vati – oder vielleicht kommt ein Brief von ihm!“, sagte sie zu Michael. „Ich habe so ein Gefühl, als ob heut ein Brief kommen müsste!“
Michael lächelte.
„Ich werd’ gleich etwas backen, wenn wir nach Hause kommen!“
„Aus Kleie?“, fragte Michael.
„Ja, Kleieplätzchen!“
Der Sonnenschein brach sich auf dem Steinbacher Dorfteich. Ein russischer Soldat saß am Ufer und hielt eine Angel in der Hand.
„Tag, Matka!“, grüßte er herüber und lachte.
Auch Lena sagte „Tag“, aber sie war etwas ängstlich.
Vor ihnen humpelte ein Mann, dem das rechte Bein fehlte. Er stützte sich schwer auf seine Krücken. Das Hosenbein war hochgeschlagen und mit einer Sicherheitsnadel befestigt.
So kommen sie nun nach Hause, dachte Lena.
Sie überholten den Einbeinigen, der – wie es schien – fremd in Steinbach war. Kurz vor der Haustür wandte sich Lena nochmals nach dem Mann in dem abgeschabten feldgrauen Rock um.
Dann ging sie schnell durch den Hausflur, die Treppe hinauf und legte den Rosenkranz auf ihren Nachttisch.
Als sie wieder herunterkam, stand der Einbeinige im Flur.
„Morgen!“, sagte er. „Frau Blaschke?“
„Ja!“ Lena starrte auf den Mann.
„Ich …“ Der Mann nahm die Mütze ab und schob sie unter die Achselhöhle, dorthin, wo die Krücke hineingedrückt wurde. „Ich bringe einen Brief von Erich!“, sagte er.
Auf Lenas Gesicht war ein mattes Lächeln, ein Lächeln, das aussah, als traue sich die Freude noch nicht ganz hervor. Sie öffnete die Zimmertür. „Kommen Sie doch herein, Herr …“
„Lachmann!“
„Kommen Sie doch herein, bitte!“, wiederholte Lena.
Der Einbeinige humpelte durch die Tür. Michael starrte auf das hochgeschlagene Hosenbein. Der Mann setzte sich.
Lena fror, zitterte, zweifelte. „Wo steckt Erich? Was ist mit ihm? Warum kommt er nicht mit Ihnen?“, fragte sie erregt.
Der Einbeinige sagte tonlos: „Schicken Sie doch den Jungen mal raus.“
Michael schlich zur Tür und ging.
Er hörte – schon draußen – die Mutter schreien: „Warum? Waruuum? Sie! Sprechen Sie doch! Warum denn …!“
Der Mann blieb ruhig. Schrei nur, Frau, dachte er, schrei dir den Schmerz aus dem Hals. Als ich nach Hause kam, da war nichts mehr da. Ich habe mich auf einen Ziegelhaufen gesetzt, die Augen geschlossen und gegen das Schreien gekämpft. Ich hab’s nicht rausgelassen …
Michael stand auf den Haustürstufen und wischte sich Tränen aus den Augen. Langsam ging er in den Garten. Eine Katze sprang über den gelben Weg. Michael rannte ihr nicht nach wie sonst. Er hörte die Bienen in den Blüten des Kirschbaumes summen, aber er beachtete sie nicht.
Jetzt nicht …
Er schlich um das Haus zum Wohnzimmerfenster, das halb offenstand. Es war ganz still drinnen. Da wagte Michael einen Blick durch das Fenster.
Die Mutter lag mit dem Kopf auf dem Tisch und schluchzte. Der Einbeinige saß daneben und rauchte eine Zigarette. Und Michael sah, wie er sich das Wohnzimmer beguckte. Jetzt blickte er zu der großen Standuhr. Michael musste schnell den Kopf zurückziehen, damit ihn der Mann nicht sah.
Der Junge lehnte an der Hauswand, sah ziellos umher. Sein Blick blieb am Sandkasten haften. – Verschwommen sieht er den Vater im Sand knien, er hat vier frischgehobelte Bretter vor sich liegen und nagelt sie zu einem Geviert zusammen. Neue Bretter. Sie riechen noch. Und der Vater sagt: „Na, die werden dich nun wohl aushalten!“
Das war vor drei Jahren gewesen. Jetzt war Michael schon seit sechs Wochen aus der Schule, da spielt man nicht mehr im Sand.
Der Junge wagte abermals einen Blick in den Raum. Er sah die Möbel. Die hatte auch der Vater gebaut. Und Lachmann beguckte sie sich genau. Auf dem Tisch lag ein weißes Blatt und daneben der aufgerissene Umschlag. Und der Umschlag war schmutziggrau. Das war also der Brief von Vater, und wenn …
„Nein, nein, nein!“, wimmerte plötzlich die Mutter. Der Einbeinige rauchte. Er zog gierig an der Zigarette.
„Das ist nicht wahr …“, schluchzte die Mutter. „Nein, das kann nicht wahr sein!“ Ihr Kopf plumpste auf die blau-weiß-karierte Tischdecke.
„Ein anderer hätt’s gemacht! Und andere haben es ja auch gemacht. Erich hat es eben nicht gemacht! Der war zu anständig!“, sagte Lachmann; er wusste nicht genau, ob die Frau zuhörte.
Michael stutzte. Was meinte der Einbeinige?
Lachmann dachte: Wenn er’s gemacht hätte, säße er vielleicht jetzt hier. Vielleicht hätte er auch nur ein Bein. Aber die Frau wäre jetzt glücklich.
Der Einbeinige hatte den Kopf auf die eine Krücke gelegt und sah mit halbgeschlossenen Augen in den Raum. Die andere Krücke lehnte an der Wand, genau unter dem Herz-Jesu-Bild mit dem Goldrahmen.
Was habe ich gebetet für Vater, dachte Michael. Was hat Mutter gebetet. Und nun steht die Krücke unter dem Herz-Jesu-Bild. Und der Krückenmann sagt, Vater sei tot.
Ob Mutter weiterbeten wird? Ich bete nur noch, wenn Mutter betet …
Drinnen wurde ein Stuhl gerückt. Michael trat einige Schritte zurück.
Die Mutter rief ihn.
Als er in die Stube kam, war der Brief vom Tisch verschwunden. Lena drückte den Jungen an sich. „Michael – Junge, der Vati …“, schluchzte sie.
Nun musste Michael wieder weinen. Er wollte nicht weinen, weil der fremde Mann hier war. Aber er konnte die Tränen nicht zurückhalten. Der Fremde hustete und drehte sich schon wieder eine Zigarette.
Lena hielt den Jungen immer noch fest. Michael sah den Brief in ihrer Schürzentasche. Es war Vaters Schrift.
Was ist mit dem Brief? dachte Michael. Warum liest ihn mir Mutter nicht vor wie sonst? Aber fragen kann ich jetzt nicht, wo der Fremde hier ist.
Die Mutter hatte ihn mit dem einen Arm losgelassen und stieß die Hand in die Schürzentasche. Michael sah, wie sie den Brief zusammendrückte und wie die blauen Adern auf ihrem Handrücken hervortraten.
II. KAPITEL
Lachmann bleibt eine Nacht da. Was steht in dem Brief?
Das Sonnenlicht flutete durch die Schlafzimmerfenster. Von der Steinbacher Kirchturmuhr schlug es zehn.
Lena und Michael knieten vor dem elfenbeinernen Kruzifix. Die Sonne schien ihnen in die Nacken.
Lena betete.
Der Junge konnte keine Andacht finden. Er hörte den Einbeinigen unten im Wohnzimmer über die Dielen stampfen. Er wird wieder rauchen, dachte er. „Jetzt müssen wir noch viel mehr für Vati beten“, hatte die Mutter vorhin gesagt. Ganz leise hatte sie es gesagt. Und Michael hatte sie fragen wollen: Jetzt, wo Vati tot ist? Warum? Aber er hatte dann doch nichts gesagt.
Plötzlich stand Michael auf.
„Ich kann nicht beten“, flüsterte er.
Lena zuckte zusammen, als hätte sie jemand geschlagen.
„Was sagst du?“
Michael blickte in ihr verweintes Gesicht.
„Ich kann nicht beten“, wiederholte er.
Die Mutter schluckte. Das ist die erste Strafe Gottes, dachte sie. Der Junge zweifelt …
„Ich muss immer an Vati denken“, sagte Michael. Und plötzlich warf er sich auf das Bett und weinte. Lena setzte sich zu ihm und strich ihm über die nackten Arme. „Man muss sich in die Andacht hineinbeten, Michael. Uns bleibt doch nur noch das Beten!“ Für Sekunden sah sie auf Erichs Bett. Auf das leere Bett, das jetzt immer leer bleiben wird. Und sie dachte an die vergangene Nacht.
„Komm, Michael!“, bettelte sie. „Komm! Wir beten für Vati.“
Michael wusste, es hat ja keinen Zweck mehr. Aber er sah den Schmerz der Mutter, und er stand auf. Und Michael betete, weil er der Mutter nicht noch mehr Schmerz zufügen wollte. Er betete ohne Andacht.
Es schlug zwölf, die Glocken läuteten zu Mittag. Als Lena mit dem Jungen in das Wohnzimmer trat, lächelte der Einbeinige.
Auf dem Tisch standen drei Teller, und der Mann rührte mit der Kelle im Suppentopf.
„Aber …“, sagte Lena. Sonst nichts. Und der Mann rührte, und er freute sich, dass Lena nicht mehr weinte.
Sie saßen am Tisch. Aber nur dem Einbeinigen schmeckte es, Lena fasste nicht einmal den Löffel an.
„Sie müssen aber auch essen, Frau Blaschke!“, sagte Lachmann und nahm sich noch zwei Kellen voll aus dem Topf.
Lena antwortete nicht.
„Ich bin froh“, fuhr der Einbeinige fort, „dass ich wieder mal an einem Tisch sitzen kann! Ich ziehe nämlich seit vier Tagen von einem Dorf zum andern. Ich such’ meine Schwester. Die muss hier irgendwo untergekommen sein. Vielleicht kann ich bei ihr bleiben!“
„Haben Sie keine Frau?“, fragte Michael.
„Meine Frau hat sich über den Tod unseres Jungen ins Grab gegrämt!“
Michael nickte und bereute, dass er gefragt hatte.
Am Nachmittag stand Lachmann vor dem Spiegel in der Küche und rasierte sich. Lena hatte ihm Vaters Rasierzeug gegeben.
Michael wollte für den Mann ein frisches Handtuch aus der Kommode holen. Aber der Schlüssel war abgezogen. Sonst hatte er immer gesteckt.
Da es bis ins nächste Dorf zwei Stunden waren, blieb Lachmann noch über Nacht. Lena hatte ihm das vorgeschlagen. Sie machte ihm in der Wohnstube ein Lager.
Abends kniete Lena im Schlafzimmer und betete. Michael durfte im Bett liegen. Er dachte an den Brief und an die abgeschlossene Kommode, und er wünschte, dass die Mutter einmal vergäße, den Schlüssel abzuziehen.
III. KAPITEL
Michael verfolgt Lachmann. Buchstaben im Staub
Am anderen Morgen – Lena und Michael kamen eben aus der Frühmesse – verabschiedete sich Lachmann. Er stand im Flur und hatte seinen Brotbeutel umgehängt. Es war warm. Die Bienen summten unter den Fenstern.
„Vielleicht finde ich die Schwester!“, sagte Lachmann. Lena hatte ihm noch ein Paket Schnitten zugesteckt, und der Mann war ihr dankbar dafür.
„Ich wünsche Ihnen alles Gute!“, sagte Lena beim Abschied.
Lachmann wäre gern hiergeblieben, bei Lena. Aber das ging ja nicht. Was sollte sie von ihm denken?
Er humpelte mit seinen Krücken über das Pflaster. An der Tankstelle drehte er sich noch einmal um. Die Frau stand an der Tür. Sie nickte ihm zu. Und dieses Nicken trug er mit sich wie eine Hand voll Wärme. –
Michael rannte auf einem Seitenweg hinaus aufs Feld. Er lief am Bach entlang – eins, zwei, drei, vier Weiden hatte er schon hinter sich gelassen. Jetzt kam die große Eberesche, die Steinbrücke. Er kroch drunter durch, die Böschung hinauf.
Schon stand er auf dem Feldweg.
Richtig! Der Krückenmann kam gerade aus dem Dorf gehumpelt. Er muss hier vorbei, überlegte Michael. Ich werde aus dem Gras springen, vor ihn hintreten, und ich werde ihn fragen: Was hat in dem Brief gestanden, Herr Lachmann? Bitte, sagen Sie es mir! Ja, so werde ich ihn fragen. So!
Michael kniete im Gras, über ihm war der blaue, wolkenlose Himmel. Er war so blau wie das Gewand der Muttergottesstatue in der Dorfkirche. Und aus diesem Blau fiel das Gold der Sonne. Es lag auf der Wiese, und ein sanfter Wind wehte über Gräser und Blumen.
Er blickte zu dem Einbeinigen. Der war noch weit weg. Manchmal blieb er stehen und blickte sich um. Sicher ruhte er sich aus.
Der Junge lief weiter in die Wiese hinein und legte sich auf den Bauch. Er blickte hinüber nach Steinbach. Vor seinen Augen zitterten die Gräser. Er beobachtete einen kleinen schwarzen Käfer, der an einer Butterblume hochkletterte. Als er oben war, schüttelte Michael den Stängel, und der Käfer fiel lautlos ins Gras. –
Bums – bums – bums! tönte es vom Weg herüber. Zwischendurch war Schlurfen zu hören. Der Krückenmann kam! Michael spürte, wie sein Herz klopfte.
Ob ich aufspringe und hinüberlaufe? Er zauderte. Da war der Mann bereits vorbei. Was würde er sagen, wenn ich plötzlich aufspränge, dachte der Junge. Aber ich kann den fremden Mann doch nicht fragen.
Plötzlich verhielt der Einbeinige, sah sich um und setzte sich an den Wegrand. Michael konnte ihm genau ins Gesicht sehen.
Natürlich! Er dreht sich schon wieder eine Zigarette. Und wie er den Qualm frisst! Der Mann ließ sich hintenüberfallen und lag im Gras und starrte in den Himmel, und die Hand mit der Zigarette hielt er auf der Brust. Die Krücken lagen neben ihm im Gras. Und um die Krücken standen Blumen.
Gestern, als die Mutter weinte, hat er auch ganz teilnahmslos dabeigesessen und geraucht, dachte Michael, und die Mutter hat geweint über die Nachricht.
Lachmann hatte die Zigarettenkippe fortgeworfen und malte mit der Krücke gedankenverloren im Staub.
Plötzlich stand er auf, guckte nach der Sonne und humpelte weiter. Michael verfolgte ihn mit den Augen. Er kroch an den Wegrand. Dort war ein Haus gezeichnet, eine Sonne mit Strahlen und ein Baum, der wie ein Rasierpinsel aussah. „Lena“ stand darunter.
Mit einem Mal begriff Michael.
Nein, das wird nichts, mein Lieber, dachte er. Er sah seinen Vater vor sich stehen. So, wie er gewesen war, stand Vater vor ihm. Pfeifend und lachend und schenkend und mahnend. Vater fuhr neben ihm auf dem Rad, wenn sie Ausflüge machten. Und letzten Winter war Vater eingezogen worden. Er war nicht gern in den Krieg gegangen. „Jetzt, wo gleich Schluss ist, holen sie mich auch noch“, hatte er gesagt. – Nein, das würde er nie dulden, was sich der Krückenmann da vorgestellt hatte. Und der Kerl hatte sich das Wohnzimmer schon ganz genau beguckt.
Er stand auf und sah den Weg entlang. Zwischen den Feldern, weit, weit hinten humpelte der Einbeinige.
IV. KAPITEL
Michael durchwühlt die Kommode – und Lena will zu Pfarrer Toberlog gehen
Langsam schlenderte Michael nach Steinbach zurück. Über dem Weg tanzte Staub, und fern am Horizont schubsten sich dicke schwarze Wolken zusammen. Irgendwo in der Ferne brummelte ein Gewitter. Die Schwalben streiften fast die Erde.
Dunkel kroch in die Gassen, so plötzlich, als hätte jemand einen Schalter geknipst.
Auch im Wohnzimmer war es dunkel. Als Michael eintrat, blickte er zuallererst auf die Kommode, auf den oberen Schubkasten.
Der Schlüssel steckte …!
Die Mutter hantierte in der Küche. Ein Fenster stand offen, und der aufkommende Sturm riss die Gardine heraus. Vielleicht hat die Mutter den Brief gerade wieder gelesen und hat ihn, als ich kam, nur rasch hineinwerfen können.
Michael lehnte mit dem Rücken gegen die Kommode. Der kleine Schlüssel drückte leicht durchs Hemd.
„Ich gehe dann gleich mal zu Pfarrer Toberlog. Ins Pfarrhaus, meine ich, Michael!“, rief die Mutter aus der Küche herüber.
Michael konnte sie durch die Glastür beobachten. Sie wusch Geschirr ab. Er hörte das Kratzen und Schaben der Teller.
Vorsichtig, ohne seine Stellung zu verändern, öffnete er den oberen Schub. Er fasste mit der rechten Hand hinein und griff nach einem Stoß Frottierhandtücher. Jedes Tuch tastete er ab. Es war unbequem, so zu stehen. Michael langte mit der linken Hand hinein und durchsuchte die andere Seite. Aber er konnte nichts finden.
Auf der Straße liefen eilig Leute vorbei. Einige Male blitzte es grell, Donner krachte, und schwere Tropfen fielen auf das Dach.
Michael fand keinen Brief …
Abermals blitzte es, darauf folgte ein schwerer Schlag, und diesen Augenblick nutzte Michael, um den Schub mit einem Ruck zurückzustoßen.
Die Mutter stand in der Küchentür. „Das war ganz nahe“, sagte sie und trocknete sich die Hände an der Schürze.
„Ob der Lachmann schon von den Feldern ist? Ich meine, ob er seine Schwester schon gefunden hat – das Gewitter, o Gott!“
„Ich denke es!“, sagte Michael, ohne die Mutter anzusehen. Sie denkt also auch an ihn, überlegte er.
V. KAPITEL
Toberlog ist ein netter Mensch und gibt Lena einen Rat
Das Steinbacher Pfarrhaus und die Kirche standen auf der höchsten Erhebung des Dorfes.
Pfarrer Toberlog war ein kleiner, dicklicher Mann mit weißem Haar. Er trug eine goldene Brille, und es gab Leute, die trotz ihres protestantischen Taufscheins in die katholische Kirche gingen, nur um seine Predigten zu hören. Toberlog wurde von seiner Kirchengemeinde geradezu verehrt, und das nicht nur wegen seiner liebenswürdigen Art, nein, auch deshalb, weil von seiner Pfarrei noch kein Rentner fortgegangen war, ohne ein Geldgeschenk erhalten zu haben.
Pfarrer Toberlog war ein lieber Mensch. So sagten die Leute. Er spielte einmal in der Woche Skat, trank einmal in der Woche ein Bier und rauchte einmal in der Woche bei diesem Skat und bei diesem Bier eine Zigarre.
Natürlich gab es auch böse Zungen in Steinbach, die allerlei Geschichten erzählten. Die Pfarrersköchin Grete war nämlich sehr jung und sehr hübsch.
Aber, wie gesagt, so etwas behaupteten böse Zungen. Kam solch ein Gerücht den ernsten Kirchenmitgliedern zu Ohren, wurde es brüsk zurückgewiesen, und nur einige Leute quittierten es mit einem Lächeln und taten so, als wären sie in ihrem Herzen bereit, diesem guten Pfarrer alles zu verzeihen.
Das Arbeitszimmer Toberlogs befand sich im ersten Stock. Hochwürden stand am Fenster. Er hatte beide Flügel weit geöffnet und blickte auf Steinbach hinunter. Die Sonne war wieder durch die Wolkenbündel gebrochen, und von den regennassen Dächern blitzten grelle Reflexe. Fuhrwerke rollten auf der Straße dahin, Radfahrer umfuhren Pfützen, und Fußgänger guckten misstrauisch hinauf zum Himmel, ob sich auch keine neuen Regenwolken zeigten.
Zufrieden beobachtete Toberlog das alles. Er zog die frische, klare Luft gierig ein.
„Die arme Frau!“, murmelte er vor sich hin, als er Lena die Straße entlangkommen sah. Er wusste längst, was ihr widerfahren war, und er wusste auch, dass sie zu ihm kam. Toberlog schloss das Fenster zur Hälfte, trat an seinen Schreibtisch, begann Zettel und aufgeschlagene Bücher zu ordnen. Danach rückte er am Ofen einen Sessel zurecht und überblickte noch einmal das Zimmer. Es klopfte.
„Ja, Grete!“, sagte Hochwürden, und in der Tür erschien die junge Pfarrersköchin mit einem Tablett, worauf eine Tasse, eine kleine Kaffeekanne und ein Teller mit einem dünnen Weißbrotschnittchen standen.
„Jetzt nicht, Grete, jetzt nicht! Lassen wir das! Frau Blaschke wird gleich klingeln. Sei recht nett zu ihr und schick sie hoch!“
Nachdem Grete gegangen war, setzte sich der Pfarrer in seinen Schreibtischsessel und nahm ein Buch zur Hand. Aber er las nicht. Er wartete auf Lena Blaschke. Als es endlich klingelte, blickte er noch mal prüfend auf den Sessel am Ofen und guckte wieder in das Buch.
Türklopfen.
„Jaja!“, sagte der Pfarrer. Lena trat ein. Toberlog klappte das Buch zu, fuhr sich mit der flachen Hand über die Stirn, als müsste er das Gelesene schnell wegwischen, und stand auf. Leicht vornübergebeugt, beide Hände ausstreckend, lief er der Frau entgegen, begrüßte sie, führte sie zu dem Sessel. Erst als Lena saß, gab er ihre Hände frei und blieb vor ihr stehen.
„Frau Blaschke!“, sagte er. Und damit war viel gesagt; denn Hochwürden legte Gewicht in diese zwei Worte.
„Ich muss zu Ihnen kommen, Herr Pfarrer!“ Und nach einiger Zeit: „Verzeihen Sie, wenn ich Sie in Ihrer Arbeit störe, aber …“
Toberlog unterbrach sie, indem er mit den Händen ihre Entschuldigung fast erschlug, und sagte: „Wo sollten Sie sonst hingehen, wenn nicht zu mir, liebe Frau Blaschke?“
Lena blickte ins Zimmer. Alles war noch so wie damals, als sie mit Erich hier gewesen war, kurz vor der Hochzeit. Sie las den gerahmten Spruch über dem Schreibtisch:
WELT! – Am Anfang steht ein Weh,
Elend und Leid in der Mitten,
und hat man das durchschritten,
ist am Ende der Welt der Tod!
Und Lena fühlte, das war die Wahrheit. – Damals, vor der Hochzeit, hatte sie anders darüber gedacht.
„Hat er noch lange leiden müssen, gute Frau Blaschke?“, fragte der Pfarrer.
Lena schüttelte den Kopf. Ihre Hände umkrampften die kleine Handtasche auf ihrem Schoß.
„Es ist alles so furchtbar!“, sagte sie und legte ihre Hand auf den verchromten Verschluss der Tasche, als habe sie Angst, dass er von allein aufspringen könnte.
„Gewiss ist es furchtbar, aber wir sollten auch versuchen, Trost zu finden, liebe Frau! Würden wir nicht, wie Judas, der Makkabäer, die Hoffnung in uns tragen, dass die Gefallenen auferstehen, so schiene es ja überflüssig und eitel, für die Verstorbenen zu beten.“ Der Pfarrer hielt inne, sah auf das Kruzifix an der Wand. „Nun aber wissen wir“, fuhr er fort, „dass eine sehr große Gnade denen vorbehalten ist, die in Frömmigkeit entschlafen sind!“
„Herr Pfarrer!“ Lena war aufgesprungen.
„Ich verstehe Sie in Ihrem Leid, Frau Blaschke!“, fuhr Toberlog fort. „Es ist also ein heiliger und heilsamer Gedanke, für die Verstorbenen zu beten! Und ich weiß auch, dass Sie das tun, und so können wir dessen versichert sein, dass die Seele Ihres teuren Entschlafenen bereits in Gottes Hand ist!“
„Es ist alles anders!“, sagte Lena leise. Sie stand noch immer, Hochwürden blickte erstaunt zu ihr auf.
„Was sagten Sie, Frau Blaschke?“
„Es ist alles anders!“, wiederholte Lena.
Sie fand nicht gleich die rechten Worte. – „Mir fällt es schwer, Herr Pfarrer, Ihnen das alles zu sagen …“
„Nur sprechen, sprechen, Frau Blaschke!“, mahnte Toberlog, aber er war unsicher, weil er nicht wusste, was nun kommen würde.
„Sie sprachen von der großen Gnade, die denen vorbehalten ist, die in Frömmigkeit entschlafen sind, Herr Pfarrer. Bei meinem Erich ist es anders!“
„Sie meinen, weil Ihr lieber Mann die Sterbesakramente nicht mehr empfangen konnte?“
Lena schwieg.
„Das hat in diesem Falle nicht viel zu besagen. Im Krieg ermöglichen es oft die Umstände nicht!“
Lena hielt es nicht mehr länger aus. Die Worte des Pfarrers waren wie Nadelstiche. Sie öffnete den kleinen verchromten Verschluss der Handtasche und brachte den Brief hervor.
„Es ist alles ganz anders!“, sagte sie noch mal. „Ich weiß nicht, wofür mich Gott so gestraft hat!“
„Gottes Ratschlüsse sind oft unerforschlich!“
Toberlog nahm das Papier aus dem Umschlag, faltete es auseinander und las:
Liebe Lena, lieber Michael!
Die letzten Stunden meines Lebens sind gekommen. Wenn Ihr diesen Brief in der Hand haltet – hoffentlich bekommt Ihr ihn! –, bin ich nicht mehr unter den Lebenden.
Ich möchte Euch soviel schreiben in dieser Stunde. Aber jedes Wort scheint mir leer und arm. Deshalb in aller Eile das Wichtigste:
Wir liegen hier in einem kleinen Dorf westlich der Oder. Bis hierher sind wir nun gejagt worden – von Posen. Rückzug. Neben mir ging ein Achtzehnjähriger. Er hieß Joachim. Als wir am Abend hier ankamen, war er verschwunden. Es stellte sich heraus, dass er in der Nähe gewohnt hatte. Man fand ihn noch in derselben Nacht in einem Versteck und verurteilte ihn wegen Fahnenflucht zum Tode. Zur Erschießung wurden zehn Mann gebraucht. Einer meldete sich freiwillig, die anderen neun wurden durch Abzählen zu fünf ermittelt. Ich war unter ihnen. Wir mussten vor die Scheune marschieren. An der Wand stand Joachim. Bei ihm war ein Pfarrer, der ihm die heilige Kommunion spendete. Ich musste an Michael denken. Diesen Jungen erschießen? Ich konnte es nicht, Lena. Mir standen die Tränen in den Augen. Als der Befehl „Legt an!“ kam, trat ich einfach vor und sagte: „Ich kann das nicht!“ Und ich sah noch, wie sich die anderen neun Gewehrläufe senkten. Der Offizier schrie wie rasend, gab mir noch mal den Befehl, aber ich konnte nur den Kopf schütteln. Da ergriff er mich bei den Schultern und schrie: „Feigling! Abführen!“ Er riss mir die Schulterklappen herunter, und zwei schafften mich weg, in den Keller des Hauses. Von hier hörte ich auch die Schüsse, die Joachim töteten.
Aber ich habe nicht geschossen!