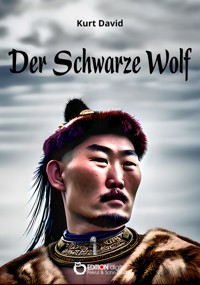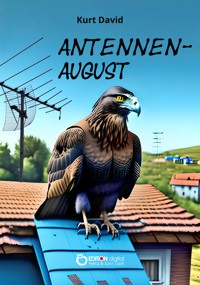4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Gefreite Wolfgang Fiedler wollte nicht sterben. Bevor die Brücke gesprengt wurde, rannte er ans andere Ufer und flüchtete in eine russische Schule. Dort stand eine große Kiste. Der Angriff der Russen kam schneller als erwartet. Immer wieder wurden sie ins Feuer getrieben, eigentlich nur, um die Kiste zu verteidigen und die Lüge des Majors von Kaltenboek nicht auffliegen zu lassen. Doch dann sah Fiedler, was in der Kiste war. Den Stoff für die Novelle entnahm der Autor einer Begebenheit, die er während des Krieges miterlebt hatte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 75
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impressum
Kurt David
Gegenstoß ins Nichts
Novelle
ISBN 978-3-96521-858-1 (E-Book)
Das Buch erschien erstmals 1957 im Verlag des Ministeriums für Nationale Verteidigung, Berlin als Heft 5 der Erzählerreihe.
© 2023 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Gegenstoß ins Nichts
Der Gefreite Wolfgang Fiedler wollte nicht sterben. Er hatte eine Braut zu Hause, ein immer feingeputztes Fahrrad, einen guten Anzug, und er hatte so viel Illusionen, dass er einen ganzen Tag davon hätte träumen können.
Hier hatte er nichts – nur Illusionen. Und dafür war jetzt keine Zeit.
Er rannte über die Eisenbahnbrücke. Eine große, lange, lange, schwarze Brücke. Drei stählerne Riesenbogen spannten sich über den Fluss, der an diesem Tage trotzig über die Ufer getreten war und wild dahingurgelte. Die Brücke war hoch. Doch Wolfgang blickte nicht in die Tiefe. Nein, das konnte er nicht. Vor ihm und hinter ihm rannten Kameraden.
Sie wird gleich gesprengt werden, dachte Wolfgang. Noch auf der östlichen Uferseite hatten sie gesehen, wie ein Soldat mit der erhobenen Hand das Zeichen „Schnell, schnell“ gab. Und nun rannte Wolfgang über die schmalen Bretter, die auf den Eisenträgern lagen. Links und rechts glitten die Verstrebungen wie lange Stahlspeichen an ihm vorüber. Er rannte und keuchte und rannte …
Alles an ihm war nass. Die Stiefel mit Lehm und Morast verschmiert. Es war alles schwer an ihm, aber er spürte diese Schwere nicht. Jetzt war nichts schwer, jetzt hieß es nur laufen, laufen und nochmals laufen.
Er stierte im Rennen auf die schmalen Bretter, als gäbe es für seine Augen im Leben nichts anderes mehr zu sehen. Und ganz verschwommen links und rechts von ihm, in der Tiefe, blinkte das braungelbe Wasser des Flusses. Und blickte er etwas weiter voraus, dann sah er, wie die Bretter immer schmaler wurden, fast zu einer Stange zusammenliefen. Natürlich, das war nur die Entfernung; die Bretter blieben ja immer gleich breit.
Fetzen von Gedanken umtanzten ihn: Vater – Mutter – Christel, seine Braut. Und durch diese Gesichter konnte er sehen, konnte er auf die Bretter sehen, und die Gesichter sahen angsterfüllt aus, als würden sie seinen Lauf über die Brücke beobachten. Ihm war, als liefe Christels Gestalt vor ihm über die Brücke. Sie drehte sich oft um. Aber dann waren wieder die Bretter ganz deutlich, die Gestalt wie weggewischt. Und es war nicht August, nein, es war März neunzehnhundertvierundvierzig. Kein Garten im heimatlichen Dorf zu Hause, nein, ein ukrainisches Dorf, Krieg! Na gut, Krieg war im August neunzehnhundertdreiundvierzig auch schon gewesen. Aber er hatte in dem Garten mit Christel kaum an ihn gedacht.
Und hier war die Brücke. Und diese Gedanken trieben ihn zur Eile an, als könnte er sie in der Wirklichkeit wieder erlaufen, ergreifen, erhaschen, erleben. Er rannte …
Ob die Russen schon hinter uns am Ufer sind? Wir waren Nachhut und sind die letzten, die über die Brücke laufen.
Gedanken über Gedanken, umweht von einem Gefühl der Todesangst …
Und so stand er nun endlich wieder auf festem Boden.
Wolfgang blickte zurück zu der Brücke und sah, wie die anderen darüber hinweghetzten. Sie liefen so geschickt, als wären sie zeit ihres Lebens nur über schmale Bretter auf einer hohen Brücke gelaufen. Sicher und doch mit verzerrten Gesichtern. Und war wieder einer von der Brücke herunter, dann sagte er: „So!“ Und er keuchte, und es schien, als habe er ein großes Ziel erreicht, und es könnte ihm jetzt nichts mehr passieren.
Aber das war doch nicht so, das mit dem Ziel!
Wolfgang stand neben einem Oberfeldwebel, der einen kleinen, schwarzen Apparat am Boden festhielt. Hin und wieder schielte er zur Brücke.
„Los, los, los, runter da, runter!“, schrie er die letzten Soldaten an, „sonst latscht mir der Iwan auch noch drüber!“
Die Brücke war leer. Die Brücke war zum letzten Mal Brücke gewesen; denn Wolfgang sah, wie der Oberfeldwebel den quietschenden Hebel des Apparates mehrmals schaltete, und plötzlich erhielt die Erde einen unheimlichen Hieb, die Soldaten duckten sich, es krachte mehrmals hintereinander. In den Stahlgliedern der Brücke zuckte es, es flog nichts in die Luft, sondern es neigte sich alles lautlos in die Tiefe, verschwand im Fluss, kam wieder etwas hoch. Eisenträger und Bögen ragten aus der Flut, fielen abermals zur Seite. Alles war wieder still geworden. Die kleinen schwarzen Wölkchen der Sprengung bauschten sich über den zerfetzten Pfeilern und verflogen.
„Meine größte Brücke bis jetzt!“, sagte der Oberfeldwebel, steckte sich eine Zigarette an und verschwand mit seinen Leuten.
Wolfgang Fiedler stand wortlos unter seinen Kameraden auf der Böschung. Wolfgang war sehr groß und dürr. Die Uniform hing verschmutzt und unansehnlich an seinem Körper. Jetzt spürte er wieder Dreck und Morast, und die Nässe spürte er auch. Und Wolfgang war voller Gedanken.
„Fiedler – Sie denken zu viel! Überlassen Sie das mal den Pferden, die haben einen größeren Kopf!“ Das hatte der Unteroffizier schon während der Ausbildungszeit immer gesagt. Aber diese Unteroffiziersworte hatten auf ihn keinen Einfluss gehabt. Und so dachte er: Wir sind zwar glücklich über die Brücke gekommen, und wir tun so, als hätten wir etwas geschafft, als hätten wir etwas hinter uns, das nicht gleich wiederkommt! Aber so ist es nicht! Morgen oder übermorgen ist das alles wieder da. Es muss ja nicht eine Brücke sein; ein Graben, ein Schützenloch, das genügt …
Ein Melder kam: „Wir liegen dort unten in der Schule!“ Sie trotteten los.
Sie liefen an einer Friedhofsmauer entlang. Die Kirche hatte ein hellgrünes Dach, drei Türmchen. Die Türen standen offen. Überhaupt standen in allen Häusern die Türen offen, manchmal auch die Fenster. Die Einwohner waren nach Westen vertrieben worden.
Die Sonne war schon untergegangen.
Die Schule war das östlichste Gebäude des Ortes. Ganz allein stand sie in der Nähe des Flusses. Frische Gräben waren gezogen und liefen zur Friedhofsmauer. Einer führte sogar unter der Mauer hindurch und schlängelte sich zwischen den Gräbern. Er riss sie auf und teilte sie, teilte sogar die Toten, die vor Tagen, Monaten oder Jahren hier beerdigt worden waren.
Im Schulgarten standen Apfelbäume, noch blattlos und dürr. Ein Oberleutnant empfing die Soldaten und wies sie in die Räume ein. Nun wurden alle wieder gesprächig.
„Macht doch die Luken dicht! Mich friert!“, sagte ein älterer, der Puppke hieß und mit dem Seitengewehr eine Käsebüchse öffnete.
Die Schule hatte vier große Räume. In dreien lagen die Soldaten, der vierte war bis zu den Fenstern mit Weizenkörnern angefüllt.
„Alles mal kurz herhören!“, sagte Oberleutnant Fahlberg. Der Lärm verstummte. Puppke mit der Käsebüchse guckte misstrauisch hoch.
Der Oberleutnant: „Die ersten zwei Züge bleiben diese Nacht hier in Ruhe. Zuvor Waffenreinigen, klar! Der dritte Zug geht raus in den Graben. Vorsichtshalber sozusagen. Vor übermorgen ist mit dem Eintreffen der Russen in stärkeren Formationen drüben am Ufer nicht zu rechnen. Zudem haben wir den Fluss – weitermachen!“
Wolfgang dachte an übermorgen! Übermorgen würde es also wieder losgehen. Wieder laufen, wieder rennen, wieder Angst haben. Aber zunächst waren da achtundvierzig Stunden Ruhe! Schlafen, essen, schlafen, essen. Zwischendurch denken, an zu Haus, an Vater, an Mutter, an Christel. Wolfgang wird an sein Fahrrad denken, an seinen Anzug, an sein Bett, an gute Schuhe, an alles …
Übermorgen …
Er sah sich im Raum um. Es roch nach feuchten Kleidern. In dem Zimmer war es inzwischen etwas wärmer geworden. Sie rauchten viel, sie wärmten sich gegenseitig, indem sie dicht aneinandergerückt dasaßen.
Minuten später lagen schon alle in einer Reihe an der Wand. Manche mit ihrem Kopf auf dem Stahlhelm, andere auf dem Kochgeschirr und manche auf einem kleinen Benzinkanister, der mit Sonnenblumenöl gefüllt war.
An der gegenüberliegenden Wand lag der Oberleutnant, daneben stand eine lange, graue Kiste, und auf dieser Kiste saß ein Mann, ein Unteroffizier. Er war rasiert, er war auch nicht so schmutzig, und er schaute recht ausgeruht in dem Raum umher.
Inzwischen wussten auch schon alle, wer das war. Einer vom Bataillon, der bei der Kiste bleiben musste, weil sie noch abgeholt werden sollte. Was in der Kiste drin war, wussten er und die anderen auch nicht. Sicher solch Schreibstubenklimbim, dachten viele.
Jedenfalls saß der Mann recht artig auf seiner Kiste. Mann und Kiste schienen hier eins zu sein. Anfangs machten welche Witze über ihn, aber kurz danach schlief alles.
Nur Wolfgang lag noch eine Zeitlang wach, und er sah, wie der Mond am Fenster hochgekrochen kam. Er stand jetzt hinter der Krone des Apfelbaumes, dessen Äste schwärzlich drohten.
Wolfgang dachte wieder einmal daran, weshalb er hier herumliegen musste. Und er hörte seinen Vater sagen: Dein Großvater zog siebzig ins Feld, dein Vater vierzehn und du dreiundvierzig. So geht das immer weiter! Für so was zieht man seine Kinder groß! Nee, da begreife einer die Politik!
Nun stand der Mond hinter dem obersten rechten Viereck der Fensterscheibe in dieser ukrainischen Schule.
Er hatte das gleiche Gesicht, dieser Mond, wie damals, als er mit Christel auf der Bank gesessen hatte. Und er schien genauso hell und silbern, und doch war alles anders. Wolfgang hörte neben sich das Schnarchen der Kameraden, roch die feuchten Kleider und dachte an die Gräben, die um die Schule liefen, die Gräben, die hinüber zum Friedhof führten, unter der Mauer hindurch. Zum Friedhof. Bei diesem Gedanken schrak er auf. Friedhof – Gräben! In spätestens achtundvierzig Stunden wird es wieder schreien in diesen Gräben, da werden die Grabenwände wieder herunterbrechen …
Nicht mehr denken, nicht mehr daran denken.
Wolfgang sah noch, wie der Mondschein auf die Kiste fiel, auf die längliche Kiste; wie eine Truhe sah sie aus. Sie hatte Bügel zum Anfassen an beiden Seiten. Und auf der Kiste saß der Unteroffizier. Er schlief nicht, er rauchte eine Zigarre und hustete manchmal leise.