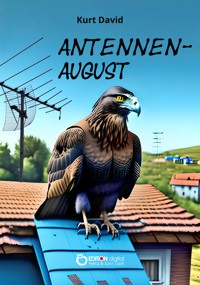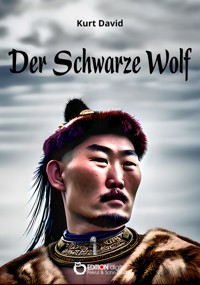
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sie nennen mich Chara-Tschono, den Schwarzen Wolf. Meine Eltern waren arme Hirten. Dennoch wurde ich der Freund von Temudschin, dem Sohn des großen Jessughei und Herrn unseres Ordu. Wir tauschten unsere Dolche und schworen, einander treu zu sein und uns bei Todesstrafe nie zu verlassen. Temudschin war klug und mutig, die Herzen flogen ihm zu und der ewig blaue Himmel schaute gnädig auf uns herab. So wuchsen unser Reichtum und unsere Macht, Temudschin wurde zum Dschingis-Chan, zum wahren Herrscher erhoben. Ich wachte über seinen Schlaf und kämpfte an seiner Seite, denn es gab viele Neider und immer neue Feinde. Dennoch kam der Tag, an dem ich aus dem Heer des Dschingis-Chan floh. Am Zaum meines Pferdes bimmelten die Glöckchen der heiligen Pfeilboten. Ich hatte sie gestohlen. Nun wiesen sie mir den Weg nach Hause, wo Goldblume und unser Sohn Tenggeri auf mich warteten. Und ich hoffte, dass es uns gelingen würde, dem Zorn und der Rache des Mannes zu entkommen, der einmal mein Freund gewesen war.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impressum
Kurt David
Der Schwarze Wolf
ISBN 978-3-96521-928-1 (E-Book)
Das Buch erschien erstmals 1966 im Verlag Neues Leben Berlin (Band 65 der Reihe „Spannend erzählt“).
© 2023 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Die Furcht vor der aufgehenden Sonne
Sie nennen mich Chara-Tschono, Schwarzer Wolf, und ich ging an einem Morgen flussaufwärts, wie ich an vielen Morgen flussaufwärts gegangen bin, und ich watete wie an vielen Morgen zuvor durch das taufrische Gras und träumte von den Fischen, die ich zu fangen wünschte. Es ließ sich gut davon träumen, in der Frühe, in der Stille, die unberührt zwischen Büschen und Gräsern im Tale ruhte. Manchmal strich ein Windhauch über Zweige und Halme, dann zitterten sie, scheu, wie ein Mädchen nach erstem Kuss.
Der Strom dampfte.
Ein Vogel schrie.
Irgendwo knackte ein Ast.
Bald erreichte ich jenen Platz, an dem vor langer Zeit der Sturm eine stolze Zeder aus dem Steilufer gerissen hatte. Auf ihrem Stamm lief ich über den Fluss, fast bis zu der Stelle, wo der Wipfel ins Wasser tauchte. Hier hockte ich mich hin, warf meine Angelschnur in den blauen Kerulon und träumte wieder von den Fischen, die ich zu fangen wünschte.
Ich war glücklich.
Am jenseitigen Ufer stand ein Reiher im seichten Wasser, grau und reglos, hinter ihm ebenso stumm und starr der schwarz-grüne Wald, aus dem die Sonne gekommen war. Schaute ich mich um, sah ich unser Ordu; feine Rauchsäulchen stiegen pfeilgerade in den Himmel. Und während die Pferde noch verschlafen herumstanden, sich den Tau aus den Mähnen schüttelten, stampften die Rinder schon über saftige Weiden, gefolgt von Schafen, die, Leib an Leib gedrängt, hinter ihnen herblökten.
Und dann hatte ich den ersten Fisch gefangen, und dann den zweiten und den dritten, und als ich den vierten aus dem Wasser zog, lächelte ich meinem entflohenen Traum vom reichen Fange nach.
Ich war nun noch glücklicher.
Mit dem Dolch tötete ich die Tiere, fädelte sie auf ein Lederriemchen und hing sie an einen starken Ast. Dort baumelten sie nun leblos in der Sonne, und selbst im Tode waren sie noch schön.
Der einsame Reiher am anderen Ufer stieß einen krächzenden Laut aus. Sein Kopf war dabei vorgeschnellt, wütend, gierig.
Dann stieg er hastig aus dem seichten Wasser, stelzte aufgeregt durch die roten Lilien, die im Waldschatten blühten.
Ich drehte mich um und blickte zu unserem Ordu. Dort war das Zelt meines Vaters, waren die Jurten der anderen, dort war ein Ulmenwäldchen, daneben eine dunkle Schlucht und hinter der Schlucht ein Hügel, von dem aus man in die unendliche Steppe sehen konnte.
Noch bevor der Reiher zu einem der Wipfel flog, hatte ich die Schar Reiter entdeckt, die schreiend und mit den Speeren drohend den Hügel hinabjagte. Ich glaubte sogar, sie lachen zu hören. Ja, sie lachten. Die Sonne schien in ihre Gesichter; denn sie ritten der Sonne entgegen, und das Morgenlicht machte sie glänzen.
Sie lachten wirklich. Ich hörte es jetzt deutlich. Vielleicht lachten sie über die Frauen und Kinder, die sich ängstlich in Jurten verkrochen, die in Sträucher huschten, jammerten und zeterten, oder über die alten Männer, die ratlos umherstanden, oder über die Burschen, die ihre Herden in die Steppe trieben und mit ihnen flüchteten. Sie lachten, die fremden Reiter, höhnisch und spöttisch.
Und ich, ich war nun nicht mehr glücklich. Wohl hingen die Fische noch an dem Ast, leblos und blank, doch die Steppe dröhnte unter den Hufen der vielen Reiter, die Steppe bebte und zitterte, und der Tau fiel von den Gräsern. Die fremden Krieger schossen mit ihren kleinen Pferden aus einer Wolke gelben Staubes, umritten die Jurten, lachten, stachen zu, schrien, Rauch stieg auf, und plötzlich verließ ein einzelner Reiter das Ordu, jagte zum Fluss. Ein wilder Schrei! Und sofort galoppierten die Verfolger hinter ihm her, als gälte es, nur den einen zu fangen, ihn, der allein mit seinem Schatten und seiner Angst zum Strom ritt.
„Temudschin“, rief ich und: „Hierherl“
„Die Tai-Tschuten, Tschono!“
Sein Pferd scheute und stürzte. Er rollte den Uferhang hinab und sprang in den Fluss. Auch ich sprang in den Fluss. Und nun schwammen wir beide zum anderen Ufer, tauchten und schwammen, tauchten immer wieder, weil wir die Pfeile der Verfolger fürchteten. Aber die schossen nicht. Ich sah, wie sie die Pferde ins Wasser trieben, nur ein Stück, und wie sie wieder lachten, und das Bündel toter Fische sah ich am Ast und in der Sonne. Der Himmel schaute so sanft herab, als wäre nichts geschehen.
Getrennt erreichten wir den Wald, drangen in das Dickicht, schlüpften durch Gestrüpp und Büsche, überkletterten zerschmetterte Baumriesen, und bald entdeckte ich, dass Temudschin nicht mehr in meiner Nähe war. Wir hatten einander verloren.
Ich horchte.
Kein Tai-Tschute, kein Temudschin. Nur die kleinen Vögel hüpften von Zweig zu Zweig, flatterten im Geäst, und manchmal traf ein Sonnenfinger ihr buntes Gefieder. Ich hätte gern solch ein Vögelchen in die hohle Hand genommen, um mich der Wärme zu erfreuen; denn ich fror in dem schattigen Wald, und ich zitterte in den nassen Kleidern, blutete an Händen und Füßen. Und die Wunden im Gesicht brannten, die Wunden von den Dornen. Hungrig war ich auch. Ich dachte an die gefangenen Fische und an das Glück. Warum jagen uns die Tai-Tschuten und tun, als gehörten ihnen unsere Weiden und der Fluss?
Später erreichte ich einen Fels, von dem Wasser fiel. Hier wuchs frisches Gras und wilder Lauch, den ich aß, Beeren fand ich, saftig und kühl. Und die Kleider trocknete ich auf den warmen Steinen, die Wunden wusch ich im kalten Wasser.
Erst als die Dämmerung in den Wald fiel und die Vögel verstummten, wagte ich, zurück zum Flusse zu gehen. Ein paar heimgekehrte Möwen weinten leise in den Wipfeln. Und am Kerulon loderten die Feuer der wachenden Tai-Tschuten. Ich sah die Pferde und roch den Duft gebratener Hammel.
„Du kannst ruhig zu ihnen gehen, Chara-Tschono“, sagte eine Stimme hinter mir.
„Temudschin!“
„Geh, geh – ich bin an deinem Unglück schuld. Die Tai-Tschuten wollen den einen fangen, um über alle herrschen zu können.“
Ich dachte: Und der eine bist du, Temudschin, Sohn des Jessughei, der Tausende Mongolen vereinte, der die Tataren schlug und ihren Häuptling gefangen nahm. Als dein Vater siegreich in sein Ordu kam, warst du geboren worden, und er gab dir den Namen des gefangenen Tataren-Häuptlings: Temudschin, das Stählerne Messer; denn du warst der Erstgeborene, und der Brauch verlangte, dass du einen Namen erhieltest, der an das größte Ereignis bei deiner Geburt erinnerte. Viele Jahre später rächten sich die Tataren an deinem Vater, indem sie ihn zu einem Gastmahl luden, das ihm verboten war abzulehnen; sie mischten Gift unter seine Speisen, und da er es unterließ, den Gastgeber zuvor kosten zu lassen, starb er. Nach dem Tode deines Vaters, Temudschin, verließen die anderen Stämme dein Ordu; denn sie wollten keinem Knaben gehorchen, auch wenn er der Sohn eines großen Häuptlings war. Und Targutai, das Oberhaupt der Tai-Tschuten, war der erste, der sich mit seinen Leuten von deiner Mutter und dir trennte.
„Ich werde nicht allein zurückgehen, Temudschin. Wenn sie den einen wollen, um über alle herrschen zu können, sollten dann nicht wir alle uns zusammenschließen, um den einen zu schützen?“
„Ich habe eine traurige Mutter, neun Pferde und sechs Hammel. Hast du heut morgen das höhnische Lachen der Tai-Tschuten gehört, Tschono? Sie lachten über unsere Armut.“
Drüben am Fluss brannten noch immer die Feuer der Wachen, tranken Targutais Männer gegorene Stutenmilch und sangen, scherzten und feierten wie vor der Tür eines Käfigs, hinter der sie Temudschin wussten.
„Wir sollten ausbrechen, bei einem Nachbarstamm Hilfe holen, Temudschin, vielleicht zu den Chungiraten gehen, wo deine Braut wartet. Ihr Vater, der gewaltige Dai-Setschen, wird deine Bitte nicht abschlagen.“
„Man wird nicht geachtet, Tschono, wenn man als Bettler in ein anderes Ordu kommt.“
Das Mondlicht drang durch das Walddach, und es war kühl, als wir zurück in das Dickicht krochen, um ein Lager für die Nacht zu suchen. Ich träumte wieder von meinen Fischen und davon, wie ich sie meinem Vater in die Jurte brachte. Er sagte in meinem Traum: „Oh, blauer Kerulon, du Spiegel des Himmels, du bist der reichste von allen Flüssen, du stillst unseren Durst und vertreibst unseren Hunger.“ Auch von Temudschin träumte ich. Zu ihm kam ein weißer Falke, den der Himmel mit Nahrung sandte.
Schuld an diesen Träumen war der Hunger, und der Hunger war es, der uns am Morgen nach Norden führte, um dem Waldkäfig, dessen Weite noch keiner durchschritten hatte, zu entrinnen. Doch auch hier wachten die Tai-Tschuten, brannten ihre Feuer. Sie feierten schon jetzt ihren Sieg über den gefangenen Temudschin, obgleich sie Temudschin noch nicht gefangen hatten. Sie brauchten nicht einmal in den Wald einzudringen; denn sie wussten, dass Temudschin von selbst erschöpft in ihre Hände laufen würde. Und jene Plätze, die für eine Flucht geeignet waren, hielten sie besetzt.
So irrten wir tagelang und lange Nächte durch den Wald zum Süden, Westen und wieder zum Norden, und da wir annahmen, die Tai-Tschuten würden öfter ihre Plätze wechseln, wiederholten wir diese Märsche. Nach Osten brauchten wir uns nicht zu wenden, denn dort schien sich der Wald bis zur aufgehenden Sonne auszudehnen.
„Bereust du nun, Chara-Tschono, dass du geblieben bist, wo wir meinetwegen hungern und Qual leiden?“
„Wir hungern, weil uns die Tai-Tschuten in den Wald gejagt haben, wir leiden Qual, weil sie dich fangen wollen, also leiden wir nicht deinetwegen, sondern wegen der Tai-Tschuten, Temudschin!“
Es gibt einen Flecken am Kerulon, wo der Wald über das Westufer hinausgedrungen ist und in die Steppe hineinlangt. „Wenn wir über den Fluss sind“, sagte Temudschin, „erreichen wir die Unendlichkeit unseres Landes. Sie wird uns schützen und unsichtbar machen.“
Nach zwei Tagen kamen wir zu diesem Flecken und durchschwammen wieder den Fluss, ruhten auf einer kleinen Insel, aus der Birken wuchsen, überquerten die andere Hälfte des Stromes und stiegen ermattet ans Ufer. Noch bevor wir in das Walddickicht der Westseite schlüpfen konnten, wurden wir von einer Schar Thai-Tschuten überwältigt und gefesselt. Und dann jagten Targutais Männer mit uns durch die Steppe, den sonnenheißen Tag und den langschattigen Abend. Sie hatten uns quer vor ihre Sättel gelegt und in den Hüften festgebunden. Das Los aller Gefangenen ist das Leid und die Ungewissheit. Mein Kopf hing so weit herab, dass er vom Stiefel und Steigbügel des Tai-Tschuten getroffen wurde, wenn der es nur wollte. Ich vermochte nicht mehr zu denken, ich sah nur noch das vorbeifliegende Gras, schmeckte Staub und Blut, auch die Fische hatte ich nun vergessen.
Sie führten uns in die Palastjurte Targutais. Der Häuptling hockte vor einer Schüssel voll Hammelfleisch und warf Stückchen um Stückchen in seinen breiten Mund. Das Fett glänzte an seinen Fingern, und es glänzte in seinem schwarzen Bart, der die Oberlippe fast verdeckte. Er achtete nicht auf uns, sondern aß und aß, trank aus einer silbernen Schale kühle Stutenmilch, knackte mit den Fingern, worauf ein Diener mit einem Porzellanschälchen getrockneter Früchte herbeieilte. Die Wächter huschten lautlos über seidene Teppiche oder warteten stumm im Halbdunkel auf die Zeichen ihres Oberhauptes.
Targutai wischte das Fett von den Händen ins Kopfhaar, womit das Ende der Mahlzeit angedeutet war. Er hob nur ein klein wenig den Kopf, so dass er unsere Füße betrachten konnte, und sagte mit heiserer Stimme: „Sind dem trotzigen Temudschin nun schon vier Beine gewachsen, um wie seine Hammel auf meinen Weiden grasen zu können?“
Und Temudschin antwortete: „Ist denn Targutai, der einst mit dem Stamme meines Vaters verbunden war, inzwischen so alt geworden, dass er einen Hammel von zwei Freunden nicht mehr unterscheiden kann?“
Der herbeispringende Wächter zog zornig das Schwert, aber Targutai hob die Hand: „Lasst das! Ich liebe die Klugheit, weil sie schärfer ist als das Schwert. Der hier vor mir steht, ist ein echter Jessughei, sein Haar ist schwarz, seine Augen glühen, seine Worte sind bedacht. Er ist wie ein wildes Pferd. Wenn man es gefangen hat, ist es störrisch und lässt sich nicht reiten. Also muss man es zähmen, erniedrigen, quälen und hungern lassen. Schließt ihn in den Kang und gebt mir den Schlüssel. So wird er am ehesten begreifen, dass ich von nun an nicht nur über meine Tai-Tschuten, sondern auch über ihn und seine Tiere und Weiden herrsche. Sein Ordu ist auch mein Ordu, und sein Wille hat sich meinem Willen unterzuordnen.“
Nun war wohl ich an der Reihe, der ich am Morgen in der Stille fischen gegangen war und dem er bis jetzt keinen Blick und kein Wort zugeworfen hatte. „Ich hatte nur den einen befohlen zu fangen“, sagte der Tai-Tschuten-Häuptling. „Da du aber mit dem einen die Nacht und den Tag geteilt hast und er dich Freund nennt, werde ich auch dich in den Kang schließen lassen. Weil du kein Sohn eines Häuptlings bist, wirst du mir schon morgen früh, wenn der erste Sonnenstrahl meine Jurte berührt, sagen, ob du mir dienen oder durch mich sterben willst. Dein Leben ist gering, dein Tod wird keinen erzürnen. Also wirst du nur ein Blatt sein, das der Wind vom Baume reißt. Und wer vermisst an einem Baum ein einzelnes Blatt?“
„So gering mein Leben sein mag, Targutais Worte machen es wertvoll!“
„Du fürchtest den Tod nicht?“
„Solange ich Targutai sehe – nein!“
Ein Wächter hieb mir die Peitsche über den Kopf.
„Stellt zu den beiden anstatt eines tüchtigen Kriegers den einäugigen und einfältigen Pferdejungen, damit sie erkennen, dass sie für mich nicht mehr als hungrige Steppenratten sind.“
Sie stießen uns aus der Palastjurte.
In dieser Nacht war der Himmel ohne Wolken, und das helle Mondlicht ließ die Sterne erblassen. Es fiel auf das Ordu der Thai-Tschuten und auf unsere hölzernen Halsjoche, die wir im Nacken trugen. Wir standen auf einem Platz nahe dem Zelt von Targutai und so weit voneinander entfernt, dass wir uns nicht verständigen konnten, ohne dass es der Pferdejunge, der zwischen uns auf und ab ging, gehört hätte.
Hin und wieder huschten Gestalten durch die Mondschatten der Jurten und verschwanden in Targutais Zelt.
Meine Furchtlosigkeit, mit der ich dem Tai-Tschuten-Oberhaupt begegnet war, reichte nicht weit in die Nacht hinein. Der schmähliche Kang drückte auf meinen Mut und auf meine Hoffnung, denn ich war gewohnt, offen zu kämpfen. Ich hatte Wölfe und Steppenantilopen erlegt, Elche und Bären bezwungen, und nie hatte mich Furcht beschlichen, auch nicht, wenn ich zu unterliegen drohte; denn dann hatte ich den Stolz in den Augen des Tieres gesehen, der mir neue Kraft verlieh. Aber Targutai hatte nur den Kang für mich, Fesseln und beleidigende Worte. Dafür sollte ich ihm dienen? Unsere Alten sagen: Wer Fremden dient, hat täglich Fleisch und Milch, aber muss er nicht immer um sein Leben fürchten?
In Targutais Zelt sangen sie, feierten den Sieg über Temudschin und lachten so dröhnend wie an jenem Morgen, als sie in unser Ordu am Kerulon eindrangen. Einmal brachte ein Diener dem einäugigen Pferdejungen eine gekochte Hammelkeule und eine große Schale voll Milch. Er schlürfte und schmatzte, dass es weit zu hören war. Den weißen Keulenknochen warf er vor Temudschins Füße. Am Fluss wieherten die Pferde, und am anderen Ufer heulten die feigen Wölfe.
Auch die Steppennacht kennt eine Stunde, wo sie stillzustehen scheint, so still, als wollte sie in die Ewigkeit hinübergleiten, die Schlafenden nie mehr aus ihrem Schlafe entlassen, die Wachenden nie mehr durch das Ende der Nacht erlösen. Alles scheint stillzustehen, der Wind hat sich niedergelegt, nur der Mond geht über Wälder, Flüsse und Wiesen, tastet Büsche und Jurten ab. Ich spürte, dass gleich etwas geschehen werde. Und da rannte Temudschin schon los, raste gegen den einäugigen Pferdejungen und rammte ihm das hölzerne Joch gegen den Hals. Der Wächter fiel ins Gras, Temudschin und ich flohen zum Fluss.
Ein Hund bellte im Lager.
Ein Kind weinte.
Und vor uns schreckte ein Nachtvogel auf, flog schreiend über den Strom.
Wir stiegen in das Wasser des Onon und wateten durch das Schilf, bis uns der mondhelle Flussspiegel am Kinn erreichte. Ich dachte: Mit dem Kang im Nacken und den gefesselten Händen gibt es keine Flucht. Stumm standen wir im Wasser, froren, hätten gern miteinander gesprochen, mussten aber schweigen, weil die Luft rein war und das Wasser unsere Worte hinein ins Ordu der Thai-Tschuten getragen hätte. Zum ersten Mal fürchtete ich die aufgehende Sonne, denn sie würde mir nicht den Morgen mit seiner Stille, den taunassen Gräsern und den Träumen vom Fischfang bringen, sondern den Tod, wenn ich nicht bereit war, Targutai zu dienen. Temudschin zu töten würden sie hingegen nicht wagen. War der Sohn Jessugheis nicht mehr am Leben, würde ein anderer Häuptling sich zu seinem Erben erklären, den Tod Temudschins rächen und die Mörder unterwerfen. Viele gab es, die auf vornehmere Herkunft verweisen konnten als Targutai.
Aus dem Ordu kamen Reiter. Am Flusse teilten sie sich und ritten das Ufer ab, suchten, stachen mit den Speeren in die Sträucher und entfernten sich.
Einer jedoch war zurückgeblieben. Sein Pferd tänzelte am Ufer im Mondschein, schnaubte und tänzelte erneut. Der Mann vermochte es kaum zu beruhigen. Er schaute auf das Wasser und in das Schilf. Plötzlich sagte er: „Siehst du, Temudschin, gerade deines Trotzes wegen hasst man dich!“ Der Mann ritt nicht denen am Ufer nach, die inzwischen im Steppennebel verschwunden waren, sondern zurück ins Ordu.
„Komm“, flüsterte Temudschin.
Wir stiegen aus dem Fluss und schlichen zu der Jurte, vor der der Mann sein Pferd absattelte. Unbemerkt gelangten wir in das Zelt und krochen unter einen Haufen Schafwolle.
Inzwischen waren die Tai-Tschuten vom Fluss und aus der Steppe zurückgekehrt und durchstöberten die Jurten. Sie kamen auch in unser Zelt. Als sie den Haufen Schafwolle entdeckten, meinte einer: „Da ist niemand. Wer sollte es bei der Hitze unter der Wolle aushalten?“ Sie sagten dann noch, dass sie am Morgen erneut suchen wollten. „Weit können sie sowieso nicht sein. Gehen die beiden in die Steppe, fressen sie die Wölfe, gehen die beiden in den Fluss, um ihn zu durchschwimmen, verschluckt sie das Wasser. Nein, mit dem Kang gibt es keine Flucht unter diesem Himmel. Oder hat einer unter euch schon mal ein Geschichtchen davon gehört?“
Sie schwiegen.
„Also: Legen wir uns nieder, und ihr werdet sehen, noch ehe die Sonne wieder hinter Targutais Jurte versinkt, werden die zwei in unserem Ordu sein, reumütig wie entlaufene Kamele, die nirgendwo etwas zu saufen bekommen haben.“
Als die Tai-Tschuten das Zelt verlassen hatten und bald darauf das Ordu wieder in der nächtlichen Stille lag, hörte ich Temudschin aus der Schafwolle kriechen. Ich tat das gleiche. Er stieß den Mann, der sich auf seine Kissen niedergelassen hatte, an die Schulter und sagte leise: „Oelön Eke lässt dich grüßen, lieber Sorgan-Schira, Mutter Wolke denkt gern an dich zurück!“
„Temudschin!“
„Und mein Freund ist auch bei mir, Sorgan-Schira. Komm hervor, Chara-Tschono, zeig ihm den Schmuck, den uns Targutai um den Hals gelegt hat.“
Der Mann presste die Hände auf seine Augen, als wollte er nicht wahrhaben, was man jetzt von ihm verlangen würde.
„Du hast doch nicht vergessen, Sorgan-Schira“, flüsterte Temudschin, „wie ich mit deinen Kindern, als ich selbst noch Kind war und ihr im Ordu meines Vaters lebtet, auf dem Eise des Kerulon gespielt hab?“
„Nein, beim Ewig blauen Himmel, nein, ich vergaß es nie!“
„Dann zerschlag unsere Kangs, Sorgan-Schira!“
„Und wenn sie euch wieder fangen? Sie werden mich als Asche in alle Winde wehen lassen. Nein, ich vermag’s nicht!“
Ich schaute ratlos zu Temudschin. Was war nun zu tun?
Doch Temudschin lächelte. „Gut, Sorgan-Schira, aber wenn Targutai hört, dass du mich am Fluss gesehen hast, wird er sich da nicht wundern, dass du es ihm nicht gesagt hast, auch nicht, als sie hier in deine Jurte kamen?“
Sorgan-Schira zerschmetterte die beiden Kangs, kochte uns ein doppelt gesäugtes Lamm, füllte ein paar Schläuche mit Pferdemilch und gab uns Pfeile und Bogen. „Der Himmel möge euch unsichtbar machen und euren Pferden Flügel verleihen, damit nicht nur ihr, sondern auch ich die Sonne wiedersehe.“
„Meine Mutter Oelön Eke wird es Euch danken, und ich werde es nie, nie vergessen, Sorgan-Schira.“
Im Jurtenfeuer knackte das Kangholz.
Der Mann gab uns noch zwei strohgelbe Stuten mit weißen Mäulern. „Reitet und sucht eure Mütter“, sagte er. Und wir sprangen auf die sattellosen Pferde, jagten hinaus in die Steppe, peitschten die Tiere vor Freude und rauften ihre Mähnen.
„Temudschin!“, schrie ich.
„Chara-Tschono!“, schrie er.
Die Morgensonne küsste unsere Gesichter. Wir lachten, riefen abermals: „Temudschin“ und „Chara-Tschono“, riefen es vor Lust und Übermut und erreichten endlich am späten Nachmittag den Hügel, hinter dem unser Ordu lag und über den an jenem Morgen die Tai-Tschuten dröhnend gesprengt waren. Wir hielten an, schauten in die nahe Schlucht, auf das Ulmenwäldchen, die saftigen Weiden und den blauen Kerulon, der schweigend am Walde entlangfloß. Dort, wo die runden Filzjurten gestanden hatten, leuchtete das Gras bleich, gelb und tot.
„Mutter Wolke wird mit meinen Brüdern und dem übrigen Ordu zum Berge Burkan-Kaldun gezogen sein“, sagte Temudschin, „denn er hat schon einmal mein Leben beschützt, und auf seinem Gipfel ist man dem Himmel am nächsten.“
Also ritten wir weiter dem Flusse nach, ritten durch die halbe Nacht, durchquerten das Walddickicht und gelangten zu dem Berge, an dessen Fuß wir die Unsrigen wiederfanden.
Der eine und der andere Dolch
Meine Eltern waren arme Hirten, die um ein krankes Schaf mehr bangten als um einen ihrer Söhne; nicht dass sie ihre Söhne nicht liebten, sondern weil ein verendetes Schaf den Hunger und ein toter Sohn nur Schmerz und Trauer bedeutete. Mein Vater hatte Jessughei gedient, an dessen Kriegen gegen die Nachbarstämme teilgenommen, wenn es das Oberhaupt gefordert hatte oder wenn sie von Feinden überfallen worden waren. Aber er hatte nie willkürlich getötet, sich nie an der Beute bereichert und sich immer an die Worte der Alten und deren Sitten gehalten. Man nannte ihn manchmal den Schweigsamen. Auch heute nennt man ihn noch den Schweigsamen. Das Schweigen hatte er an den Ufern des Kerulon beim Fischen und in den Wäldern um den Burkan-Kaldun beim Jagen gelernt. Nach den Kriegen kehrte er gern heim zum Fluss und zum Berg, weil er die Einsamkeit liebte und das Leben achtete.
Als ich, sein Ältester, in die Jurte trat und erzählte, was mir und Temudschin bei den Tai-Tschuten widerfahren war, küsste er meine Augen, ging zur Truhe und entnahm ihr einen kleinen Dolch, der in ein seidenes Tuch geschlagen war.
Schweigend verließen wir das Zelt.
Über dem Ordu streckte sich das Grau des Morgens und verdrängte die Nacht, schob sie hinaus in die Steppe, wo der Mond schon hinter den spitzen Gräsern versank.
Um den Gipfel des Burkan-Kaldun krochen Nebel; der Wald auf der Nordseite des Berges stand noch schwarz in der weichenden Finsternis. Wir kletterten auf einem schmalen Pfad, und es war schön, dem aufblühenden Morgen entgegenzugehen. Am tiefsten empfand ich es, ich, der ich heut den Sonnenaufgang, zu dem mich mein Vater führte, nicht zu fürchten brauchte.
Auf dem Gipfel beugte ein sanfter Wind die Gräser.
Wir ließen uns schweigend auf einem Gesteinsblock nieder, schauten über den Wald hinweg bis zu dem breiten roten Streifen hinter den schwarzen Bäumen, aus dem die Sonne wuchs. Danach setzten wir die Mützen ab, hingen unsere Leibriemen um den Hals und verneigten uns dankend vor der glühenden Feuerkugel. Als das geschehen war, wickelte mein Vater den kleinen Dolch aus dem Seidentuch, legte ihn in meine geöffneten Hände und sagte feierlich: „Ich jagte einst mit dem alten Jessughei jenseits des Kerulon im Dickicht. Wir waren zwölf Männer, die ihn begleiteten, hatten das Wild aufzustöbern und einzukreisen. Das Töten aber war unserem Oberhaupt vorbehalten, so lautete sein Befehl, den wir achteten, nicht nur der Strenge wegen, mit der er verkündet worden war. Obwohl Jessughei gut zu jagen verstand und mit dem Pfeil immer die Stelle traf, die er vorher bezeichnet hatte, missglückte ihm an jenem Morgen der Schuss auf einen mächtigen Bären, und auch der zweite Pfeil traf das Tier nicht ins Herz, worauf es, gereizt und wütend, auf Jessughei losstürzte. Während die anderen elf Begleiter vor Schreck erbleichten und nicht wussten, ob sie den Befehl brechen durften, schoss ich meinen Pfeil ab, noch ehe der Bär unser Oberhaupt umklammern konnte. Ich traf gut und hieb dem Tier sofort mein Messer neben den Pfeil in den Leib.“
„Und Jessughei, Vater, was tat er, was sagte er?“
„Ja, was tat und sagte er, Chara-Tschono! Damals wartete ich genauso auf seine Antwort wie du heut auf die meine. Was wäre geschehen, wenn er behauptet hätte, selbst imstande gewesen zu sein, das Tier zu überwältigen? Niemand hätte gewagt, ihm zu widersprechen. Und wer kennt sich schon in den Launen eines Oberhauptes aus? Er hätte auch sagen können, ich hätte an seiner Tapferkeit gezweifelt, an seinem Mut – und überhaupt, wie konnte ich seinem Befehl nicht gehorchen? Doch Jessughei war weise und sagte: ,Elf von euch folgten meinem Befehl, der mich das Leben gekostet hätte, einer folgte ihm nicht und rettete mich vor dem Tode. Wenn ich dem einen jetzt danke und ihn beschenke, danke ich ihm dann seinen Ungehorsam? Denkt selbst darüber nach, und ihr werdet erkennen, was ich euch rate!‘ Und da, Chara-Tschono, überreichte mir Jessughei diesen kostbaren Dolch.“
Die Strahlen der Sonne sprühten wie Feuer in den Edelsteinen und warfen grelle Lichtpünktchen in das Gesicht meines Vaters.
Über uns kreisten lautlos zwei Falken, stießen plötzlich zum Fluss hinab und hinein in einen Schwarm Möwen. Weiße Federn trudelten traurig und einsam über dem Wasser, fielen in das Blau des Kerulon und schaukelten davon.
Mein Vater sagte: „Trag diesen Dolch zu Temudschin, danke ihm, dass er dir durch seine List das Leben gerettet hat. Möge er aber auch so weise werden wie sein Vater Jessughei.“
Auf unserem Abstieg begegneten wir am Fuße des Berges einer Kamelkarawane chinesischer Kaufleute, die ins Ordu zog. Kinder verließen schreiend die Jurten und Weiden, rannten den fremden Männern entgegen, verstummten vor den farbigen Gewändern der Händler und bestaunten die hochbeladenen Kamele, die große Ballen und Kisten ins Lager trugen.
Sofort war die Karawane auch von den Hirten und Jägern und deren Frauen umringt; denn die Kisten und Ballen bargen wundersame Dinge: seidene Teppiche mit bunten Ornamenten, brokatene Kleider und kostbare Stoffe, Pfeilköcher aus Elfenbein, Kampfschilde und Dolche, Schmuck und Süßigkeiten.
Ich stand mit meinem Vater in der Menge und lauschte den geschmeidigen Worten, mit denen die Kaufleute ihre Waren anboten, beobachtete, wie sie Süßigkeiten an die Kinder verteilten, ohne dafür etwas zu fordern, und ich sah, wie bald darauf die ersten Ordu- Bewohner in ihre Jurten liefen und mit Fellen zurückkamen, wie sie Schafe brachten, Pferde und Häute, ja einer führte den Kaufleuten sogar einen mächtigen Yak vor, der begutachtet und gegen verschiedene Sachen eingetauscht wurde.
Noch immer hielt ich den in das Seidentuch gewickelten Dolch in der Hand und suchte Temudschin unter den Leuten. Ich fand ihn nicht, ich fand nur seine Mutter, Mutter Wolke. Die Weißhaarige kniete mit einer großen Schüssel voll Salz neben einem Händler. Das Salz hatte sie von einem nahen See geholt. Mutter Wolke erhielt für das Salz drei Trinkschalen. Sie beklopfte mit den Fingernägeln das hauchdünne Porzellan, hielt die Gefäße gegen die Sonne, während der Händler zufrieden im Salz wühlte und es durch die Finger rieseln ließ.
Dann sah ich Temudschin. Er stand vor seiner Jurte, allein und ernsten Gesichtes, schaute herüber zu den Kaufleuten, mit verschränkten Armen stand er da, blickte auf die Händler, als wolle er sie aus dem Ordu jagen, ihnen die Waren wegnehmen.
„Es ist gut, dass du kommst“, sagte Temudschin zu mir, ohne mich anzusehen.
„Ich wollte dir einen …“
„Sei still, Chara-Tschono, zerstöre nicht meine Gedanken, schau lieber mit mir zu den Händlern, und ich werde dir erklären, was mir ihre glatten Gesichter verraten.“ Und nach einer Pause meinte Temudschin: „Da wäre zunächst dort drüben bei dem weißen Kamel der Kaufmann mit den Teppichen. Er hat keine Zähne, kein Haar, aber ein rosiges Gesicht. Seine Finger krallen sich gierig in das Wolfsfell, das man ihm anbietet. Sag, Tschono, könnte der Händler einen Wolf töten?“
„Nein, der nicht!“ Ich musste lachen.
„Siehst du, aber er gibt unseren Jägern nur so viel für das Fell, wie ihm genehm ist. Neben ihm sitzt der Kaufmann mit den bunten Stoffen, der mit der Narbe auf der Stirn. Könnte er ein wildes Pferd zureiten?“
„Nein, der nicht!“ Und wieder musste ich lachen.
„Siehst du, aber er lächelt geringschätzig über unsere Hirten, weil sie nur in Zelten leben, von Weide zu Weide ziehen mit den Herden und er aus einer großen Stadt kommt, die aus Steinen und Mauern gebaut ist, wie mir mein Vater immer gesagt hat. Und sieh dir den nächsten an, Chara-Tschono, den mit den blitzenden Ringen am Finger und den zusammengekniffenen Katzenaugen. Seine Ringe sind mehr wert als unser Ordu. Kann er schießen, mit dem Pfeil treffen?“
„Er wird es nicht können; denn er hat Begleiter, die es für ihn tun und ihn schützen.“
„So ist es. Meine Mutter reichte ihm das Salz und wollte vier Trinkschalen. Wie ich sehe; hat sie nur drei erhalten. Warum? Weil er sie nicht achtet, weil die Händler wie die Elstern sind, gierig und schlau, weil sie glauben, uns betrügen zu können, uns, die wir nicht in den steinernen Städten wohnen, uns, die wir nicht in kostbaren Kleidern gehen.“ Temudschin ging in seine Jurte und kam mit zwei Bögen sowie einer Handvoll Pfeile zurück. Erschrocken fragte ich: „Was willst du tun?“
„Ihnen zeigen, Chara-Tschono, was wir können, und unseren Leuten zeigen, was die nicht können. Das wird die einen herabdrücken und die anderen aufrichten!“
Wir drängten uns durch die Menge, bis zu dem Händler, der Temudschins Mutter nur drei statt vier Trinkschalen gegeben hatte.
„Ich hätte eine weiße Stute für Euch“, sagte Temudschin.
Und der Händler: „Was wünscht Ihr dafür einzuhandeln, junger Herr?“
„Nichts!“
„Nichts? Das ist ungewöhnlich, ich zahle gern meinen Preis.“
„Ihr könnt doch reiten, nicht wahr?“
Der Händler lächelte. „Meint Ihr, wir wären zu Fuß aus dem Reiche Chin gekommen?“
Ich holte die Stute und führte sie zu dem Händler. Sie war ein gutgewachsenes Tier, unruhig, breitbrüstig und langmähnig. Einige Ordu-Bewohner lachten spöttisch, andere blickten aus verwunderten Gesichtern und warteten, was Temudschin mit dem Händler vorhatte.
„Ihr könnt also dieses Pferd haben“, sagte Temudschin, „wenn Ihr mit ihm zum Fluss hinunter und wieder zurück ins Ordu reitet.“
Der Händler betrachtete misstrauisch die Stute und sagte schroff: „Ich bin kein Nomade, also reite ich mit Sattel!“
„Wir können beides, Händler“, antwortete Temudschin, „aber Ihr sollt einen Sattel haben, denn wir wollen Euch nicht benachteiligen!“ Wir rissen die Stute ins Gras, warfen uns auf ihre Beine, drehten ihr Schwanz und Ohren fest, dass sie vor Schmerz schnaubte und wieherte, und sattelten das Pferd.
„Ihr wollt mich betrügen“, schrie der Händler. „Ich seh schon, es ist eine Stute, die keiner zu reiten vermag!“
„Er lügt! Er lügt!“, riefen einige Ordu-Bewohner. „Er will uns beleidigen! Er lügt, der Händler!“
Temudschin ließ die Hirten und Jäger in ihrem Zorn gewähren. Dann gebot er Ruhe: „Ihr habt unsere Antwort gehört? Ich würde nicht wagen, von Euch etwas zu verlangen, das ich nicht selber imstande wäre zu tun! Das widerspräche unseren Sitten und wäre gegen die Gesetze unserer Väter, Händler!“
„Gut, ich reite, zuvor müsst Ihr mir jedoch beweisen, dass Eure Worte wahr sind.“
Temudschin sprang sofort in den Sattel der Stute, sprengte hinüber zum Kerulon, galoppierte entlang des Ufers, und obwohl das Tier manchmal plötzlich stehenblieb, hochsprang, mit den Beinen ausschlug, sich wütend in den Staub warf und störrisch den Kopf senkte, gelang es ihm nicht, den Reiter Apsu schütteln. Temudschin hatte nicht ein einziges Mal den Boden mit den Stiefeln berührt. Die Hirten und Jäger schrien vor Freude, sangen, klatschten, riefen: „Er ist ein echter Jessughei, unser Temudschin, ein echter Jessughei!“ Triumphierend blickten wir alle zu dem Händler, der diesen kühnen Ritt bedrückt verfolgte, aber es dann trotzdem nicht ablehnte, das Pferd zu besteigen; denn es war zwar ein wildes, doch ein edles Tier, das er gern besessen hätte, zumal die Möglichkeit bestand, es geschenkt zu bekommen.
Ich hielt die Stute fest, als sie der Händler bestieg. Große Stille ringsum, selbst die Kinder blickten andächtig und erwartungsvoll. „So“, sagte der Kaufmann zu mir, „nun lass mich allein mit ihr!“ Ich sprang zur Seite. Und das Pferd jagte davon, nein, es sprang davon, es sprang durch die Luft, machte einen wilden großen Satz, fiel auf die Knie, und der Händler flog über den Kopf des Tieres in das Gras. Fröhlich trabte das Pferd reiterlos zum Fluss. Die Ordu-Bewohner lachten. Aber der Händler, getrieben von dem Wunsch, die Stute zu erhalten - vielleicht war er sogar etwas tapferer, als Temudschin wahrhaben wollte –, bestieg ein zweites Mal das Pferd. Er stürzte abermals, nämlich in dem Augenblick, als sich das Tier plötzlich seitwärts zu Boden fallen ließ und wild mit den Beinen um sich schlug.
„Ihr könnt es noch einmal versuchen“, meinte Temudschin, und ich holte die Stute zurück. Und ich sagte: „Die Stute verdient es, Händler!“
„Ein Teufelspferd ist das!“ Er spuckte und ging, den Staub von den Kleidern klopfend, zu seinen Waren.
„Vielleicht ist einer unter euch, der sich aufs Bogenschießen versteht“, fragte Temudschin die übrigen Kaufleute. „Wer die vorher bezeichnete Stelle trifft, bekommt die Stute.“
Es meldete sich keiner.
Abermals lachten viele Ordu-Bewohner, und einige ließen auch von den Tauschgeschäften ab, bei denen sie meist übervorteilt wurden. Andere allerdings sahen den davonziehenden Kaufleuten etwas wehmütig nach; denn sie hatten sich noch ein gutes Geschäft erhofft. Zu ihnen sagte Temudschin: „Lasst sie ziehen. Sie werden überall erzählen, wie sie in unserem Ordu behandelt worden sind. Also werden diejenigen, die nach ihnen kommen, nicht so großartig hier einziehen und über uns geringschätzig lächeln, nur weil wir in Filzjurten wohnen und von Weideplatz zu Weideplatz wandern. Wir aber werden jeden, der nicht mehr als wir selber sein will, freundlich empfangen, mit ihm handeln und gute Gastgeber sein!“
Temudschin führte mich zu seiner Jurte, der junge Temudschin, den sie heute einen „echten Jessughei“ genannt hatten.
„Du bist vorhin zu mir gekommen, und ich hab dich nicht reden lassen. Was gibt es, Tschono?“
„Mich schickt mein Vater zu dir“, sagte ich und wickelte den Dolch aus dem Seidentuch. „Hier, Temudschin, sein Geschenk, weil du mich und uns durch deine List vor Targutai gerettet hast. Und mein Vater sagte, du mögest so weise werden wie Jessughei, den er achtete und vor dem sicheren Tode gerettet hat.“
„Ich weiß“, antwortete Temudschin, „bei der Jagd auf einen Bären. Mutter Wolke hat es mir erzählt und immer wieder erzählt. In der Begebenheit steckt Weisheit, Tschono!“
Draußen brach der Wind auf, donnerte in den Filzwänden der Jurte. Dunkle Wolken schluckten das Sonnenlicht. Donner murrte hinter den Wäldern.
„Der Dolch meines Vaters“, sagte Temudschin leise. „Ein wertvolles Geschenk. Es trifft meinen Namen, Chara-Tschono, ‚Stählernes Messer'.“
Temudschin stand auf und ging zu einer mit rotem Leder überzogenen Truhe. Auch er entnahm ihr einen in Seide gehüllten Dolch. „Dieses Messer hat ebenfalls eine Vergangenheit, Tschono. Es gehörte jenem tatarischen Temudschin, den mein Vater gefangen nahm und dessen Namen ich trage. Von diesem Häuptling ist nichts geblieben als dieses Messer. Da du mein erster Freund bist, schenke ich es dir, Chara-Tschono, freilich nicht, ohne dich jetzt zu fragen, ob du mein Freund sein möchtest und ich für immer der deine sein soll!“
„Du nanntest mich schon vor Targutais wütenden Augen einen Freund, Temudschin!“
Der Sturm fetzte den Vorhang am Jurteneingang beiseite. Wir sahen nun den Fluss und den Wald, über den der Sturm herfiel. Eine Zeder brach krachend und fiel in den Strom. Blitze zerschnitten den Himmel, fielen wie Feuerpfeile in den Wald, und der Donner rollte um den Burkan-Kaldun, erschütterte die Erde, raste brüllend durch unser Ordu.
„Gut“, antwortete Temudschin, „dann wollen wir einander schwören, dass keiner den anderen verlässt, dass wir uns immer die Treue halten werden. Brichst du den Schwur, töte ich dich mit dem Dolch meines Vaters, den du mir schenkst, breche ich den Schwur, tötest du mich mit dem Dolch des tatarischen Temudschins, den ich dir schenke. Ist das gerecht und unserem Brauche würdig, Tschono?“
„Es ist gerecht, Temudschin!“
Wir tauschten die Dolche.
Als ich zur Jurte meines Vaters lief, fiel Regen. Zunächst waren es nur einzelne große Tropfen, die auf die Zeltdächer trommelten. Doch bald regnete es heftiger und dann so stark, dass der Kerulon anschwoll und mächtig und schäumend dahinschoss. Dort, wo der Fluss eine kurze Strecke durch die offene Wiese lief und eine Biegung machte, schwappte das braune Wasser über das Ufer. Manchmal leuchteten Schaumkämme wie graue Strähnen auf.
Chara-Tschono hat nun einen Freund, dachte ich, einen Freund, der ein Sohn Jessugheis ist. Der Regen machte mir nichts aus. Nun nicht mehr, da ich geschworen hatte, ein Freund zu sein. Es war wieder etwas von dem Glück in mir, das ich an jenem Morgen beim Fischen empfunden hatte. Und der Donner? Den Donner empfand ich wie das dumpfe Schlagen vieler Pauken.
Mein Vater saß auf seiner Filzmatte in der Jurte und besserte einen Stiefel aus. Ich überbrachte ihm die Kunde, die mich so froh machte. Meine Augen glänzten vor Glück. Aber mein Vater hörte meine Worte, ohne mich anzusehen.
Er schwieg, mein Vater, er schwieg und hantierte weiter an dem Stiefel.
Zu zweit auf einem Pferd
Nun ging ich wieder hinunter zum Kerulon, um zu fischen, so wie an den vielen glücklichen Morgen zuvor, ehe uns die Tai-Tschuten gefange genommen hatten. Manchmal war Temudschin bei mir. Dann fischten wir beide. Oder beide gingen wir auf die Murmeltierjagd und kamen erst nach Sonnenuntergang zurück. Unseren kahlschwänzigen Braunen mit dem gewölbten Rücken hatten wir dann so hoch mit Murmeltieren beladen, dass er unter der Last schwankte, wenn wir müde ins Ordu zogen. Die Beute teilten wir.
Saß ich allein am Fluss, dachte ich an das Schweigen meines Vaters, mit dem er die Nachricht, ich sei Temudschins Freund geworden, aufgenommen hatte. Das Schweigen der Alten ist weise und wohlbedacht. Bei meinem Vater brauchte es weder Zustimmung noch Ablehnung zu bedeuten. Er ließ sich immer Zeit, bevor er etwas sagte; denn einen entsprungenen Hammel kann man wieder einfangen, aber Worte nicht. Trotz allem: Ich dachte über sein Schweigen mehr nach, als ich es mir erklären konnte.
Eines Tages raubten die Tai-Tschuten unsere acht Pferde, darunter den silbergrauen Wallach und die feurige weiße Stute, die wilde und edle, die den Kaufmann abgeworfen hatte. Das geschah vor unseren Augen und zu der Stunde, wo die Sonne am höchsten stand. Noch ehe wir unsere Bogen fassen und unsere gefiederten Pfeile auflegen konnten, waren die tai-tschutischen Räuber in der Steppe verschwunden.
„Ich will hinterher!“, sagte einer der Brüder Temudschins.
Und Temudschin fragte: „Wie?“
Und dann schwiegen wir alle, blickten hinaus in die gelbe Ebene, in die Weite, in die Unendlichkeit, aber wir hatten keine Pferde mehr. Bis auf eins, mit dem einer im Walde jagte, waren die acht Pferde alle unsere Pferde gewesen. So warteten wir auf das eine, das einzige Pferd, das unser Ordu noch besaß, und standen unter der grellen Sonne, die mit den Dieben nach Westen floh und uns in der Dämmerung zurückließ.
„Wie sie heut unsere Pferde geraubt haben, treiben sie morgen unsere Schafe fort“, sagte Temudschin.
„Und danach unsere Frauen und die Kinder!“, sagte ich.