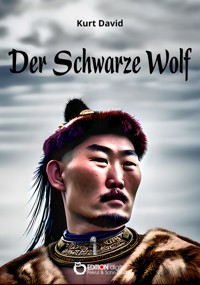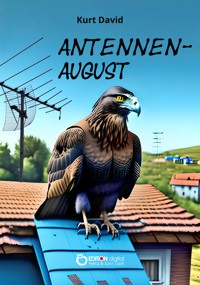7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Autor reist Anfang der 1960er Jahre durch die Mongolische Volksrepublik. Er ist auf der Suche nach Menschen und ihren Geschichten aus Vergangenheit und Gegenwart. Seine Suche beginnt in der TU 104. Er bereist die Hauptstadt Ulan Bator, die Steppe im Westen, die Wüste Gobi im Süden und das Altai-Gebirge. Überall begegnet man dem Deutschen mit großer Offenheit und Freundlichkeit. Fotos des Autors veranschaulichen den Text. Ein kleines Lexikon am Ende vermittelt Wissenswertes über das Land.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impressum
Kurt David
Im Land der Bogenschützen
Reisebilder aus der Mongolischen Volksrepublik
Mit 93 Fotos des Verfassers
ISBN 978-3-96521-908-3 (E-Book)
Das Buch erschien 1962 im Verlag Neues Leben Berlin.
© 2023 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Unterwegs
Von Zigaretten, Keksen und Waffeln
TU-104
An unserem Tischchen saßen ein ukrainischer Ingenieur, der eine Schachtel Belomor-Kanal-Zigaretten auf das Tischchen legte, ein Londoner Arzt, der eine Packung Viceroy-Zigaretten daneben stellte, zwei französische Rechtsanwälte, von denen einer Zigarren in einer tomatenroten Packung auskramte, während der andere einen Keks knabberte und die Schachtel dem braunen Tischchen anvertraute. Von der Sicherheit meiner Mitreisenden überwältigt und von dem Gefühl getrieben, sie könnten annehmen, ich hätte als einziger Flugpassagier gar nichts auf das Tischchen zu legen, fischte ich meine Schachtel Dubec und die Streichhölzer aus der Tasche und legte beides darauf. Dass Rauchen vor und während des Starts untersagt war, darüber belehrte uns eine rot glühende Schrift hinter einer Glasscheibe. Also lehnte ich mich in den weichen Sessel zurück, schielte heimlich auf die Rollbahn und machte ein Gesicht, als interessiere mich der Start, der gleich erfolgen musste, nicht im Geringsten. Ich tat ebenfalls so, als flöge ich Tag für Tag mit einer Düsenmaschine zur Arbeitsstelle.
Die Triebwerke heulten auf. Der silberne Vogel erzitterte. Ein Ruck. Am Rande der Rollbahn duckten sich Gräser. Und dann schoss er davon, wischte unter ärgerlichem Donner unsere internationale Tabakwarenausstellung vom Tischchen, strafte unsere Unehrlichkeit. Mühelos hatte er uns entlarvt.
In fünftausend Meter Höhe, als er etwas ruhiger geworden war, als sich der Düsenlärm in ein sanftes Singen verwandelt hatte, tauchten wir alle unter das Tischchen. Ich angelte nach Viceroy-Zigaretten, der Franzose nach Dubec, der Londoner klaubte Kekse vom Teppich, der andere Franzose war fast unter dem Sessel verschwunden, suchte Zigarren und Feuerzeug.
Demaskiert saßen wir da. Jetzt verhielten wir uns so, wie wir uns vorher nicht hatten verhalten wollen: wie normale Menschen, ohne Getue, ohne Tünche; wir sprachen plötzlich miteinander ...
Das alles hatte ich bei meiner vorjährigen Asienreise erlebt. Jetzt, bei meinem zweiten Flug, legt keiner etwas auf das Tischchen. Zudem sitzt ein Herr an meiner Seite, der von vornherein sehr gesprächig ist und mich für einen Moskauer hält. Fehlt ihm eine russische Vokabel, stopft er das Loch im Satz mit einer englischen. Er reist mit einem Tonbandgerät, will in Zentralasien alte Lieder aufnehmen und sammeln. Mit dem „Russisch-Englisch-Mischmasch“ quälen wir uns eine halbe Stunde durch das Gespräch. Mir fehlt plötzlich ein Wort, das ich weder in der einen noch anderen Sprache sagen kann. Im Eifer rutscht es mir Deutsch über die Lippen. Der „Engländer“, „Franzose“ oder „Schweizer“ – was weiß ich, wer er ist – bricht in Lachen aus: „Sie sprechen auch deutsch?“ Ein Wiener!
Nachträglich bedanke ich mich bei dem fehlenden Wort.
Unter uns fließt langsam sibirische Unendlichkeit dahin. Fünfzehn Kilometer in einer Minute, hundertfünfzig Kilometer in zehn Minuten, dreitausend Kilometer in zweihundert Minuten. Immer bleibt es Sibirien.
Man kann über dieses Land nicht hinwegfliegen, ohne an die Zeit zurückzudenken, da aus geifernden Mündern dieses Wort gespuckt, mit Lügenhänden an Bretterzäune und Hausgiebel geschmiert wurde: ENDSIEG ODER SIBIRIEN – Hunderttausende sind an diesem in die Hirne gehämmerten Satz gestorben, ohne Sibirien gesehen zu haben.
Von Zeit zu Zeit strahlen unzählige Lichter aus der tiefen, dunklen Nacht.
Stadtaugen blicken wie leuchtende Perlen zu uns herauf, scheinen fragen zu wollen: Kennt ihr uns? Ufa, Tscheljabinsk, Swerdlowsk, Omsk, Nowosibirsk ... Wie lichtbestickte Teppiche wirken die sibirischen Riesen.
Der Wiener, endlich gesprächsmüde, ist am Tischchen eingeschlafen. Blicke ich flüchtig hinaus, sehe ich die Schleier der Nacht, dunkel und undurchsichtig. Schaue ich zurück nach Westen, entdecke ich den letzten tiefroten Schimmer der untergegangenen Sonne, und im Osten überrascht mich eine zarte Morgendämmerung, silberblau und schmal. Wir fliegen zwischen Abend und Morgen. Der bleiche Mond strahlt auf blitzende Tragflächen. An Bord ist es Mitternacht.
Im Gang beobachte ich eine ukrainische Mutter, die ein Paket Waffeln in den Händen hält, mit dem sie einem kleinen Mädchen die ersten Schritte entlockt. Die Kleine tapselt von Sessel zu Sessel. Sie sind wie Stationen. Zwei schafft sie mühelos, aber die Mutter will drei. Bei zweieinhalb werden die Schrittchen mit einer Waffel belohnt. Danach ist Pause; es wird geknabbert, gekrümelt, gelacht – und von neuem Anlauf genommen. „Wie alt war ich, als ich zu laufen begann?“, wird das Mädchen später einmal fragen. Und da wird diese Geschichte erzählt werden; man wird hinzufügen: „In neuntausend Meter Höhe – in einer TU.“ Das wird in zwölf oder fünfzehn Jahren sein. In zwölf oder fünfzehn Jahren wird man sich wundern, dass es nur in neuntausend Meter Höhe gewesen ist.
Wir fliegen Irkutsk zu. Diese größte Stadt Mittelsibiriens, unweit des Baikal-Sees, nahe der mongolischen Grenze, bezeichnen die Piloten als Waschküche. In Irkutsk herrscht meist Nebel oder Regen oder auch beides, und haben die zwei keine Zeit, weil sie sich anderswo unbeliebt machen müssen, springt der wütende Sturm für sie ein, stürzt donnernd von den sajanischen Bergen. Manchmal lächelt auch in Irkutsk die Sonne.
In mein Tagebuch schreibe ich: „Von Zittau bis Rostock benötigt man ebensoviel Zeit wie von Berlin bis Ulan-Bator: zehn Stunden.“ Diese zehn Stunden sind relativ; der Irkutsker Nebel setzt Flugpläne außer Kraft.
Ich schaue über die Tragfläche hinweg: Vor uns blüht ein sonnenroter Morgen. In zwanzig Minuten müssten wir in Irkutsk landen. Und wenn diese Sonne ein Lächeln für diese Stadt übrig hätte, wäre ich am Vormittag in Ulan-Bator.
Die Düsenmaschine verändert den Kurs, kippt nach rechts weg. Das rote Feuerrad der Sonne rollt über die Tragfläche. Wir verlieren an Höhe; die Ohren schmerzen. Die Sonne ist wie vom Himmel gerissen. Mit ihr verschwand die Hoffnung auf ein sonniges Irkutsk. Wolken flitzen vorüber; Dunst, Nebel, sprühender Regen. Es dunkelt im Flugzeug. Die Deckenbeleuchtung glüht auf. Die Fenster haben ihren Sinn verloren.
Spaziergang an der Angara
Irkutsk an der Angara
Irkutsk an der Angara
Irkutsker Geschichten, aber nicht im Theater
Sieben Uhr; in Berlin ist es Mitternacht. Eine Stunde später stehe ich in der Flughafenhalle, wo die Wartenden auf den Lautsprecher blicken, als käme dort nicht nur die Stimme der Dame, sondern die Dame selber jeden Augenblick hervor: „Flugverkehr wird aus Sicherheitsgründen eingestellt.“
Man trinkt den heißen und so schrecklich süßen Milchkaffee, isst eisgekühlten Kaviar, hört das Schnappen der Kühlschränke, das Zischen der Espressos und vergisst ein bisschen, dass man in Sibirien ist.
Vor einem Jahr war ich auch in dieser Stadt.
Ich hatte mich einer Reisegesellschaft angeschlossen, die ihrem Wunsch gemäß – geführt von einem Sibirier, der englisch und französisch sprach – von Kirche zu Kirche hetzte, von Museum zu Museum jagte und sich alle paar Schritte darüber wunderte, dass der Sowjetstaat die Kirchen restaurierte, die Dächer neu bepinselte, die Spitzen frisch vergoldete. Solche Leute waren das. Ich habe nichts gegen alte Kirchen und gut gepflegte Museen, aber ich bringe die Kraft nicht auf, mir fortwährend auswendig gelernte Geschichte ins Ohr stopfen zu lassen. Das ist natürlich nicht nur hier so. Einer aus dieser Gesellschaft war geflüchtet: ein langer Amerikaner, alt, grauhaarig, ein Zeitungsmensch, der mir vom Flug her in Erinnerung war. Er hatte über Sibirien etwas von „oben nach unten“ gefilmt, obwohl das untersagt ist. Die Stewardess hatte ihn höflich noch einmal auf dieses Verbot hingewiesen. Damit hätte die Geschichte erledigt sein können. Der Mann drehte unverfroren weiter. Daraufhin entfernte man den Film, hielt ihn in die Sonne, die ihn auf ihre Art „entwickelte“. Dieser Herr war also aus der Reisegesellschaft geflohen. Und als ich ihn draußen traf, sah ich, wie er Dreck und Lumpen sammelte. Er filmte Kinder mit Rotznasen, eingefallene Gartenzäune, wacklige Holzbuden, winklige Seitengassen, alte Männer mit schiefen Mützen, kurz: alles das, was er zu Hause oder in jedem anderen Land auch hätte finden können. Dass er es nicht tat, um seinen amerikanischen Lesern zu zeigen, wie es zur Zeit des Zaren in Irkutsk ausgesehen hat, ging aus seinem blinden Eifer überzeugend genug hervor. So hatten wir beide aus verschiedenen Gründen die Reisegesellschaft verlassen. Er raffte gierig nach Altem, um es für Gegenwart auszugeben, ich suchte nach Neuem, um zu erfahren, wie das Alte überwunden wird.
Nun, zum zweiten Mal in der Stadt, besteige ich einen Bus und will hinunter ins Zentrum. Der Bus fährt mit Licht, der Bus fährt langsam. Die Straßenlampen brennen. Das gelbe Licht schwimmt im dicken Nebel. Hier und da huschen vermummte Gestalten durch den milchigen Dampf. Vor mir tauschen zwei Schuljungen Briefmarken. Neben mir klemmt ein junger Mann eine Schallplatte unter den Arm. Vom roten Etikett erhasche ich das Wort „Samba“. Es ist ein unübersehbares Glück für dieses Land, dass die modernsten europäischen Schlager nicht mit der Schnelligkeit an- und einreisen wie etwa die Flugzeuge; durch die riesige Entfernung leiert sich schon unterwegs ein Teil zu Tode. Sonst scheint man kritische Ohren zu haben; denn der junge Mann erzählt mir, dass er mit seinem Tonbandgerät einen deutschen Schlager aufgenommen habe, einen Dixieland, den er übersetzen wolle. In ihm würden einige Worte gesungen, die er weder in der Schule gelernt noch in einem Wörterbuch gefunden habe. Es müssen schwere Worte sein; denn er holt einen Zettel hervor. Insgeheim mache ich mir Gedanken, ob ich sie ihm ins Russische übersetzen kann. Lächelnd reicht er mir das Papier. Darauf steht achtmal: Zip–zip–zip–zip–zip–zip–zip–zip. Verschämt und ratlos erkläre ich ihm, das könne man nicht übersetzen.
Irkutsk ist eine dreihundert Jahre alte Stadt, die jung gemacht wird. In dem Wörtchen „gemacht“ stecken nicht nur Ziegel und Zement. Eine fast vierhunderttausend Einwohner zählende Stadt lässt sich nicht wenden wie ein Stück alten Stoffes, um ihn für neu auszugeben. Hier ist nichts auszubessern, nichts zu flicken, nichts zu verkleben und zu verputzen, hier musste von vorn angefangen werden. Man kann nichts wegreißen, ohne Neues zu bauen. Also muss erst gebaut werden; weil man die vierhunderttausend Menschen in der Zwischenzeit nicht in Urlaub schicken kann, müssen sie zu einem Teil noch in den alten Behausungen, in den sibirischen Holzhäusern, wohnen. Und eben diese Leute aus diesen Behausungen bauten sich ihre Universität, ihre Schulen, ihre Institute, ihre Werke, ihren Hafen, ihre Theater und – ihre neuen Häuser, von denen schon ein unübersehbares Meer in den nebligen Himmel ragt. Es sind noch nicht genug Häuser,– überall kratzen Bagger die Vergangenheit aus, schwenken Kräne mit ihren stählernen Armen ganze Hausfassaden über die geduckten Hütten der Vergangenheit.
In der großen Stadt, an einem verkehrsreichen Punkt, dort, wo Straßenbahnen, Autobusse, Fahrräder, Motorräder über den Platz hupen oder bimmeln und auch noch alte Troikas vorüberrollen, steht Lenin auf einem marmornen Sockel; dargestellt in der uns allen bekannten Geste des Redners. Hier scheint er auf die neue Stadt zu zeigen.
Während ich hinunter zur Angara gehe, einem Fluss, der sein Wasser aus dem Baikal ableitet, reißt der Himmel an einigen Stellen auf, zeigt blaue Flecke. An einem eisernen Tor, hinter dem ich einen Park vermute, der bis zu den Ufern des Flusses reichen muss, bleibe ich stehen. Ein Pappschild besagt, dass an diesem Tag der Park verschlossen ist. Obwohl es Juni ist, tun Sträucher und Bäume so, als stecke in ihren Wurzeln noch der eisige März. Ein weißbärtiger alter Mann wirft gelben Sand auf einen Weg. Als er mich sieht, lehnt er die Schaufel an einen Baumstamm, rückt seine Mütze gerade und kommt zu mir. Der Alte erinnert mich an Gorkis „Zimmermann Ossip“, der mit seinem Silberbart dem heiligen Nikolaus ähnlich war. Er sagt gar nichts, öffnet das eiserne Tor. Nachdem ich ihn gegrüßt habe, nachdem ich mich dafür bedanke, dass ich trotz Schildchen in den Park darf, meint er: „Ich muss doch aufschließen. Wie konnten Sie in Berlin wissen, dass in Irkutsk der Park freitags geschlossen ist?“
Unter meinen Füßen knirscht frischer Kies. Von Sträuchern und Bäumen tröpfelt Nebelwasser. Hin und wieder sticht die Sonne einen glitzernden, nassen Strauch heraus, doch nur für Sekunden; sofort zerren die Nebel wieder ihre Schleier vor die große gelbe Scheibe. Ich komme an einem blauen Tanzpavillon vorüber; am Rand einer Wiese steht ein kleiner Grasmäher, wie man ihn überall in den Anlagen verwendet. Feuchtigkeit glänzt matt auf ihm. Er sieht verweint aus. Da stehst du nun schon, denke ich, und das Junigras schlummert noch unter der schwarzen Erde, als fürchte es deine scharfen Messer.
Der graue Fluss ist breit und mächtig. Pfeiler ragen wie Fäuste aus dem Wasser, tragen eine der gewaltigen Brücken, über die Autokolonnen lautlos hingleiten, so lautlos wie unter ihr die schwarzen Frachtdampfer mit umgelegtem Schornstein. Die Fluten, schnell dahinschießend, haben sozusagen Feierabend; einige Meter oberhalb waren sie in die Turbinen gestürzt, hatten sie angetrieben und damit den Hunderttausenden helles warmes Licht in die Wohnungen gebracht. Jetzt brauchen sie nur noch Schiffe, Kähne, Segelboote und Ausflugsdampfer zu tragen. Eins der größten Kraftwerke ist hier in den letzten Jahren entstanden. Der Nebel hält es verborgen, aber auch ohne Nebel kann man seine wirkliche Größe nur ahnen. Hier hat sich die „Irkutsker Geschichte“ zugetragen, die wir in unseren Theatern nacherlebten, hier in der Angara ist Sergej ertrunken, und sicher wohnt irgendwo in der großen Stadt auch Walja mit ihren Zwillingen.
Aber es gibt noch andere „Irkutsker Geschichten“. Eine erzählt mir der weißbärtige Alte, als er mich wieder zum Tor hinauslässt. 1959 sei hier ein junger Mann aus Kiew eingetroffen, ein Maurer, der die ungeheuren Weiten auf Güterwagen überwunden habe. Anfangs wollte man den „undisziplinierten Kerl“, wie der Alte sagt, zurückschicken, aber da hat er eine Begründung gehabt, die den Verantwortlichen ein Lächeln entlockte: Er habe den Bau des größten Wasserkraftwerks in Kuibyschew versäumt, und jetzt, hier an der Angara, da wollte er endlich dabei sein, wenn so ein Riese entstehe. Unglücklicherweise habe der junge Maurer durch eine Unvorsichtigkeit einen Finger eingebüßt. Und es soll Leute gegeben haben, die sagten: Siehst du, wärst du in Kiew geblieben, da – Ja, so war das gewesen. Der junge wilde Kerl habe gemeint: Was ist ein Finger für so ein Werk, das Tausende Hände ersetzt. „Er war ein Feuerkopf, der Junge!“, meint der alte Mann. Und als ich jenseits des Tores stehe: „Beim Zaren wurden die Leute hierher verbannt, heut fahren sie schwarz auf Güterzügen nach Sibirien, um nichts zu verpassen.“
Wieder draußen im Flughafen, gehe ich auf mein Zimmer und öffne das Fenster. Der Platz liegt im Schlaf. Die Flugzeuge hocken mit ausgebreiteten Flügeln wie graue Krähen im Nebel.
In der Nacht fällt Regen über die Stadt. Am Mittag des nächsten Tages verjagt der Sturm den Regen und bläst wieder dicken Nebel ins Tal.
Gespräch über Fliegen
Am dritten Morgen erwachen endlich die Lautsprecher. Die Sonne bestrahlt ein Flugzeug der „MONGOLIA“. Im Restaurant esse ich eine heiße Borstsch (Kohlsuppe) mit kalter dicker Sahne. Die großen schweren Silberbestecke wirken auf mich, als wollten auch sie die Größe des Landes demonstrieren.
Meine Gedanken gleiten noch einmal zurück ins vergangene Jahr. Ich saß am selben Tisch und spielte mit zwei jungen koreanischen Offizieren Schach. Wir hatten uns während des Fluges kennengelernt. Als ich mit dem einen über das Spiel grübelte, schrieb mir der andere einige Sätze in mein Tagebuch, natürlich in der Sprache seiner Heimat: „In Ihren Augen haben wir unsere Herzen gesehen. Wir spielten Schach. Jeder erzählte von seiner Heimat. Wir sprachen so miteinander, als wäre Ihre Heimat unsere, und unsere Ihre! Im Flugzeug lernten wir drei einen weißhaarigen Herrn kennen, dem man einen Film aus der Kamera nehmen musste, um ihn zur Vernunft zu bringen. Dieser Herr war aus dem Land, dessen Soldaten unseren kleinen Koreanern das Wort DIEB mit Säure ins Gesicht schrieben, wenn sie vor Hunger einem Amerikaner einen koreanischen Apfel gestohlen hatten.“
Der rote Sonnenball steht über dem Flugplatz. Er hat den bösen Nebel zerfetzt. Ich steige in die mongolische Maschine. Mir ist, als betrete ich ein Stückchen Mongolei. Die kleine schwarzhaarige Stewardess grüßt jeden Passagier mit mongolischem „Guten Tag“: „Sainbaino“. Über dem Baikal schütteln Wolkenfäuste das Flugzeug, als wollten sie daran erinnern, dass es noch Irkutsker Gebiet sei. Über die weiße Runddecke der Maschine spaziert eine Fliege, die in Irkutsk „zugestiegen“ sein muss und derentwegen ich mit einem polnischen Journalisten ins Gespräch komme. Er sagt: „In der Mongolei gibt es mehr Fliegen als Menschen, in China mehr Menschen als Fliegen.“ In dem Augenblick kommt die Stewardess mit einer Klatsche und beendet den Spaziergang des blinden Passagiers. Dem Polen, der nach Peking fliegt – und der mir noch versichert, dass ich in der Mongolei nicht einen Zentimeter Asphalt zu Gesicht bekommen werde –, sage ich: Dass ich zum zweiten Mal in das Land reise, weil ich noch gründlicher sehen will, wie ein Volk, das zu Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts noch so lebte wie im dreizehnten, diesen ungeheuren Rückstand überwindet.
Die Baikal-Wolken haben wir hinter uns gelassen. Um uns ist nur noch Sonne, Sonne und blauer Himmel. Wir haben die Grenze überflogen.
Die Flüsse unter uns wirken wie die gespreizten Finger vieler Kinderhände. Um das Rund eines faltigen Berges rasen Pferde. Staubfahnen lodern. Adler kreisen. Jurten leuchten zu uns herauf, erinnern an umgestülpte weiße Trinkschalen.
Ich bin wieder da, mir wird warm, und ich freue mich auf das Wiedersehen.
In der Hauptstadt
Der zweite Eindruck
Ich stehe auf dem Balkon des Altai-Hotels im Zentrum der Hauptstadt.
Die Geräusche, die vom weiten Suche-Bator-Platz zu mir heraufdringen, empfinde ich bei meinem zweiten Besuch wie die Melodie eines lieb gewordenen Liedes. Dazu gehört das Pfeifkonzert der Verkehrspolizisten, die, sonnenbebrillt, auf Kreuzungen stehen, mit eleganten Bewegungen blitzende Wolgas und Skodas, schwer beladene Kraftwagen und staubige Jeeps, zweirädrige Pferdekarren und lastenschaukelnde Kamelkarawanen in die gewünschte Richtung weisen. Dazu gehören die hellen Kinderstimmen, die aus dem Gewühl herausflattern wie die vielen Tauben, deren Zahl keiner zu nennen vermag. Dazu gehört der Apfelverkäufer im weißen Kittel, der unter mir steht und seine rotwangigen Früchte in die Messingschale der Waage fallen lässt. Er verkauft pfund- oder kiloweise. Erlauben sich vier Äpfel, fünfhundertzwanzig Gramm zu wiegen, greift er zum Messer, schneidet zwanzig Gramm ab, um sie dem zu geben, dessen Äpfel mit vierhundertachtzig Gramm ausgewogen wurden. Um ihn scharen sich Leute in farbigen Trachten, Männer mit weißen Filzhüten, Frauen in bunten Kopftüchern. Sie scharen sich auch um einen Limonadenverkäufer, um einen Mann, der helles Gebäck anbietet, um eine Frau, die weißes Brot und harte rote Wurst verkauft und ihren Stand neben einem Kiosk hat, wo Gedichtbändchen einen beneidenswerten Absatz finden.
Der Suche-Bator-Platz ist das Herz der Stadt.
Zu diesem Herz gehört die Ruhestätte des Führers der Revolution, nach dem dieser Platz benannt ist. In den vielen Fenstern des grellweißen Regierungsgebäudes blitzt die Sonne. Drüben im Staatstheater spielen sie die dritte Woche Shakespeares „Othello“.
Es ist eine breit angelegte, sich weit dehnende Stadt. Man kann sie von hier nie begreifen, nicht erfassen. Und so steigen wir in ein Auto, reihen uns in den Strom, fahren hinaus in die nahen Berge, die Ulan-Bator umgeben. Es sind heilige Berge, umwoben von Legenden und Sagen. Und auch jener Berg ist nicht allzu weit, in dessen Wäldern sich einst der junge Temudschin, der spätere Dschingis-Khan und „Herrscher aller in Filzhütten lebenden Völker“, mehrmals vor den Merkiten verbarg, weil einen „Vogel, der im Käfig saß und in den Busch geflüchtet ist, der Busch schützt“. Nach drei Tagen stieg er wieder vom Berg Burhan. In der „Geheimen Geschichte der Mongolen“ erzählt er: „Weil die alte Cho-achtschin wie ein Iltis hören, weil sie wie ein Fuchs sehen konnte, bin ich auf den Burhan entkommen, um mein eigenes Leben zu retten und, nur mit Halfter und Pferd mich auf Hirschpfaden durchwindend, mir eine Ulmenhütte zu bauen. Durch den Burhan Chaldun ist mir mein Leben bewahrt worden. Auf den Chaldun bin ich entkommen, um mein alleiniges Leben zu schonen und, mit einem einzigen Pferd auf dem Pfad eines Elches mich durchwindend, mir eine Hütte aus Weidenruten zu bauen. Durch den Chaldun Burhan ist mir mein Leben beschützt worden. Ich habe große Angst ausgestanden. Den Burhan Chaldun will ich jeden Morgen durch Opfer ehren, und jeden Tag will ich ihn anbeten. Meine Kinder und Kindeskinder sollen dessen immer eingedenk sein!“
Diese Geschichte ist siebenhundert Jahre alt, Ulan-Bator, das früher Urga hieß, dreihundert. Eine Stadt ohne Sehenswürdigkeiten, wenn man darunter nur das versteht, was wir in Paris „Arc de Triomphe“, in Prag „Hradschin“ oder, um nach Asien zurückzukehren, in Peking „Verbotene Stadt“ nennen. Freilich, wer zum ersten Mal hier weilt, auf den wirken die Eindrücke wie eine Sturzflut. Schon zu Hause träumt er sich das Land vor, setzt insgeheim goldene Lichter auf, damit es noch schöner funkelt, und wenn er da ist, findet er es anders vor als geträumt, noch schöner. Alles ist interessant, auch das Uninteressante. Hinzu kommt, dass er vielleicht von der Angst gepeinigt wird, nur vier Wochen hier zu sein. In dieser Zeit will er alles kennenlernen, auch wenn das Land fast fünfmal so groß wie Deutschland ist. Es könnte einer daheim fragen: Hast du auch dies und jenes gesehen? Nein? Dann bist du nicht dort gewesen. Reiseprospekte behaupten das auch. Er wird also mit einem Zettel in der Tasche umherrennen, auf dem seine Stationen vorgezeichnet sind. Er wird abhaken. Theater gesehen: Häkchen, Pionierpalast besucht: Häkchen, im Tempel gewesen: Häkchen, Kombinat besichtigt: Häkchen. Bestandsaufnahme, sonst nichts, Bestandsaufnahme eines Besichtigungskranken.
Aber diesmal habe ich acht Wochen Zeit. Man ist sicherer im Blick. Man wundert sich nicht mehr über jedes Kamel so, als sei es das letzte auf Erden. Man bestaunt nicht mehr eine besonders hübsche farbige Tracht, als gäbe es sie nur einmal. Man weiß, was vor einem liegt, kann etwas von dem Gefühl – acht Wochen Zeit! – in die Tage fließen lassen.
Mit dieser Ruhe sitze ich auf einem der legendären Berge, blicke hinunter auf die Stadt, die ihre hellen Straßenarme in alle Himmelsrichtungen ausstreckt. Da liegst du vor mir ausgebreitet, denke ich, schaust zu mir herauf, zeigst mir dein weißes Antlitz; denn man nennt dich auch die „weiße Stadt“. Von Tag zu Tag wirst du jünger, und man versteht dich erst, wenn man deine Vergangenheit kennt. Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts besuchte der russische Forschungsreisende Pewzow die Stadt Urga und schrieb: „In Urga verschmelzen zwei Städte, die mongolische unter dem Namen Bogdo-kuren oder Da-kuren und die chinesische unter dem Namen Maimatschin. Beide Stadtteile sind fünf Kilometer voneinander entfernt, und dazwischen liegt auf einer Anhöhe das russische Konsulat. Das einstöckige Gebäude ist aus Holz gebaut und mit Ziegelsteinen verkleidet. Außer mehreren Seitenflügeln sind ihm auch einige Wirtschaftsgebäude angegliedert. Dieser weiträumige Bau, der seinesgleichen in der ganzen Mongolei nicht findet, zieht immer wieder die Blicke der von fern her kommenden Mongolen auf sich. Sie schauen das Haus verwundert an und bleiben lange vor ihm stehen.“
Damals war es noch eine Zeltstadt. Tausende Jurten beherbergten fünfzehntausend Bewohner. Und dieses eine Haus wirkte wie vom Himmel herabgelassen, wie ein Palast zwischen Zelten und Lehmhütten, wie ein Schloss auf der Weide, umgeben von Kamelen, Schafen, Pferden, Ziegen, denn seit Jahrhunderten zählte das Nomadenwort: „Wo sich der Mongole niederlässt, ist seine Wohnung.“
Tempel gab es auch, viele Tempel. Und tausend Götter. Mehr Götter als Lesende und Schreibende. Die Lamas lehrten den Menschen das „OM MANI PADME HUM“ (O Kleinod in der Lotosblüte). Das beteten sie zu Pferde, zu Fuß, auf der Weide, im Halbschlaf. OM MANI PADME HUM – diese Worte sollten nach der Lehre wundertätige Kraft besitzen, je mehr sie gebetet wurden. Man schrieb sie auf Churden, die man wie Mühlräder an Bächen aufstellte, man schrieb sie auf Zylinder, in denen Gebetsrollen lagen und die Jahrhunderte nach rechts gedreht wurden, man schrieb sie auf Steine und an Felswände. OM MANI PADME HUM – verlangten Tausende Lamas, die das Volk täuschten, es ihren Unterdrückern, den feudalen Fürsten, in die Arme trieben. Ein ganzes Volk kniete jahrhundertelang hungrig im Staub, drückte seine Stirnen auf Betbretter, damit der Verstand, wie es hieß, erleuchtet werde. OM MANI PADME HUM ...
Ich weiß nicht, aus welcher Schlucht sie gekommen sind, aber ich blicke über die Stadt hinweg zu den Bergen des Nordens. Von dort stürmten die Reiter Suche Bators und Tschoibalsans heran. Sie trugen auf ihren roten Fahnen das alte Sojembo, das schon in vergangenen Jahrhunderten auf Fahnen leuchtete, wenn es zum Kampf gegen Unterdrücker und fremde Eroberer ging. Auf ihm lodert Feuer, das Wiedergeburt bedeutet, auf ihm scheinen Sonne und Mond, die sagen, dass das mongolische Volk ewig leben und gedeihen werde, auf ihm sind zwei Fische abgebildet, die das Volk aufrufen, klug und weise zu sein, wach wie die Fische. Und die zwei nach unten gerichteten Pfeilspitzen fordern: Tod den Feinden des Volkes! Mit dem Sojembo auf dem Banner kämpfte im 17. Jahrhundert der mongolische Aufklärer Tsogtu Taij gegen die Mandschu-Kaiser und die Oberhäupter des Gelben Klosters, trug es hinauf zum Plateau des Schneelandberges. Dieses Symbol der Freiheit und Unabhängigkeit trugen im Jahre 1911 und 1912 die Kämpfer Hatan Bator Magsarjavs im Kampf gegen die Mandschu-Truppen, hissten die Fahne mit diesem Zeichen über der Festung Kobdo, die von den Mandschus für unüberwindlich gehalten wurde. Und im Jahre 1921 war es Suche Bator, der mit seinen Genossen Urga befreite, die Revolution zum Sieg führte. Dieser achtundzwanzigjährige Held war ein Schüler Lenins; die Partei, die er führte, war kaum ein Jahr alt. Die Befreiung war eine Frucht der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution, über der Jurtenstadt wehte die Fahne mit dem Sojembo.
Noch lebte der Bogdo-gegen, der Fürst-Lama. Noch rutschten viele auf Knien um die Stadt, noch glaubten viele, dass dieser vier Kilometer lange Weg, den sie eines Gelübdes wegen dahinkrochen, ihr Weg zur Zukunft sei. Der Staub, den sie aufrührten, stieg weiter zum blauen mongolischen Himmel, verdunkelte ihren Blick. In den Seuchen, die im Land herrschten, in den fünfzig Toten von hundert Geborenen, sahen sie immer noch die „Strafe“ dafür, dass sie das OM MANI PADME HUM zu wenig beteten, die Gebetsmühlen zu selten drehten. Während die einen die Revolution unterstützten, indem sie Pläne für die Zukunft des Volkes schufen, lasen andere ihre Zukunft weiterhin aus Schafsknochen, die sie ins Feuer legten.
1924 wurde die Volksrepublik ausgerufen.
Die junge Sowjetunion, von Feinden umlauert, war das einzige Land, das diesen neuen Staat unterstützte und anerkannte. Schulen wurden gebaut: Götter lassen sich nur durch Wissen besiegen. Die Zeit der inneren Kämpfe begann. An der Ostgrenze standen die imperialistischen Japaner, fielen ein, verwüsteten zu einem Teil das, was unter unsagbaren Schwierigkeiten geschaffen worden war. Doch das Neue schlug schon in tausend Herzen, bewegte Hirne und Hände, riss immer mehr von den harten Betbrettern, so dass dieses OM MANI PADME HUM an Kraft verlor und nur noch über welke Lippen torkelte. Aus Urga war Ulan-Bator geworden, zu deutsch: Stadt des roten Helden.
Neben mir sitzt mein Dolmetscher Namchei-Zeren. Ein lang aufgeschossener Mann, den die junge Volksregierung im Jahre 1926 mit dreißig anderen Schülern nach Deutschland schickte, da es im eigenen Land noch zu wenig Schulen gab. Namchei ist Kunstmaler und arbeitet als Bühnenbildner am Staatstheater in Ulan-Bator. Während ich die Stadt betrachtete, einen Ausflug in die Geschichte unternahm, hat er sie aquarelliert. Deutlich erkennbar ragt aus der Mitte des Bildes das Suche-Bator-Denkmal im Zentrum. Bewusst von ihm erhöht, wirkt es als Wahrzeichen dieser Stadt, umgeben von Regierungsgebäude, Universität, Theater, Außenministerium, Hotel, Kino, Postamt, Klub und Warenhaus. Auch ein weiteres Theater und ein Hotel, die noch im Rohbau sind, hat Namchei auf seinem Bild schon fertiggestellt, und das wiederum wird von vielen neuen Wohnblöcken umgeben, die an breiten Alleen stehen. Ebenfalls die neuen Straßen sind bei Namchei fertig, doch ich blicke hinunter zu ihnen und sehe die Dampfwalzen, acht hintereinander, wie sie pusten, schwarze Rauchwölkchen in den Himmel stoßen. Bei den vorn liegenden Häuserreihen wird mein Freund Namchei fast pedantisch; da malt er sogar liebevoll die vielen kleinen bunten Balkons mit auf das Bild. Ich verstehe ihn, ich begreife diese Liebe, und ich weiß, dass sie bis zu dem Wunsch reicht, eins der neuen Häuser im Schnitt zu zeigen, damit man in die Drei- und Vierzimmerwohnungen blicken kann, bis ins Bad. Der Stadtrand wird von Namchei mit grünbraunen Flecken umgeben. Hier löscht er auf seinem Bild das, was die Vergangenheit der Stadt ahnen lässt. Alte schiefe Lehmhütten, um die sich unfreundliche Palisadenzäune schlingen. Verwinkelte Gassen, holprig und dunkel. Grasbewachsene Dächer. Und Jurten, viele Jurten stehen noch da, oft sind sechs oder acht von einem hohen Bretterzaun eingefasst, der gegen Sturm schützen soll. Diese Reste eines Nomadenlebens stehen ihre letzten Tage. Die großen Bagger mit ihren klirrenden Stahlraupen kriechen schon auf sie zu.
Hinter uns dröhnt der heiße Sommerwind in den Lärchen- und Zedernwäldern. Am Fuße des Berges schlängelt sich die himmelblaue Tola. Es ist ein märchenhaftes Blau, das einen vergessen lässt, wie gefährlich dieser Fluss mit seinen Strudeln sein kann. Er teilt sich in viele Arme. Draußen vor der Weststadt zerfasert er in kleine Fäden, die von hier wie auf Steine geworfenes blaues Garn aussehen, über großen Inseln, auf denen sich gelbgrüne Wasserweiden wiegen, gleiten Scharen von Bussarden.
Als wir aufgestanden sind, sagt Namchei: „Die weiße Holzbrücke da unten habe ich gebaut.“ Er sagt das in einem Ton, als bauten überall auf der Welt Kunstmaler Brücken.
„Sie?“
„Na ja, bei uns muss man vieles machen, ohne es gelernt zu haben.“
„Aber die Berechnungen und –“
Ich weiß selber nicht genau, was zu einer Brücke gehört.
Namchei ist ein Mensch, der sich für alles verantwortlich fühlt. Sein Zuständigkeitsbereich scheint unbegrenzt, wie ich in den folgenden Wochen erlebe. Er habe China besucht, und das zu einer Zeit, als es in der Mongolei noch keine Brücken gab. Dort habe er sie auf seinem Skizzenblock abgezeichnet, Einzelheiten vermerkt, immer in der Absicht: Eines Tages brauchen auch wir das!
Fast zwanzig Jahre ist über diese lange Holzbrücke der Verkehr in die Stadt geflossen. So gut war die Brücke eines Kunstmalers, die ich mir heimlich als „Namchei-Zeren-Brücke“ in meinem Tagebuch notiert habe. Heute dient sie dem Karawanenverkehr, den Pferdekarren und Reitern; ein Stückchen dahinter hat man eine moderne Betonbrücke gebaut, von der ein breites graues Asphaltband in die Stadt führt. Die Straße ist eingefasst von jungen silberstämmigen Espen, denen man wünschen muss, ihren ersten Winter schadlos zu überdauern; denn seine fünfundvierzig Grad werden ihnen arg zusetzen.
Wir kommen an einem Obo vorüber. Das ist ein Haufen zusammengetragener Steine, der zwei bis sechs Meter hoch sein kann. Diese Kegel schichtete man an sichtbaren Stellen zu Ehren eines Geistes, des Beherrschers eines Berges, Passes, Flusses oder Weges, auf. Manchmal steckt eine lange, dünne Stange zwischen den Steinen, an der bunte Stofffetzen oder Glöckchen hängen. Hier brachte man den Geistern Opfer dar, sprach Gebete, ruhte aus. Dieser Brauch geht in die Zeit des Schamanentums zurück.
Namchei lädt mich zum Sitzen ein. „Es ist eine alte Tradition“, erzählt er mir, „wir lieben sie noch, pflegen sie, auch wenn wir nicht mehr an Geister glauben und ihnen Opfer bringen.“ Er blickt mich an, als wollte er meine Gedanken enträtseln, als fürchte er, allein mit seiner Meinung zu sein. „Die Obos stehen überall in der Mongolei an den schönsten Stellen. Es sind guttuende Ruhepunkte. Kein Mongole wird achtlos an ihnen vorüberreiten, kein Hirt wird es versäumen, abzusitzen, seine Edelsteinpfeife aus dem Stiefelschaft zu ziehen, zu rauchen und über das weite Land seiner Heimat zu schauen.“ Oft reißt der Sturm einen Stein aus diesem Kegel. Ob Erwachsene oder Kinder, wer vorübergeht, hebt diesen Stein auf und legt ihn wieder zu den anderen.
Nun sitzen auch wir da, erfreuen uns dieses gewählten Platzes, schauen zu den Bergen des Westens, hinter denen sich unendliche Steppen ausbreiten, deren Leere einen Fremden schmerzen kann. Ich schaue zurück zu den Bergen, in dessen Wälder sich Dschingis-Khan rettete, und ich weiß, hinter diesen Bergen fällt das Land ab, fließt in eine unendliche Ebene, die man Wüste Gobi nennt. Der Einheimische empfindet diese Leere nirgends, wie mir ein Lied auch beweist, das Namchei übersetzt – allerdings mit der Einschränkung, dass Übersetzungen einem Original nie gerecht werden können:
Beeren und Edelsteine sind der Ruhm der Berge und Wälder, in denen sie wachsen. Ein mutiger, redlicher Mann preist seine Heimat, seinen Ail. Rein und mächtig ist unser herrliches Land, viele Herden weiden auf seiner breiten Brust. Die ewig murmelnde Wasserquelle kennt keinen Schmutz, die wind- und sonnenerfüllte Steppe keinen schlechten Geruch. Ich singe, gleich dem Wind im dichten Federgras, von meinem glücklichen, schönen Vaterland wie schon mein Volk in den alten mongolischen Heldenliedern. Weit erstrecken sich die dreiunddreißig Gobi-Wüsten, die noch kein Held durchwandert hat. Weit dehnen sich die vom Wind umwehten prächtigen grünen Hügel, deren Ende du nicht siehst, wanderst du auch viele Monate lang. Acht gelbe Steppen verschwinden im Dunst, wenn der Sturm heult, acht herrliche gelbe Steppen, deren Ende du nicht siehst, wanderst du auch viele Jahre lang.
So schön, so weit ist meine Heimat … (Diese Übersetzung wurde vervollständigt nach Mursajew, „Auf unbetretenen Pfaden“, Brockhaus-Verlag Leipzig.)
Namchei hat diese Worte wie ein Dichter gesprochen. Aber er beteuert mir noch einmal, dass das Lied in der mongolischen Sprache „tausendmal schöner sei“. „Da hört man den Sturm“, sagt Namchei, „da riecht man das Gras, den Wermut, da spürt man die Weite. Die mongolischen Worte, die sind wie – ich weiß es nicht, ich kann es deutsch nicht sagen. Nehmen wir das Wort ,weit‘. Als ich damals in Deutschland war, machten wir in Thüringen Schulwanderungen. Manchmal sagte der Lehrer: Nehmt euch zu essen mit, es ist sehr weit! Und dann waren es fünf oder höchstens acht Kilometer, die wir wanderten. Es hat unter uns Mongolenkinder gegeben, die sich heimlich ein Beutelchen Tee einsteckten. Ein Mongole, der einen weiten Weg vor sich hat, nimmt Tee mit. Unser Wort ,weit‘ drückt etwas anderes aus. Sie werden es noch unten in der Gobi erleben. Fragt man dort die Leute, wie lange man bis zum nächsten Dorf braucht, sagen sie: Das ist nicht weit. – Aber es werden mindestens neunzig Kilometer sein, und das, – das ist wirklich gar nicht weit.“