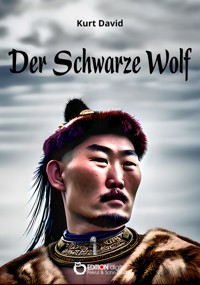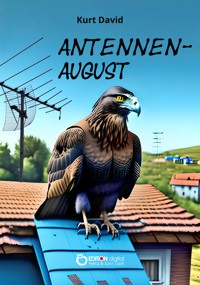6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Seine ersten musikalischen Erfahrungen machte er bei einem Spielmann, Spielmann wollte er auch werden. Der Vater hingegen wollte etwas Solides aus ihm machen, er sollte Schulmeister werden wie er selbst und seine Brüder. Ein schwerer Konflikt im Leben des jungen Franz Schubert, der immer wieder aufbrach. Aber es ist auch nicht leicht für einen braven und etwas despotischen Lehrer, ein Genie zum Sohn zu haben. Kurt David zeichnet in seiner meisterhaften Erzählung ein warmherziges Schubert-Bild vor dem Hintergrund seiner Zeit, der Zeit der napoleonischen Kriege, der Zeit Metternichs und des Wiener Kongresses.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impressum
Kurt David
Der Spielmann vom Himmelpfortgrund
ISBN 978-3-96521-934-2 (E-Book)
Das Buch erschien erstmals 1964 in Der Kinderbuchverlag Berlin.
© 2023 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Für Leser von 12 Jahren an
Draußen in der Vorstadt
Ein grauer Himmel hing schmal und schwer über der Gasse. Die Häuser duckten sich unterm Schnee, Wind wehte über frierende Weingärten, und der Knabe wurde geboren. Das fahle Mittagslicht wagte sich schüchtern in die enge Stube. Eine Uhr tickte, deren Pendel mit seinem matten Schatten hin und her schwang.
Der Vater hatte die Kinder hinausgeschickt. In blauen Wollstrümpfen lief er über die Diele und trat an das Bett seiner Frau. Mit einem weißen Tuch wischte er ihr den Schweiß aus dem Gesicht und sagte, ein Stück Schwarzbrot reichend, leise: „Schweiß und Brot liegen im Leben für die meisten dicht beieinander.“ Sie nahm das duftende Brot und biss hinein. In ihren Augen blitzte Schmerz.
„Ich hör nur die Uhr! Atmet es noch?“
„Es atmet, Elisabeth!“ Er beugte sich über das Neugeborene. „Lass mal, das Schreien lernt er.“
Plötzlich begann der Knabe zu wimmern, zart und unaufdringlich begrüßte er die Eltern, die düstere Stube, die große Welt, obgleich ihn diese Welt noch nicht hörte und er noch nichts von ihr wusste. Doch etwas musste es in seinem kleinen Reich schon geben, das ihn enttäuschte; denn seine roten Fäustchen fuchtelten ungelenk vor seinem Gesicht. Über das blasse Antlitz der Mutter aber huschte ein zärtliches Lächeln.
Das Haus, in dem das geschah, trug den Namen „Zum roten Krebsen“ und stand unweit des Wienerwaldes und des Kahlenberges am Himmelpfortgrund, ein Name, der von einem alten Kloster herrührte, ein Ort, der mehr Dorf als Stadt war und in dem es mehr Kinder als Brot gab. Neben Handwerkern wohnten hier draußen vor allem Arbeiter und Tagelöhner, die in die Seidenmanufakturen gingen, in einer Porzellanfabrik, Brauerei oder Ziegelei ihren mäßigen Lohn verdienten.
Als der Tag verlosch, entzündete der Mann eine Kerze und beriet sich mit seiner Frau, welchen Namen sie dem Neugeborenen geben sollten. Während sie überlegten, entnahm er dem Tischkasten ein blaues Heft, auf dem zu lesen stand: „Geburts- und Sterbefälle in der Familie des Schullehrers Franz Schubert.“ Dieses Register sowie die längere Überlegung, wie der neugeborene Sohn heißen solle, schienen schon deshalb notwendig, weil der Knabe das zwölfte Kind der Ehe war und acht Kinder bei der Geburt oder kurz danach wieder gestorben waren.
„Nennen wir ihn Franz“, sagte der Vater, „Franz, wie unseren guten Kaiser Franz.“ Er schaute hinüber zu seiner Frau und wartete, bis sich ihre blauen Lippen ein wenig öffneten.
„Ja, Franz soll er heißen, Franz – wie du.“ Sie sagte es müde und fast teilnahmslos, als fürchte sie, auch dieses Kind könnte nicht lange leben.
Daraufhin schrieb der Schulmeister Franz Theodor Florian Schubert in seine Familienchronik neben der Nummer zwölf das Datum vom 31. Januar 1797 und den Namen Franz.
Begleitet von seinem Bruder Karl, trug er tags darauf den Knaben, in eine lederne Decke gehüllt, in das nahe gelegene Liechtental, wo er in der Pfarrkirche „Zu den vierzehn Nothelfern“ getauft werden sollte.
Der Kooperator, ein Hilfsgeistlicher namens Wanzka, wartete in der Sakristei auf sie und führte die Brüder mit dem Bündel in die Kirche zum Taufstein, betete, betupfte die Sinnesorgane des Knaben mit einem öligen Wattebausch und besprengte ihn mit Weihwasser. Da die Sonne schien, fiel das bunte Licht der hohen Glasfenster auf ihre Gesichter. Unter dem steinernen Kirchenhimmel war es kalt. Die silbernen Orgelpfeifen blickten schweigend und wie zu Eis erstarrt auf den Täufling und seine Umgebung.
Wieder in der Sakristei, beglückwünschte der Hilfsgeistliche den Vater zur Geburt des Kindes und bestätigte auf dem Taufschein, „dass Franz Schubert ein ehelich erzeugter Sohn des Herrn Franz Schubert, Schullehrer, und dessen Ehegattin Elisabeth geborene Fitz, beide katholischer Religion, am Himmelpfortgrund Nr. 72 geboren und am 1. Februar 1797 von dem Kooperator Johann Wanzka im Beisein des Herrn Karl Schubert, Schullehrer, als Paten, in hiesiger Pfarre nach christkatholischem Gebrauch getauft worden ist“.
Beim Abschied sagte Herr Wanzka: „In seiner Güte hat der Herrgott acht Ihrer Kinder frühzeitig zu sich genommen, vielleicht vollbringt er in seiner unermesslichen Liebe diesmal das Wunder und schenkt diesem Knaben Franz ein längeres Leben.“
Der Schulmeister Schubert dankte und schritt mit seinem Bruder und dem in Leder gehüllten Bündel unterm Arm wieder hinaus in den Winter und durch die Gassen am Himmelpfortgrund, vorbei an sechsundachtzig Häusern, bescheidenen Hausungen, in denen dreitausend Menschen eng beieinander wohnten.
Der kleine Franz blieb am Leben, zum Glück der Menschen, die da waren und noch sein werden.
Sonnenblumen vor weißen Wolken
Die Schuberts stammten aus Mähren. Sie hatten als Bauern und Holzfäller gearbeitet und an den Rändern des Hochwaldes gewohnt, unter Schindeldächern und auf fürstlichen Wiesen und Äckern. Karl Schubert, Ortsrichter im mährischen Neudorf, angesehen und wohlhabend geworden, hatte zwei seiner Söhne zur Ausbildung als Lehrer nach Wien geschickt, in das Wien Josephs II., eines Monarchen, der die fortschrittlichen Reformen seiner Mutter, Kaiserin Maria Theresia, übernahm und erweiterte, indem er die Erziehung dem Klerus entzog, die Leibeigenschaft beseitigte, Handel und Manufakturen förderte. Einer dieser zwei Söhne des mährischen Ortsrichters war Franz Theodor Florian Schubert, der spätere Schulmeister am Himmelpfortgrund und Vater unseres kleinen Franz. Ein energischer Mann, ernst und fromm, gutherzig und streng, immer darauf bedacht, seinem Kaiser zu dienen und zu gehorchen, auch wenn es nicht mehr Joseph war, der herrschte, sondern Franz II. Dieser Kaiser hob fast alle Reformen seiner Vorgänger wieder auf, führte eine Schulpolizei ein, die nicht nur Kinder und Studenten, sondern auch Lehrer überwachte, ließ die Josephiner verhaften, einen Teil hinrichten oder zu lebenslangem Kerker verurteilen, weil sie sich der Aufhebung der Errungenschaften unter Joseph II. widersetzten.
So wuchs Franz mit seinen älteren Brüdern Ignaz, Ferdinand und Karl, zu denen sich später noch eine Schwester Maria Theresia gesellte, unter einer Erziehung auf, welche die Herrschaft Kaiser Franz II. als einen natürlichen und von Gott gewollten Zustand ansah.
Die ersten Jahre vergingen, und dem kleinen Franz war, als wüchse nicht er, sondern sein Vater, der ihm immer größer erschien, unerreichbar groß, da er alle Fragen beantwortete, Verbote aussprach, Strafen verhängte und unentwegt als einziger tadelte. Die Mutter blieb dagegen gleich; sie erzählte abends am Bett kleine Geschichten, die er verstand, gut verstand, die er liebte und oft wiedererzählt haben wollte, während er Vaters dunkle Worte manchmal nicht begriff. Und die Mutter konnte lächeln und weinen, was der Vater anscheinend nie vermochte.
So blieben in Franzens kleiner Seele nur jene Erlebnisse lebendig, die schön waren und ihn reich machten, schön wie Blumen auf einem kargen Boden.
Sie waren umgezogen, in ein Haus der angrenzenden Vorstadt Rossau, das „Zum schwarzen Rössel“ hieß und in dem sich das Schulzimmer seines Vaters befand.
Vor dem Hoftor blühte eine Akazie.
Die Sonne schien, und ein italienischer Salami- und Käseverkäufer schrie durch die Gasse: „Salamini – Keso! Salamini – Keso!“ Eine Schar Kinder umringte ihn, darunter der kleine Franz. Unter dem breitkrempigen schwarzen Hut des Verkäufers glänzte sein braunes Gesicht. Die Frauen im Hof verließen den Brunnen und ihre Waschtröge, rochen an Käse und Salami, scherzten und kosteten; zwei kauften Käse und wickelten die dicken gelben Scheiben in ein weißes Tuch.
„Salamini – Keso!“, schrie wieder der Verkäufer und wanderte in den nächsten Hof.
Ein paar Kinder rannten hinterher.
Franz blieb unter der schattigen Akazie und hörte die Stimme seines Vaters aus dem Schulzimmer. „A – B – C – D – und alle!“
„A – B – C – D“, antwortete der kleine Chor, und die hell klingenden Stimmen flatterten in das Geäst des blühenden Baumes, schlüpften unter das grüne Blätterdach, wo sie verstummten.
„A – B – C – D – E“, buchstabierte der Vater, und ein voreiliger Junge rief: „E – wie Esterreich!“
„Dummkopf“, sagte der Vater, „E – wie Esel!“
Die Kinder lachten. Franz aber lächelte unter dem Fenster. Er wusste, dass Österreich mit ö geschrieben wurde und dass nach D – E und F kamen; denn er hörte es Tag für Tag, früh wie mittags, und er kannte alle Worte, mit denen der Vater den Kindern das Alphabet beibrachte. Er sagte: A – wie Apfel, B – wie Brot und C – wie Cäcilia. Und bei Cäcilia hielt er sich immer etwas länger auf, fügte hinzu, dass sie die Schutzgöttin der Kirchenmusik und Erfinderin der Orgel wäre.
Auf der Gasse ritt eine Schar Offiziere mit ihren Damen vorüber. Sie saßen auf prächtigen Schimmeln und trugen fesche Uniformen, an denen sich Franz nicht satt sehen konnte. Die Knöpfe blitzten in der Sonne wie Gold, und in den tief herabwehenden Seidenkleidern der Damen raschelte der Reitwind.
Aber all das, was Franz hier sah, angefangen beim italienischen Salamiverkäufer, über Vaters Alphabetstunde bis zu den reitenden Offizieren, war nichts, nichts gegen das, was er bei einem Spielmann empfand, was in ihm klang und jubelte, wenn ein Spielmann durch die Höfe zog. Der Salamiverkäufer rief und sang immer das gleiche, der Vater buchstabierte immer das gleiche, die Offiziere und ihre Damen saßen immer auf prächtigen Pferden und ritten immer in gut sitzenden Uniformen und kostbaren Kleidern. Aber der Spielmann! Der Spielmann in seinem abgewetzten Rock, der brachte immer neue Melodien und neue Worte in die Gasse, als schöpfe er seinen Reichtum aus einem Brunnen, dessen Tiefe nur ihm zugänglich wäre.
Während Franzens Vater oft in der Familie vom Kaiser sprach und sich Franz diesen Monarchen nicht gut vorzustellen vermochte, lediglich dachte, der Kaiser muss so sein wie Vater, sonst würde er ihn wohl nicht lieben, wünschte sich der Junge in seinen Träumen, der beste Spielmann müsste Kaiser sein.
Auch an diesem sonnigen Frühlingstag, als Franz den Reitern nachblickte, bog ein Spielmann in die Gasse. Er ging in zerrissenen Schuhen und blickte aus flinken kleinen Augen, die listig und lustig umherschauten und von welker Haut umgeben waren.
„Holt’s alle Leut, nur nicht die Schiefgucker“, rief er, zog seine Geige aus einem Beutel und stellte sich unter die Akazie, spielte, sang, tanzte, lachte, weinte, fiedelte seine Melodien in die Herzen der Frauen und Männer, Mädchen und Jungen, die begeistert in die Hände klatschten. Und der kleine Franz klatschte mit. Wenn er auch etwas abseits stand, so nur aus Scheu und Bewunderung. Der Werkelmann, wie man die Leute nannte, sang ein Liedchen, in dem die Worte vorkamen, dass Tanzen auch Gottesdienst sei, ein Beten mit den Beinen. Als ein schnauzbärtiger Polizist vorüberschritt und misstrauisch unter seinem Helm hervorguckte, wandelte der Spielmann die Melodie ab und besang den Kaiser und dessen unendliche Güte. Allerdings ließ er dabei die Geige sehr kläglich jammern und den Fiedelbogen auf den Saiten kratzen, als gälte es, sie zu durchsägen. Aus dem pfiffigen Lächeln des Spielmannes, der mit dem Instrument vor dem Gesicht des Polizisten herumfuchtelte, konnten die meisten Leute entnehmen, weshalb die Geige so jämmerlich klagte. Der kleine Franz Schubert fand bald heraus, dass ein Spielmann nur dann gut musizierte, wenn kein Polizist in der Nähe stand.
Selbstverständlich hielt der Musikant, nachdem er geendet hatte, dem Polizisten zuerst seinen Hut hin; denn jetzt sammelte er Geld für sein Spiel, das die Leute gern gaben.
Der Uniformierte tippte mit den Fingerspitzen an den Helm und ging weiter, ohne eine Münze in den Hut geworfen zu haben. Dadurch waren sie den Mann am ehesten los, und der Musikant wanderte zufrieden in den nächsten Hof, hinter ihm der kleine Schubert, der vor Eifer das Schulzimmer seines Vaters und das Buchstabieren vergessen hatte.
Als er dem Werkelmann nicht mehr folgen konnte, weil der schon am Ende der Gasse sang und spielte und wohl, wie Franzl dachte, durch die ganze schöne Welt zog, blieb er in einem fremden Garten stehen und hörte in der Ferne immer noch die Melodien, die, leiser werdend, mit den Vögeln davonzuschweben schienen.
In einer nahen Werkstatt wurde gehämmert.
Sägen ratschelten.
Und dann klimperte jemand auf einem Klavier. „Ping – ping – ping pinkerte es, und der Ton schraubte sich höher.
Hämmern.
Ratscheln.
Pinkern.
Franz trat an das Fenster der Werkstatt, blickte durch eine trübe Scheibe und ein dahinter zitterndes Spinnennetz, das mit Sägespänen vollgespritzt war. Ein weißhaariger Mann stand vor dem Klavier, drückte mit dem rechten Zeigefinger ein und dieselbe Taste und hantierte mit der linken Hand im Leib des Instrumentes.
Plötzlich rief hinter dem Jungen eine Stimme: „Grüß dich Gott, Bub!“ Franz drehte sich erschrocken um und entdeckte einen barfüßigen jungen Tischlergesellen, der auf einem Stapel breiter Bretter umherkroch und herablachte.
„Grüß Gott“, sagte Franz, und er hatte es leise gesagt, so schüchtern, als fürchte er, der Mann könne gleich zu schimpfen beginnen und ihn fortjagen.
„Tu mal deine Hand da drauf“, sagte der Geselle und deutete auf ein Brett, das obenauf und in der Sonne lag.
„Warm, es ist ganz warm“, meinte Franz und tastete das Brett ab.
„Jaja, warm sind die, warm wie – hm – wie das Gesicht deiner Mutter.“
Woher weiß er, dass meine Mutter ein warmes Gesicht hat, dachte Franz und betrachtete den jungen Mann. Es ist wahr, Mutters Gesicht ist warm. Bei Vater weiß ich es nicht.
Der Geselle kletterte vom Stapel, schulterte drei Bretter und brachte sie in die Werkstatt. „Komm mit, oder hast du Angst?“
Angst hatte er keine. Der Tischlergeselle fragte ihn nach seinem Namen.
In der Werkstatt roch es nach Holz und kochendem Leim. Klaviere standen stumm herum, weiße, schwarze, große, kleine; am Fußboden ringelten sich Kupfer- und Messingdrähte, die in der Sonne wie Schlangen schillerten.
„Such dir eins aus, Franzl“, sagte der Geselle. Der weißhaarige Mann, der in einer Schachtel zwischen Elfenbeinplättchen wühlte, schob seine Brille hoch, beguckte den kleinen Jungen und lachte.
„Was soll ich mir aussuchen, Herr?“
„Herr! Herr!“, antwortete der Geselle. „Ich bin kein Hausbesitzer vom Brillantengrund (rial",sans-serif; font-weight:normal'>Gemeint ist die Vorstadt Schottenfeld)! Zu mir kannst du Joseph sagen, Joseph oder Sepp, wie du willst. Und aussuchen sollst du dir ein Klavier. Du möchtest doch klimpern, nicht?“
Franz errötete vor Freude, wollte dem Gesellen noch erzählen, er möchte Spielmann werden, immer neue Melodien hervorzaubern, und sagen wollte er dem Manne auch, dass er erst richtig glücklich sei, wenn er Musik höre, wenn seine älteren Brüder mit dem Vater musizierten. Aber kein Wort sprach aus seinem Mund. Er lief auf ein Klavier zu, stolperte über eine Tannenholzplatte und fiel hin.
„Aber Franzl“, rief der Geselle, „tret mir nicht auf den Resonanzboden fürs Klavier des Fürsten Grobschinsky, der gnädige Herr würd es mir übel ankreiden.“
Er schämte sich und wäre am liebsten fortgelaufen, wenn da nicht das Instrument gewesen wäre, das Klavier, das ihn ansah. Zu Hause hatten sie auch eins. Aber da er noch zu klein war, durfte er nicht spielen, nicht klimpern. Sein Bruder Ignaz spielte und entlockte mit seinen Händen, die wie flinke Käferchen über die schwarz-weißen Tasten krabbelten, dem Instrument zart schwingende Melodien, die ihn erschauern ließen vor Freude und traurig stimmten vor Wehmut. Und sie offenbarten ihm auch Bilder: Lichtwarme Sonnenblumen standen vor weißen Wolken, strahlten, als wären sie selber Sonnen, barfüßige Kinder liefen neben Offizierspferden her, neben den Hufen und im rauchenden Staub, Bettler baten um Almosen, Regen fiel auf mattrote Dächer, Hoftore quietschten, Vater malte große Buchstaben in ein Heft, Mutter lächelte, und der Spielmann kam; alles wurde zur Musik, wenn er Musik hörte, um alles schlangen sich Melodien, glückliche und traurige.
Der Tischlergeselle erhöhte den Klaviersessel mit einer kleinen Kiste und hob Franz hoch. Nun saß er mit baumelnden Beinen vor dem Instrument, und sein Gesicht glühte wie eine Feuerblume.
„Jetzt kannst du klimpern, Kapellmeister“, sagte Joseph, „wir klopfen, sägen und hobeln dazu. Das stört dich hoffentlich nicht?“
Er schüttelte den Kopf. Nein, das störte ihn wirklich nicht, im Gegenteil, er dachte: Je mehr sie sägen, hämmern und hobeln, desto weniger hören sie mein Geklimper.
Und sie klopften auch sofort tüchtig drauflos; Joseph und der weißhaarige Alte arbeiteten mit einem Eifer, als wäre der kleine Franz gar nicht anwesend oder als hätten sie seine Gedanken erraten.
Er betrachtete die lange Reihe der Tasten, unter denen das Reich seiner Fantasie verborgen zu sein schien. Auch die Melodien zu Mutters Märchen und Rittergeschichten mussten hier drin schlummern, denn wenn sie erzählte, hörte er in der Ferne Musik. Behutsam tippte er mit dem Zeigefinger auf eine Taste. Ein Ton erklang, schüchtern und so leis, wie er geweckt worden war. An diesen ersten Ton reihten sich in Franzls Gedanken sofort viele Töne, die er nun auf dem Klavier suchte und nicht fand oder so spät fand, dass er sie nicht mehr brauchen konnte. Aber darüber war er nicht unglücklich, vielmehr entdeckte er, dass das Reich der Töne unerschöpflich ist und dass es galt, Ordnung in die unzähligen Klänge zu bringen. Das war eine lohnende Aufgabe, schön und aufregend. Drückte er die letzten Tasten auf der linken Seite des Instrumentes, grollten die Töne wie ein schauerlicher Donner, der in Bergen und Wäldern dröhnt, drückte er auf die letzten Tasten auf der rechten Seite, hämmerten die Töne wie eine Schar lustiger Finken im Wipfel einer hohen Tanne. Und in der Mitte? Da wohnte das Herz der Musik, immer hörbar, trotz Tiefe und Höhe, die es einschlossen.
Von dieser Stunde an lief Franzl Tag für Tag in die Werkstatt, zum Tischlergesellen Joseph und dem schweigsamen Alten; sie ließen den Knaben klimpern, sicherlich in dem Glauben, dies wäre nicht mehr als ein kindlicher Zeitvertreib. Und sie ahnten nicht, dass in dem kleinen Franz Schubert, Sohn eines Vorstadtlehrers, eine Welt erwacht war.
Nur einmal gibt es das auf der Welt
Franz Theodor Florian Schubert, der dem Tischlergesellen nahestand, erfuhr von den heimlichen Klavierübungen seines jüngsten Sohnes in der Werkstatt. Er war sehr angetan von dieser Nachricht und sagte zu seiner Frau: „Da scheinen ja alle unsere Söhne etwas Musik im Blute zu haben, und wenn es auch nur soviel ist, wie sie als künftige Lehrer benötigen werden.“
Die Frau lächelte. Sie wusste, ihren Mann beseelte ein Gedanke: seinen Kindern eine gute Zukunft zu sichern. Diese Möglichkeit sah er im Beruf des Lehrers. Und ein Lehrer musste singen und musizieren, Rohrstock wie Fiedelbogen gebrauchen können.
Also lehrte Vater Schubert seinen Franz, der jetzt zur Schule ging, das Geigenspiel, obwohl er es nur mäßig beherrschte und schon nach Wochen spürte, dass ihm sein Junge weit vorauseilte.
„Herr Vater, hier möchten Sie gefehlt haben“, unterbrach Franz manchmal während eines Duettes plötzlich das Spiel; denn sein Lehrer war aus dem Takt geraten und hatte eine Sechzehntelnote hinterhergefiedelt.
„Von vorn“, sagte der Vater und dachte: Das ist mir einer, der Junge hat ein drittes Ohr. Allerdings, es geschah auch, dass sich diese Unterbrechungen häuften und der Vater in Verlegenheit geriet. Da er glaubte, seine Autorität könnte unter dem Tadel leiden, sagte er gereizt: „Ich bin heut so unkonzentriert, weißt du, Franzl, meine Gedanken sind noch in der Schule.“ Franzl nickte und begann unverdrossen wieder mit dem Vater das Spiel.
Schlimmer war es, wenn Vater behauptete: „Na, ich glaube, diesmal warst du es, der falsch gespielt hat. Was meinst du, Franzl?“
Da wurde er rot. Nein, er hatte nicht falsch gespielt, keinen Ton zu tief oder zu hoch gegriffen, keine Note ausgelassen. Und nun verdächtigte ihn Vater? Unsicher begann er mit seinem Lehrer das Duett von vorn, immer noch die Röte im Gesicht, die Anschuldigung im Kopf, die Aufregung in den Fingern. Und da verspielte er sich, stolperte über ein paar Noten, brach das Spiel sofort ab, senkte beschämt den Kopf. Seine Wangen brannten.
„Aber jetzt warst du’s, Franzl“, triumphierte der Vater und tat so, als wäre es weiter gar nichts.
„Ja, Herr Vater, ich hab gefehlt.“
„Siehst du, das kann jedem passieren“, antwortete der Vater sanft und glaubte, sein Ansehen wieder aufgebessert zu haben.
Als der Knabe acht Jahre alt war und schon bei seinem Bruder das Klavierspiel erlernte, brachte ihn der Vater in die Singstunde zu Herrn Michael Holzer, den Chorregenten der Liechtentaler Pfarrkirche, einen würdigen und klugen Lehrer, der mehrere Kinder unterrichtete. Der Unterricht war kostenlos. Die Knaben mussten zu den Messen im Chor singen oder im Orchester spielen. Da er in dem kleinen Schubert sehr bald seinen begabtesten Schüler vorfand, lehrte er ihn gleichzeitig das Orgelspiel und die Harmonielehre.
„Du kommst immer donnerstags pünktlich um drei“, sagte Herr Holzer.
Und Franzl kam immer donnerstags pünktlich um drei, saß mit dem Chorregenten auf dem Orgelbänkchen, spielte, hörte zu, träumte und erwachte erst, wenn es von der Turmuhr vier schlug. Dann war er traurig, dass die Stunde schon vorüber war. Manchmal gab Herr Holzer etwas zu, zwanzig oder dreißig Minuten, aber danach zog er die goldene Uhr, die er zu seinem Jubiläum von einem Hofrat geschenkt bekommen hatte, aus der Westentasche und sagte: „Ich muss jetzt weg, Franzl. Wenn du magst, kannst du bleiben.“ Und im Gehen bemerkte er: „Den Schlüssel gibst beim Kirchendiener ab.“
Franz blieb. Die Klänge der Orgel rauschten über das weite Kirchenschiff dahin, schwebten zu dem steinernen Gewölbe hinauf, umtosten Säulen und Altäre, Kronleuchter und Heiligenfiguren, dröhnten im Gebälk der Empore. Und im Herzen, im Herzen des kleinen Franz, der wie ein Zwerg vor dem Riesen Orgel saß.
Aber auch hier kam der Tag, an dem Michael Holzer mit seinem Schüler zu Vater Schubert ging und sagte: „Solch einen Schüler hab ich noch nicht gehabt, Herr Schulmeister. Nein, solch einen nicht. Immer, wenn ich ihm etwas Neues beibringen will, weiß er’s schon. Folglich gebe ich ihm keinen Unterricht, sondern unterhalt mich bloß mit ihm und staune ihn stillschweigend an.“
Der Vater betrachtete seinen Jungen wohlwollend. „Das freut mich, Herr Chorregent. Schließlich soll er mal ein tüchtiger Schulmeister werden, und da wird ihm die schnelle Auffassungsgabe sehr von Nutzen sein.“
„Schulmeister?“ Der alte Holzer trat einen Schritt zurück. „Der muss mehr werden als ein Lehrer.“
„Mehr?“ Schubert konnte sich nicht vorstellen, was mehr war als Lehrer.
„Ja, mehr! Dieser Kerl hat doch die Harmonie im kleinen Finger.“ Der würdige alte Mann glühte vor Eifer.
„Bis dahin ist ja noch viel Zeit“, versuchte die Mutter zu beschwichtigen.
Franz lief zum Fenster und blickte auf die Gasse, als interessiere ihn das Gespräch nicht. Er summte etwas vor sich hin. Eine elegante Kutsche, gezogen von zwei feurigen Hengsten, jagte vorüber. Der Diener stand hinten drauf, schwarz und steif wie aus Ebenholz geschnitzt.
Franz hörte, wie sein Vater zu Herrn Holzer sagte: „Von Musik kann man nicht leben, Herr Chorregent. Sie ist schön, und ich liebe sie, sie ist wunderschön, die holde Frau Musica, aber sie macht nicht satt. Mit Noten kann man keine Familie ernähren.“
Herr Holzer fragte, ob er sich setzen dürfe.
„Bitte.“ Vater Schubert deutete auf einen Stuhl.
Der alte Mann nahm Platz, klemmte seinen Spazierstock zwischen die Knie und stülpte den schwarzen Zylinder auf den silbernen Knauf. Er holte tief Luft, seufzte, schaute zum Schulmeister und sagte mit andächtiger Stimme: „Mit Noten kann man keine Familie ernähren, sagten Sie. Aber Sie übersehen, lieber Schulmeister, dass ein Genie erst sein Werk sieht, sein Schaffen an diesem Werk – und dann das Brot. Und so leben früh sterbende Genies länger als spät sterbende Satte.“
„Genies! Verehrter Herr Holzer, Genies! Das Blut steigt mir in den Kopf.“ Vater Schubert ging zur Wand und zeigte auf ein Mozartbild. „Hier, ein Genie! Fast verhungert, jawohl, verhungert, beigesetzt in einem Massengrab, in einem Armengrab der Stadt Wien!“
„Aber nicht vergessen, lieber Herr Schubert. Er kommt Tag für Tag in Ihre Stube, in die Salons der Reichen, in die Kirchen und Wohnungen der Ärmsten, auch wenn sie nur eine Geige oder gar nur ein paar gute Singstimmen ihr eigen nennen können. Aber er ist unter uns, lebt und spricht in Noten zu Ihnen, zu mir, zu uns allen, in Noten, die unsterblich sind und ihn nicht ernährten.“
„Verhungert ist er“, wiederholte der Schulmeister hartnäckig und lief in der Stube auf und ab.
„War seine Musik daran schuld?“
Schubert schwieg. Er blickte zu seiner Frau, die am Herd hantierte und mit der kleinen Therese flüsterte.
„Oder Gott?“, fragte Holzer. „Vielleicht der Kaiser?“
„Warum nennen Sie nicht seinen Vater, lieber Herr Holzer? Der konnte nicht früh genug ein Wunderkind aus dem Knaben machen, mit ihm von Hof zu Hof, von Land zu Land reisen“, antwortete der Lehrer und nahm erregt der Therese einen Löffel aus der Hand, mit dem sie fortwährend auf ein Holzscheit trommelte. „Einen anständigen Beruf hätte er ihn erlernen lassen sollen. Für die Musik, die wir alle lieben, wäre noch genug Zeit verblieben.“
Er ist nahe daran, sich zu versündigen, dachte Michael Holzer. Dieser Vorstadtlehrer ist so vernagelt, dass man nicht weiß, wie man ihm beikommen kann. Der Chorregent schwieg.
Indessen summte Franz am Fenster unentwegt sein Melodiechen, schaute auf die Gasse, die Häuser, die Spatzen, die Bäume, und es schien, als habe er nicht auf das Gespräch gehört, das Vater und Holzer seinetwegen führten. Die Brüder Ignaz, Ferdinand und Karl standen bei einem Scherenschleifer. Die Klingen blitzten in der Sonne.
Plötzlich sagte Franzl: „Ich hab’s, ich hab’s!“ Drehte sich um und rannte durch die Stube, vorbei an Holzer, vorbei am Vater, hinüber zum Klavier.
Stille.
Selbst Therese hielt die Holzscheite ruhig in der Hand und schaute zu ihrem Bruder.
Franzl spielte.
Das schlichte Melodiechen atmete Anmut und Liebe.
Die Mutter verhielt und schaute auf ihren Jungen, wie es nur eine gute Mutter vermag.
Der Vater zeigte Stolz und dachte an die Zukunft.
Und die Augen des alten Holzer glänzten. Er sagte: „Genies gehen ihren eigenen Weg. Und es gibt nichts, was sie aufhalten könnte, nichts – gar nichts.“ Er nahm Stock und Zylinder, trat zu Franz, beugte sich hinab und meinte: „Sollte das nicht ein Wiegenliedchen sein, Franzl?“
Verschämt stand der Junge auf. „Ja, Herr Chorregent, ein Wiegenliedchen für Therese.“
„Brav war’s, Franzl, wie ein Gänseblümchen, das sanft hin und her schaukelt.“
An der Tür wandte sich der Alte um und brummelte: „Und wir streiten uns, Schulmeister Schubert, wir streiten und reden. Geantwortet hat der Junge, der Franzl! Grüß Sie Gott, ich muss zur Kirche.“ Die Tür knarrte.
Der alte Mann war gegangen, und der Vater sagte: „Hast mir viel Freud gemacht, Franzl.“
Als er im Bett lag, sang er Therese noch einmal die Melodie vor. Sanft streifte der Wind die Äste der Akazie, die im bleichen Mondlicht schimmerten. Eine Turmuhr schlug. Und der erzene Ruf klang durch die Nacht.
Die Sterne blickten in Franzls Augen.
Therese war eingeschlafen.
Er dachte wieder an das Melodiechen. Summte es erneut. Mein Liedchen. Das habe ich mir zurechtgesummt. Es ist ganz neu, neu wie das Lied eines Spielmannes. Nur einmal gibt es das auf der Welt, ein einziges Mal. Mein Liedchen!
Und Vater sagt zu Herrn Holzer: „Von Musik kann man nicht leben.“ Ich möchte sagen: Herr Vater, und ich könnte ohne Musik nicht leben!
Die Kaiserin gießt selbst den Kaffee in die Tassen
Der Sommer des Jahres 1808 war heiß und trocken. Franz streifte in seiner Freizeit durch Wiesen und Felder, beobachtete die Bauern bei der Heumahd, lauschte dem Posthorn, sah den Forellen zu, wenn sie blitzschnell in klaren Bächen dahinschossen. In den Weingärten leuchteten die weißen Kopftücher der Winzerinnen, auf den Dächern der Häuser knatterten Wetterfahnen. Das alles war schön, ergötzte ihn, ihn, der wie ein Suchender das Land am Himmelpfortgrund jeden Tag neu entdeckte.
Als er an einem dieser heißen Tage nach Hause kam und der Himmel überm Haus „Zum schwarzen Rössel“ gütig herniederschaute, wartete in der Stube der Vater.
„Setz dich, Franzl.“
„Herr Vater?“
Es war schwül. Ein Windstoß fuhr in die Zeitung, die der Schulmeister in der Hand hielt. Sicher war es eine gute Nachricht, die Franz Theodor Florian seinem Sohn mitzuteilen hatte, denn die Mutter schien sie schon zu kennen und lächelte.
„Eine günstige Gelegenheit für dich, Franzl.“ Vater faltete die Zeitung auseinander. „Eine ganz große Gelegenheit.“
„Und welche, Herr Vater?“
„In der Wiener Zeitung steht folgende Kundmachung. Ich lese vor, Franzl, hör gut zu.“
Der Vater wies auf einen dicken Bleistiftstrich, den er am Rande angebracht hatte. Dann las er so laut und langsam, als stünde er auf einem öffentlichen Platz vor versammelter Menge: „Da in der kaiserlich-königlichen Hofkapelle zwei Sängerknabenstellen neu zu besetzen sind, so haben diejenigen, welche eine dieser Stellen zu erlangen wünschen, den 30. September nachmittags um 3 Uhr im k. k. Konvikte am Universitätsplatz Nr. 796 zu erscheinen und sich der mit ihnen sowohl in Ansehung ihrer in den Studien bisher gemachten Fortschritte als auch in ihrer in der Musik schon erworbenen Kenntnisse vorzunehmenden Prüfung zu unterziehen und ihre Schulzeugnisse mitzubringen. Die Konkurrenten müssen das zehnte Jahr vollendet haben und fähig sein, in die erste Grammatikal-Klasse einzutreten. Wenn die aufgenommenen Knaben sich in Sitten und Studien auszeichnen, so haben sie nach der allerhöchsten Anordnung auch nach Mutierung (Stimmwechsel) der Stimme im Konvikte zu verbleiben.“
„Ach“, sagte Franz. Das besagte zunächst nichts, das war weder ablehnend noch zusagend; er wusste nicht, ob er sich freuen oder nicht freuen sollte. Was war ein Konvikt überhaupt? Und Mutierung der Stimme, was bedeutete das? Die Schulzeugnisse sollte er mitbringen? Davor hatte er keine Furcht, die Zensuren waren gut.