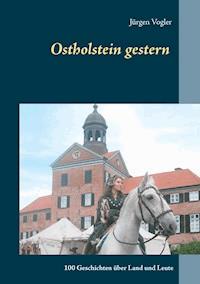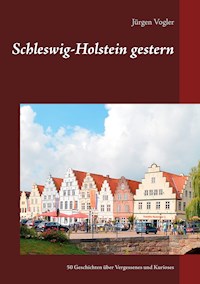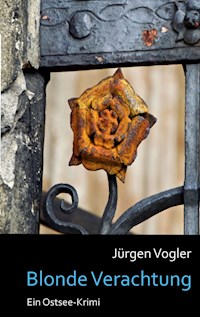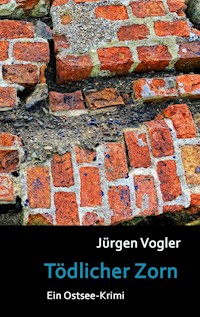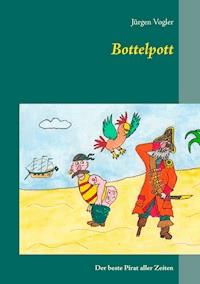Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Charles de Villers, Artillerieoffizier Napoleons, muss aus Paris fliehen. In Göttingen lernt er die frisch gebackene Doktorin der Philosophie Dorothea Schlözer, kennen und lieben. Doch ihre Hochzeit mit dem reichen Kaufmann Matthäus Rodde zerstört seine Träume. Als er bei seiner weiteren Flucht Unterschlupf im Haus des Senators in Lübeck findet, genießt er die Nähe zu Dorothea. Durch den Überfall der preußischen und napoleonischen Truppen 1806 auf die freie Hansestadt beginnt auch für die Ménage à trois eine Zeit des Schreckens. Die drei historischen Figuren, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Lübeck gewirkt haben, erleben die wohl blutigste Episode in der Geschichte der Hansestadt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 616
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Jürgen Vogler wurde 1946 in der Holsteinischen Schweiz geboren und wohnt heute an der Ostseeküste. Nach seinem Dienst als Pressesprecher bei der Bundespolizei arbeitet er seit 1988 als Freier Journalist und Autor.
Neben zwei Kinderbüchern sind Historisches und Kriminelles die Schwerpunkte seiner Arbeit. In „Der Marquis von Lübeck“ erlaubt er einen Blick in die bewegende Zeit zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Das abenteuerliche Leben der drei historischen Figuren und die Begegnungen mit Persönlichkeiten jener Epoche scheinen zum Greifen nahe.
www.juergenvogler.de
Bereits erschienen:
„Ostholstein gestern“
„Der Mohr von Plön“
„Der Narr von Eutin“
„Schwarzer Nebel“
„Kopflos im Strandkorb“
Wenn du wissen willst, wer dich beherrscht, musst du nur herausfinden, wen du nicht kritisieren darfst.
Voltaire (französischer Philosoph 1694–1778)
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 1
Wie ein Leichentuch legte sich die Schwüle über die Dächer von Paris. Sie erdrückte und lähmte jede Geschäftigkeit. Selbst das Wasser der Seine schien sich an diesem warmen Sommertag im Juni 1802 nur träge plätschernd den Weg in den Ärmelkanal zu suchen. Kein Lufthauch brachte Linderung. Faulende Dämpfe stiegen aus den Gassen auf. Die Straßenköter kniffen ihre Schwänze ein und suchten schattige Plätze, von denen sie nicht vertrieben werden konnten. Die Rufe der Marktweiber klangen müde und ermattet. Türen und Fensterläden waren geschlossen, um die brütende Hitze auszusperren. Das sonst so ausgelassene und übermütige Mädchen Paris glich an diesem Tag eher einem erschöpft keuchenden alten Waschweib.
Lediglich einen Bewohner des Hauses Nummer 15 in der Rue de Nevers störte die schwüle Sommerluft offensichtlich wenig. Die Fenster in der ersten Etage waren weit geöffnet, vielleicht in der vagen Hoffnung, dass ein erfrischender Windhauch die dumpfe Hitze vertreiben könnte.
Bekleidet mit einem leichten Hemd und einer blauen Uniformhose saß Charles de Villers konzentriert an seinem Schreibtisch. Vor sich unzählige Blätter. Einige hatten sich selbstständig gemacht und waren auf den Fußboden gesegelt. Charles de Villers schrieb unaufhaltsam. Immer wieder tauchte er die Feder in das Tintenfass, hielt kurz inne, fasste seine Gedanken in Worte und kritzelte sie in hastigen Zügen nieder. Tief versunken schwebte er in einer anderen Welt. Weder die quälende Hitze noch die polternden Handkarren auf dem Straßenpflaster oder das nörgelnde Jammern übel gelaunter Kinder erreichten ihn. In Lothringen als Sohn eines Finanzbeamten und einer adligen Mutter aus dem Languedoc aufgewachsen, hatte er schon als junger Mensch alles schriftlich festgehalten, was er am Tag erlebt hatte.
Auch während seiner Schulzeit in Metz und später als Soldat hatte ihn die Faszination des Schreibens nie verlassen. Bis heute brachte er seine Gedanken zu Papier. Mit dem kleinen Unterschied, dass er sich nicht mehr nur auf die Beschreibung des Alltags beschränkte, sondern die Welt durch eine äußerst kritische Brille sah und dies in messerscharfe Worte fasste.
„Charles, komm raus aus deinem Schneckenhaus!“ Erst als die Tür zu seinem Arbeitszimmer aufgerissen wurde, sprang er auf und sah den ungehobelten Eindringling feindselig an. Seine Gesichtszüge verwandelten sich jedoch sofort in verständnisvolle Milde, als er erkannte, wer seine Gedanken auf diese impertinente Weise gestört hatte.
„Paul, du bist ein ungehobelter Mensch.“
„Aus deinem Mund ist das ein Kompliment, mein Lieber.“
Paul Martigny war wie Charles de Villers Capitaine des 2. Artillerieregiments. Beide hatten in den Revolutionskriegen tapfer ihren Mann gestanden, ihre soldatischen Fähigkeiten bewiesen und galten trotz ihrer jungen Jahre als erfahrene Offiziere. Sie waren seit langer Zeit befreundet und jeder kannte die Stärken und Schwächen des anderen nur zu gut.
„Lass mich noch kurz meine letzten Gedanken notieren, dann stehe ich dir voll und ganz zur Verfügung.“
„Tu, was du nicht lassen kannst. Gibt es denn in deiner kargen Behausung wenigstens ein Glas Wein?“
„Bediene dich! Dort auf der Kommode steht alles, was dein Säuferherz begehrt.“ Charles zeigte nach rechts, wo auf einem Tablett mehrere Karaffen und Gläser standen. Dann setzte er sich wieder an den Schreibtisch.
Paul schnallte seinen Säbel ab und zog seinen blauen Waffenrock aus. Nachdem er sich ein Glas Wein eingeschenkt hatte, warf er sich in einen Sessel und legte entspannt sein rechtes Bein über die Armlehne. Genüsslich schlürfend beobachtete er seinen Freund, der sich bereits wieder entschlossen seinen Notizen widmete. Paul musste schmunzeln.
Die beiden unterschieden sich grundlegend. Während Charles' fein geschnittenes Gesicht von blonden Haaren und Koteletten eingerahmt war und seine blauen Augen eine seltene Tiefe und Klarheit zeigten, konnte Paul seine südländische Herkunft nicht verleugnen. Sein blauschwarzes Haar, sein bronzefarbener Teint und seine fast schwarzen, ständig funkelnden Augen verrieten sein Temperament und seine Heimat im tiefen Süden Frankreichs. Charles neigte eher dazu, überlegt zu handeln, während Paul das Leben stets von der sonnigen Seite sah.
Nach ungefähr fünf Minuten des Schweigens legte Charles die Feder zur Seite und lächelte seinen Freund an. „Nun, Paul, was gibt es Neues aus der Pariser Halbwelt?“
„Es ist zum Haareraufen, dass du dich lieber hinter deinem Schreibtisch verschanzt, als dich in die Gefechte des Salonlebens zu stürzen. Die Pariser Weiblichkeit verlangt nach dir.“
„Da habe ich in dir doch einen guten und allzeit gern gesehenen Vertreter.“
„Grundsätzlich hast du recht, aber auch ich stoße an ganz natürliche Grenzen.“
„Soll das etwa heißen, dass du dem Ansturm deiner Verehrerinnen nicht mehr gewachsen bist?“ Charles stand auf, schenkte sich ebenfalls ein Glas Wein ein und prostete seinem Freund schelmisch lächelnd zu.
„Den Tag wirst du nicht erleben, mein Lieber. Aber Paris ruft nach dir. Ich habe ja absolutes Verständnis dafür, dass du dich nur zu gern in deinen Blätterwald vertiefst und deine wirren Gedanken zu Papier bringen musst, aber die Damen in den Salons warten förmlich auf junge und stattliche Offiziere, die mit ihnen intelligente Konversation pflegen, ihnen Komplimente machen, sie zum Tanz ausführen und ihnen das Gefühl geben, dass sie leben und begehrenswert sind. Dazu bist du berufen, Charles de Villers. Das ist deine Pflicht als Offizier. Verschieße dein Pulver nicht nur auf den Schlachtfeldern und in deinen schriftlichen Attacken gegen die Irrwege der Menschheit; auch auf den Boulevards von Paris gibt es genügend attraktive Zielobjekte.“
Charles musste lachen. „Paul, deine Ausführungen über die Pflichten eines Offiziers sind einzigartig. Vielleicht sollten wir sie in das Programm zur Ausbildung der Kadetten mit aufnehmen.“
„Keine schlechte Idee. An deinem Glück kommst du trotzdem nicht vorbei. Ich habe uns beide für übermorgen im Salon von Baronin de Stael avisiert. Wie du weißt, hat sie schon mehrfach sehnsüchtig dein Kommen erwartet. Enttäusche sie also nicht. Die Frau hat Einfluss. Und den hast du möglicherweise sehr bald nötig.“
„Die gute Madame de Stael mag ja ein liebenswerter Mensch sein“, sagte Charles, „aber sie ist anstrengend. Ich habe den Verdacht, dass sie weitaus mehr von mir will als nur geistreiche Anerkennung ihrer manchmal etwas wundersamen Gedanken. Wieso bist du der Meinung, dass ich in Zukunft auf ihre guten Beziehungen angewiesen sein sollte?“
„Ich will nicht die Pferde wild machen, aber im Casino herrscht unter den Offizieren seit einigen Tagen eine ganz eigenartige Stimmung, wenn dein Name fällt.“ Auf Pauls Stirn waren plötzlich deutlich Sorgenfalten zu erkennen.
„Und was meinst du, woran das liegt?“
„Wie es aussieht, sind deine jüngsten Veröffentlichungen nicht von allen Parisern mit Begeisterung aufgenommen worden. Auch unter den höheren Offizieren gibt es genügend Ignoranten, die allein schon die Tatsache für anmaßend und hochverräterisch halten, dass ein kleiner Capitaine seine kritischen Gedanken in die Öffentlichkeit posaunt.“
„Paul, wir haben uns doch schon oft genug darüber aufgeregt. Wo sind denn die hohen Ideale der Revolution geblieben? Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Dass ich nicht lache! Wie viele Köpfe sind über das Pariser Pflaster gerollt, nur weil sie freiheitliche Ideen geäußert haben, die Männern wie Robespierre, Danton und Saint-Just nicht gefallen haben. Wie sieht die gepriesene heilige Gleichheit denn heute aus? Hast du auf dem Weg zu mir einmal die Bettler gezählt, die dir die Hände entgegengestreckt haben? Und die praktizierte Brüderlichkeit beschränkt sich doch ausschließlich darauf, dass nur der mein Bruder im Geiste ist, der mir persönlich Vorteile bringt. Wir nützlichen Idioten verteidigen auch noch diese korrupte Bande mit unserem Leben, indem wir als Soldaten unter Fanfarenklängen gegen Österreich, Preußen, Italien und Holland ziehen, während der wahre Feind hinter unserem Rücken im eigenen Nest sein Unwesen treibt. Allen voran unser Erster Konsul, Napoleon Bonaparte, der schon jetzt alle Macht des Staates in den Händen hält. Haben wir nicht gerade vor gut zehn Jahren diese Art von Absolutismus bekämpft?“
Charles de Villers hatte sich in Rage geredet. Nicht das erste Mal. Er wusste, dass sein Freund ähnlich dachte wie er. So manche Nacht hatten sie über die Revolution mit all ihren politischen Verirrungen und persönlichen Schicksalen diskutiert. Ihre Treue zu Frankreich war dabei nie gefährdet gewesen. Doch ihre Fragen waren häufig genug unbeantwortet geblieben. Charles hatte daraufhin begonnen, regelmäßig seine zweiflerischen Gedanken in kritischen und satirischen Aufsätzen niederzuschreiben und im Journal de Paris zu veröffentlichen. So auch in der vergangenen Woche, was in manchen Kreisen der Pariser Gesellschaft offensichtlich nicht gern gesehen war.
„Charles, ich verstehe ja deinen Zorn und gebe dir auch grundsätzlich recht, aber du weißt genau, dass deine Thesen nicht überall gut ankommen. Die Besitzenden tönen stets lautstark, wenn es um Gleichheit geht, aber wehe, einer, der weniger hat als sie, kratzt an ihren Reichtümern, dann ist der Ruf nach schützenden Gesetzen groß. Durch deine Aufsätze bringst du dich selber in Gefahr.“
„Soll ich mir deswegen von irgendwelchen Gestrigen und Opportunisten das Maul verbieten lassen?“
„Nein, ganz bestimmt nicht, aber vielleicht wäre es besser, wenn du dich in den nächsten Wochen ein wenig zurückhältst und das Feuer mit weiteren Artikeln nicht noch schürst.“
„Da werde ich nicht schweigen. Auch in Zukunft nicht.“
„Aber genau das ist meine Sorge.“ Nachdenklich strich Paul mit dem Finger über den Rand des Weinglases.
„Es ehrt dich, lieber Freund, dass du dich um mein Seelenheil sorgst, aber ich denke, du übertreibst ein wenig.“
„Ich glaube, du bist dir deiner prekären Lage tatsächlich nicht bewusst, Charles. Die höheren Offiziere unseres Regiments befürchten, dass durch deine ketzerischen Artikel auch auf sie Schimpf und Schande fallen könnte. Außerdem ist bereits der Generalstab auf dich aufmerksam geworden. Es sieht so aus, als ob du mit General Davout einen ganz besonderen Feind gewonnen hast. Als bei der letzten Stabsbesprechung dein Name fiel, soll er gewütet haben wie ein angestochener Stier. Seitdem er mit Aimée Leclerc verheiratet und damit sogar mit Napoleon entfernt verwandt ist, hat sein Wort mehr und mehr Gewicht. Charles, die schießen sich auf dich ein!“ Paul hielt kurz inne, um seinen Worten mehr Gewicht zu verleihen. „Und wie mir ein Mädchen aus dem Haus von Madame Gabriele berichtet hat, hält sich das Gerücht, dass auch schon Spitzel unseres übereifrigen Polizeiministers Fouché über deine kritischen Artikel gestolpert sind.“
„Paul, ich bitte dich, Napoleon und Davout kümmern sich doch einen Dreck um einen einfachen Artilleriecapitaine. Außerdem, neidvolle Intrigen unter den Offizieren hat es schon immer gegeben. Und Hand aufs Herz, wie bedeutungsvoll sind die Worte eines Freudenmädchens während eines Schäferstündchens?“
Paul seufzte. „Ich habe befürchtet, dass meine Warnungen bei dir nicht auf fruchtbaren Boden fallen würden. Aber um eines bitte ich dich in aller Freundschaft. Sei vorsichtig! Da braut sich etwas zusammen.“
Es versprach ein milder Sommertag zu werden. Das nächtliche Gewitter hatte die Schwüle vertrieben. Ein leichter Wind ließ die Blätter der Pappeln vor dem Haus rauschen. Selbst die Seine schien an diesem Morgen zu neuem Leben erwacht zu sein. Ihr Wasser sprudelte, sprang und rauschte, als ob frische Quellen sie gefüttert hätten.
Charles de Villers öffnete schlaftrunken die Augen, als er ein lautes Klopfen an der Haustür vernahm. Träge wühlte er sich aus dem Bett, warf sich seinen Uniformmantel über und stolperte die Stiege hinunter, nachdem seine Wirtin, Madame Adele, den Lärm vor dem Haus nicht gehört oder das Haus für ihre morgendlichen Besorgungen bereits verlassen hatte. Als er die schwere Tür öffnete und in die Sonne blinzelte, streckte ihm ein Caporal seines Regiments ohne ein weiteres Wort ein gesiegeltes Kuvert entgegen, grüßte schneidig, machte kehrt und verschwand in der Gasse.
Charles schüttelte den Kopf, schloss die Haustür und stieg wieder die Treppe empor. Es war spät geworden am Abend zuvor, nachdem ihn Paul letztlich doch überredet hatte, den Tag nicht ohne weibliche Begleitung ausklingen zu lassen. Auch wenn Charles anfangs gezögert hatte, so konnte er sich der unbändigen Lebensfreude seines Freundes nicht entziehen. Sie hatten getrunken und getanzt. Er war erst in den frühen Morgenstunden ins Bett gefallen. Mit dem festen Vorsatz, mindestens bis zum Mittag zu schlafen, da er erst in drei Tagen wieder seinen Dienst antreten musste.
Charles warf seinen Mantel auf das Bett und erbrach das Siegel. Kopfschüttelnd überflog er die wenigen Zeilen. Der Adjutant des Regimentskommandeurs, Major Debussy, wies ihn an, heute um zwölf Uhr zum Rapport im Generalstab zu erscheinen. Keine weiteren Erklärungen. Keine Begründung. Er zuckte resignierend mit den Schultern. Einerseits war er es gewohnt, dass die Befehle beim Militär nicht immer logischen Regeln unterworfen waren. Andererseits war es ungewöhnlich, Offiziere während ihres Urlaubs zum Rapport zu bestellen. Es sei denn, das Regiment musste kurzfristig zu neuen Kriegseinsätzen ausrücken. Doch zu solchen Anlässen hatte es bisher nie eine schriftliche Einladung gegeben. Er blickte auf die Uhr. In vier Stunden würde er mehr wissen.
Charles de Villers war pünktlich. Kurz vor zwölf meldete er sich beim Adjutanten des Generals. „Ganz im Vertrauen, Major, wissen Sie, was der General von mir will?“
„Das werden Sie noch früh genug erfahren, de Villers.“
Charles wunderte sich über die schroffe Antwort. Bisher hatte er zu dem Adjutanten des Generals stets ein kameradschaftliches Verhältnis gehabt.
„Sie können sich ruhig zunächst ins Casino begeben. Der General hat noch keine Zeit für Sie. Ich lasse Sie rufen, wenn es so weit ist.“ Der Adjutant widmete sich wieder den Papieren auf seinem Schreibtisch.
Charles konnte sich das eigenartige Verhalten des Adjutanten immer noch nicht erklären. Oder sollten seine kritischen Artikel im Journal de Paris einigen Offizieren doch missfallen haben, wie Paul berichtet hatte? Er wollte sich nicht den Tag durch die schlechte Laune eines frustrierten Offiziers verderben lassen. Warum sollte er also nicht ins Casino gehen? Dort hätte er zumindest die Chance, um diese Zeit einige seiner Kameraden zu treffen. Vielleicht hatte auch Paul schon aus dem Bett gefunden.
Mit Verwunderung registrierte er wenig später die bunte Collage der Kopfbedeckungen in der Garderobe des Regimentscasinos, als er seinen Tschako abgeben wollte.
„Habe ich etwas versäumt?“, fragte er die Ordonnanz.
„Ich weiß es auch nicht, Mon Capitaine. Es sind nicht nur die Offiziere unseres Regiments hier. Schauen Sie nur. Ich habe heute fast alle Waffengattungen im Angebot.“ Der Soldat zeigte auf die verschiedenen Mützen, Tschakos und Helme.
Als Charles das Kaminzimmer des Casinos betrat, blieb er verwundert in der Tür stehen. Hohe Offiziere, nicht nur des Artillerieregiments, standen in Gruppen zusammen und unterhielten sich angeregt. Dieser Aufmarsch erschien ihm ungewöhnlich. Während das Bild im Casino sonst zumeist von den blauen Uniformen der Artillerie bestimmt wurde, waren heute neben den grünen Waffenröcken der Elitejäger auch die Dragoner in ihren weißen Hosen und die Husaren mit ihren über die Schulter gehängten Jacken anwesend. Unter ihnen sogar mehrere Generäle.
Zu seiner Erleichterung entdeckte Charles in der hintersten Ecke des Raumes einige jüngere Offiziere, die er kannte. Auch seinen Freund Paul. Zügig ging er auf sie zu. Dabei blieb ihm nicht verborgen, dass ihn hier und da kritische Blicke verfolgten. Die Offiziere rund um Paul, zwei Capitaine und drei Leutnants, begrüßten Charles freundlich.
„Sagt einmal, habt ihr eine Erklärung für diesen Massenauflauf?“
„Genaues weiß keiner von uns. Dafür gibt es aber genug Latrinenparolen“, beantwortete Paul die Frage.
„Und welches Gerücht hält sich am hartnäckigsten?“, wollte Charles wissen.
„Der Erste Schreiber des Generalstabs hat mir geflüstert, dass der Regimentsgeneral einen geplanten Aufstand unter den Offizieren vermutet“, wusste einer der jungen Leutnants zu berichten.
„Wie kommt der alte Knochen denn auf diese blödsinnige Idee?“ Charles wunderte sich nicht das erste Mal über die eigenartigen Ansichten des Generals. Auch andere jüngere Offiziere zählten ihn zum alten Eisen, der die Zeichen der Zeit nicht mehr richtig deuten konnte oder wollte. Auf welch wunderliche Weise der General während der Wirren der Revolutionszeit seine Karriereleiter erfolgreich erklommen hatte, konnte kaum jemand nachvollziehen und wusste niemand genau.
„Selbst wenn es stimmt, was Leutnant Basseur gehört hat, erklärt das noch nicht die Anwesenheit der hohen Offiziere anderer Waffengattungen in unserem Casino.“ Auch Paul konnte sich keinen Reim darauf machen.
„Nur die Aufklärung führt zu Ergebnissen. Fragen wir sie doch einfach.“ Noch bevor die anderen etwas erwidern konnten, hatte sich Charles umgedreht und war auf eine nahe stehende Gruppe der Husaren zugegangen. „Verzeihen Sie, wenn ich störe, doch gibt es einen triftigen Grund, weshalb Sie heute die Gastfreundschaft unseres Regiments in Anspruch nehmen?“
Die fünf Offiziere der Husaren waren zur Seite getreten und blickten Charles irritiert an.
„Nun, Capitaine, es wundert mich schon, wenn Ihr eigener Regimentskommandeur es nicht für nötig hält, seine Offiziere über seine Pläne zu informieren“, beantwortete ein Colonel der Husaren Charles' Frage. „Offensichtlich scheint der General sein Vorhaben in seinen eigenen Räumen weitaus geheimer zu halten als uns gegenüber.“
Die umstehenden Offiziere kommentierten die Bemerkung mit einem Lachen.
„Ganz im Vertrauen, Capitaine“, fuhr der Colonel fort, „Ihr General hat die Offiziere der einzelnen Waffengattungen zu einer Konferenz einberufen, bei der die Ausbildung der Kadetten grundsätzlich neu geregelt werden soll. Allerdings ist uns auch zu Ohren gekommen, dass man die Befugnisse und Rechte der Offiziere einschränken will. Das mag die derzeitige Unruhe in diesem Raum erklären.“
Charles bedankte sich bei den Husaren und kehrte zu Paul und den anderen Artillerieoffizieren zurück, die ihn bereits mit neugierigen Blicken erwarteten. Er berichtete ihnen kurz, was ihm die Husaren verraten hatten.
„Vielleicht hat ja ein nicht ganz so schneidiger Leutnant den Alten nicht rechtzeitig gegrüßt oder der Frau Generalin nicht zum Geburtstag gratuliert“, stellte Paul spöttisch fest.
„Ich protestiere auf das Schärfste, Mon Capitaine. In unserem Regiment gibt es nur schneidige Leutnants.“ Einer der jungen Leutnants konnte sich diese Bemerkung nicht verkneifen und grinste Paul dabei verschmitzt an.
„Ihr Wort in Gottes Ohr, Leutnant.“ Paul wandte sich Charles zu, nahm ihm beim Arm und zog ihn zur Seite. „Was ist los, Charles? Wieso bist du an deinem freien Tag überhaupt in der Kaserne?“
„Der General hat mich zum Rapport befohlen. Worum es geht, weiß ich auch nicht. Selbst sein Adjutant hüllt sich in Schweigen.“
„Das ist alles mehr als mysteriös. Hat der Alte das Regiment nicht mehr im Griff? Man könnte ...“ Paul unterbrach sich, als eine Ordonnanz neben sie getreten war, und blickte den jungen Soldaten fragend an.
„Capitaine de Villers, der General erwartet Sie jetzt.“
„Na, dann wollen wir mal. Ich werde dir heute Abend berichten, Paul. Vorausgesetzt, deine abendlichen Verabredungen erlauben es.“
„Viel Glück, alter Knabe.“ Paul drückte ihm die Daumen. Wofür auch immer.
Als er dem Ausgang zustrebte, bemerkte Charles, dass die Augen der anderen Offiziere auch jetzt auf ihn gerichtet waren. Noch bevor er die Tür erreicht hatte, drang eine schnarrende Stimme an sein Ohr.
„De Villers, sind Sie der Schmierfink, der im Journal de Paris diese verräterischen und widerwärtigen Parolen verbreitet?“
Charles drehte sich um und blickte dem General der Dragoner, der ihn auf diese beleidigende Weise angesprochen hatte, in das arrogante Gesicht. Im Casino herrschte Totenstille.
„Mon Général, es freut mich ganz besonders, dass Ihnen meine Aufsätze gefallen. Berichten Sie doch auch Ihren Offizieren davon. Jetzt bitte ich Sie, mich zu entschuldigen. Mein Kommandeur erwartet mich.“
Charles drehte sich um und verließ, begleitet von aufbrausendem Stimmengewirr, das Casino.
„De Villers, Sie mögen in der Vergangenheit ihre Verdienste gehabt haben. Dafür haben Sie auch den einen oder anderen Orden verliehen bekommen. Was Sie sich allerdings in der letzten Zeit leisten, ist eines Offiziers unwürdig.“
Capitaine de Villers stand vor dem Schreibtisch seines Regimentskommandeurs und sah diesen mit unbewegter Miene an. General Robert Legrand war ein alter Mann mit schütterem grauem Haar und tiefen Falten im Gesicht, der ihn aus wässerigen Augen musterte. Seine mit goldenen Tressen besetzte Uniform schien der hageren Gestalt etwas zu groß geworden zu sein. Der General schob sein Kinn nach vorn.
„Mon Général, ich bin mir keiner Tatsache bewusst, für die ich mich rechtfertigen, geschweige denn entschuldigen müsste“, erwiderte Charles betont ruhig.
Die hochgezogenen Augenbrauen des Adjutanten, der stocksteif neben dem Stuhl des Generals stand, nahm Charles wohl wahr.
„Ganz Paris spricht von den abscheulichen Schmierereien eines Capitaines der Artillerie, der die hervorragenden Errungenschaften der Revolution in den Schmutz zieht und damit den Waffenrock, den er trägt, und somit jene des gesamten Regiments unehrenhaft befleckt.“
„Gehört nicht zur Freiheit der Revolution auch die Freiheit des Wortes, Mon Général?“ Charles' Verstand und seine Bildung hatten ihn schon in jungen Jahren dazu befähigt, unterschiedliche Positionen logisch und sachlich zu diskutieren. Auch in dem Bewusstsein, dass in der Armee Befehl und Gehorsam galten. Doch er befand sich jetzt nicht auf dem Schlachtfeld. Ein klares Wort unter Offizieren musste erlaubt sein, ganz gleich, welchen Rang sie auch bekleideten.
„Wollen Sie junger Schnösel mich über die Bedeutung der Französischen Revolution belehren? Ich habe Sie nicht herbefohlen, um mit einem renitenten Capitaine eine Debattierrunde abzuhalten. Deshalb frage ich Sie: Sind Sie der Verfasser der Artikel im Journal de Paris, der immer wieder die glorreichen Erfolge der Revolution in den Dreck zieht?“
„Es ist richtig, dass ich von Zeit zu Zeit Aufsätze für das Journal de Paris schreibe.“
„Da kommt ein hergelaufener Capitaine auf die segensreiche Idee, seine unsortierten Gedanken zu Papier zu bringen und diese auch noch zum Wohl aller Weltenbürger lauthals zu verkünden. Hat Sie denn die Hybris befallen, Sie Kretin? Meinen Sie, dass irgendjemand in Paris auf Ihre unbedeutenden Seelenfurze Wert legt?“ Der General war inzwischen rot angelaufen. Seine Schläfenadern traten hervor.
Charles zog es vor zu schweigen.
„Ich befehle Ihnen, Capitaine de Villers, Ihre Schmierereien unverzüglich einzustellen“, schrie der General. „Ich werde Sie in Arrest nehmen lassen, wenn ich noch ein Wort von Ihnen lese oder höre. Vor ein paar Jahren hätten aufsässige Kreaturen wie Sie längst unter der Guillotine gelegen.“
Charles blickte ihn kaum merklich kopfschüttelnd an, verzog dabei jedoch keine Miene. „Mon Général, ich danke Ihnen aufrichtig, dass mir das heute erspart bleibt. Sie gestatten, dass ich mich abmelde?“ Er salutierte übertrieben schneidig, drehte sich um und ließ schnellen Schrittes den General allein zurück, der ihm sprachlos und mit offenem Mund hinterherblickte. Charles wusste, dass mit diesem Verhalten seine Karriere in der Armee soeben ein Ende gefunden hatte. Doch auch ein verknöcherter General würde sich ihm nicht widersetzen können. Schließlich waren die Gedanken frei.
Charles de Villers hatte zwei schlaflose Nächte hinter sich. Die Auseinandersetzung mit dem Regimentskommandeur beunruhigte ihn. Sollte sein Freund Paul doch recht haben? Braute sich hier tatsächlich etwas zusammen? Welches Gewicht hatte der Hinweis auf General Davout und dessen Empörung? Charles hatte zwar genügend Freunde unter den Offizieren des Regiments, selbst in exponierten Positionen, die grundsätzlich seine Ansichten teilten, doch würden sie auch zu ihm halten, wenn die Generalität ihm ihr Wohlwollen entzog? Auch wenn er gegenwärtig keine Antwort auf diese Fragen wusste, über eines war er sich absolut im Klaren: Es gab niemanden auf der Welt, der ihm das Schreiben verbieten konnte.
Er musste auf andere Gedanken kommen. Dafür war heute ein guter Tag. Auch wenn der Besuch bei der Baronin de Stael, den Paul angekündigt hatte, ihm ein gewisses Magengrummeln verursachte, bot sich hier zumindest die Gelegenheit, in unbekümmerter Atmosphäre seine Gedanken zu formulieren, ohne Gefahr zu laufen, dass ihm wegen eines unbedachten Wortes die Guillotine angedroht wurde. Charles erinnerte sich nur ungern an die geschmacklosen Ausbrüche des Generals.
„Oh, mein Herz macht freudige Sprünge, wenn es Sie sieht, mein lieber Charles. Es ist eine Todsünde, dass Sie sich so rarmachen. Ich müsste Ihnen böse sein. Doch mein Verstand kann meinem hüpfenden Herzen nicht widersprechen.“
Madame de Stael, wie die Baronin von allen genannt wurde, begrüßte Charles überschwänglich, als er ihren Salon betrat. Mit offenen Armen umfing sie ihn und drückte ihn an ihren wogenden Busen. Germaine de Stael war eine Persönlichkeit, eine Institution. In ihrem Salon trafen sich regelmäßig bedeutende Personen der Stadt, um ihre Gedanken auszutauschen, zu philosophieren und zu politisieren. Natürlich wurden bei solchen Treffen auch ausführlich die literarischen Werke der Gastgeberin erörtert. Worauf sie selbst stets großen Wert legte. Germaine de Stael hatte Einfluss. Dadurch, dass sie die Großen und Mächtigen Frankreichs kannte, die bei ihr ein und aus gingen, hatte sie naturgemäß auch die Möglichkeit, mit wenigen Worten Schicksale zu lenken, Karrieren zu fördern oder auch zu zerstören.
Doch diese hohe Wertschätzung machte nicht allein die imposante Erscheinung der Baronin aus. Nicht nur dass sie stets lautstark in einem unermüdlichen Redefluss ihre Meinung verkündete, Madame de Stael war auch körperlich beeindruckend präsent. Durch eine raffinierte Auswahl ihrer Kleidung gelang es ihr, ihre üppigen Formen äußerst vorteilhaft zur Geltung zu bringen. Wer glaubte, dieser intelligenten Frau nur auf edlem geistigem Niveau begegnen zu können, der musste sich sehr schnell eines Besseren belehren lassen. Die Baronin war kein Kind von Traurigkeit. Niemand hatte sich bisher die Mühe gemacht, ihre Geliebten zu zählen. Als junge Witwe hielt sie augenscheinlich eine gewisse Diskretion für entbehrlich. Man munkelte sogar, dass auch während ihrer Ehe Treue nicht unbedingt zu ihren favorisierten Tugenden gehört haben sollte. Wie unbedarft und gleichzeitig unverblümt Madame de Stael ihren Favoriten zu verstehen gab, dass ihre Liebe das Platonische gern überschreiten dürfe, hatte Charles bei der herzlichen Begrüßung erneut sehr deutlich verspürt. Es amüsierte ihn einerseits, doch er hatte andererseits wirklich keine Ambitionen, in die Legion der abgelegten Liebhaber der Baronin aufgenommen zu werden. Um sich trotzdem ihr Wohlwollen zu erhalten, musste er behutsam und diplomatisch vorgehen.
„Verehrte Madame de Stael, es ist für mich gleichermaßen eine Freude, Sie in vollster Blüte anzutreffen. Wie müde und erschöpfend wäre es für uns beide, würden wir uns jeden Tag sehen. Wir wissen doch, nicht jede Muschel trägt eine Perle, aber wenn wir eine finden, ist unser Glück umso überschäumender.“
„Charles de Villers, Sie sind ein galanter und unverbesserlicher Charmeur. Vermutlich ist das der Grund, weshalb ich mich in Ihrer Nähe so wohl fühle. Aber jetzt genug der Schmeicheleien, dafür haben wir später noch Zeit. Ich möchte Ihnen meine anderen Gäste vorstellen.“ Mit diesen Worten hängte sich Madame de Stael bei Charles ein und geleitete ihn in den großen Salon, wo bereits ein Dutzend Gäste in Gespräche vertieft waren. Auch Charles' Freund Paul gehörte dazu.
Als dieser die beiden erblickte, steuerte er auf sie zu. „Madame, wenn ich Ihre geröteten Wangen sehe, lässt das nur einen Schluss zu. Sie sind freudig erregt, meinen Freund Charles begrüßen zu können. Trotzdem muss ich Sie bitten, dass ich ihn für einen kurzen Augenblick entführen darf.“
„Nur für fünf Minuten, mein lieber Paul, keine Sekunde länger.“ Die Baronin lächelte die beiden Offiziere kokett an und schwebte davon.
„Hast du heute schon etwas Neues aus dem Regiment gehört?“ Charles und Paul waren in eine Nische getreten, in der sie sich ungestört unterhalten konnten.
„Nein, nach dem Eklat mit dem General habe ich nie wieder etwas gehört. Ich werde morgen ganz normal nach dem Urlaub meinen Dienst antreten und so tun, als ob nichts gewesen wäre. Vielleicht haben sich die Gemüter ja wieder beruhigt.“
„Du bist und bleibst ein Optimist, Charles. Du hast doch gehört, was dieser aufgeblasene General der Dragoner im Casino dir hinterhergerufen hat. Der hat dich im Visier. Er heißt übrigens Dominique Cartier und schwirrt ständig im Schatten von General Davout herum. Jetzt weißt du auch, weshalb Davout so gut über dich informiert ist. Und was glaubst du, was die Generalität am Nachmittag bei der Konferenz noch alles ausgebrütet hat? Da kannst du ganz sicher sein, dass dein Name mehrfach gefallen ist. Und ganz bestimmt werden es keine Lobgesänge gewesen sein. Konntest du wenigstens den Druck deines letzten Artikels im Journal de Paris noch bremsen?“
„Nein, das war zu spät. Der wird definitiv morgen erscheinen.“
„Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist Wasser auf die Mühlen deiner Feinde. Lieber Charles, ich ahne Fürchterliches.“
„Du magst ja recht haben, Paul, aber wir sollten uns damit nicht den heutigen Abend verderben. Stürzen wir uns jetzt in das Getümmel und lassen die bezaubernde Madame de Stael nicht länger warten, bevor sie ungeduldig wird.“
Die Baronin nahm die beiden Offiziere sofort wieder in Beschlag. Sie führte sie zu einer Gruppe von Damen und Herren, die sich angeregt unterhielten, stellte sie einander vor und ergriff anschließend das Wort.
„Mein lieber Charles, Ihr Urteil kommt uns gerade zur rechten Zeit. In dieser Runde herrschen ein paar eigentümliche Vorstellungen von den Qualitäten unseres Ersten Konsuls, Napoleon Bonaparte. Wie Sie wissen, stehe ich diesem kleinen Emporkömmling skeptisch gegenüber. Wie sehen Sie ihn?“
„Wenn ich mich recht entsinne, verehrte Baronin, gab es eine Zeit, in der Sie den Korsen als einen kühnen Krieger, tiefen Denker und schlechthin als das ungewöhnlichste Genie der Geschichte bezeichneten. Woher der Sinneswandel?“
„Napoleon ist nicht mehr als ein Parvenü, ein Ungebildeter, der lediglich die Konfusion der Zeit nach der Revolution genutzt hat, um sich nach oben zu kämpfen. Seinen Ägyptenfeldzug stellt er als heroischen Sieg dar. Und was ist es wirklich gewesen? Ein riesengroßes Desaster, bei dem der glorreiche Feldherr auch noch seine Armee im Stich gelassen hat. Fahnenflucht nennt man so etwas.“ Mit bebender Stimme hatte Benjamin Constant das Wort ergriffen. Der Schweizer Philosoph und ständige Begleiter der Baronin war für die kritische Beurteilung des Ersten Konsuls bekannt. Er hatte noch nie ein gutes Haar an ihm gelassen und seine Sicht auch stets unverblümt geäußert.
„Ich kann meinem Freund Benjamin nur recht geben. Dieser Wichtigtuer wird Frankreich noch ins Verderben führen.“ Die Baronin legte Benjamin Constant beruhigend die Hand auf den Arm.
„Aber damit ist meine Frage noch nicht beantwortet, Madame. Woher der Sinneswandel?“ Charles lächelte sie freundlich an.
„Ja, ich gebe gern zu, dass ich anfangs große Hoffnungen in diesen Mann gesetzt habe. Doch inzwischen ist mir bewusst geworden, dass ich einem hinterhältigen Verführer auf den Leim gegangen bin. Es beruhigt mich wenig, dass ich nicht die Einzige war, die ihn im falschen Licht gesehen hat. Ganz im Vertrauen, er ist nichts anderes als ein Bauer, ein Rüpel, ein ungehobelter Klotz.“ Bei diesen Worten schien die sonst so souveräne Überlegenheit der Baronin einen kleinen Kratzer erlitten zu haben. Ihre leidenschaftlichen Gesten und geröteten Wangen irritierten die Anwesenden. Bei allem Engagement für die Sache war ihre heftige Reaktion für die meisten von ihnen kaum verständlich.
„Verzeihen Sie bitte, Madame, ich wollte Ihnen mit meiner Frage kein Unbehagen bereiten. Es sieht fast so aus, als ob Ihre letzte Begegnung mit Napoleon eine eher unerfreuliche war. Ist er Ihnen etwa zu nahe getreten?“ Die Umstehenden hielten die Luft an. Konnte man eine Dame so etwas fragen?
„Mein lieber Charles, es erstaunt mich immer wieder, auf welch betörende Weise und Präzision Sie der Sache auf den Grund gehen, ganz gleich, über welches Thema wir uns unterhalten. Doch nun zu Ihrer Frage. Dieser ungehobelte Kerl hat fürwahr bei meinem letzten Besuch nicht den richtigen Ton getroffen.“ Inzwischen schien sich die Baronin wieder gefasst zu haben, denn in ihren Augen war ein amüsiertes Blitzen zu entdecken. „Eigentlich wollte ich von diesem Vorfall niemandem erzählen. Selbst mein braver Freund Benjamin weiß nichts davon.“
„Madame, wollen Sie uns etwa jetzt über eine Staatsaffäre berichten? Dann müssen wir als Offiziere und treue Diener des Vaterlandes Ihren Salon verlassen“, warf Paul Martigny mit bedeutender Miene ein. Was augenblicklich zu übersprudelnder Heiterkeit aller führte.
„Mein lieber Paul, es ist weitaus bedeutender. Hören Sie aufmerksam zu. Wie es sich für eine Dame aus gutem Hause gehört, habe ich mich sehr penibel auf den Besuch bei unserem Ersten Konsul vorbereitet. Dazu zählte eine angemessene Garderobe, wie Sie alle verstehen werden. Ich wählte ein Kleid, das absolut dem neuen Schick und der aktuellen Mode entsprach. Ein weich fallendes Gewand in Grau und Violett, lose mit einem bestickten Seidenbrokatband unter der Brust gebunden sowie mit einem dekorativen Ausschnitt. Wissen Sie, was dieser Flegel zu mir sagte, als er mich sah und begrüßte?“ Madame de Stael erwartete keine Antwort und fuhr gleich fort. „Er sagte wörtlich: Madame, ich gehe davon aus, dass Sie Ihre Kinder selbst stillen. Dabei starrte er mir ohne jede Scham auf den Busen.“ Die Baronin konnte nicht weitersprechen, weil sie in das schallende Gelächter ihrer Gäste mit einstimmen musste. Es dauerte eine Weile, bis sich alle wieder beruhigt hatten.
„Madame, aus dem Mund eines Mannes, den Gott nicht mit allzu großer Körperlänge bedacht hat und der notgedrungen mit Ihren weiblichen Reizen auf Augenhöhe korrespondieren muss, können Sie ein solches Wort nur als Kompliment werten.“ Alle Anwesenden amüsierten sich königlich über Charles' Beurteilung der Situation.
„Sie sind wirklich in der Lage, den Dingen des Lebens die richtige Blickrichtung zu geben, mein lieber Charles. Auch wenn ich die fröhliche Stimmung nur ungern zerstöre, so sind Sie mir doch immer noch eine Antwort schuldig. Wie beurteilen Sie Napoleon?“
„Nun, Madame, wie Sie wissen, beobachte ich die Entwicklung der vergangenen Jahre mit großer Besorgnis. Sie kennen alle meine Schriften, in denen ich den Verlust der Ideale der Revolution beklage. Von ihren blutrünstigen Auswüchsen und Gräueltaten ganz zu schweigen. Die Machtgelüste einzelner Köpfe bestimmen die Politik. Die neue Verfassung ist ein einziger Witz. Das Volk wurde bei der Abstimmung betrogen und die Parlamente entmachtet. Nur der Erste Konsul hat die Macht. Er bestimmt die Minister und die Staatsbeamten. Auch wenn er lauthals verkündet, dass die Revolution zu ihren Grundsätzen zurückgekehrt sei, so frage ich Sie, welche er denn meint. Von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit kann ich kaum mehr etwas entdecken. Nach meiner Ansicht haben wir heute eine Situation, die mir nicht wesentlich besser erscheint als vor der Revolution. Ich befürchte sogar, wir sind einer Diktatur nicht fern.“
„Monsieur de Villers, jetzt muss ich Ihnen aber doch mit Vehemenz widersprechen.“ Ein älterer Herr mit weißem Schnauzbart, den Madame de Stael als Advokat namens Pierre Durand vorgestellt hatte, protestierte voller Inbrunst. „Napoleon Bonaparte hat uns den Frieden beschert. Hat er nicht im vergangenen Jahr in Lunéville den Frieden mit Österreich geschlossen und in diesem Jahr im Frieden von Amiens den Krieg mit England beendet?“
„Diesen Frieden sind jahrelang Kriege vorausgegangen, Monsieur. Mein Freund Paul und ich wissen, wovon wir sprechen. Wir waren dabei. Tausende anderer Soldaten auch, die unser Vaterland verteidigt und ihr Leben für Frankreich gelassen haben. Zu welchem Preis, Monsieur Durand? Ich will es Ihnen sagen. Auch wenn wir die feudalen Privilegien weitestgehend abgeschafft haben, sind es heute die bürgerlichen Schichten, die ihren Platz eingenommen haben. Sie verteidigen ihre Pfründe und halten Napoleon den Steigbügel zu seinem Aufstieg.“
„Ich gebe Monsieur de Villers uneingeschränkt recht“, schaltete sich Benjamin Constant erneut in das Gespräch ein, „der Korse benutzt das Volk für seine persönlichen Zwecke. Und das merkt es noch nicht einmal.“
„Meine Damen, meine Herren, wie ich sehe, hat unser hochgelobter Erster Konsul an diesem Abend schlechte Karten. Er müsste sich schon sehr bemühen, um unser Wohlwollen wieder zu erlangen. Wir werden noch genügend Zeit haben, uns über seine Pläne zu ereifern. Aber zunächst sollten wir unsere leiblichen Gelüste nicht aus den Augen verlieren.“
Madame de Stael unterbrach die leidenschaftlichen Diskussionen und bat ihre Gäste zum Diner.
Kapitel 2
Fröhliches Lachen hallte über den Campus der Universität von Göttingen, lautes Rufen erklang, erregte Stimmen warfen einander Frechheiten zu. Professor Schlözer schüttelte den Kopf. Hatte er vergeblich versucht, den jungen Hitzköpfen die Bedeutung des Lebens und die Sinnhaftigkeit der menschlichen Natur nahezubringen? Waren alle seine Bemühungen umsonst gewesen, ihnen die wahre Größe des Geistes eines Homo sapiens zu vermitteln? Wie Lausbuben tobten sie herum, neckten einander und benahmen sich wie geistlose Wesen, kaum dass die Vorlesungsstunde beendet war. Doch im Grunde seines Herzens nahm er den sorglosen Studenten ihren Übermut nicht übel. War er nicht selbst schuld daran, dass die jungen Menschen sich ihrer Unbekümmertheit und ihrer lebensfrohen Kraft bewusst waren? Sie drängten sich wissbegierig in seine Vorlesungen, hingen an seinen Lippen. Nicht zuletzt auch, weil er es verstand, sie zu begeistern. Seine oft provozierenden Thesen führten nicht selten zu aufbrausenden Diskussionen. Seine zeitweise ungewöhnliche Wortwahl und die für viele seiner Kollegen allzu liberalen Ansichten fielen bei den Studenten auf fruchtbaren Boden. Oft genug hatten ihm andere Professoren vorgeworfen, dass er die lockere Moral der verantwortungslosen Jugend von heute durch sein Verhalten noch fördern würde. Doch Professor August Ludwig Schlözer ließ sich nicht von seinem Weg abbringen. Als Historiker und Pädagoge hatte er sich längst über die Grenzen Göttingens hinaus einen anerkannten Ruf erworben. Das verantwortungsvolle Handeln der Menschheit in ihrer Entwicklung und im Gefüge der Geschichte hatte für ihn eine ebenso unabweisbare Bedeutung wie auch die staatsrechtliche Verantwortung aller Regierenden. Dabei nahm er nie ein Blatt vor den Mund, wenn es darum ging, die Willkür der Obrigkeit in ihren politischen Entscheidungen anzuprangern und von seinen Studenten gleichermaßen einen wachen Geist zu fordern.
Professor Schlözer schmunzelte. Letztlich hatte er doch selbst die Saat gelegt, die den Drang der jungen Menschen nach Freiheit und Ausbruch aus den allzu strengen Konventionen dieser Zeit nur zu verständlich machten. Gemütlichen Schrittes verließ er das Universitätsgelände, genoss die wärmenden Sonnenstrahlen und steuerte sein Zuhause in der Paulinerstraße an.
Kaum hatte der Professor sein Haus betreten, kam ihm sein Eheweib aufgeregt entgegengerauscht. „August, du bist spät und bringst unseren ganzen Zeitplan durcheinander! Du weißt doch, dass wir heute zum Kaffee Gäste erwarten, und hast immer noch kein Mittagsmahl zu dir genommen.“
„Caroline, was beunruhigt dich so? Ich kann meine Arbeit an der Universität nicht wie ein fauler Maurer beenden und die Kelle beim Glockenschlag fallen lassen.“ August Schlözer wollte sich seine gute Stimmung nicht durch irgendwelche häuslichen Nebensächlichkeiten verderben lassen. „Mach dir keine Umstände“, fuhr er fort, „ich werde eine Kleinigkeit in der Küche zu mir nehmen und deine heimische Ordnung nicht durcheinanderbringen.“ Doch dann zögerte der Professor. „Hilf mir bitte, meine Liebe. Wen erwarten wir denn heute noch?“
„Ach, August. Seit Tagen sprechen wir davon, dass wir unbedingt die Basedows einladen müssen. Es wäre doch peinlich, wenn wir das immer wieder auf die lange Bank schieben. Damit wir uns nicht nur mit den beiden beschäftigen müssen, habe ich weitere Bekannte dazugebeten, denen wir ebenfalls mehr oder weniger verpflichtet sind.“
Innerhalb von Sekunden war die gute Stimmung des Professors verflogen. Missmutig sah er seine Frau an.
„Ich weiß, August, dass du den Namen Basedow nicht gern hörst, aber wir haben schließlich eine gesellschaftliche Verantwortung.“
„Dass der Name Basedow mir nicht gefällt, ist stark untertrieben. Dagegen ist die Pest geradezu eine Wohltat.“
„August! Bitte sei jetzt nicht ungerecht. Er ist ein Kollege und kann von dir einen gewissen Respekt erwarten. Ich möchte dich eindringlich bitten, eure Differenzen wenigstens unter unserem Dach ruhen zu lassen.“
„Das kann ich dir nicht versprechen. Bereits der Gedanke an ihn bringt mein Blut zum Kochen. Vielleicht kann ja das Essen von Minna mein Gemüt ein wenig beruhigen.“ Grummelnd drehte sich August Schlözer um und stieg die Treppe in das Reich ihrer Köchin hinunter. Caroline Schlözer blickte ihrem Mann kopfschüttelnd hinterher.
„Hallo, Papa, was hat Sie denn so verstimmt?“ Dorothea, die siebzehn Jahre alte und über alles geliebte Tochter des Professors, kam ihm auf der untersten Stufe der Treppe zur Küche entgegen.
„Ach, Dortchen. Hast du gewusst, dass die Basedows heute bei uns einfallen werden?“
„Aber Papa, das hat doch Mama schon vor längerer Zeit erwähnt. Spielen wir jetzt wieder den zerstreuten Professor?“ Gemeinsam mit ihrem Vater betrat Dorothea die Küche.
„Weißt du eigentlich, dass in gewöhnlichen Haushalten bei solch respektlosem Verhalten den Eltern gegenüber die Kinder übers Knie gelegt oder im Hühnerstall eingesperrt werden?“ August Schlözer konnte seiner Tochter nie böse sein.
Dorothea lachte unbekümmert. „Ich bin untröstlich, lieber Vater, dass Sie eine so unerzogene Tochter haben.“
„Herr Professor, Fräulein Dorothea, ist etwas geschehen? Kann ich helfen?“ Minna, die langjährige Köchin des Hauses, flatterte den beiden wie ein durch einen Fuchs aufgescheuchtes Huhn entgegen und trocknete sich verlegen die Hände in der Schürze ab.
„Keine Aufregung, Minna“, versuchte der Professor die dralle Köchin zu beruhigen, „ich möchte nur ein kleines Mittagessen in deiner Küche zu mir nehmen, damit ich die Vorbereitungen zum Kaffeekränzchen im Speisesalon nicht störe.“
„Selbstverständlich, Herr Professor. Gesa, wisch den Tisch ab; Hermine, hol Besteck und Teller für den Herrn Professor!“ Minna scheuchte die Küchenmädchen auf, die die seltenen Gäste in ihrer Küche bisher untätig angestarrt hatten.
Dorothea setzte sich ihrem Vater gegenüber an den derben Eichentisch und lächelte ihn an. „Papa, wie lange kennen Sie eigentlich schon Professor Basedow? Oder besser noch: Seit wann gelingt es ihm, Sie regelmäßig so sehr aus der Fassung zu bringen?“
„Wenn ich das nur genau wüsste. Du kennst seine verwirrten Ansichten über den Unterschied des menschlichen Geistes zwischen Männern und Frauen. Wir haben oft genug darüber gesprochen. Jetzt, wo wir ihm mit deiner Ausbildung einen Beweis erbracht haben, dass jeder Mensch, ganz gleich welchen Geschlechtes, zu logischem Denken und wissenschaftlichen Analysen fähig ist, beharrt er nach wie vor auf seinen unsinnigen Thesen und verkündet noch irrwitzigere Erklärungen für seine Hirngespinste.“
„Aber Sie kennen ihn und seine Ansichten doch schon so lange, und haben Sie mir nicht oft genug im Zusammenhang mit der menschlichen Ignoranz geraten, man könne von einem Ochsen nicht mehr als Rindfleisch verlangen?“
Überrascht sah Professor Schlözer seine Tochter an und lachte. Die Köchin und die Mägde, die sich eifrig am Herd zu schaffen gemacht hatten, fuhren erschrocken herum.
„Du hast ja recht, Dortchen, hoffentlich fange ich nachher beim Kaffee nicht ohne Grund an zu lachen, wenn ich mir anstelle von Basedow einen Ochsen bildlich vorstelle.“ Vater und Tochter brauchten eine Weile, bis sie sich wieder beruhigt hatten. Das Küchenpersonal verfolgte die ausgelassenen Albernheiten seiner Herrschaften mit verwunderten Augen.
Am Nachmittag herrschte eine eher gedämpfte Stimmung im Speisesalon der Familie Schlözer in der Paulinerstraße. Eingeladen waren sechs Honoratioren der Stadt mit ihren Ehefrauen. Neben dem Dekan, Professor Michaelis, gehörten auch Professor Basedow und Hofrat Kästner sowie Bürgermeister Gabelstein, der Apotheker Mahlberg und Pastor Ockernagel zu den Gästen. Es wurde Kaffee und Gebäck gereicht und alle waren darum bemüht, leichte Konversation zu betreiben. Lediglich Dorothea war nicht entgangen, dass Frau Basedow und die Frau des Pastors sich bedeutungsvolle Blicke zugeworfen hatten, als auch sie sich mit an den Kaffeetisch gesetzt hatte.
„Nun, Herr Dekan, wird denn die Universität ihr fünfundsechzigjähriges Bestehen in diesem Jahr festlich begehen?“ Der Apotheker hatte seine Stimme erhoben und sah sein Gegenüber fragend an. Die anderen am Tisch verstummten und erwarteten die Antwort des Dekans.
„Mein lieber Herr Mahlberg, ich weiß, dass Sie und so mancher Bürger dieser Stadt der Meinung sind, dass die Studenten der Universität nichts anderes tun, als ununterbrochen Feste zu feiern, statt sich auf ihr Studium zu konzentrieren. Dies ist nur möglich, da auch die Professoren eine gleiche Geisteshaltung vertreten.“
Der Apotheker sah den Dekan mit weit aufgerissenen Augen an und wollte heftig protestieren. Auch Hofrat Kästner und Professor Basedow zeigten sich entrüstet, doch der Dekan hob abwehrend eine Hand, bevor jemand das Wort ergreifen konnte.
„Meine Damen, meine Herren, wo haben Sie Ihren Sinn für Humor versteckt? Verzeihen Sie meinen Zynismus. Zu Ihrer Frage, Herr Apotheker, fünfundsechzig ist keine jubiläumswürdige Zahl und somit auch kein Grund für eine Feier.“
Ein allgemeines Aufatmen war zu hören, hatte der eine oder andere doch eine schärfere Auseinandersetzung befürchtet, da der Apotheker allgemein als Querkopf bekannt war. Doch der wiederhergestellte Burgfriede im Hause Schlözer sollte nicht lange andauern.
„Sagen Sie, Kollege Schlözer, ich gehe davon aus, dass Sie uns heute noch einen Höhepunkt bieten möchten, oder wie können wir die Anwesenheit Ihres Fräulein Tochter in dieser Runde deuten?“ Professor Basedow hatte ein süffisantes Lächeln aufgesetzt, was seinem Kontrahenten gegenüber und allen anderen Anwesenden eine gewisse Überlegenheit demonstrieren sollte. Betretene Stille trat ein.
„Nun, verehrter Kollege, ich weiß nicht, was Sie anderes von mir und meiner Familie erwartet haben als einen gemütlichen Nachmittag unter meinem Dach.“
Caroline Schlözer fiel ein Stein vom Herzen, als sie die verbindliche Antwort ihres Mannes hörte.
„Geben Sie es doch zu, Schlözer, Ihnen brennt es förmlich auf den Nägeln, uns Ihr vortrefflich dressiertes Töchterchen mit all ihrem Wissen zu präsentieren.“ Professor Basedow grinste immer noch unverschämt und blickte sich zudem noch Beifall heischend um.
„Herr Professor Basedow, es war in diesem Haus bisher noch nie üblich und es wird auch heute nicht so sein, dass Personen in irgendeiner Weise zu zirkusähnlichen Darbietungen aufgefordert werden, wie sehr auch immer sich ein sensationslüsternes Publikum danach sehnen mag.“
„Soll das möglicherweise heißen, dass Ihre Tochter doch nicht über den sprichwörtlichen Wissensstand verfügt, über den man sich überall erzählt?“ Professor Basedow ließ nicht locker.
Noch bevor der Hausherr antworten konnte, erhob der Dekan das Wort. „Meine Herren, ich glaube, wir sollten die Damen nicht mit unseren fachkundigen Themen ermüden. Vielleicht bleibt dafür nach dem Kaffee in anderer Zusammensetzung noch Zeit.“
„Ein dankenswerter und weiser Hinweis, Herr Dekan. Wir Herren der Schöpfung werden uns beizeiten in die Bibliothek zurückziehen und so auch den Damen Gelegenheit geben, sich ihrem heimischen Erfahrungsaustausch zu widmen.“ Professor Schlözer nickte dem Dekan freundlich zu und schenkte seiner Frau und seiner Tochter ein aufmunterndes Lächeln.
Dorothea hatte die Diskussion mit unbewegter Miene verfolgt. Sie wusste schon seit Langem, mit welcher Abscheu Professor Basedow ihre Erziehung verfolgte. In seinen Augen war nur das männliche Geschlecht zu wissenschaftlichem und logischem Denken fähig. Eine Frau hatte Kinder zu gebären und gehörte hinter den Herd.
Dass Dorothea bereits mit vier Jahren lesen konnte und jetzt mit siebzehn Jahren zehn Sprachen beherrschte, dass sie schon in jungen Jahren mit ihrem Vater eine Studienreise nach Rom unternommen und unzählige Vorlesungen an der Universität besucht und profunde Kenntnisse in verschiedenen Fakultäten erworben hatte, hielt nicht nur Professor Basedow in Göttingen für widernatürlich.
Kaum hatten sich die Herren in die Bibliothek zurückgezogen, war die Erziehung Dorotheas bei den Damen das vorrangige Thema. Auch sie schienen über diese ungewöhnliche Entwicklung mehr als beunruhigt zu sein. Wo gab es denn so etwas, dass sich junge Frauen in Konkurrenz zu dem männlichen Geschlecht begaben und dabei womöglich noch ihre elementaren hausfraulichen Pflichten versäumten?
„Wie konnten Sie es nur zulassen, meine Liebe, dass Ihr Gatte mit Dorothea derart ungewöhnliche Exerzitien betrieben hat?“ Die Frau des Pastors Ockernagel schien immer noch entrüstet zu sein.
„Ach, Frau Ockernagel, in Dorotheas Erziehung werden so viele Wenn und Aber hineininterpretiert und Fragezeichen gesetzt. Das Kind war einfach nur wissbegierig und mein Mann hat diese natürliche Neugier lediglich ein wenig gefördert.“ Caroline Schlözer wollte sich von den aufgebrachten Damen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ähnlich wie ihrem Mann waren ihr diese verknöcherten Vorstellungen eines vermeintlich ehrbaren Lebens ein Gräuel.
„Aber Sie werden doch zugeben, Frau Schlözer, dass die Stellung einer ehrbaren Frau in unserer Gesellschaft die an der Seite eines gut situierten Mannes ist. Wie will ein so überdrehtes Mädchen wie Dorothea denn eine solche Position überhaupt zufriedenstellend erfüllen können?“ Nun blies auch die Frau von Bürgermeister Gabelstein in dasselbe Horn wie die Frau des Pastors.
Dorothea hatte die sie betreffende Diskussion aufmerksam verfolgt, doch jetzt konnte sie sich nicht mehr zurückhalten. „Worin sehen Sie das Problem, Frau Gabelstein, wenn eine Ehefrau ihrem Gatten auf Augenhöhe begegnet und sich mit ihm bei Bedarf über seine beruflichen Sorgen unterhalten kann?“
Irritiert wandten die Damen ihre Köpfe Dorothea zu. Ihre Anwesenheit hatten sie bisher konsequent ignoriert.
„Wir glauben kaum, dass ein Kind deines Alters diese Dinge beurteilen kann“, fuhr Frau Basedow Dorothea über den Mund.
Doch die ließ sich von dieser aufgeblasenen Matrone nicht einschüchtern. „Sie sind also der Meinung, dass Sie Ihren Pflichten als treu sorgende Ehefrau damit Genüge tun, dass Sie Ihren Ehemännern regelmäßig das Essen servieren lassen und ihnen eine ausreichende Zahl an Kindern gebären?“ Dorothea registrierte, dass ihre Mutter bei diesen Worten besorgt die linke Augenbraue hob. Sie wusste aber auch, dass ihre Mutter ähnlich dachte wie sie.
„Frau Schlözer, ich weiß nicht, ob wir uns das von Ihrer Tochter bieten lassen müssen?“ Die Frau des Apothekers schien jetzt ebenfalls in ihrer Hausfrauenehre gekränkt zu sein.
„Meine Damen, es besteht doch gar kein Anlass, sich in irgendeiner Weise zu erregen. Auch Dorothea wird ohne Frage beizeiten einen passenden Ehemann finden und ihm gleichermaßen eine gute Ehefrau sein.“
„Ist sie dazu denn überhaupt in der Lage?“, wollte jetzt die Frau des Pastors wissen.
„Warum sollte sie das nicht sein, Frau Ockernagel?“ Die Hausherrin runzelte die Stirn.
„Nun, von den Fähigkeiten einer guten Hausfrau hat man ja im Zusammenhang mit Dorothea noch nie etwas gehört, da sie bisher ihre Nase nur in Bücher gesteckt hat. Kann sie überhaupt kochen oder nähen?“ Die Damen unterhielten sich weiter so, als ob Dorothea gar nicht anwesend wäre.
„Sie können ganz beruhigt sein, meine Damen. Ich habe meine Tochter sehr gründlich in allen Dingen unterwiesen, die von einer zukünftigen Ehefrau erwartet werden.“ Caroline Schlözer nickte Dorothea beruhigend zu, als wollte sie sagen: „Nimm die aufgeplusterten Hühner einfach nicht ernst.“
„Davon war bisher aber nichts zu spüren“, bemerkte die Frau des Bürgermeisters pikiert, „denn von einer braven Tochter hätte man ja schon einige Handreichungen erwarten können, als uns der Kaffee serviert wurde.“
Dorothea wusste nicht, ob sie sich über so viel Borniertheit aufregen oder diese Ansammlung einfältiger Überheblichkeit belächeln sollte? Bevor ihre Mutter etwas erwidern konnte, sagte sie selbstbewusst: „Wie Sie alle wissen, bin ich in einem Haus aufgewachsen, das meine Eltern gut bestellt haben. Wir leisten uns den Luxus, wie auch Sie, verehrte Damen, Bedienstete zu beschäftigen, die uns zur Hand gehen. Worin besteht also die Notwendigkeit, diesen hilfreichen Personen ihre Arbeit streitig zu machen?“
„Es ist doch eine Unverschämtheit! So kann nur jemand sprechen, der von Hausarbeit keine Ahnung hat.“ Die Frau des Pastors konnte sich kaum beruhigen.
„Ich bitte Sie, meine Damen. Mein Mann hat bereits erklärt, dass es in unserem Haus unüblich ist, schauspielerische Demonstrationen zu veranstalten.“ Dorothea musste dieser Scharade einfach ein Ende setzen. Abrupt stand sie auf. „Vielleicht stellen Sie sich alle selbst einmal die Frage, wann Sie das letzte Mal persönlich am Herd gestanden und Ihrem Gatten eine Suppe gekocht haben. Oder auch, wie lange es her ist, dass Sie Nadel und Faden in die Hand genommen haben, um Ihrem geliebten Ehemann die Strümpfe zu stopfen. Sie werden mich jetzt sicherlich entschuldigen, aber meine hausfraulichen Pflichten rufen mich.“ Dorothea vollführte einen übertriebenen Knicks und rauschte davon. Zurück blieben entgeisterte Damen, die ihr Entsetzen kaum mehr in Worte fassen konnten.
Auch im Kreise der Herren in der Bibliothek prallten bei einem Glas Portwein die unterschiedlichen Auffassungen aufeinander. Kaum hatten sich die Türen geschlossen, stürzte Professor Basedow sich erneut auf den Hausherrn. „Nun, Schlözer, wo ist Ihr Beweis, dass auch Frauen wissenschaftlich analysieren können?“
„Ich weiß, Herr Kollege Basedow, dass Sie ausschließlich für sich den Anspruch erheben, der von Gott berufene Pädagoge nördlich der Alpen zu sein ...“
„Aber meine Herren, ich bitte Sie ...“
Die redliche Bemühung des Dekans um Mäßigung wurde nicht erhört.
„... doch seien Sie versichert“, fuhr Professor Schlözer unbeirrt fort, „es gibt neben Ihnen auch noch andere, die in der Erziehung von Kindern durchaus bewandert sind.“
„Meinen Sie damit etwa sich selbst? Nur weil Sie ein pädagogisches Konzept verfasst und veröffentlicht haben, das für Jungen und Mädchen gleichermaßen gelten soll. Welch ein irrsinniger Ansatz!“
„Ist das wirklich wahr?“ Pastor Ockernagel wirkte erschüttert. Erregt hatte er sein Portweinglas auf dem Tischchen neben sich abgestellt und sah Professor Schlözer ungläubig an. „Herr Professor, behaupten Sie ernsthaft, dass die Erziehung von Frauen jener der Männer gleichzusetzen ist?“
„Was entsetzt Sie daran so, verehrter Herr Pastor?“
„Das ist Gotteslästerung, infam und unbegreiflich. Schon im Brief des Apostel Paulus an die Epheser steht geschrieben: ,Die Weiber seien Untertan ihren Männern'.“
„Sie sprechen mir aus dem Herzen, lieber Pastor. Nun, Schlözer, haben Sie jetzt begriffen, wie weit Sie sich mit Ihren unsinnigen Theorien aus dem Fenster gelehnt haben?“ Professor Basedow hatte erneut sein abfälliges Grinsen aufgesetzt, was wiederum Professor Schlözer auf die Palme brachte. Von einem Kirchenmann hatte er nichts anderes erwartet, als dass der sich, ganz gleich bei welchen Themen, hinter der Bibel versteckte. Aber ein Mann der Wissenschaft sollte grundsätzlich anders argumentieren, selbst wenn seine Thesen irrwitzig waren.
„Basedow, was sind Sie für ein armseliger Wissenschaftler, wenn Sie als einziges Argument ein Bibelzitat vorweisen können? Ich frage Sie alle, meine Herren, kann man einem Menschen seine elementaren Menschenrechte nehmen, nur weil dieser ein Weib ist?“
„Ich glaube, meine Herren, wir müssen uns in dieser Angelegenheit gar nicht so stark echauffieren.“ Hofrat Kästner versuchte zu vermitteln. „Unstrittig ist, dass mit der vortrefflichen Erziehung Dorotheas ein intelligentes Mädchen herangewachsen ist. Wenn es nun ausschließlich als Beweis für oder gegen die eine oder andere These herhalten soll, tut man dem Kind selbst mehr als unrecht. Ich meine zu wissen, dass der Herr Dekan in dieser Sache noch etwas anzumerken hat.“
Erwartungsvoll sahen die Herren den Dekan an.
„Mein lieber Kästner, Sie bringen mich in eine gewisse Verlegenheit. Aber es scheint der angemessene Zeitpunkt zu sein, Ihnen eine bedeutende Entscheidung des Senats der Universität mitzuteilen. Es ist mehrheitlich entschieden worden, die junge Gelehrte und Kandidatin Dorothea Schlözer einem Examen zu unterziehen. Ziel ist es, ihr die Doktorwürde zu erteilen.“
Noch bevor es zu aufgeregten Äußerungen der Anwesenden kommen konnte, war der Dekan mit seinem Glas in der Hand aufgestanden und auf Professor Schlözer zugetreten. „Ich beglückwünsche Sie von ganzem Herzen, mein lieber Schlözer, und bin fest davon überzeugt, dass Ihre Tochter dem Hause Schlözer keine Schande bereiten wird.“
Auch die anderen Gäste hatten sich erhoben und stießen mit dem Hausherrn an. Keiner von ihnen traute sich, den Beschluss des Senats zu kritisieren. Nur an den verbissenen Gesichtern von Professor Basedow und Pastor Ockernagel war zu erkennen, dass sie die Entscheidung keineswegs akzeptabel fanden. Professor Schlözer nahm die Glückwünsche mit souveräner Gelassenheit entgegen, obwohl er in seinem Innern vor unbändiger Freude Purzelbäume schlug.
Kapitel 3
Um die sieben Türme der alten Hansestadt Lübeck wehte ein kühlender Ostwind. Eine wohltuende Erholung von der erdrückenden Schwüle der vergangenen Tage. Irgendwo über der Ostsee musste ein Gewitter die Luft gereinigt haben.
Der Kaufmann und Senator Matthäus Rodde saß in seinem Kontor in der Breiten Straße und beugte sich über seine Bücher. Eine Aufgabe, die ihm keine allzu große Freude bereitete. Für solch profane Tätigkeiten hatte er schließlich Buchhalter und Schreiber. Doch als einer der mächtigsten Kaufleute Lübecks hielt er es nun einmal für nötig, von Zeit zu Zeit nach dem Rechten zu sehen, obwohl Geld für Matthäus Rodde keine Rolle spielte. Weitaus mehr Wert legte er auf sein Renommee. Seinem Amt als Senator der Hansestadt widmete er den größten Teil seiner Zeit und die volle Aufmerksamkeit. Sein Wort hatte Gewicht bei den Herren im Rathaus, und es gab kaum eine Entscheidung der Ratsherren, die nicht auch seine Handschrift trug.
„Verzeihen Sie, Herr Senator, Kapitän Wartenberg möchte Sie sprechen.“
Matthäus Rodde schrak auf. Er hatte nicht gemerkt, dass sein Buchhalter eingetreten war. „Wartenberg? Ist er schon da? Ich hatte ihn erst übermorgen erwartet. Es geht ja nichts über schnelle Schiffe, was, Holtkamp? Er soll hereinkommen.“ Wenig später begrüßte er seinen Besucher. „Wartenberg, lassen Sie sich ansehen. Sie sind schneller, als ich gedacht hatte.“ Matthäus Rodde war dem Kapitän entgegengetreten und begrüßte ihn mit Handschlag.
Andreas Wartenberg war der Kapitän eines seiner Handelsschiffe mit dem Namen „Sturmvogel“, einem schnellen Schoner, der mit Waren aus Nowgorod den Lübecker Hafen erreicht hatte. Er war ein stattlicher Mann, groß, kräftig und trotz seiner erst dreißig Jahre bereits ein erfahrener Seemann, dem an Land wie auf See niemand so schnell das Ruder aus der Hand nehmen konnte. Kapitän Wartenberg sagte, was er dachte. Manch einer hielt ihn für grob und ungehobelt, doch die wenigen, die ihn kannten, wussten, dass sich hinter der derben Schale ein intelligenter und aufrechter Charakter sowie ein gutes Herz verbargen.
„Wir hatten 'ne ganze Zeit fünf bis sechs Windstärken aus Ost, Herr Senator. Das lässt den ,Sturmvogel' selbst mit vollem Bauch verdammt gut fliegen.“
„Das hört sich zufriedenstellend an. Irgendwelche Probleme in Nowgorod?“
„Nein. Nichts von Bedeutung. Die üblichen Rangeleien um den besten Liegeplatz und die Kabbeleien mit den Zöllnern. Aber das kennen wir ja schon. Was nicht Martens schon im Keim erstickt hat, haben wir selbst überzeugend geregelt.“ Der Kapitän lächelte vielsagend. „Ich habe übrigens einen Brief von ihm mitgebracht, den ich Ihnen persönlich übergeben soll.“ Er zog einen versiegelten Umschlag aus seiner Jacke und überreichte ihn dem Senator. Der legte ihn unbeachtet auf den Schreibtisch.
„Gut, dass alle gesund wieder in Lübeck gelandet sind. Sie kümmern sich zunächst darum, dass das Schiff schnell entladen wird. Wann und mit welcher Ladung Sie wieder auslaufen werden, kann ich erst in drei bis vier Tagen sagen. Auf jeden Fall muss das Schiff nach dem Entladen gleich seeklar gemacht werden. Die Heuer für die Leute zahlt wie immer Holtkamp aus, wenn das Schiff entladen ist.“
Matthäus Rodde entließ den Kapitän, setzte sich wieder hinter seinen Schreibtisch und erbrach das Siegel des Sekretärs Martens seines Kontors aus Nowgorod. Stirnrunzelnd las er die wenigen Zeilen, die Martens vermutlich in Eile kurz vor dem Ablegen des Schiffes auf das Papier gekritzelt hatte. Er schrieb von Unwettern der letzten Wochen in Russland, die einen nicht unerheblichen Teil der Getreideernte vernichtet haben sollten. Genaue Zahlen konnte er nicht nennen, aber nach seiner Einschätzung würden die Russen im kommenden Winter hungern oder größere Mengen Getreide einführen müssen. Das war eine Information, die Matthäus Rodde in einen nicht unerheblichen Gewissenskonflikt brachte. Wenn die Russen größere Mengen an Korn benötigten, um ihre hungrigen Mäuler zu stopfen, dann hieß es, schnell zu handeln, wollte man sich als Kaufmann einen Vorteil aus dieser Information verschaffen. Allzu lange würde es nicht dauern, bis auch andere Kaufleute in Lübeck von dem Dilemma in Russland erfuhren. Doch woher sollte er das Getreide nehmen? In Holstein hatte die Ernte noch nicht einmal begonnen.
Gleichzeitig lockte ein weiteres Angebot auf ein einträgliches Geschäft. Die Schonenfahrer hatten bei ihm angefragt, ob er kurzfristig ein oder zwei Schiffe zur Verfügung stellen könnte, da ihre Kapazität ausgeschöpft sei. Die Schweden benötigten in diesem Jahr wider Erwarten weitaus mehr Salz als erwartet. Würde er aber seine Schiffe dafür zur Verfügung stellen, fehlten sie für einen möglichen Transport des Getreides nach Russland. Matthäus Rodde musste eine Entscheidung treffen. Aber welche?
„Holtkamp!“, klang es durch die Räume in der Breiten Straße.
Es dauerte nur wenige Sekunden, bis der Buchhalter vor dem Schreibtisch des Kaufmanns stand.
„Zwei Aufträge, die keinen Aufschub erlauben. Erstens, du schickst unverzüglich unsere Inspektoren zu den uns bekannten Gutsherren ins Holsteinische. Sie sollen mit ihnen per Handschlag vereinbaren, dass wir auch in diesem Jahr ihr Getreide zu einem anständigen Preis kaufen werden.“
„Kaufen wir das Korn schon auf dem Halm, Herr Senator?“
„Holtkamp, rede kein dummes Zeug. Niemals! Erst nach der Ernte. Und erst dann wird auch bezahlt. Ich möchte nur sichergehen, dass die Gutsherren ihr Korn an uns verkaufen.“
„Gibt es dafür einen triftigen Grund, Herr Senator?“
„Das kann ich dir noch nicht sagen, aber sicher ist sicher. Zweitens, schick einen von den Jungs zu den Schonenfahrern in die Mengstraße und lass dem Ältermann bestellen, dass ich ihn sprechen möchte. Er findet mich im Rathaus.“
Matthäus Rodde hatte sich entschieden. Den lukrativen Auftrag mit den Schonenfahrern wollte er sich nicht vor der Nase wegschnappen lassen. Obwohl der mögliche Getreideverkauf an die Russen das bessere und einträglichere Geschäft versprach, waren ihm die Unwägbarkeiten einfach zu groß. Zunächst hatte er alles getan, was möglich und sinnvoll war. Der Kaufmann stand auf und warf einen Blick in den Spiegel. Er sah einen aufrechten vierzigjährigen Mann, der etwas darstellte. Der dezent, aber vornehm gekleidet eine gewisse Würde und Autorität ausstrahlte. Matthäus Rodde war rundherum mit sich zufrieden.