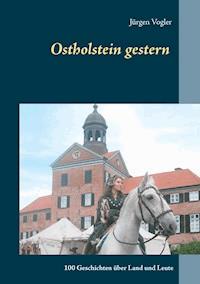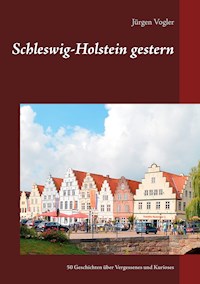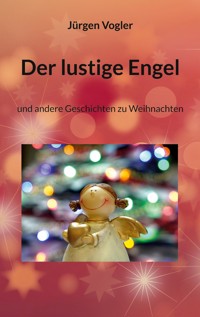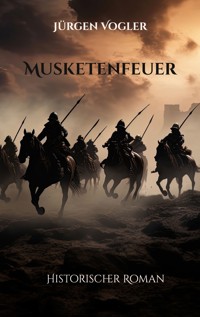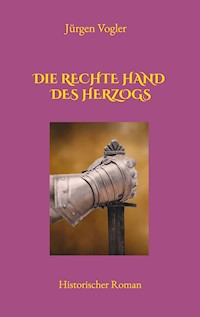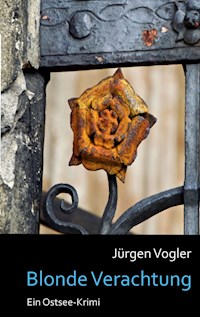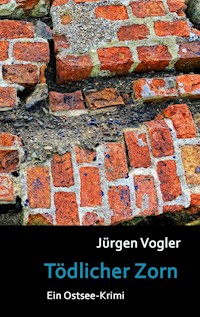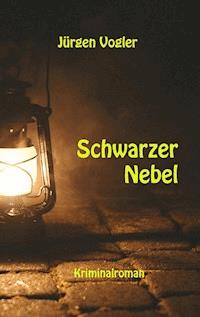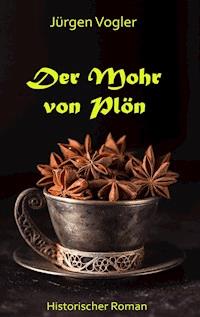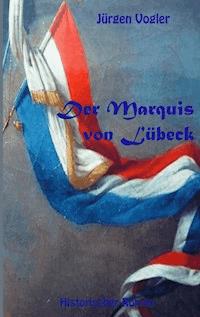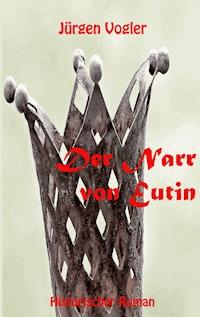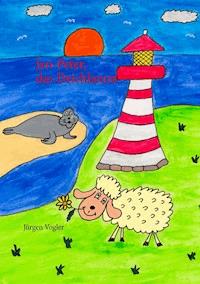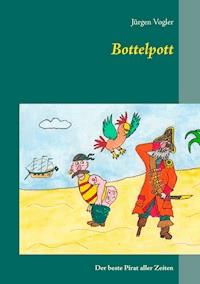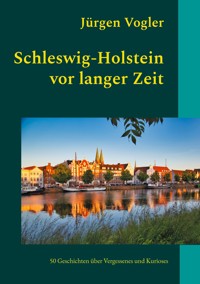
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die wechselvolle Vergangenheit Schleswig-Holsteins kann man auf ganz unterschiedliche Weise erleben. Wie bereits in -Schleswig-Holstein gestern- ermöglichen in -Schleswig-Holstein vor langer Zeit- erneut 50 Geschichten über Vergessenes und Kurioses einen außergewöhnlichen Spaziergang ins Gestern. Tragische und erschreckende Begebenheiten gehören ebenso zum Alltag von einst wie auch amüsante und verwunderliche Ereignisse. Entdecker und Abenteurer, wie auch Namen bedeutender Persönlichkeiten tauchen auf, die man in unserem Land zwischen den Meeren eher nicht vermutet hat. Sie alle zeichnen das bunte Bild eines Schleswig-Holsteins von damals wie ein faszinierender Blick durch ein historisches Kaleidoskop.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Schleswig-Holstein
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die Hochbrücke in Rendsburg
Mord in der Residenzstadt
Wanke nicht mein Vaterland
Das Wunderkind aus Lübeck
Flower Power auf Fehmarn
Auf und Nieder eines Schlosses
Sisi-Kaiserin von Holstein
Das Gefecht von Eckernförde
Rasende Postkutschen
Das nordfriesische Rumpelstilzchen
Anrüchige Ostsee
Vergessene Entdecker
Der kleinste Dom der Welt
Fragwürdige Ortsnamen
Gute und böse Dämonen
Sound vergangener Tage
Die Moorleichen von Windeby
Er wollte die Welt retten
Flensburg und der Rum
Votivschiffe -Der falsche Name-
Der Zukunft auf der Spur
Eine schillernde Figur
Historische Schätze
Verhängnisvoller Ritt auf dem Besen
Der verhasste Graf und sein Ende
Prähistorische Zeitzeugen
Dank der Finnen
Gruseln in der Altstadt
Kartoffel -Die unbekannte Pflanze-
Von guten und von bösen Geistern
Karl Schlözer -Wirken in aller Stille-
Savoir Vivre am Elbufer
Moin -Der Gruß für Tag und Nacht-
Rungholt -Wahr oder nicht wahr?-
Die preußische Gendarmerie
Galionsfiguren- Bunte Zeitzeugen-
Gemaltes Nordfriesland
Das Götterpaar von Braak
Blütezeit als Witwenresidenz
Holten Tüffeln sünd gesund
Ein Zar in Kiel
Ein unwillkommenes Geschenk
Johann Sebastian Bach in Lübeck
Eine vergessene Burg
Das erste Dampfschiff
Freie holsteinische Knechte
Kleine Stadt und große Schiffe
„Aktion Storch“ für die Kinder
Der geliebte „Kleiderbügel“
Der mühsame Weg zur Erleuchtung
Autor
Bildnachweis
Vorwort
„Only three people have ever really understood the Schleswig-Holstein business - Prince Albert, who is dead - a German professor, who has gone mad - and I, who have forgotten all about it.“
„Nur drei Menschen haben die schleswig-holsteinische Geschichte begriffen – Prinzgemahl Albert, der ist tot; ein deutscher Professor, der ist wahnsinnig geworden; und ich, nur ich habe alles darüber vergessen.“ Henry John Temple, 3. Viscount Palmerston (1784-1865)
Sie werden sich sicherlich verwundert die Augen reiben, dass ich mein Buch über Schleswig-Holstein mit einem Zitat eines einstigen britischen Premierministers aus dem 19. Jahrhundert beginne. Doch kaum einer hat die verwirrende und komplizierte Geschichte unseres Landes so treffend und humorvoll auf den Punkt gebracht wie er. Keine Angst, ich werde Sie nicht mit der schwer zu überblickenden Chronologie des Landes zwischen den Meeren ermüden. Wie bereits in „Ostholstein gestern“ und „Schleswig-Holstein gestern“ sind es auch hier in „Schleswig-Holstein vor langer Zeit“ einzelne Geschichten, in denen ich verdiente und weniger lobenswerte, aber oft vergessene Persönlichkeiten für kurze Zeit zum Leben erwecke, besondere Ereignisse in Erinnerung bringe oder auch einen kurzen Blick hinter die Mauern bekannter Gebäude werfe. Es sind Begebenheiten aus der Vergangenheit, die auf unterschiedliche Weise im Trubel der Zeit untergegangen sind und an Bedeutung verloren haben, aber letztlich doch die Besonderheiten Schleswig-Holsteins kennzeichnen.
Sollten Sie den Hintergrund der einen oder anderen erzählten Geschichte bereits kennen, blättern Sie einfach weiter, die nächste Überraschung bei meinem Ausflug in die vergangenen Tage Schleswig-Holsteins ist Ihnen sicher.
Jürgen Vogler
Die Hochbrücke in Rendsburg
Was haben Paris und Rendsburg gemeinsam? In beiden Orten findet man die meisten Nieten. Damit keine Missverständnisse aufkommen, gemeint sind natürlich jene Bolzen, die massiv gestaucht werden, um Platten oder Streben aus Stahl zusammenzuhalten. Sie ahnen es, der Vergleich bezieht sich auf den Eiffelturm und die Hochbrücke.
„Dieser Vergleich hinkt aber sehr!“, mag mancher von Ihnen denken. Das gilt jedoch nur, wenn man die Höhe der beiden Objekte betrachtet. Mit seinen 324 Metern ist der Eiffelturm natürlich unerreichbar. Dagegen nehmen sich die 68 Meter der Hochbrücke geradezu bescheiden aus. Allerdings, wenn wir auf die Baukosten blicken, hat Rendsburg die Nase vorn. 7,74 Millionen Franc (heute 60 Millionen Euro) kostet der Bau des Eiffelturms. Für die Hochbrücke sind es 13,4 Goldmark (heute 73,9 Millionen Euro). Und zählt man die Zahl der verarbeiteten Nieten an den beiden Eisenfachwerkbauten, ist Rendsburg der absolute Gewinner. (Eiffelturm: 2,5 Millionen, Hochbrücke 3,2 Millionen).
Verlassen wir die französische Hauptstadt mit ihrem Wahrzeichen und widmen uns etwas genauer der beeindruckenden Konstruktion über den Nord-Ostsee-Kanal. Genau dieser bereitet den Verkehrsplanern größere Sorgen. Bei seiner feierlichen Einweihung 1895, als er noch Kaiser-Wilhelm-Kanal heißt, wird der segensreiche Seeweg zwischen den beiden Meeren hoch gelobt. Doch gleichwohl bildet er für den Landweg ein Hindernis. Zunächst sind es Drehbrücken, mit deren Hilfe man den Kanal überwinden kann. Doch bereits Ende des 19. Jahrhunderts werden Hochbrücken errichtet (Grünentaler, Levensauer). Erste Planungsgedanken für eine Eisenbahnhochbrücke in Rendsburg führen beim Magistrat der Stadt auf erheblichen Widerstand. Von einem „Monstrum“ ist die Rede. Zudem macht man sich Sorgen um das Stadtbild, das durch ein „ungeheures Stahlgerüst“ verschandelt würde. Ganz unberechtigt ist die Kritik nicht, denn mit einem einfachen Brückenschlag von Ufer zu Ufer ist es nicht getan. Um die durch die kaiserliche Marine vorgegebene Durchfahrthöhe für Schiffe von 42 Metern zu erreichen, müssen links und rechts des Wasserweges lange Dämme errichtet werden. In ländlichen Regionen kein Problem, aber Rendsburg liegt unmittelbar am Kanal. Somit sind lange Rampen im Stadtbereich keine Option. Außerdem befindet sich Rendsburgs Bahnhof nur rund 600 Meter Luftlinie vom Kanal entfernt. Wie kann man das Problem lösen, wenn ein Zug zu jener Zeit eine Strecke von 150 Metern benötigt, um einen Höhenunterschied von einem Meter zu überwinden?
Die geniale Idee hat Friedrich Voß. Ein Brückenbaumeister, der bereits bei zahlreichen Projekten seinen Erfindungsreichtum und seine Erfahrung eingebracht hat. Während auf der Südseite des Kanals Dämme und Rampen die Gleise auf die geforderte Höhe bringen können, ist es nötig, im Stadtbereich die Fahrstrecke zu verlängern. Friedrich Voß löst das Problem, indem er mittels einer Stahlkonstruktion eine 4,5 Kilometer lange Schleife in Form einer Ellipse bauen lässt. Geführt wird sie über den damals noch wenig bebauten Ostteil der Stadt. Gleichzeitig lässt er den Bahnhof insgesamt um 4,50 Meter höherlegen.
Wie bereits bei den ersten Planungsgedanken regt sich der Protest nach dem Beginn der Bauarbeiten 1910 unter der Bevölkerung erheblich. Für die Rampen sind mächtige Erdbewegungen nötig. Pfeiler und überdimensionale Fundamente aus Beton werden gegossen, um die Stahlkonstruktionen aufzunehmen. 350 Männer bauen fast rund um die Uhr gleichzeitig auf beiden Seiten des Kanals. Sie klettern nicht selten ohne Leitern und Gerüste über die Stahlträger. Der heulende Wind in den luftigen Höhen lässt eine Verständigung manchmal nur mit Zeichensprache zu. Erst wenn Sturm und Orkanböen über das Land fegen, ruht auch die Arbeit.
Die Niethämmer dröhnen Tag um Tag, Woche um Woche. Monat um Monat. Es sind 3,2 Millionen Nieten, die tausende Stahlteile zusammenhalten. Die Brücke über den Kanal wiegt allein 3.696 Tonnen. Um den Bau vor Korrosion zu schützen, werden 100.000 Kilo Farbe verstrichen.
Der Einfallsreichtum von Friedrich Voß zeigt sich auch noch auf andere Weise. Damit nicht nur Züge das Kanalhindernis überwinden können, hängt er kurzerhand mit Drahtseilen eine Schwebefähre an die Brückenkonstruktion. Auf diese Weise ist es auch möglich, dass Fußgänger und Autos ohne große Umwege den Kanal überqueren können. Vier Fahrzeuge und bis zu 100 Personen schafft die Schwebefähre maximal.
Obwohl die Sicherheitsmaßnahmen während der Bauzeit peinlichst beachtet werden, verletzen sich fünfzig Arbeiter schwer, fünf Männer stürzen sogar von der Brücke in den Tod.
Nach zahlreichen Testfahrten und Überprüfungen wird die Hochbrücke am 1. Oktober 1913 offiziell für den Bahnverkehr freigegeben. Sie ist in dieser Zeit das größte Stahlbauwerk Europas und ihre 3,2 Millionen Nieten halten sie bis heute zusammen.
Mord in der Residenzstadt
„Von Qualenscher Hof" oder auch „Von Qualensches Palais“ wird zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein Gebäude in Eutin genannt, das zwischen Lübecker Straße und Jungfernstieg liegt. Es gehört dem Kammerherrn Rudolf Anton Ludwig von Qualen. Ein Königlich Dänischer Minister und Gesandter am Hofe des Fürstbischofs in Eutin mit äußerst eigensinnigen Ansichten und befremdlichen Gewohnheiten.
Seit mehreren Jahren bewohnt er dieses stattliche Haus, hinter dem auch ein rundherum eingefriedeter Garten mit Treibhaus liegt. Dieser reicht bis an einen öffentlichen Spazierweg, den man Jungfernstieg nennt und der durch eine Schmiede und eine sieben Fuß (ca. 2,20 Meter) hohe Mauer begrenzt ist. Den Schlüssel zu der mit eisernen Spitzen bewehrten Tür in der Mauer verwahrt der Herr des Hauses stets in seiner Tasche.
Kammerherr von Qualen ist eine Respektsperson, an deren Autorität niemand zu zweifeln hat. Durch seine Erziehung in einem Kadettenhaus und dem späteren Dienst als dänischer Offizier gehören „strenge Subordination, schweigender Gehorsam, ein Anordnen des ganzen Tages nach Stunden und Minuten, eine pedantische Regelmäßigkeit auch in den kleinsten Dingen“ zu seinem Alltag. Eigenschaften, die er auch von seinem Hauspersonal verlangt. Die Uhr bestimmt den Tagesablauf. Er instruiert seine Bediensteten bis ins letzte Detail ihrer Hausarbeit, verbietet sich aber kategorisch mögliche Nachfragen. Wahrhaftig kein Mensch zum Liebhaben.
Von seiner amtlichen Stellung und seiner Person hat der Kammerherr selbst eine hohe Meinung. Überzeugt, wie er nun einmal von sich ist, akzeptiert er als auswärtiger Minister keinen Richter im Ort, der über ihn hätte befinden können. Folglich sieht er sich auch selbst als Richter seiner Leute. Ein Passus, der sogar in den Dienstverträgen der Dienerschaft festgehalten wird. So verwundert es kaum, dass zwischen dem Hausherrn und der Dienerschaft kein freundliches Verhältnis besteht und dieses eher von ständigen Spannungen geprägt ist.
Der Kreis der Dienerschaft umfasst den Kutscher, den Diener, den Hausknecht, die Köchin, das Hausmädchen, das Nähmädchen und ein Kindermädchen. Diese sechs Bediensteten haben den Kammerherrn, seine Ehefrau, eine Gräfin von Ahlefeldt zu Langeland und Rixingen, fünf Kinder im Alter von zwei bis zehn Jahren, die Stiefmutter und eine Schwester des Hausherrn zu betreuen.
Der 21. Februar 1830 ist Jahrmarktssonntag in Eutin. Der Tag im von Qualenschen Palais verläuft wie auch jeder andere Sonntag nach den vorgegebenen zeitlichen Regeln. Und doch soll er für die Familie von Qualen zu einem Schicksalstag werden. Gegen sieben Uhr dreißig am Abend geht der Kammerherr in den Garten, um seinen obligatorischen Spaziergang aufzunehmen. Ein genauerer Zeitpunkt für sein Verlassen des Hauses kann später nicht festgestellt werden, da sich lediglich die Kammerherrin an Schritte im Gartensaal erinnert. Zudem ist dem Diener das Fehlen des Knotenstocks aufgefallen. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass der Hausherr zum Spaziergang aufgebrochen ist. Dieser führt normalerweise durch den eigenen Garten und dann über den Jungfernstieg zum Schlossvorplatz und durch die Lübecker Straße zum Haus zurück.
Als an diesem Abend der Kammerherr über die übliche Zeit hinaus fortbleibt, nimmt man an, dass ihn ein Besuch in der Stadt aufgehalten haben könnte. Um halb zehn, der Herr von Qualen ist immer noch nicht zurückgekehrt, schickt man den Diener fort, um nach seinem Herrn zu suchen. Im Garten findet er die Tür zum Jungfernstieg verschlossen vor. Auch ein Rufen nach dem Gesuchten ergibt keine Antwort. Der Diener weckt daraufhin den Hausknecht und gemeinsam suchen sie mit einer Laterne erneut den Garten ab. Gegen elf Uhr finden sie den Kammerherrn von Qualen tot auf dem Gartenweg nicht weit vom Haus entfernt. Den grausigen Fund verschweigen sie der Kammerherrin und eilen mit der Nachricht zum Hausarzt der Familie, Dr. Voß (Sohn des Dichters Johann Heinrich Voß). Eiligen Schrittes begibt er sich in den Garten und trägt den Toten gemeinsam mit dem Diener aus dem benachbarten Witzlebenschen Haus in die Kutscherstube, später in den Gartensaal.
Noch in derselben Nacht beginnt eine von der Großherzoglichen Justizkanzlei eingesetzte Gerichtskommission, bestehend aus dem Arzt Dr. Voß und dem Chirurgen Köhn, mit der Untersuchung. Nach einer eingehenden Visitation der Fundstelle im Garten beschränkt sich die Tätigkeit der Kommission jedoch darauf, die auf dem Tisch liegende Leiche beim trüben Schein einer Laterne oberflächlich zu begutachten. Schnell kommt man zu der Überzeugung, dass die schweren Verletzungen am Kopf nicht durch einen Sturz, sondern nur durch Gewalt eingetreten sein können. Bei der erst am übernächsten Tag vorgenommenen Leichenöffnung stellt man fest, dass der Kammerherr durch zehn Wunden und einen völlig zertrümmerten Schädel zu Tode gekommen ist, die offensichtlich von Schlägen mit der scharfen und stumpfen Seite eines Beils stammen.
Nach der Feststellung der Todesursache geht die weitere Untersuchung nur schleppend voran. Aufklärungsarbeit in Form der Spurensicherung am Tatort findet nicht statt. Außerdem trifft man keine Maßnahmen, bevor man sich nicht der Zustimmung der Kammerherrin und der dänischen Behörden sicher ist.
Der Täterverdacht wird ausschließlich auf die Personen im Hausstand des getöteten Kammerherrn gerichtet. Im „Anzeiger für das Fürstentum Lübeck“ erscheint am 9. März 1830 eine „Obrigkeitliche Kundmachung“, in der man eine Prämie in Höhe von 1.500 Mark für Hinweise zur Ergreifung des Täters auslobt. Wenige Tage danach wird der Kutscher und acht weitere Monate darauf auch der Diener des Kammerherrn verhaftet. Beide beteuern ihre Unschuld. Weitere umständliche Untersuchungen folgen, die immer wieder Zeugen und Angeschuldigte vor den Untersuchungsrichter zwingen. So werden das Dienstmädchen allein 24-mal und der Hausknecht 39-mal vernommen. Der Kutscher steht 80-mal vor dem Untersuchungsrichter, und der Diener muss 63-mal aussagen. Die Gerichtsakte wächst auf mehr als 5.000 Seiten an. Ein Geständnis gibt es nicht. Die schwerwiegenden Indizien gegen den Diener beruhen in erster Linie auf dessen mehrfach geäußerten Hass gegen seinen Dienstherrn.
Die Untersuchungshaft für beide Angeklagten dauert sechs Jahre, bis am 19. April 1836 das Eutiner Gericht die Angeklagten freispricht. Wegen der Berufung vor dem Oberappellationsgericht in Oldenburg müssen beide noch ein weiteres Jahr einsitzen. Am 18. Februar 1837 spricht auch dieses Gericht den Kutscher gänzlich frei. Der Diener wird zwar wegen Mangels an Beweisen nicht bestraft, muss aber die Kosten für die Verpflegung im Gefängnis und seine Verteidigung tragen.
Der Mord an dem Kammerherrn von Qualen in Eutin wird nie aufgeklärt. Die Beschuldigten arbeiten bis zu ihrem Lebensende als rechtschaffende und arbeitsame
Männer in Eutin. Das Haus auf dem Gelände des von Qualenschen Grundstücks wird später als Justizkanzlei genutzt, neben dem man 1836 ein Gefängnis errichtet. 1909 entsteht das neue Regierungsgebäude (heutiger Altbau der Kreisverwaltung) an jener Stelle, an der der Kammerherr von Qualen 1830 auf so ungeklärte Weise sein Leben lässt.
Auf jenem Grundstück, auf dem heute das Kreishaus in Eutin steht, geschieht 1830 ein rätselhafter Mord an dem Kammerherrn von Qualen, der nie aufgeklärt wird.
„Wanke nicht, mein Vaterland!“
Wer behauptet, dass der 24. Juli für das Land zwischen den Meeren eigentlich ein Feiertag sein müsste, wird von seinen Landsleuten vermutlich nur ein ratloses Kopfschütteln ernten. Doch wer ein wenig in der Geschichte des Landes wühlt, kommt dem wahren Grund sehr schnell auf die Spur. Richtig. Am 24. Juli 1844 wird das „Schleswig-Holstein-Lied“ beim Sängerfest in Schleswig das erste Mal offiziell gesungen.
Zu jener Zeit sind Sängerfeste weitaus mehr als ein Zusammentreffen sangesfreudiger Menschen, die in unbekümmerter Gemeinschaft bekannte Volkslieder trällern. Es ist die Zeit „nationaler Erhebung“. Mehr und mehr verbreitet sich die Idee, dass ein Volk seine individuellen, durch Geschichte, Kultur und Sprache geprägten Eigenheiten am besten in einem nationalen Staat entfalten könne.
Es ist kaum verwunderlich, dass in diesem Zusammenhang der historisch ständige Konflikt zwischen den Herzogtümern Schleswig und Holstein hochkocht. Während Dänemark das nördliche Herzogtum in seinen Gesamtstaat eingliedern möchte, votieren die zum Deutschen Bund gehörenden Holsteiner für eine politische Eigenständigkeit der Herzogtümer Schleswig und Holstein.
Da Zusammenkünfte des gemeinen Volkes, um ihre politischen Ansichten öffentlich darzustellen, von den Herrschern in der Regel verboten sind, sucht man einen Ausweg. Es sind die Volks- und Sängerfeste, die neben den Sangesfreuden immer auch den Rahmen schaffen, sich politisch zu äußern. Auch im Landesteil Schleswig gärt es. Was sich in erster Linie in einem Kultur- und Sprachenstreit zeigt. Die dänische Landbevölkerung wehrt sich vehement gegen die deutsche Sprache, die vor Gericht und in der Verwaltung üblich ist. In der Schleswigschen Ständeversammlung, dem Parlament des Herzogtums Schleswig, (die Holsteinische Ständeversammlung hat ihren Sitz in Itzehoe) kommt es 1842 zu einem Eklat. Obwohl auch hier allein Deutsch als Amtssprache zugelassen ist, hält der Abgeordnete Peter Hiort Lorenzen eine Rede in Dänisch. Er wird vom Parlamentspräsidenten zur Ordnung gerufen. Die Entrüstung der vorrangig deutschgesinnten Abgeordneten ist groß.
Geradezu als Provokation wird die Einmischung des dänischen Königs Christian VIII. in diesem Streit empfunden, als dieser kurz vor dem Sängerfest öffentlich die Zurechtweisung seines Landsmannes Lorenzen missbilligt. Kaum zu glauben, dass dieser Disput die Grundlage für den Text des Schleswig-Holstein-Liedes bilden soll.
Als für das Sängerfest ein zündendes Lied gesucht wird, komponiert der Kantor des St.-Johannis-Klosters vor Schleswig, Carl Gottlieb Bellmann, eine hymnische Melodie und der Berliner Karl Friedrich Straß, ein dichterisch begabter Rechtsanwalt, vier Strophen dazu. Hierin lobt er die Schönheit des Landes seiner Vorfahren.
Denkmal des Schleswig-Holstein Liedes in Schleswig
Den Mitgliedern der Liedertafel als Organisatoren und Einladende des Sängerfestes ist dieser Text des Berliner Rechtsanwalts jedoch zu harmlos und zu schwach. Zu sehr ärgert man sich noch über die als unangemessen empfundene Zurechtweisung des dänischen Königs. Kurzerhand schreibt der Schleswiger Advokat Matthäus Friedrich Chemnitz sieben neue Strophen, in denen er von den ursprünglich vier Strophen seines Vorgängers lediglich drei Zeilen übernimmt. Getrieben wird er von dem Wunsch, in dem Lied die Forderung nach Einheit zu betonen. Bereits die Überschrift soll dieses plakativ zum Ausdruck bringen. Aus dem staatsrechtlichen korrekten „Schleswig, Holstein“ des Berliner Rechtsanwalts macht Chemnitz ein „Schleswig-Holstein“, um damit die Eigenständigkeit dieses Landes deutlich zu machen. Mit 27 Kanonenschüssen startet der Festzug des Sängerfestes am 24. Juli 1844. Es liegt eine aufgeregte Stimmung über der Schützenkoppel, als die 30 Gesangvereine mit Banner und Fahnen einziehen, die sich bereits nach den ersten patriotischen Liedern noch steigert. Selbst der Dirigent am Notenpult zerbricht in seiner Erregung den Taktstock.
Das „Rendsburger Wochenblatt“ berichtet von mehr als zehntausend Zuhörern. Seinen Höhepunkt findet das Fest jedoch, als 56 Sänger des Schleswiger Gesangvereins das Podium betreten und das neue Schleswig-Holstein-Lied anstimmen. Als die 500 Sänger der beiden Herzogtümer von den vorher verteilten Flugblättern die beiden letzten Zeilen jeder Strophe mitsingen, kennt der Jubel keine Grenzen. „Schleswig-Holstein, stammverwandt, wanke nicht, mein Vaterland!“