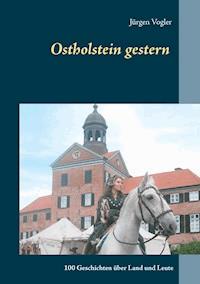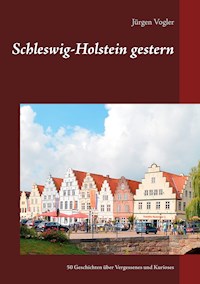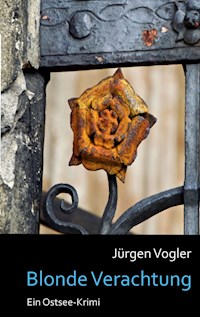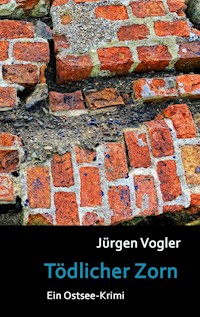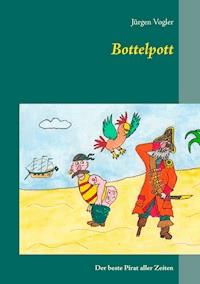Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eutin im Frühjahr 1633. Aufgrund seines "zweiten Gesichts" lebt Martin Seedorf in ständiger Gefahr, als Hexer verfolgt zu werden. Als der Herzog auf den tatkräftigen jungen Mann aufmerksam wird, tritt dieser in seine Dienste. Doch schon bald muss Martin feststellen, dass auch im Schloss Habgier, Intrigen und Mordlust lauern. Jetzt kommen dem "Hofnarr", wie er heimlich genannt wird, seine Visionen zu Hilfe und mit List und Beharrlichkeit deckt er so manche Schandtat auf. Eine Welt voller Aberglaube und Hochmut, aber auch von Aufrichtigkeit und Freundschaft, eingebettet in die geschichtlichen Ereignisse jener Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 588
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Jürgen Vogler wurde 1946 in der Holsteinischen Schweiz geboren und wohnt heute an der Ostseeküste. Nach seinem Dienst als Pressesprecher bei der Bundespolizei arbeitet er seit 1988 als Freier Journalist und Autor.
Neben zwei Kinderbüchern sind Historisches und Kriminelles die Schwerpunkte seiner Arbeit. In„Der Narr von Eutin“ entführt er die Leser in eine Zeit voller Aberglaube, in der ein junger Mann mit Visionen Gefahr läuft als Hexer verfolgt zu werden. Den Intrigen am Eutiner Fürstenhof kann der Narr - wie er abfällig genannt wird - nur mit List und Mut begegnen.
Jürgen Vogler bildet mit Eutins Schloss und Altstadt einen anschaulichen Rahmen für die abenteuerliche Geschichte, eingebunden in die historischen Ereignisse des 17. Jahrhunderts. www.juergenvogler.de
Bereits erschienen:
„Ostholstein gestern“
„Der Mohr von Plön“
„Der Marquis von Lübeck“
„Schwarzer Nebel“
„Kopflos im Strandkorb“
„Wer ohne jede Narrheit lebt,
ist nicht so weise, wie er glaubt.“
François VI. Duc de La Rochefoucauld (1613–1680)
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Epilog
Prolog
Heiligenhafen, im Herbst 1597
Nebelschwaden wälzten sich über die Ostsee, als wollten sie die Wellen erdrücken. Das Klagen der Möwen schien verstummt zu sein. Wo sonst Meeresrauschen zu hören war oder das Scheppern der Fensterläden, wenn der Sturm die Gischt gegen das Fischerhaus auf dem Graswarder in Heiligenhafen peitschte, war heute nur Stille. Ungewöhnlich. Beängstigend.
Das einzige gleichbleibende Geräusch, das Frauke Bergmann an diesem Morgen vernahm, war das grunzende Schnarchen ihres Mannes im Bett neben sich. Karl, der Fischer. Es war ein guter Mann. Fleißig, ein wenig derb, aber im Grunde seines Herzens ein liebenswürdiger Kerl. Zwei Kinder hatte sie ihm geschenkt. Elisabeth und Hartmut, die jetzt drei und vier Jahre alt waren und die er abgöttisch liebte.
„Kannst du wieder nicht schlafen?“ Karl Bergmann war aufgewacht, hatte sich im Bett aufgesetzt und sah seine Frau sorgenvoll an.
„Es ist schon gut, Karl, aber ich glaube, du solltest heute nicht rausfahren.“
Der Fischer stand auf und sah aus dem Fenster. „Nebel hat uns noch nie gestört. Also, was spricht dagegen, dass ich auch heute rausfahre? Spätestens gegen Mittag kommt Wind auf und bläst die trübe Suppe weg.“
„Es ist wegen des Unwetters.“
Karl Bergmann drehte sich um und starrte seine Frau entgeistert an. „Du hast wieder etwas gesehen, oder?“ Er ging auf sie zu, setzte sich auf die Bettkante und ergriff ihre Hände.
„Ja, Karl, es war schrecklich. Zwei Boote sind nicht wiedergekommen. Sturm, Gewitter, Blitz und Donner haben die Ostsee in einen Hexenkessel verwandelt.“ Frauke fing an zu weinen.
Karl Bergmann drückte seine Frau an seine breite Brust und streichelte ihr tröstend den Rücken.
„Du bleibst doch im Hafen?“, fragte sie, nachdem sie sich wieder beruhigt hatte.
„Wir müssen vorsichtig sein, Frauke. Bei dem ruhigen Wetter, das wir jetzt haben, glaubt mir doch kein Mensch, dass ein Unwetter aufziehen könnte. Und du weißt genau, dass einige im Dorf uns belauern, weil du ihnen mit deinen Kräutern und den heilenden Händen verdächtig vorkommst. Wenn ich jetzt noch erzähle, dass deine nächtlichen Bilder mich davon abhalten, meine Segel zu setzen, dann kommen wir in Teufels Küche.“
„Bergmann, bist du noch bei Trost oder hast du am frühen Morgen schon zu tief in die Buddel geguckt?“ Hinnerk Puttfarken, der Ältermann der Fischer, funkelte Karl Bergmann ungläubig an.
„Was soll der Schwachsinn, Karl? Sag uns einen Grund, weshalb wir nicht raussegeln sollen.“ Fiete Ohmsen schüttelte ebenfalls voller Unverständnis den Kopf.
Damit war er nicht allein, auch unter den zwölf anderen Fischern gab es keinen, der Karl Bergmanns Bedenken teilte. Sie machten sich lustig über ihn und schimpften ihn einen Hasenfuß. „Guck dir doch den Himmel an! Woher soll denn da ein Unwetter kommen? Oder hat dir deine allwissende Frauke wieder etwas geflüstert?“
Karl Bergmann drehte sich um und verließ ohne ein Wort die Fischhalle am Hafen. Die Debatte hatte eine gefährliche Wendung genommen, der er sich nicht länger aussetzen wollte. Was sollte er machen? Fraukes Visionen folgen, im Hafen bleiben und sich den Spott der anderen anhören oder die Einwände seiner Frau ignorieren und doch auslaufen?
„Verflucht, das kommt noch dicker. So was habe ich noch nicht erlebt!“
„Was hast du noch nicht erlebt, Merten?“ Karl Bergmann setzte sich am späten Nachmittag in der Fischerklause an den Tisch, an dem vier alte Fischer saßen und ihren Grog schlürften. Merten Sass war der Älteste von ihnen. Ein von Wind und Wetter gegerbter Seemann, von dem niemand wusste, wie alt er eigentlich war.
„Du bist nicht rausgefahren, Karl? Wirst wohl deine Gründe haben. Guckt mal aus dem Fenster! Da braut sich mächtig was zusammen. Gott möge den armen Seelen da draußen gnädig sein.“ Merten Sass sah Karl Bergmann mit einem durchdringenden Blick an.
Schon zur Mittagszeit war Wind aufgekommen und hatte die Nebelschwaden in kürzester Zeit vertrieben. Inzwischen fegten heftige Sturmböen über das brodelnde Wasser. Im Westen türmten sich bedrohlich dunkle Wolkenbänke auf, die immer wieder durch zuckende Blitze kurz erhellt wurden. Noch war der rollende Donner fern. Doch lange würde es nicht mehr dauern, bis das Unwetter auch Fehmarn und Heiligenhafen erreicht hatte. „Warum ist dein Karl nicht rausgefahren?“
„Du hast die anderen auf dem Gewissen!“
„Ich habe es ja schon immer gesagt, hier geht etwas nicht mit rechten Dingen zu.“
„Sie steckt mit dem Teufel unter einer Decke!“
„Frauke Bergmann, du bist eine Hexe!“
Frauke wusste nicht, wie ihr geschah, als sie zwei Tage später auf den Markt ging und dort von den anderen Frauen mit wüsten Beschimpfungen empfangen wurde. Nach dem verheerenden Sturm waren zwei Fischerboote nicht wieder in den Hafen zurückgekehrt. Von ihnen fehlte jede Spur. Einige hatten es nur mit zerfetzten Segeln und gebrochenen Masten geschafft. Zwei weitere hatten Glück und waren auf Fehmarn gestrandet.
Fluchtartig verließ Frauke die aufgebrachten Frauen und verkroch sich in ihrem Haus am Graswarder.
Als Karl Bergmann am Abend nach Hause kam, hatte er Mühe, seine in Tränen aufgelöste Frau zu beruhigen. „Halte dich fern von den aufgescheuchten Hühnern, Frauke. Lass Gras über die Sache wachsen und gib ihnen keinen weiteren Anlass, schlecht über dich zu reden.“ Er strich ihr sanft über das Haar.
So zuversichtlich, wie er sich gab, war er jedoch nicht. Karl Bergmann wusste, dass seine Worte nur wenig ausrichten konnten. Missgunst und Aberglaube suchten nach Schuldigen. Da waren er, der dem Unglück auf wundersame Weise entkommen war, und Frauke, das geheimnisvolle Fischweib mit seinen Kräuterkenntnissen, das schon lange misstrauisch beäugt wurde, willkommene Opfer. Als Hexe hatte man sie bisher allerdings noch nicht beschimpft. Karl Bergmann fuhr ein Schauder über den Rücken.
Fünf Wochen gingen ins Land, und es schien, dass sich die Gemüter ein wenig beruhigt hatten. Karl fuhr regelmäßig zum Fischen und vermied, so gut es ging, Gespräche mit anderen Fischern. Auch Frauke ließ sich während dieser Zeit im Dorf nicht sehen, und für die Einkäufe schickte sie ihre Magd Erna auf den Markt. Auch die sonst üblichen nachbarlichen Klönschnacks vermied Frauke nach Möglichkeit. „Das ist der beste Weg, um keine schlafenden Hunde zu wecken“, hatte Karl gesagt.
„Frauke, es ist einfach schrecklich.“ Gesine, die Frau vom Fischer Wolter, war am Morgen händeringend und schluchzend in Fraukes Küche gestürzt. „Meine kleine Ruth ist tot. Sie ist einfach tot!“ Erst vor zwei Monaten hatte Gesine ihre Tochter, ein gesundes und dralles Mädchen, auf die Welt gebracht.
„Was ist geschehen, Gesine?“ Frauke nahm die verzweifelte Mutter in den Arm.
„Ich weiß es nicht. Heute Morgen, als ich sie aus der Wiege nehmen wollte, um sie zu füttern, war sie einfach tot.“
„Komm mit!“ Frauke drehte sich um und eilte mit Gesine ins Nachbarhaus. Neben Gesines Eltern, drei weiteren Kindern und zwei älteren Fischerfrauen traf sie dort auch Pastor Schickedanz an, und sie alle blickten hilflos und betreten auf das Kind in der Wiege.
„Macht Platz!“, befahl Frauke barsch und warf einen kurzen Blick auf das blasse Kind. Behutsam hob sie die kleine Ruth aus der Wiege.
„Welch ein Frevel. Ihr stört die Totenruhe. Gott stehe uns bei!“ Der Pastor schien einer Ohnmacht nahe. Auch die Fischerfrauen schlugen sich entsetzt die Hände vor den Mund.
Doch Frauke achtete nicht auf sie. Sanft legte sie das Kind auf den Tisch, knotete die Haube auf, die es auf dem Kopf trug, und zog ihm das Kleidchen aus. Der lautstarke Protest des Pastors erreichte sie nicht, ebenso wie das Gejammer der Frauen. Streichelnd massierte sie die Brust der kleinen Ruth und summte dabei eine Melodie, die wie ein Schlaflied klang. Plötzlich schlug sie dem Kind mit der rechten Faust auf die kleine Brust. Heulendes Entsetzen aller Umstehenden hallte durch das Fischerhaus, das Sekunden später von einem krähenden Kinderschrei unterbrochen wurde. Frauke hob die kleine Ruth auf, küsste sie auf die Stirn und legte sie ihrer schluchzenden Mutter in die Arme.
„Solange du lebst, wird sie dein Sonnenschein sein, Gesine. Gib gut auf sie Acht!“
„Was hast du gemacht, Frauke? Bist du denn von allen guten Geistern verlassen?“ Karl Bergman tobte, als er am Abend nach Hause kam. Das Wunder hatte sich wie ein Lauffeuer in dem kleinen Fischerdorf herumgesprochen. Gleichzeitig aber predigte auch Pastor Schickedanz lauthals, dass die Rettung der kleinen Ruth Teufelswerk gewesen und Frauke Gottes Willen mit satanischen Beschwörungsformeln begegnet sei.
„Was sollte ich denn tun, Karl? Ich konnte das Kind doch nicht sterben lassen. Ich musste helfen!“
„Alle erzählen, das Kind war schon tot und du hast es wieder zum Leben erweckt. Sie sagen auch, in dich sei der Leibhaftige gefahren.“
„Glaubst du das auch, Karl?“ Frauke war den Tränen nahe.
„Nein, Frauke, das glaube ich nicht. Das weißt du auch. Aber ich habe Angst um dich. Unbändige Angst. Du musst vorsichtig sein. Die Neider und Scheinheiligen lauern überall.“
Erst spät gingen sie an diesem Abend zu Bett. In der Nacht wälzte sich Frauke unruhig von einer Seite auf die andere. Sie sah rote Nebelschwaden, die sich zu Wolken auftürmten und kurz drauf in zerfranste und flackernde Schleier zerfielen. Begleitet wurden die schnell wechselnden Bilder von einem unheilvollen Knistern, das sich zu einem prasselnden Feuer entwickelte. Reisig brannte. Ein Scheiterhaufen. An einem Pfahl sah Frauke ein wehendes Gewand, das sich vergeblich zerrend den leckenden und gierigen Flammen entwinden wollte. Immer deutlicher wurde die Gestalt in dem Gewand – bis Frauke voller Entsetzen in ihr eigenes Gesicht blickte.
Schweißüberströmt schrak sie hoch. Ein markerschütternder Schrei brach durch die Nacht und wurde vom Rauschen der Wellen verschluckt ...
Kapitel 1
Eutin, im Frühjahr 1633
Tag für Tag erwachte die kleine Stadt im hohen Norden bereits bei Sonnenaufgang zum Leben. Die Wachsoldaten öffneten wie üblich die Stadttore, um Bauern und Händler hereinzulassen. Pferdehufe und eisenbeschlagene Karren klapperten über das Pflaster. Hier und da bellte ein Hund. Auf dem Marktplatz wurden Stände und Buden errichtet. Wenig später erklangen die ersten Rufe der Marktschreier, die ihre Waren anpriesen. Es wurde gefeilscht, gestritten und lamentiert, aber es blieb auch Zeit für den Austausch neuester Nachrichten. Ein ganz normaler Tag in der kleinen Residenzstadt Eutin.
Doch heute schien alles ganz anders zu sein. Vom Trubel auf dem Marktplatz keine Spur. Gähnende Leere rund um das Rathaus. Es sah so aus, als hätten selbst die Hunde an diesem Morgen ihre Freude am Bellen verloren. Lediglich vom Kirchturm schwebten die letzten sieben Glockenschläge träge über die Dächer der Stadt. Es war Sonntag. Die Bürger der Stadt würden ihre Festtagskleidung anlegen und sehr bald dem Ruf der Kirchenglocken zum Gottesdienst folgen. Zeit der Besinnung und der Einkehr.
Im Haus des Apothekers und Stadtrats Henricus Seedorf direkt am Markplatz war der sonntägliche Frieden bereits beim familiären Frühstück aus den Fugen geraten.
„Martin, es ist unerträglich, dass ich mich für dein ungebührliches und närrisches Verhalten immer wieder entschuldigen muss. Was bildest du dir eigentlich ein?“, entrüstete sich der Apotheker nicht das erste Mal über seinen ältesten Sohn.
„Vater, verzeiht, wenn ich Euch Unannehmlichkeiten bereitet habe, aber ich bin mir keiner Schuld bewusst“.
„Aber genau das setzt dem Ganzen ja noch die Krone auf. Hast du gestern den Stadtrat Pechstein auf dem Marktplatz getroffen? Und hat er sich erkundigt, ob du in der Kanzlei deine Arbeiten ordentlich verrichtet hast?“
„Ja, Vater, das hat er.“
„Und was hast du darauf geantwortet?“
„Ich habe ihn gleichermaßen freundlich begrüßt und ihm erklärt, dass ich meine Aufgaben nach bestem Wissen erfüllt habe.“
„Das war aber noch nicht alles.“
„Nein, Vater, ich habe den Stadtrat Pechstein dann noch gefragt, ob denn auch er seine Aufgaben zum Wohle der Bürger Eutins gerecht und pflichtgemäß vollzogen habe.“
Die Runde am Esstisch des Stadtrats Seedorf reagierte belustigt.
„Das ist nicht zum Lachen“, wies der Stadtrat seine Familienmitglieder empört zurecht. „Einem ehrwürdigen Rat und Kaufmann der Stadt hat man Respekt zu erweisen und keine vorwitzigen Fragen zu stellen.“
„Nun, Henricus, jetzt muss ich auch einmal das Wort ergreifen“, warf Elisabeth Seedorf, die Ehefrau des Stadtrats, ein, was diesen verwundert aufblicken ließ. „So, wie ich die Lage sehe, hat unser Sohn sich durchaus korrekt verhalten. Wie wir ihn alle kennen, wird er seine Frage an Stadtrat Pechstein freundlich und respektvoll formuliert haben.“
„Elisabeth, ich glaube nicht, dass dies der richtige Rahmen ist, grundsätzliche Fragen des Anstandes vor den Kindern zu diskutieren. Fest steht, dass Martin sich einmal mehr aufsässig und ungebührlich gegenüber angesehenen Personen der Stadt verhalten hat, was ich jetzt und auch in Zukunft nicht dulden werde.“
Henricus Seedorf hielt es für notwendig, ein Machtwort zu sprechen. Dieser Junge konnte einen stets aufs Neue zur Weißglut bringen. Jetzt fiel ihm, dem Familienoberhaupt, auch noch sein Weib in den Rücken. Und das vor den Kindern! Der Stadtrat war entrüstet.
Martin konnte sich ein Schmunzeln kaum verkneifen, besonders wenn er in die Gesichter seiner Geschwister sah. Die zwei Jahre jüngeren Zwillinge Andreas und Elsbeth feixten. Selbst seine ältere Schwester Margret, die als die Vernünftigste von allen galt, wie ihr Vater stets betonte, hatte ein schelmisches Blitzen in den Augen. Alle Kinder wussten, dass ihr Vater gesteigerten Wert auf Anstand und Reputation legte. Das war er seiner Stellung als Apotheker und Mitglied des Rates der Stadt Eutin schuldig. Nach seiner Vorstellung gehörte auch eine gesellschaftliche Ordnung dazu, die jedem seinen Platz zuwies und der sich jeder zu fügen hatte. Eine Auffassung, mit der der Stadtrat im eigenen Hause jedoch immer wieder an seine Grenzen stieß. Elisabeth Seedorf hatte ihre Kinder zwar nach strengen Regeln erzogen, ihnen aber auch sehr deutlich klargemacht, dass alle Menschen vor Gott gleich waren.
„Verzeiht, Vater, wenn ich erneut um eine Erklärung bitte“, formulierte Martin seine Worte bewusst behutsam, nachdem sich die Erregung des Vaters ein wenig gelegt hatte. „Ist es mein jugendliches Alter, das es mir verbietet, ergrauten Bürgern ebenbürtige und möglicherweise auch unbequeme Fragen zu stellen?“
Henricus Seedorf musterte seinen Sohn eine Weile, schüttelte dann bedächtig den Kopf. „Martin, der Stadtrat Pechstein empfand deine Frage als vorlaut und impertinent. Kein erwachsener Mensch lässt sich gern von einem siebzehnjährigen Bengel einen Spiegel vorhalten ...“
„Wobei wir uns langsam dem Kern der Geschichte nähern“, bemerkte Martins Mutter nicht ohne süffisanten Unterton.
„Wie darf ich dich verstehen, meine Liebe?“, reagierte der Apotheker erneut irritiert auf den Einwand seines Eheweibes.
„Nun, es ist doch allgemein bekannt, dass der ach so ehrenwerte Stadtrat Pechstein lieber auf der faulen Haut liegt oder sich in Wirtshäusern aufhält, als seinen eigentlichen Aufgaben nachzukommen.“
„Elisabeth, ich bitte dich! Das gehört doch nun wirklich nicht hierher.“
„Oh doch, lieber Gemahl, denn er scheint über Martins Frage nur aus diesem Grunde entrüstet gewesen zu sein. Hattest du nicht selbst eben von dem Spiegel gesprochen? Kurzum, der hochverehrte Herr Stadtrat fühlte sich ertappt. Wobei ich davon ausgehe, dass Martin von der Art, wie Pechstein sein Amt ausführt, bis jetzt nichts gewusst hat, oder?“ Elisabeth Seedorf blickte ihren Sohn fragend an.
„Nein, Mutter, wirklich nicht. Davon höre ich zum ersten Mal.“ Martin blieb nicht verborgen, dass seine Mutter aufgrund seiner eiligen Antwort skeptisch die linke Augenbraue hob.
Martin lag auf seinem Bett, die Hände hinter dem Kopf verschränkt, und dachte über die Worte seiner Eltern nach. Er konnte es sich nicht erklären, weshalb es ihm immer wieder gelang, erwachsene Menschen mit seinen Fragen und Bemerkungen innerhalb kürzester Zeit zu verwundern oder gar zu entrüsten. Er schien die Menschen mit ganz anderen Augen zu sehen. Besondere Eigenarten in ihrem Verhalten fielen ihm sofort auf, wie er auch persönliche Merkmale ihres Aussehens gleich entdeckte. Schon häufiger hatte er vor dem großen Spiegel im Ankleideraum seiner Eltern ohne Mühe einige seiner Mitmenschen nachgeahmt. Als Elsbeth und Andreas ihn einmal dabei ertappt hatten, konnten sie gar nicht genug davon sehen. Immer wieder musste er die alte Marktfrau mit den Kartoffeln spielen, deren Nase große Ähnlichkeit mit ihren Erdäpfeln hatte. Auch die Kopie des schlurfenden Nachtwächters Sägemiel, des näselnden Schneidermeisters Klopf und des gebeugten Stadtschreibers Neumann begeisterten die Kinder. Martin verblüffte zudem auch mit einer ungeahnten Fingerfertigkeit, wenn er Münzen auf unerklärliche Weise verschwinden ließ, die kurz darauf hinter den Ohren seiner Betrachter wieder auftauchten, oder wenn er eine Nuss, die eben noch auf dem Tisch gelegen hatte, wenig später aus der Jackentasche seines Nachbarn hervorzauberte. Es war schon erstaunlich, auf welch einfache Weise die Menschen zu belustigen waren.
Weniger amüsant dagegen fand Martin die Bilder, die sich ohne Ankündigung wie in einem Traum in seinem Kopf zeigten. Wann sie auftreten würden, wusste er nicht. Sie überfielen ihn stets unvermutet. Das, was Martin beunruhigte und erschreckte, war die Tatsache, dass in den darauf folgenden Tagen diese Bilder zur grausamen Wirklichkeit wurden. Das Bild der von einem Blitz getroffenen und daraufhin umstürzenden Eiche vor dem Stadttor hatte er am Abend vor dem Gewitter ebenso gesehen, wie er seine Tante bereits auf dem Totenbett hatte liegen sehen, noch bevor sie starb. Zwei Tage später war ihr Leben zu Ende gewesen. Martin hatte mit niemandem darüber gesprochen. Einerseits weil er fürchtete, dass man ihn für verrückt halten könnte, andererseits weil er wusste, dass Menschen mit vergleichbaren Gaben sehr schnell bezichtigt wurden, mit dem Teufel im Bunde zu sein.
Und Pechstein? Martin musste schmunzeln. Es gab kaum jemanden in der Stadt, der nicht wusste, dass der ehrenwerte Herr Stadtrat ein zwielichtiger Geselle war, der die Arbeit nicht erfunden hatte. Hinter vorgehaltener Hand war von windigen Machenschaften die Rede. Es wurde sogar behauptet, dass der Stadtrat seine Mündel betrog und sie um ihre Erbschaft brachte. Martin erinnerte sich an Karl Lafrenz. Auch für diesen jungen Mann hatte Pechstein nach dem Tod der Eltern die Vormundschaft übernommen. Nach seiner Volljährigkeit hatte Karl das Haus umbauen und dort eine Korbflechterei betreiben wollen. Doch er war angezeigt worden, weil er, angeblich unrechtmäßig, im Forst des Herzogs Weiden geschnitten haben sollte. Beim Prozess hatten sich dann die beiden Zeugen als stadtbekannte Säufer herausgestellt, die irgendjemand bezahlt haben musste. Karl war freigesprochen worden, doch sein Ruf war für alle Zeit ruiniert und er verließ die Stadt. Vorher aber hatte der ehrenwerte Stadtrat und Pferdehändler Leberecht Pechstein ihm sein Haus für einen Spottpreis abgekauft und danach diese Tat noch als gnädigen Akt verkündet.
Unwillig schüttelte Martin den Kopf. Und dieser armseligen Kreatur, die die Ehrbarkeit aller anderen mit Füßen trat, sollte er nach Auffassung seines Vaters respektvoll begegnen?
Kapitel 2
In Gedanken versunken schritt Pater Simon über den Schlosshof. Irgendetwas stimmte nicht. Es waren keine theologischen oder philosophischen Fragen, auf die er Antworten suchte und die ihn nicht selten in ferne Sphären trugen – weit entrückt von der Realität des Alltags. Heute waren es ganz profane Zahlen und Zeichen, die auf irgendeine Weise nicht zueinander passen wollten.
„Ich gehe davon aus, Pater Simon, dass Ihr nicht unbedingt nach einem Pferd verlangen wollt.“
Der Pater schreckte aus seinen Gedanken auf und blickte sein Gegenüber irritiert an. Vor ihm stand der Zweite Stallmeister des Herzogs, Hartmut Bergmann, der aus dem Marstall getreten war und ihn verständnisvoll anlächelte. „Ich registriere mit großer Besorgnis, Meister Bergmann, dass Ihr mich zu gut kennt.“
Pater Simon mochte den Stallmeister, der wie kaum ein anderer über ausgeprägte Pferdekenntnisse verfügte und zudem ein strenges Regiment über seine Bediensteten im Marstall führte. Kein leichtes Amt für einen Mann, der nicht von Adel war.
„Nun, Pater Simon, da Ihr noch nie den Wunsch geäußert habt, Euch auf den Rücken eines Pferdes zu schwingen, war meine Prognose nicht allzu schwer.“
„Ihr habt recht, Meister Bergmann, und ich werde Euch den Grund verraten, weshalb ich einen respektvollen Abstand zu den großen Vierbeinern halte: Ein Priester mit einer hochgerafften Kutte auf einem Pferd – welch ein gar schrecklicher Anblick!“
„Das wundert mich aber, Pater Simon, denn bisher war ich der Meinung, dass Eitelkeit nicht zu Euren Lastern gehören würde.“
„Auch ein Mann Gottes ist nicht frei von solchen nur zu menschlichen Tiefen. Außerdem bin ich fest davon überzeugt, dass es in ferner Zukunft Menschen geben wird, die über dieses Tier ein einhelliges Urteil fällen werden. Das Pferd ist vorn wie hinten gleichermaßen gefährlich und in der Mitte zudem äußerst unbequem.“
Der Stallmeister wusste, dass der Pater seine Abneigung Pferden gegenüber nur vortäuschte und sie zum Anlass nahm, das Thema zu wechseln.
Pater Simon war als zweiter Sohn des Grafen Engelhart von Hohenstein mit Pferden aufgewachsen. Doch da die Erbfolge im Holsteinischen nur dem Erstgeborenen, in diesem Falle Pater Simons Bruder Laurentz, Gut und Ländereien vermachte, entschieden sich die Zweitgeborenen und weitere Söhne für eine militärische Laufbahn, oder sie wurden Priester, wie auch Pater Simon, der auf den Namen Graf Sebastian von Hohenstein getauft worden war. Unter den zahlreichen Kirchenmännern am Hof des Fürstbischofs in Eutin gehörte Pater Simon zu den wenigen, die auch eine menschliche Seite zeigten.
Pater Simon war ein weiser Mann. Unerschütterlich in seinem Glauben, aber auch mit der Gabe gesegnet, allen menschlichen Schwächen gegenüber Verständnis zu zeigen und sie nicht selten durch eine humorvolle Brille zu sehen. Die vielen Falten um seine Augen waren ein deutlicher Beweis dafür. Seine schlanke, asketische Erscheinung und sein aufrechter Gang strahlten Selbstsicherheit und Würde aus. Sein Bart verriet nicht, ob er die Vierzig schon überschritten hatte oder ob er bereits in jungen Jahren ergraut war.
„Wo ich Euch gerade sehe, Meister Bergmann, eine Frage nur. Hat es in Eurem Bereich in der jüngsten Vergangenheit irgendwelche besonderen Verkäufe gegeben?“
„Seid Ihr unter die Kaufleute gegangen, Pater Simon?“ Der Stallmeister war verwundert über diese ungewöhnliche Frage aus dem Mund des Kirchenmannes.
„Nein, keine Angst, ich werde meinen Studien und Überset-Zungen nicht untreu. Ich wollte lediglich wissen, ob Pferde oder Kutschen veräußert wurden. Nur so ein Gedanke.“
„Nein, Pater Simon, es ist alles ganz normal im Marstall. Keine Auffälligkeiten dieser Art.“
„Schön, mehr wollte ich gar nicht wissen. Nun werde ich mich mal wieder meinen alten Griechen zuwenden und versuchen, deren Geheimnisse zu ergründen. Gott mit Euch, Meister Bergmann.“ Pater Simon wandte sich um und schritt über den Hof dem Schlosstor zu.
Seit nunmehr drei Tagen kam er nicht zur Ruhe. Zu viel Ungewissheit hatte sich in dieser Zeit vor ihm aufgetürmt. Was hatte Pater Anselm ihm kurz vor seinem Tod nicht mehr verraten können? Er war der Schatzmeister gewesen, der die Einnahmen und Ausgaben des Hofes in Eutin verwaltet hatte. Einen Hofkämmerer gab es nicht, da die Herzöge nicht in Eutin weilten. Zu später Stunde hatte ihn der alte Mann ans Krankenbett gerufen. Pater Simon erinnerte sich an den traurigen Moment.
Als er dort eingetroffen war, befand sich Pater Anselm bereits im Delirium, und in den wenigen wachen Momente stammelte er Unverständliches: „Die Zahlen lügen ...“, „Ich bin nur ein Knecht ...“, „Gnade mir armem Sünder ...“
Dies, einige dahingeworfene wilde Zahlenreihen und der Ruf nach Hilfe erschütterten den ohnehin kraftlosen Leib des sterbenden Priesters. Pater Simon war es ein Bedürfnis, ihn zu beruhigen und ihm Trost zuzusprechen. Noch in derselben Nacht starb Pater Anselm, ohne sein Geheimnis verraten zu haben.
Pater Simon bemühte sich, aus den Bruchstücken, die ihm im Gedächtnis geblieben waren, ein Ganzes zu bilden. Er sah sich, kurz nachdem der alte Priester die Augen für immer geschlossen hatte, in dessen Kammer um. Die karge Einrichtung wurde von einem Stehpult bestimmt, auf dem ein in Leder gebundenes Buch lag. Daneben befanden sich Tintenfass und Federn. Auf einem angrenzenden Regal stapelten sich Dokumente und Urkunden. Pater Simon schlug das Buch an der Stelle auf, an der ein Blatt Papier herausragte. Zahlenkolonnen und fein säuberliche Eintragungen in steiler Schrift sprangen ihm entgegen. Auch für den nicht eingeweihten Betrachter war schnell zu erkennen, dass in diesem Hauptbuch die Schätze des Schlosses verwaltet wurden. Hinter jeder Position waren Beträge in Talern und Schillingen vermerkt, sei es für den Kauf von Weizen und Gerste oder für den Verkauf von Dokumenten, die die Gottesmänner als Duplikate angefertigt hatten. Pater Simon blätterte zurück. Nichts Auffälliges, das die Unruhe und Aufgeregtheit des sterbenden Priesters hätte erklären können.
Pater Simon hörte ein Rascheln vor der Tür. Eilig schlug er das Buch zu und ergriff die Kerze. Durch seine hastige Bewegung fiel etwas zu Boden, doch er bemerkte es nicht und setzte sich schnell wieder an das Bett des toten Priesters.
„Wie geht es unserem Bruder Anselm?“ In der Tür stand der Dekan des Stifts, Pater Benedict.
„Er hat soeben das Zeitliche gesegnet und steht nun vor unserem Herrgott.“
„Der Herr sei seiner armen Seele gnädig. Lasst uns für ihn beten.“
Beide Gottesmänner falteten die Hände und versanken in ein stilles Gebet.
„Ich gehe davon aus, Bruder Simon, da Ihr ihm das letzte Geleit gegeben habt, dass Ihr auch die nötigen Vorbereitungen für die Trauerfeier und seine Beisetzung treffen werdet“, ordnete der Dekan nach dem „Amen“ an. „Um alles andere werde ich mich kümmern. Wir müssen uns zuerst Gedanken darüber machen, wer ab sofort das Amt des Schatzmeisters übernehmen wird.“ Mit diesen Worten verließ der Dekan leisen Schrittes die Kammer des Toten.
Pater Simon runzelte die Stirn. Er kannte Pater Benedict seit einigen Jahren. Ein sachlicher Mann, dem eine gewisse Überheblichkeit anhaftete, die seine adlige Herkunft nicht verleugnen konnte. Als Vertreter des Propstes hielt er alle Fäden im Eutiner Schloss in der Hand. Der unterkühlte Auftritt angesichts des gerade verstorbenen Bruders Anselm verwunderte Pater Simon ein wenig. Viel mehr noch beschäftigten ihn die wirren Worte, die der Sterbende von sich gegeben hatte. Wovor hatte Pater Ansehn Angst gehabt? Welche Zahlen hatten ihn derart gequält, dass er offensichtlich um sein Seelenheil fürchtete?
Erneut ergriff Pater Simon die Kerze und wandte sich dem Stehpult zu. Plötzlich spürte er etwas unter seinem rechten Fuß. Er bückte sich und leuchtete auf den Boden. Vor ihm lag ein Buch auf den Fliesen. Es sah aus wie ein Gesangbuch und war in geprägtes Leder eingeschlagen. Simon hob es auf und betrachtete es von allen Seiten. Es trug keine Aufschrift. Als er es aufschlug, entdeckte er Zahlen, Daten und ungeordnete Buchstaben. Dazwischen fand er ähnliche Eintragungen wie in dem großen Hauptbuch. „Verkauf 30 ha Stendorf – 1200 Taler“. Pater Simon stutzte. Drei Seiten später ein weiterer Eintrag: „Verkauf 25 ha Friedrichsburg – 1000 Taler“. Die genannten Dörfer und die dazugehörigen Ländereien gehörten dem Fürstbischof. Grundsätzlich war es das Bestreben aller adligen Herrschaften, ihre Güter und Ackerbauflächen zu erweitern, um so ihre regelmäßigen Einkünfte zu mehren. Wieso aber hatte man hier herzogliches Land verkauft? Pater Simon konnte sich darauf keinen Reim machen. Erst recht nicht, als er noch einmal in das Hauptbuch blickte und unter den angegebenen Daten keine Einträge fand. Kurzerhand steckte er das kleine Buch ein und verließ die Kammer des verstorbenen Paters Anselm.
Kapitel 3
Martin war an diesem Morgen frohen Mutes. Seit einem Jahr war er in der Kanzlei des Advokaten Friedrich Mauritius beschäftigt. Seine Tätigkeit hatte sich anfangs nur auf das Abschreiben von Verträgen und Dokumenten beschränkt – eine Arbeit, die keine großen Anforderungen an ihn stellte. Die verschiedenen Botengänge, die er wenig später zusätzlich für den Advokaten zu erledigen hatte, machten ihm dagegen große Freude. Eigentlich war er nur der Empfehlung seines Vaters gefolgt und hatte eher lustlos seinen Dienst in der Kanzlei angetreten. Ob er je die Chance erhalten würde, ein Studium der Jurisprudenz aufzunehmen, stand ohnehin in den Sternen. Viel wichtiger war seinem Vater daran gelegen, Martin so schnell wie möglich aus der Lateinschule zu nehmen, da es keinen Tag gegeben hatte, an dem sich die Lehrer nicht über den vorlauten und alles besser wissenden Schüler beklagt hatten.
Bücher hatten auf Martin schon in jüngster Kindheit eine magische Anziehungskraft ausgeübt. Förderlich war dabei eine umfassende Bibliothek gewesen, die sein inzwischen verstorbener Großvater väterlicherseits der Familie hinterlassen hatte. Seine Worte klangen Martin bis heute im Ohr: „Nur wer viel weiß, wird es im Leben weit bringen.“
So blieb es nicht aus, dass der Junge jede Gelegenheit nutzte, um in den alten Büchern zu stöbern. Die Folge war, dass sich dabei in dem jungen Hirn immer mehr Fragen anhäuften, die beantwortet werden mussten. Während sein Vater nicht selten Martins ungestüme Fragen mit einem „Dafür bist du noch zu jung!“ abtat, fand er bei seinem Onkel Hartmut, dem Bruder seiner Mutter, stets ein offenes Ohr und viel Geduld.
Hartmut Bergmann war kein unbedeutender Mann. Seine Stellung am herzoglichen Hof in Eutin bedeutete Anerkennung und Privileg zugleich, da solche herausgehobenen Positionen in der Regel von Männern edler Abstammung erfüllt wurden. Es gab wohl kaum jemanden, der so viel über Pferde wusste wie Hartmut Bergmann. Dieses Wissen und die Fähigkeit, die richtigen Pferde für die verschiedenen Aufgaben bei Hofe auszuwählen und auszubilden, hatte Martins Onkel im Laufe der Jahre die Anerkennung des Herzogs und somit auch die Stellung als Zweiter Stallmeister eingebracht. Da der Erste Stallmeister ein Junker aus gräflichem Landadel war, der sich viel lieber in die Lustbarkeiten des Hoflebens stürzte, als sich mit schwitzenden Pferdeleibern und dampfenden Pferdeäpfeln abzugeben, hatte Hartmut Bergmann im herzoglichen Marstall freie Hand.
Ein Grund, weshalb Martin an diesem sonnigen Morgen voller Tatendrang der Kanzlei zustrebte, war ein bevorstehender Botengang zum Schloss. Der alte Kanzleischreiber Heckenrat hatte ihm am Vortag bereits angekündigt, dass noch am Morgen wichtige Verträge dem Kanzleidirektor des Herzogs zu überbringen seien. Und dass Martin sich dabei ruhig Zeit lassen könne, denn der Advokat sei an diesem Tag ohnehin nicht in der Stadt.
Die Aussicht, bei dem Botengang ins Schloss auch seinen Onkel Hartmut besuchen zu können, stimmte Martin froh. Gleichermaßen freute er sich auch auf den Nachmittag. Vielleicht gelang es ihm ja, seinen besten Freund Daniel, den Sohn des Schmieds, zu einem Ausritt zu überreden. Wobei das größere Hindernis sicherlich dessen arbeitsamer und strenger Vater war, der ungern auf die Tatkraft seines Sohnes verzichtete.
Schon von Weitem konnte er den typischen Gesang einer Schmiede hören. Das Klingen des Ambosses. Die unterschiedlichen Schläge von schweren und leichteren Hämmern. Als er am Ende des Segenhörn um die Ecke bog, erblickte er das vertraute Bild einer emsigen Schmiede, in der Meister Hellwag mit einem mächtigen Hammer auf eine glühende Eisenstange schlug, die einer seiner Gesellen mit einer Zange hielt, während ein zweiter im gleichmäßigen Wechsel mit dem Meister das Eisen auf dem Amboss bearbeitete. Im Hintergrund trat Jochen, der Lehrling, mit Schwung auf den Blasebalg, der die Funken im Feuer aufscheuchte und weitere Eisen erglühen ließ. Vor dem großen Tor stand ein kräftiges Pferd, dessen linker Hinterhuf auf Daniels Oberschenkel lag und dem er mit schwungvollen Schlägen ein neues Hufeisen verpasste.
„Ah, der angehende Herr Advokat will uns helfen. Welch eine Ehre!“, begrüßte der Schmiedemeister Martin lächelnd.
„Herzlich gern, Meister Hellwag. Wie viele krumme Hufnägel und schiefe Hufeisen benötigt Ihr noch?“ Martin strahlte den Vater seines Freundes an.
„Martin, Martin, du bringst die Menschen immer wieder zum Lachen. Auch wenn man dich wegen deiner Frechheit einmal kräftig über das Knie legen sollte.“ Nach kurzen Anweisungen an seine Gesellen, wie mit dem Eisen weiter zu verfahren war, trat er auf Martin zu, während er sich mit einem Tuch den Schweiß von der Stirn wischte. Daniel hatte das kurze Wortspiel zwischen seinem Vater und Martin schmunzelnd verfolgt und gesellte sich, nachdem er den Ackergaul fachgerecht beschlagen hatte, zu den beiden.
„Was führt dich zu so früher Stunde zu uns, mein Junge?“, wollte Meister Hellwag noch immer lächelnd von Martin wissen.
„Ich habe da ein kleines Problem, Meister Hellwag, und ich wollte ...“
„Wenn du auf diese Weise anfängst und mich dazu mit deinen treuen Augen so bettelnd anguckst, dann weiß ich, was du willst“, unterbrach der Schmiedemeister Martin kurzerhand. „Meine Antwort heißt: Nein!“
„Kann es sein, Meister Hellwag, dass Ihr mit der Gottesgabe beschlagen seid, Gedanken lesen zu können?“ Martin ließ sich durch die schroffe Absage des Schmiedemeisters nicht aus der Ruhe bringen. Wusste er doch, dass Daniels Vater stets einen derben Ton anschlug, dabei aber ein herzensguter Mensch war.
„Daniel Hellwag, warum konntest du dir nicht einen zurückhaltenden, friedfertigen und ehrbaren Freund aussuchen, sondern musstest mir diesen garstigen Lauselümmel ins Haus bringen?“, wandte sich Dietrich Hellwag gespielt vorwurfsvoll an seinen Sohn.
„Es tut mir außerordentlich leid, verehrter Vater, aber er läuft mir schon seit Jahren wie ein herrenloser Hund hinterher. Ich kann nichts dagegen machen.“ Daniel hob verzeihend die Hände und grinste aus seinem rußverschmierten Gesicht.
„Wenn du nicht so verdreckt wärst wie eine Wildsau nach der Suhle und ich nicht eine vornehme Kinderstube genossen hätte, würde ich dir jetzt kurzerhand an die Wäsche gehen“, begegnete Martin seinem Freund mit gespielter Entrüstung.
„Wie ich dich kenne, willst du meinen ohnehin faulen Sohn vom Arbeiten abhalten und dich mit ihm dem Müßiggang widmen. Oder sollten mich meine hellseherischen Fähigkeiten in diesem offensichtlichen Fall im Stich gelassen haben?“
„Wir würden Eure Großzügigkeit hoch zu schätzen wissen, Meister Hellwag, und diese auch im ganzen Reich laut verkünden“, warf Martin mit einem Augenzwinkern ein.
„Wenn du weiterhin einem ehrbaren Schmiedemeister den nötigen Respekt verweigerst, besteht die Gefahr, mein lieber Martin Seedorf, dass du eines Tages wie die Pferde ein glühendes Brandmal auf deinem Hinterteil spüren wirst.“
„Von Eurer Hand geprägt wäre es für mich wie ein Ritterschlag.“ Gespielt ehrfürchtig verbeugte sich Martin vor Daniels Vater.
„Um Euch unseren Müßiggang ein wenig schmackhafter zu machen, Vater, könnten wir doch bei unserem Ausritt die Pferde des Grafen Plessen in Kasseedorf ansehen, die er letzte Woche zum Beschlagen angekündigt hat.“ Daniel sah seinen Vater herausfordernd an.
„Endlich einmal ein vernünftiger Vorschlag aus dem Mund unreifer Wirrköpfe. Bis zum Mittagsmahl wird aber noch kräftig in die Hände gespuckt.“ Bei diesen Worten schlug er Martin mit seiner schwieligen Rechten derb auf die Schulter und wandte sich wieder seiner Arbeit zu.
Nachdem Martin seinem Freund verschwörerisch zugezwinkert hatte, verließ er die Schmiede. So schnell wie möglich wollte er jetzt seinen Auftrag erledigen und die Dokumente von der Kanzlei in das Schloss bringen. Die Räume des Advokaten Friedrich Mauritius lagen unmittelbar in der Nähe des Lübschen Tors, und um keine Zeit zu verlieren, entschloss sich Martin, den Weg durch die schmale und immer etwas dunkle Twiete zu wählen, die hinter den Häusern des Segenhörn verlief.
„Ach, der Herr Advokatus persönlich. Seht an, seht an!“
Martin wurde abrupt aus seinen Gedanken gerissen.
Vor ihm stand Adalbert Pechstein, der Sohn des Stadtrats, und neben ihm grinsten ihn dessen unzertrennliche Kumpane, Bertholt Wagenbiel und Arnold Prigge, dümmlich an.
Adalbert Pechstein war eine Stadtplage. So sah Martin ihn, und damit war er nicht allein. Aufgrund der herausgehobenen Stellung von Adalberts Vater, dem Stadtrat und Pferdehändler Leberecht Pechstein, nahm sich der missratene Sohn so manche Rechte heraus, die die Bürger Eutins mit Skepsis verfolgten, manche sogar missbilligten. Nicht nur einmal hatte der Vater nur aufgrund seines Amtes die Missetaten seines Sohnes vertuschen und sein Erscheinen vor Gericht verhindern können. Außerdem ging der junge Mann keiner geregelten Arbeit nach, sondern aalte sich im Wohlstand seines Vaters. Gleichermaßen war ihm eine gewisse Feigheit zu eigen, denn nur selten traf man Adalbert Pechstein ohne seine beiden Begleiter an. Diese gehörten ohnehin nicht zu den hellsten Köpfen und ließen sich daher sehr leicht vor Adalberts Karren spannen. Insbesondere, wenn es um handgreifliche Auseinandersetzungen ging, bei denen sich ihr Anführer stets diskret zurückzog.
„Ach, Adalbert, wieder einmal unterwegs zu neuen Taten?“, begrüßte Martin den Sohn des Pferdehändlers, wohl wissend, dass er den dreien in der engen Gasse nicht aus dem Weg gehen konnte.
„Wie es aussieht, versperrt uns so eine kleine, vergeistigte Advokatenlaus den Weg, oder wie seht ihr das, Jungs?“, warf Adalbert ein und blickte seine beiden Kumpane über die Schulter hinweg auffordernd an.
Die grinsten begriffsstutzig.
„Es gibt Dinge im Leben, die kann man verändern, mein lieber Adalbert, aber es gibt auch Tatsachen, die unverrückbar sind.“
„Was soll das blödsinnige Gestammel?“, fragte Adalbert irritiert nach.
„Nun, würde jeder von uns einen Schritt zur Seite treten, dann hätten wir alle etwas zur Entspannung der Lage beigetragen. Doch sieht man Euch dreien in die Augen, dann muss man erkennen, dass die Dummheit, die ihnen entspringt, kaum veränderbar ist.“
„Willst du uns beleidigen, du alter Klugscheißer?“, brauste Adalbert auf, während seine Begleiter, wie ihren stupiden Gesichtsausrücken zu entnehmen war, die Bedeutung von Martins Worten nicht verstanden hatten.
„Beleidigen kann man nur Männer von Ehre, doch auch die suche ich bei euch vergebens ...“
Plötzlich zuckte Martin zusammen. Adalbert und die beiden anderen schienen sich wie im Nebel aufzulösen. Mehrfach musste er blinzeln, doch vor seine Augen drängte sich unaufhaltsam ein Bild, das immer deutlichere Konturen annahm. Das Bild zeigte Adalbert, der im Graben des Schlosses hektisch mit den Armen ruderte. Wasser spritzte auf, Wellen schwappten ringförmig von dem Ertrinkenden fort, während seine beiden vermeintlichen Freunde teilnahmslos am Ufer standen. Aus der Ferne erklangen wie durch ein dickes Tuch gedämpft und undeutlich Hilferufe an sein Ohr.
Martin schüttelte den Kopf. Langsam verschwamm das Schreckensbild wieder und ihm wurde bewusst, wo er sich gerade befand. In der Twiete. Vor ihm stand immer noch Adalbert Pechstein mit seinen Begleitern, doch jegliche Anzeichen von Aggressivität waren von ihnen gewichen. Entgeistert, geradezu entsetzt, glotzten sie Martin an. Dessen Augen waren weit aufgerissen und starrten in die Ferne. Sein Gesicht war leichenblass.
„Ich glaube, wir sollten jetzt gehen“, murmelte er, indem er sich an den dreien vorbeizwängte. „Und du, Adalbert, solltest in Zukunft nicht so dicht ans Wasser treten.“
Adalbert Pechstein, Bertholt Wagenbiel und Arnold Prigge blickten Martin Seedorf wie gelähmt hinterher. Ihnen war, als hätten sie gerade einen Geist gesehen.
„Mein Gott, was ist dir denn widerfahren?“ Der alte Kanzleischreiber Ernst Heckenrat kam eilig hinter seinem Stehpult hervor und lief Martin entgegen, als dieser totenblass in die Kanzlei taumelte. „Bring den Hocker her, bevor der Junge noch umkippt!“, wies er Jakob, den Hausknecht, an, der gerade dabei war, ein paar Akten zu sortieren und diese in das Archiv zu tragen. „Du bleibst bei ihm und passt auf, dass er nicht vom Hocker fällt!“, war der nächste Befehl an den Hausknecht.
Nach kurzer Zeit kam der Kanzleischreiber mit einem kleinen Glas in der Hand zurück. Darin funkelte eine goldene Flüssigkeit. Der alte Mann drückte Martin das Glas in die Hand und forderte ihn mit heftigem Kopfnicken zum Trinken auf.
Martin atmete tief durch, als er merkte wie ihm die Flüssigkeit brennend die Kehle hinunterlief. „Großer Gott, was ist das denn für ein Zeug?“ Er schnappte mehrmals nach Luft.
„Das ist der Branntwein für ganz besondere Gäste, den unserer Herr Advokat wie seinen Augapfel hütet und hinter einem Aktenordner mit der Aufschrift ,Diskrete Korrespondenz' versteckt hält. Bei Notfällen wie diesem scheint er aber auch seine Wirkung nicht zu verfehlen, denn langsam nimmt dein Gesicht wieder eine menschliche Farbe an. Du sahst aus wie der wandelnde Tod. Was ist bloß geschehen? Bist du etwa dem Leibhaftigen begegnet?“
Martin schmunzelte bei der Beredsamkeit des Kanzleischreibers. „Nein, nein, Herr Secretarius, Ihr müsst nicht besorgt sein. Ich habe mir wohl ein wenig den Magen verdorben. Wie Ihr seht, geht es mir dank Eurer vortrefflichen Medizin schon wieder viel besser.“ Martin versuchte von sich abzulenken. Doch der Kanzleischreiber musterte den jungen Mann skeptisch.
„Bei den allgemein bekannten vorzüglichen Kochkünsten deiner Frau Mutter und eurer tüchtigen Köchin Hertha wage ich dieser Theorie entschieden zu widersprechen.“
Martin ließ sich auch dadurch nicht zu weiteren Erklärungen ermuntern. „Ich würde jetzt ganz gern die Dokumente ins Schloss bringen, wie Ihr es gestern angekündigt habt.“
„Fühlst du dich dazu denn in der Lage?“ Ernst Heckenrat runzelte besorgt die Stirn.
„Doch, es geht mir wieder gut, Herr Secretarius. Wo ist die Mappe mit den Dokumenten?“ Martin erhob sich von dem Hocker und trat dem Kanzleischreiber entgegen.
Von einem Stehpult nahm dieser eine braune, reich verzierte Ledertasche, deren Überwurf in einer schweren Metalllasche endete, in die ein Schloss eingelassen war. Er reichte sie Martin. „Hier sind alle Dokumente, die man im Schloss erwartet. Wie du weißt, verfügt Graf von Wartenburg über einen Schlüssel, mit dem er die Tasche öffnen kann. Nur ihm persönlich übergibst du sie. Er wird sie vermutlich behalten und uns zur gegebenen Zeit zurücksenden. – Und du fühlst dich wirklich wieder wohl?“
„Es ist alles in Ordnung, Herr Secretarius. Ihr könnt Euch auf mich verlassen.“
„Ist gut. Ich will dich heute hier nicht mehr sehen. Nutze die Zeit, um dich ein wenig zu erholen.“ Der Kanzleisekretär schob Martin mit der umgehängten Ledertasche zur Tür hinaus und blickte ihm kopfschüttelnd hinterher.
„So kommst du hier nicht rein, du verdreckter Suffkopp!“
Aus dem Torhaus der Schlosswache klangen Martin laute Töne entgegen. Das Portal des ersten Schlosstores war durch einen schweren Leiterwagen zugestellt, auf dem kreuz und quer Buchenscheite gestapelt waren. Gezogen wurde das Fuhrwerk von zwei schweren, verschmutzten Ackergäulen. Auf dem Kutschbock saß mit einem schäbigen Mantel bekleidet ein kräftiger Mann mittleren Alters, der aufgeregt mit seiner Peitsche fuchtelte. Als Martin näher trat, sah er auch den Sergeanten der Schlosswache, den alle wegen seines dunklen Haar- und Bartwuchses „Sergeant Swattkopp“ riefen. Dieser hatte gerade dem Kutscher lautstark die Einfahrt in den Schlossbereich verweigert.
„Ich soll das Brennholz nach dem Herzog bringen, oder wollt ihr alle den nächsten Winter frieren, du Wichtigtuer?“, schrie der Kutscher zurück.
„Nun hör einmal genau zu, du verfilzte Ratte. Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass ich deine vollgeschissenen Klepper und deine vor Dreck starrende Karre passieren lasse. Setz zurück und mach den Weg frei, bevor ich meine Soldaten auf dich hetze! Sieh zu, dass deine Pferde und der Wagen gewaschen werden, und zieh einen sauberen Rock an. Erst dann darfst du deine Fuhre bis in den Schlosshof fahren. Hast du das kapiert, du verlauster Straßenköter?“ Der Sergeant griff mit seiner Rechten an seinen Säbel, um seinen Worten den nötigen Nachdruck zu verleihen.
„Bloß weil du 'ne Uniform anhaben tust, meinst du wohl, hier den großen Feldherrn spielen zu können, du Zinnsoldat ...“
Bevor sich der Kutscher weiter aufregen konnte, sprang der Sergeant blitzschnell zwei Schritte nach vorn, ergriff die Peitsche und zerrte den total überraschten Kutscher vom Bock, so dass dieser krachend auf dem Boden landete. Danach trat er zurück und winkte zwei seiner Wachsoldaten heran, die den Kutscher mit gekonnten Griffen wieder auf die Beine stellten und ihn gegen die Wand des Torhauses lehnten. „Ich wusste nicht, dass du auch noch schwerhörig bist.“ Der Sergeant trat wieder näher und musterte den Kutscher abfällig von oben bis unten. „Wenn du mit deiner Mistkarre nicht in fünf Minuten verschwunden bist, wirst du noch heute Bekanntschaft mit unserem feudalen Kerker machen. Hast du mich jetzt verstanden, du stinkende Wildsau?“
Sichtlich eingeschüchtert humpelte der Kutscher zu seinen Pferden und führte sie unter ständigem Gemurmel rückwärts aus der Toreinfahrt. Martin hielt die Luft an, als der Kutscher dicht an ihm vorbeiging und ihm ein Dunst aus billigem Fusel und menschlichen Körpersäften entgegenwaberte.
„Endlich einmal ein Lichtblick an diesem trüben Morgen!“, rief der Sergeant ihm entgegen, als er Martin erblickte. „Hast du dieses Erdferkel gesehen, Martin? Die Leute denken doch, wenn sie einen solchen Schweinewagen die Schlosspforten passieren sehen, dass hier auch solche Kanalratten wohnen.“
„Sie ist sicherlich nicht immer ganz leicht, Eure Arbeit, Sergeant, aber dem Mann habt Ihr doch sehr eindrucksvoll gezeigt, wer der wahre Meister der Schlosswache ist.“ Martin lachte den Sergeanten an. Sie kannten sich schon lange, zumal Martin bei seinen Botengängen des Öfteren das Schlosstor passieren musste. Und so wussten die Wachsoldaten auch, dass Martins Onkel der Zweite Stallmeister des Herzogs war.
„Wieso habe ich bei dir immer das Gefühl, dass du mich auf den Arm nehmen willst?“ Der Sergeant grinste Martin an.
„Das würde ich mich nie trauen, Sergeant Swattkopp. Immerhin seid Ihr doch eine Respektsperson.“
„Pass bloß auf, dass ich dir nicht mit meinem Säbel noch den nötigen Respekt beibringe“, rief er Martin hinterher, nachdem dieser mit schnellen Schritten das Schlosstor passiert hatte.
Martin war immer wieder fasziniert von der ganz anderen Welt, die er im Schlosshof vorfand. Vergessen waren die engen Gassen der Stadt, die Schweine, die sich durch den Unrat wühlten, die Misthaufen vor den Türen und die grau in grau gekleideten Menschen, die emsig ihren Beschäftigungen nachgingen. Bereits auf dem Vorplatz des Schlosses bot sich ihm ein ganz anderes Bild. Vor der Remise zur rechten Hand standen zwei herrschaftliche Kutschen. Ihre Türen zierten das farbige Wappen des Herzogs. Vor dem Marstall zur Linken waren Stalljungen damit beschäftigt, drei edle Rösser – einen Braunen und zwei Schimmel – zu striegeln und ihnen Geschirre anzulegen, deren glänzende Beschläge im Sonnenlicht funkelten. Zwei Geistliche, gänzlich in Schwarz gekleidet und tief in ein Gespräch vertieft, schritten an ihm vorbei, ohne ihn zu bemerken.
Auch am zweiten Tor ließ die Wache ihn ungehindert passieren. Als Martin den Innenhof des Schlosses betrat, hielt er für kurze Zeit inne. Auch das Bild, das sich ihm hier bot, beeindruckte ihn stets aufs Neue. Rund um den Brunnen in der Mitte des Platzes standen Hofdamen und edle Herren, die unbekümmert miteinander plauderten. Sie trugen prachtvolle Gewänder aus Seide und Brokat, verziert mit Spitze und Rüschen. Nicht weit davon entfernt vergnügten sich vier junge Höflinge beim Kartenspiel, während anderen Damen und Herren des herzoglichen Hofstaates von Pagen Gebäck und Wein gereicht wurde. Auch sie nahmen von Martin kaum Notiz, als er schließlich den Hof überquerte.
„Was willst du?“, herrschte der Kanzleischreiber Martin an, als er die Hofkanzlei nach kurzem Anklopfen betreten hatte. „Du bist hier nicht im Kuhstall, wo jeder hergelaufene Knecht hereinpoltern kann, wie er will.“
„Oh, das ist mir ganz neu, dass auch Ihr über ein Vorzimmer verfügt, hochverehrter Herr Hofsecretarius. Sollte ich auf diese Weise gegen das Hofzeremoniell verstoßen haben, entschuldige ich mich ergeben.“ Martin deutete eine kleine Verbeugung an. Eine einzige Witzfigur, dieser elenden Gernegroß!
„Willst du mich beleidigen, du Lümmel?“
„Ich bitte Euch, Herr Hofsecretarius, wie könnte ein hergelaufener Straßenjunge wie ich denn eine so gefestigte Amtsperson wie Euch je erschüttern?“ Martin konnte sich nur mit Mühe ein Lachen verkneifen, als er in das verdatterte Gesicht des Schreibers blickte. „Ich überbringe wichtige Dokumente vom Advokaten Mauritius für den Herrn Kanzleidirektor und wäre Euch sehr verbunden, wenn Ihr mich avisieren würdet.“
„Gib her die Dokumente! Alles andere erledige ich schon.“ Der Kanzleischreiber streckte Martin auffordernd seine Hand entgegen.
„Das wird nicht möglich sein, da ich die Dokumente nur dem Herrn Grafen von Wartenburg persönlich übergeben darf.“
„Traust du mir etwa nicht zu, dass ich deine unwichtigen Papiere ordnungsgemäß weiterreichen werde, du vorlauter Bengel?“
„Euch traue ich alles zu, verehrter Herr Hofsecretarius. Doch wenn Ihr in Eurer Machtfülle entscheiden könnt, dass der Herr Graf die Dokumente nicht benötigt, dann gehe ich eben wieder.“ Martin drehte sich um und steuerte die Tür an.
„Halt! Bleib stehen!“, schrie der Schreiber. Er schien jetzt vollkommen verunsichert zu sein und wusste offensichtlich nicht, wie er die missliche Situation bereinigen sollte, ohne sein Gesicht zu verlieren. „Ich werde sehen, ob seine Gnaden zugegen ist.“ Unwirsch drehte er sich um und klopfte an die Tür hinter seinem Pult Martin schüttelte den Kopf, als der Schreiber im benachbarten Zimmer verschwand und die Tür hinter sich schloss. Wieso kam ihm in diesem Augenblick das Bild eines aufgeplusterten Gockels auf dem Misthaufen in den Sinn?
Kurze Zeit später öffnete sich die Tür wieder und der Hofschreiber winkte ihn widerwillig heran. „Martin Seedorf, der Gehilfe des Advokaten Mauritius, Euer Gnaden.“
Dieser Hohlkopf, dachte Martin, als er an ihm vorbei schritt. Der kennt mich und meinen Namen genau und bläst sich trotzdem jedes Mal so auf.
„Ah, die sehnlich erwarteten Urkunden. Tritt näher, Junge!“ Graf Gerald von Wartenburg, der Kanzleidirektor, der in Abwesenheit des Herzogs dessen Interessen wahrte, begrüßte Martin ernst, aber freundlich, erhob sich kurz hinter seinem Schreibtisch und nahm die Dokumentenmappe entgegen. „Ihr könnt gehen, Stülpnagel. Für Euch gibt es hier nichts zu tun“, wies der Hofrat seinen Schreiber an, als er sah, dass der immer noch neugierig in der Tür lauerte.
Aus einem Kästchen auf dem Schreibtisch entnahm Graf von Wartenburg einen kleinen Schlüssel und öffnete damit das Schloss der Ledermappe. Schweigsam studierte er die Dokumente und legte sie nacheinander zur Seite. Hin und wieder hörte Martin ein kurzes Brummen, nicht wissend, ob der Graf damit sein Missfallen oder seine Zustimmung ausdrücken wollte.
„Das sieht alles sehr ordentlich aus“, sagte dieser. „Bestell dem Advokaten Mauritius, dass der herzogliche Hof mit der Arbeit seiner Kanzlei zufrieden ist! Besonders die Duplikate der Urkunden weisen seit geraumer Zeit ein erfreuliches Erscheinungsbild in Präzision und dekorativer Ausführung aus. Ich habe sonst keine weiteren Weisungen für dich.“ Mit diesen Worten war Martin entlassen. Ohne den Schreiber im Vorzimmer zu beachten, verließ er die Hofkanzlei und trat hinaus in den Innenhof des Schlosses.
„Julius, du Schlafmütze, sieh zu, dass du den Wallach vom Grafen von Weißhaupt gesattelt kriegst! Der will ihn beim Glockenschlag um zwölf vor dem Schlosstor haben. – Anton, ist die Kutsche der Komtesse schon angespannt? – Paul und Wilhelm, der Futtertrog mit dem Hafer ist fast leer. Der muss wieder aufgefüllt werden. Los, ihr beiden, nehmt die Beine in die Hand!“
Nicht ohne Stolz beobachtete Martin den Zweiten Stallmeister des Herzogs. Er mochte seinen Onkel sehr. Hartmut Bergmann verfügte über ein ebenso ausgeglichenes und gutmütiges Wesen wie dessen Schwester, Martins Mutter. Er war zudem voller Tatendrang und Elan. Seine Stellung als herzoglicher Stallmeister hatte er sich schwer erarbeiten müssen. Doch bis heute konnte ihm in seinem Reich der Pferde niemand etwas vormachen. Graf Aribert von Merkenheim, der Oberstallmeister, trug zwar offiziell die Verantwortung für den Marstall, kümmerte sich aber kaum darum. Viel zu sehr war er damit beschäftigt, den reizvollen Hofdamen nachzusteigen und um ihre Gunst zu werben – meist mit mäßigem Erfolg, wie man sich erzählte, da er mit einer viel zu langen Nase und einem mehr als breiten Mund über ein besonders unattraktives Äußeres verfügte. Was er persönlich offensichtlich nicht so empfand.
„Ach, Martin, schön, dass ich dich sehe. Kannst du diesen Hornochsen einmal klarmachen, worin der Unterscheid zwischen einem Schimmel und einem Rappen besteht? Sie werden es nie begreifen!“ Hartmut Bergmann schüttelte resignierend den Kopf. „Ich ernenne dich hiermit zum herzoglichen Oberstallburschen, damit du den Torfköpfen unter anderem beibringst, wo bei einem Pferd vorn und hinten ist.“
„Herzlichen Dank für die großen Ehre, verehrter Onkel, aber ich glaube, solchen fundamentalen Aufgaben bin ich nicht gewachsen. Und habt Ihr mir nicht selbst beigebracht, dass man vom Ochsen nicht mehr als Rindfleisch verlangen kann?“
„Nun schlägt der Bengel mich mit meinen eigenen Waffen. Womit habe ich das bloß verdient?“
„Ich ströme über vor Gram und Mitleid, Onkel.“
Fröhlich lachend schloss der Zweite Stallmeister des Herzogs seinen Neffen in die Arme. „Komm, mein Junge, wir gehen hinter das Haus und gönnen uns eine kleine Pause. Nach meinem Anpfiff wird der Laden für kurze Zeit wohl auch ohne meine Aufsicht laufen. Schön, dass du mich besuchst. Was führt dich ins Schloss?“
„Ach, das Übliche. Dokumente von meinem Advokaten für den Kanzleidirektor und die Neugier, ob es Euch gut geht?“
Inzwischen hatten sie die Rückseite des Marstalls erreicht und setzten sich auf ein paar Strohballen in die Sonne.
„Und das soll ich dir glauben?“
„Warum habt Ihr Zweifel?“
„Es ist schon gut, mein Junge. In der Welt, in der ich lebe, muss man stets auf der Hut sein. Aufrichtigkeit und Freundschaft sind hier keine Selbstverständlichkeit. Bei Hofe gibt es überall Gruben und Fallstricke. Da kannst du schneller stolpern, als selbst der eiligste Pferdeapfel den Boden erreicht hat.“
„Welch pessimistische Töne höre ich da aus Eurem Mund, Onkel. Das kenne ich ja gar nicht von Euch.“
„Du hast recht, Martin. Ich klage wie ein altes Waschweib.“
„Aber irgendetwas beunruhigt Euch?“
„Weißt du, eigentlich hat sich nichts verändert. Es geht alles seinen üblichen Gang. Doch mehr und mehr fällt mir auf, dass am Hofe im Laufe der Jahre die Uhren doch anders gehen. Dadurch, dass der Herzog im fernen Gottorf weilt, haben sich hier Strukturen entwickelt, die ich mit einer gewissen Sorge beobachte. Aber was erzähle ich denn? Das sollte dich doch alles gar nicht interessieren.“
„Ihr und Euer Wohlergehen liegen mir sehr wohl am Herzen.“
„Das weiß ich, Martin.“ Geistesabwesend tätschelte der Stallmeister seinem Neffen die Schulter.
Nach einer Weile des Schweigens nahm Martin allen Mut zusammen. „Onkel, darf ich Euch eine vielleicht etwas ungewöhnliche Frage stellen?“
Hartmut Bergmann wurde aus seinen Gedanken gerissen und blickte Martin zunächst verwundert an. Dann lächelte er. „Das wäre ja nicht das erste Mal. Schieß los!“
„Mutter und Ihr habt doch früher öfter einmal von Großmutter Frauke erzählt.“
„Ja, und?“
„Da habt Ihr auch einmal gesagt, sie hätte das zweite Gesicht besessen. Könnt Ihr mir sagen, was das bedeutet?“
Hartmut Bergmann erschrak. Gegen seine sonst so gelassene Natur wirkte er urplötzlich beunruhigt, rutschte nervös auf dem Strohballen hin und her und blickte hastig um sich. „Warum willst du das wissen?“, stieß er hervor.
„Es interessiert mich.“
„Du solltest solchen Bemerkungen keine allzu große Bedeutung beimessen, mein Junge. Wirklich nicht.“
„Aber eine Erklärung für diesen Ausdruck ,zweites Gesicht' gibt es schon?“
„Martin, du bist manchmal lästig wie eine Fliege auf dem Abort. Deine Großmutter Frauke war deiner Mutter und mir eine herzensgute Mutter. Leider ist sie viel zu früh von uns gegangen. Sie war eine sehr weise Frau und sah Dinge, die allen anderen verborgen blieben.“
„War es das, was Ihr dann ,das zweite Gesicht' genannt habt?
„Ja, ja.“ Wieder blickte sich Hartmut Bergmann nervös um.
„Hör mir jetzt einmal genau zu, Martin. Vor rund zwanzig Jahren litt Bürgermeister Bahr, der auch heute noch im Amt ist, unter einer rätselhaften Krankheit. Die Menschen behaupteten, dass ein Mann namens Hans Klindt den Bürgermeister verhext haben soll und dass das der Grund für dessen Leiden sei. Das alles nur, weil die Schwester dieses Hans Klindt wenige Jahre zuvor als Hexe verbrannt worden war. Als der Rat der Stadt ihn daraufhin befragte und er aussagte, dass er kein Hexer sei, ließen sie ihn wieder frei. Woraufhin sich die Eutiner derart entrüsteten, dass der Rat Hans Klindt in Schutzhaft nehmen musste. Das Volk beruhigte sich nicht und forderte die Bestrafung des vermeintlichen Hexers. Hans Klindt wurde mehrfach peinlich verhört, aber auch unter der Folter blieb er bei seiner Aussage, er könne nicht hexen. Daraufhin ließ ihn der Rat der Stadt frei. Drei Wochen später fand man ihn tot im Straßengraben vor den Toren der Stadt. Wahnwitzige und verblendete Bürger hatten ihn erschlagen.“
Martin hatte seinem Onkel wie gebannt zugehört. Wie abergläubisch die Menschen waren, das hatte er schon oft genug erlebt und belächelt. Doch dass ein solcher Wirrglaube die Menschen zu derartigen Taten führen konnte, entsetzte ihn maßlos.
„Weißt du, was ich dir mit dieser Geschichte sagen will?“
„Ich glaube schon“, antwortete Martin zögerlich, immer noch erschüttert von dem, was er soeben gehört hatte.
„Allein der Verdacht, dass es in unserer Familie einen Menschen gegeben haben soll, nämlich deine Großmutter Frauke mit ihrem zweiten Gesicht, und die Tatsache, dass dein Vater Apotheker ist, dessen Kunst von schlichten Gemütern auch gern als Hexenzauber gesehen wird, kann uns sehr schnell in Teufels Küche bringen. Also kein Wort darüber! Verstanden?“
„Ja, ich habe verstanden, Onkel. Ich konnte nicht ahnen, dass meine Frage so viel Gefahr birgt.“
„Ich weiß, mein Junge. So, jetzt ist es aber an der Zeit, dass ich meinen vertrottelten Pferdeburschen Beine mache.“
Martin verabschiedete sich von seinem Onkel und ging auf das Schlosstor zu. Dort stand noch immer der Kutscher mit den beiden Ackergäulen und der Ladung Holz, den Sergeant Swattkopp bei Martins Ankunft so derbe abgekanzelte hatte. Die beiden waren in eine angeregte Unterhaltung vertieft.
„Na, also, es geht doch“, sagte der Sergeant. „Vorzeigbar seid ihr, du und deine Klepper, zwar immer noch nicht, aber mehr kann man von einem Waldschrat wohl nicht erwarten.“
Martin sah, dass der Kutscher den Versuch unternommen haben musste, seine Pferde und die Räder des Leiterwagens zu säubern. Den verschmutzten Mantel hatte der Mann ausgezogen und unter die Holzscheite gestopft. Sein Gesicht schien mit Wasser zumindest in Berührung gekommen zu sein, denn einige Tropfen hingen noch in seinem Bart. Vermutlich war der Kutscher über die nahe liegende Wasserstraße zum See gefahren. „Nun gib endlich Ruhe und lass mir rein“, war seine knurrige Antwort.
„Merten, begleite die edle Karosse, damit der Trottel sich nicht verfährt“, wies der Sergeant einen seiner Soldaten an. „Das Holz kommt direkt zur Küche. Die dicke Wilhelmine weiß Bescheid.“
Missmutig trieb der Kutscher seine beiden Gäule an und folgte dem Wachsoldaten, während Sergeant Swattkopp dem komischen Gespann kopfschüttelnd hinterhersah.
Kapitel 4
„Bruder Simon, ich möchte Euch von ganzem Herzen danken, mit welcher Andacht und Liebe Ihr die Trauerfeierlichkeiten für Bruder Anselm geregelt habt. Es war ein angemessener Abschied für unseren ehrwürdigen Bruder. Gott sei seiner Seele gnädig.“
Der Dekan am fürstbischöflichen Hof in Eutin hatte Pater Simon zu sich befohlen. In seinem Audienzsaal saß er auf einem Stuhl mit hoher Rückenlehne hinter einem reich verzierten Schreibtisch und blickte sein Gegenüber abschätzend an. Seinen nachgeordneten Kirchenleuten ebenfalls einen Stuhl anzubieten, befand sich außerhalb seiner Vorstellungskraft. Er war sich seiner Machtfülle als Vertreter des Propstes, der im fernen Lübeck residierte, durchaus bewusst und demonstrierte diese in derartigen Äußerlichkeiten.
„Es war mir ein Bedürfnis und eine Pflicht zugleich, Bruder Anselm ein würdevolles Geleit zu geben.“
„Eure Bescheidenheit ehrt Euch, Bruder Simon. Aber sie scheint Euch in unserer Gemeinschaft stets auch ein wenig im Weg zu sein. Könnt Ihr Euch immer noch nicht entschließen, Euch für ein höheres Amt zu öffnen? Ich möchte Euch keine Versprechungen machen, aber Ihr wisst selbst, dass Euer Name nicht das erste Mal vom Propst und sogar von unserer fürstbischöflichen Durchlaucht genannt wurde, wenn es um die Besetzung herausgehobener Posten ging.“
„Ihr kennt meine Antwort, Bruder Benedict, ich widme mich lieber meinen Studien und versuche, die philosophischen Höhenflüge der Griechen einzufangen und auf unser bescheidenes irdisches Maß zu transformieren. Eine Aufgabe, für die sicherlich mehrere Menschenleben nicht reichen werden. Erlaubt mir somit, meinen bescheidenen Anteil daran zu leisten.“
„Wie Ihr wisst, schätze ich Eure Studien hoch ein, aber gleichermaßen muss ich auch dafür Sorge tragen, dass das Haus seiner fürstbischöflichen Durchlaucht kompetent bestellt wird. Ich gehe davon aus, dass Ihr an dem vakanten Amt des Schatzmeisters nicht interessiert seid.“
„Verzeiht, Bruder Benedict, ich sehe durchaus die Notwendigkeit einer funktionierenden Administration einschließlich eines Schatzmeisters, die ein so vielschichtiges Gefüge wie der fürstbischöfliche Hof benötigt, aber die Welt der Zahlen und das kaufmännische Denken erschließen sich mir nicht.“
„Ich habe eine Antwort wie diese erwartet und respektiere Eure Entscheidung. Aber seid Ihr nicht dem kränkelnden Bruder Anselm bereits in den letzten Wochen zur Hand gegangen? So wurde mir zumindest berichtet“
„Zugegeben, er hat meinen Beistand gesucht, den ich ihm auch gern gewährt habe, aber doch eher im geistigen Sinne als in der Hilfe bei seinen Zahlen. Eines jedoch hat mich ein wenig beunruhigt und beschäftigt mich bis heute. Vielleicht könnt Ihr Licht in diese Ungewissheit bringen.“
„Ihr macht mich neugierig, Bruder Simon.“
„In seinen letzten Stunden war Bruder Anselm nicht immer bei vollem Geiste. Er sprach wirr. Auffällig war jedoch, dass er um Gnade bat, angeblich, weil die Zahlen lügen würden, wie er sich ausdrückte. Augenscheinlich fühlte er sich dafür verantwortlich. Ich hatte den Eindruck, dass er für ein sündhaftes Verhalten um Absolution bat. Habt Ihr eine Erklärung dafür?“
„Nein, Bruder Simon. Ich glaube, wir sollten dieser Verwirrung keine allzu große Bedeutung beimessen. Bruder Anselm hat das Amt des Schatzmeisters stets gewissenhaft ausgeführt. Schreiben wir seine Konfusion dem nahenden Tod zu.“
„Wenn Ihr erlaubt, noch eine Frage für mein Verständnis.“ Der Dekan nickte ein wenig gereizt.