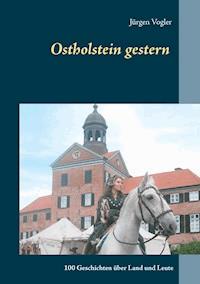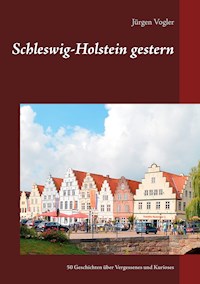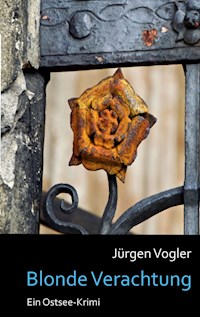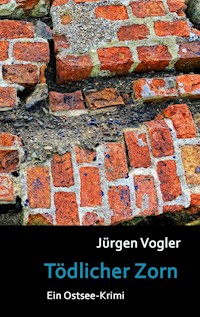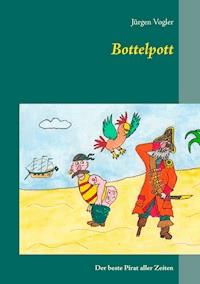Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nicht ganz freiwillig tritt Richard Graf von Frankenthal in die Dienste des Herzogs von Schleswig-Holstein-Gottorf. Er soll für die Sicherheit des lebenslustigen Prinzen Christian Albrecht sorgen. Keine leichte Aufgabe. Neid, Missgunst und Intrigen fordern Richard und seinen treuen Sergeanten Tolksdorf nicht nur einmal heraus. Durch familiäre Schicksalsschläge gerät Christian Albrecht als junger Herzog sehr bald zwischen die Mühlensteine der Geschichte, die von Verfolgung, Betrug und kriegerischen Auseinandersetzungen geprägt sind. Und welche Rollen spielen dabei Hofkanzler Kielman und das Küchenmädchen Agnes? Ein abenteuerlicher Ausflug in die bewegte Vergangenheit Schleswig-Holsteins bis zur Gründung der Christian-Albrechts-Universität in Kiel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Jürgen Vogler wurde 1946 in der Holsteinischen Schweiz geboren und wohnt heute an der Ostseeküste. Nach seinem Dienst als Pressesprecher bei der Bundespolizei arbeitet er seit 1988 als Freier Journalist und Autor. „Ostholstein gestern“ zeigt sehr anschaulich sein Interesse an geschichtlichen Ereignissen. 2012 wurde sein erster historischer Roman „Der Mohr von Plön“ veröffentlicht, dem die tatsächliche Geschichte um den schwarzen Feldtrompeter Christian Gottlieb zu Grunde liegt. Es folgten die historischen Romane „Der Narr von Eutin“ und „Der Marquis von Lübeck“. Mit „Schleswig-Holstein gestern“ setzte er 2021 seinen Ausflug in die Geschichte des Landes zwischen den Meeren fort. „Die rechte Hand des Herzogs“ ist sein neuester Roman über die Geschichte Schleswig-Holsteins. Wenn er nicht mit der Recherche für seine historischen Geschichten beschäftigt ist, schreibt der Autor auch Kurzkrimis und Kriminalromane.
www.juergenvogler.de
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Dichtung und Wahrheit
Vorwort
Blicken wir in diesen Tagen auf die Karte Europas, so präsentieren sich die einzelnen Staaten in den meisten Fällen als geschlossene Territorien. Ein Anblick, von dem man im 17. Jahrhundert weit entfernt war. Auch im hohen Norden, jener Region, die heute zu Deutschland zählt und in der meine Geschichte spielt, zerschnitten unübersichtliche Grenzen das Land und verwandelten es in einen bunten Flickenteppich kleinteiliger Fürstentümer und Herrschaftsbereiche. In vielen Fällen war es kaum der Mühe wert, sich um den einen oder anderen Farbklecks auf der Landkarte zu kümmern, um seine historische Bedeutung zu erforschen. Der Lauf der Geschichte hat ihn einfach ausradiert. Was so viel bedeutete, dass andere Herrscher bei den damals üblichen kriegerischen Auseinandersetzungen das kleine Fürstentum kurzerhand einkassiert hatten. Auch das Aussterben eines fürstlichen Geschlechts ließ sehr schnell das überschaubare Staatsgebilde von der Karte verschwinden.
Ein Herzogtum allerdings, das naturgemäß in seinen Grenzen als solches nicht mehr existiert, konnte sich auf ganz andere Weise bis heute behaupten. Immerhin gab das Herzogtum Schleswig-Holstein-Gottorf dem nördlichsten Bundesland seinen Namen. Was nicht unbedingt zu erwarten war, denn nicht nur einmal war das kleine Herzogtum zwischen die Mühlenräder der Geschichte geraten. Allein das verbriefte Recht des gemeinsamen Herrschens durch den dänischen König und den Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorf barg über Jahrhunderte immer wieder Zündstoff. Insbesondere als im 17. Jahrhundert Herzog Friedrich III. die Freundschaft zum schwedischen König suchte, setzte der dänische König seine Truppen in Marsch. Mehrfach wurden die Schachfiguren des Herzogtums zwischen den beiden skandinavischen Erzfeinden hin- und hergeschoben oder zeitweise sogar vom Brett gefegt. Allerdings hatten die Kontrahenten nicht mit der Aufmerksamkeit großer Herrscher Europas gerechnet, die immer wieder dafür sorgten, dass das kleine Herzogtum Schleswig-Holstein-Gottorf zu seinem Recht kam und wieder aufblühen konnte.
In diesen politisch unruhigen Zeiten wuchs Christian Albrecht auf. Als zehntes Kind und fünfter Sohn von Herzog Friedrich III. von Schleswig-Holstein-Gottorf und Maria Elisabeth von Sachsen schien ihm trotz allem ein sorgenfreies Leben am fortschrittlichen und kulturell beachtlichen Hof in Gottorf beschieden zu sein. Aufgrund seiner älteren Brüder war er allerdings fern einer verantwortlichen Erbfolge. Weder der Titel des Fürstbischofs von Lübeck, der stets dem Zweitgeborenen zustand, konnte ihn erreichen, geschweige denn die Herrscherwürde des Herzogs, die dem ältesten Sohn beim Tode des Vaters gehörte.
Doch wie so oft im Leben sollten die Zeiger der Schicksalsuhr auch für Christian Albrecht sehr bald in eine andere Richtung schwenken. Missgunst, Neid und Anfeindungen begleiteten sehr bald sein Leben. Er musste sich in Kriegen behaupten, sich raffgierigen Speichelleckern erwehren und nicht nur einmal vor politischen Intriganten fliehen. Wohl dem, der in solchen schweren Zeiten einen verlässlichen Begleiter an seiner Seite hatte.
Ich habe mir erlaubt, in meiner Macht als Autor eine solche Figur ins Leben zu rufen. Richard Graf von Frankenthal habe ich diesen wackeren Streiter getauft und ihn eingebunden in jene bewegende Zeit. Seine Geschichte will ich Ihnen heute erzählen.
Jürgen Vogler
Kapitel 1
1656 irgendwo zwischen Husum und SchleswigRegen peitschte unaufhaltsam durch die Baumwipfel. Blitz und Donner verwandelten den Wald in ein apokalyptisches Inferno. Der Gasthof am Rande des Weges schien sich unter der furchterregenden Last der Naturgewalten zu ducken. Schwallartig rauschte das Wasser über das marode Reetdach. Tümpelähnliche Pfützen bildeten sich auf dem unbefestigten Hof. Der sandige Kutschweg hatte sich in Kürze in einen Pfad voller Schlamm und Morast verwandelt.
In der Dunkelheit, nur kurzzeitig erhellt durch das Licht der Blitze, waren plötzlich vier Reiter zu erkennen. In geduckter Haltung versuchten sie sich unter ihren Mänteln und heruntergezogenen Hüten vergeblich vor den Wasserfluten zu schützen. Fluchend lenkten sie ihre Pferde auf die Ställe des Gasthofes zu und saßen ab. Einer von ihnen riss die Stalltür auf. „Gibt es hier irgendwo eine versoffene Kreatur, die sich um unsere Pferde kümmert?“
Aus dem Dämmerlicht einer Stalllaterne erschien ein ungefähr zwölfjähriger Knabe, der den lauten Eindringling verschüchtert ansah. Er sagte kein Wort.
„Unsere Pferde müssen versorgt werden“, wies ihn der Reiter an. „Reib sie ordentlich trocken, bring das Sattelzeug in Ordnung und gib ihnen zu saufen und zu fressen. Bekommst du das hin?“
Der Junge nickte nur. Der Reiter griff in seine Jackentasche und holte eine Münze hervor. Mit einer lässigen Bewegung schnipste er das Geldstück dem Jungen entgegen. Reaktionsschnell fing dieser die Münze auf. Als er das silberblinkende Teil in seiner Hand betrachtete, blickte er den Reiter erstaunt an. Im selben Augenblick erhellte sich sein Gesicht. „Ich werde alles zu Eurer Zufriedenheit erledigen, gnädiger Herr.“ Dabei neigte er seinen Oberkörper mehrfach nach vorne, was einer devoten Verbeugung nahekam.
Als die vier durchnässten Reiter den Schankraum betraten, strömte ihnen ein Schwall stickiger Luft entgegen. Hinter dem Tresen hantierte der glatzköpfige Wirt. Ein fleckiger Lederschurz umspannte seinen fassförmigen Körper, für den vermutlich ein ganzer Ochse sein Leben gelassen hatte. Mit knarziger Stimme, die kaum zu seinem mächtigen Volumen passte, scheuchte er die beiden jungen Schankmädchen herum. Wie es schien, saßen in erster Linie Männer an den Tischen, die vor dem Unwetter Schutz gesucht hatten. Manche von ihnen würfelten, andere erzählten sich Geschichten und tranken sich laut lachend zu. Die eifrigen Schankmädchen konnten die durstigen Zecher kaum zügig genug mit neuem Bier versorgen. Auch wenn der Gasthof „Drei Eichen“ in seiner Erscheinung innen wie außen nicht unbedingt einen einladenden Eindruck vermittelte, war er aufgrund seiner Lage nicht unbedeutend. Wer von Schleswig aus auf einigermaßen befahrbaren Wegen Husum erreichen wollte, musste zwangsläufig den Gasthof passieren. Nicht nur, dass er Unterschlupf bot, wenn die himmlischen Schleusentore sich öffneten, er erlaubte auch Reisenden eine erholsame Rast. Zugleich konnten Pferde mit Hafer und Wasser versorgt und wenn nötig, auch kleine Reparaturen an Kutschen und Zaumzeug vorgenommen werden.
Watschelnd kam der Wirt hinter dem Tresen hervor, als er die vier neuen Gäste eintreten sah.
„Wie kann ich den Herrschaften dienen?“, fragte er beflissen, während er sich seine Hände an einem Tuch undefinierbarer Farbe abtrocknete.
„Zunächst benötigen wir einen Tisch, Herr Wirt, und anschließend wäre es hilfreich, wenn Ihr dafür sorgen würdet, dass unsere Mäntel zum Trocknen aufgehängt werden“, antwortete der Reiter, der auch dem Stalljungen den Auftrag für die Pferde erteilt hatte.
„Kein Problem, gnädige Herren.“ Der Wirt drehte sich um und trottete auf einen Tisch zu, an dem ein einzelner Zecher mit seinem Kopf auf den Armen schlief. Mit einem beherzten Griff packte er den Schlafenden am Kragen, hob ihn ohne Mühe von der Bank und ließ ihn einen Meter daneben fallen. Gleichzeitig lud er die vier Reiter mit einer einladenden Handbewegung ein, sich an den Tisch zu setzen.
„Meine Mädchen werden gleich zu Euch kommen, verehrte Herren, und Eure Wünsche erfüllen“, beteuerte der Wirt, nicht ohne vorher den Tisch mit seinem schmutzigen Tuch abgewischt zu haben. Den erwachten und protestierenden Zecher, der sich gerade vergeblich darum bemühte, aufzustehen, ergriff er erneut am Kragen und beförderte ihn, ohne seine wüsten Beschimpfungen zu beachten, vor die Tür.
„Sag mir mal einen Grund, Richard, weshalb wir deinen hirnrissigen Vorschlägen immer wieder folgen und uns solche Ausflüge an tun?“
Der Angesprochene stöhnte lachend auf. „Benedict, du bist und bleibst ein alter Miesepeter. Was willst du mehr? Wir sitzen im Trockenen, liebreizende Mädchen werden uns sehr bald einen erfrischenden Tropfen und würzige Speisen servieren. Und du bist in geselliger Runde.“
Richard Graf von Frankenthal gehörte zu einem alten Adelsgeschlecht, dessen Familie im Holsteinischen über ausgedehnte Ländereien verfügte. Es war nicht das erste Mal, dass er mit seinen Freunden Ausflüge unternahm, die man von einem Sohn edler Herkunft nicht erwarten konnte. Baron Benedict von Arlewatt war einer von ihnen. Ebenfalls einer aus gutem Haus, allerdings gehörte seine Familie nicht dem Hochadel an. Caspar Graf von Löwenstedt hingegen verfügte über eine ebenso lange ritterliche Ahnentafel wie sein Freund Richard. Der vierte im Bunde war Oswald Tolksdorf. Jener Reiter, der den Stallburschen so derb gerufen hatte. Der Einzige in der erlauchten Runde, der nicht zu den Edelleuten zählte.
„Benedict und ich machen uns schon seit längerer Zeit Gedanken darüber, mein lieber Richard, wieso es dich so beharrlich zu dem einfachen Volke zieht?“, erklärte nun auch Caspar von Löwenstedt.
„Was für eine Frage überhaupt? Ihr seht doch, wo das Leben tobt.“ Dabei warf Oswald Tolksdorf einen umfassenden Blick durch die Schankstube und unterstrich es mit einer ausladenden Armbewegung. „In euren vornehmen Häusern wird man doch wahnsinnig, weil alle, wie sie da sind, dort ständig mit hoher Nase und einem Ladestock im Arsch herumlaufen.“
Alle fingen schallend an zu lachen.
„Wo unser Tolksdorf recht hat, hat er recht“, pflichtete ihm Graf Richard bei. „Bisher hatte ich allerdings den Eindruck, dass unsere Verkleidungen und unsere Streifzüge durch niedere Auen euch auch gefallen haben. Oder irre ich mich da?“
„Grundsätzlich pflichten wir dir ja bei“, erklärte Caspar von Löwenstedt wohlwollend nickend. „Die ständige Aufsicht unserer ach so fürsorglichen Väter ist nicht selten erdrückend. Da sind unsere Exkursionen schon eine wahre Erholung. Wobei ich Tolksdorfs Erklärung über unsere häuslichen Verhältnisse nur in Ansätzen akzeptiere, unabhängig von seiner völlig unangemessenen Wortwahl.“
„Es tut mir aufrichtig leid, Herr Graf, wenn ich deine empfindliche Seele durch meine Worte treffsicher verletzt habe. Ich gelobe für die Zukunft definitiv keine Besserung“, reagierte Oswald Tolksdorf mit einem schelmischen Grinsen.
„Ich wäre vollkommen enttäuscht von dir, Tolksdorf, wenn es anders käme ...“
Unterbrochen wurde der Graf von den beiden Schankmädchen, die an den Tisch herangetreten waren. Dass die beiden Töchter des Wirts Schwestern sein sollten, war kaum erkennbar. Eine von ihnen verfügte über eine schlanke, aber wohl proportionierte Figur, was selbst unter ihrem derben Wollkittel erkennbar war. Ihre blonden Haare konnte sie nur mühsam mit einem Kopftuch bändigen. Mit großen blauen Augen in ihrem herzförmigen Gesicht strahlte sie die Gäste an. Ihre Schwester hingegen war trotz ihrer Jugend auf dem besten Weg, dem körperlichen Umfang ihres Vaters zu folgen. Ihr Kittel wölbte sich nicht nur prall über ihrer ausladenden Oberweite, sondern ließ auch ihrem Hinterteil keinen Platz zwischen Stoff und Haut. Ihre rosigen Pausbacken reduzierten ihre Augen zu schmalen Schlitzen. Beiden hatte die Natur anscheinend ein sonniges Gemüt mit auf den Lebensweg gegeben. Trotz der betriebsamen Hektik in der Wirtschaft strahlten die Mädchen eine unbekümmerte Fröhlichkeit aus.
„Wie können wir den werten Herren zu Diensten sein?“, ließ die Schlankere von ihnen eine glockenklare Stimme erklingen. Dabei strahlte sie besonders Graf Richard an. Mit seinen bis zur Schulter reichenden dunkelblonden und gewellten Haaren, seinen ebenmäßigen, aber markanten Gesichtszügen und den eindringlich dreinblickenden blauen Augen verfügte er über eine Ausstrahlung, der sich selbst schlichte Gemüter wie die der Schankmädchen nicht entziehen konnten.
„Gegen vier Krüge Bier und etwas Herzhaftes zum Beißen hätten wir nichts einzuwenden. Und dann wäre es noch hilfreich, wenn sich jemand um unsere nassen Mäntel kümmern würde.“ Richard von Frankenthal bedachte die beiden Mädchen gleichermaßen mit einem freundlichen Lächeln.
„Alles wird unverzüglich zu Eurer vollsten Zufriedenheit erledigt, mein Herr.“ Die Schankmädchen deuteten einen Knicks an, nahmen die feuchten Mäntel entgegen und entfernten sich kichernd.
„Quod erat demonstrandum!“, verkündete Baron von Arlewatt, kaum hatten die Mädchen den Tisch verlassen.
„Was sollte zu beweisen sein, Benedict?“, wandte sich Richard ein wenig ratlos an seinen Freund.
„Das war doch eben offensichtlich, dass du einen Hang zum niederen Personal hast. Die beiden Elfen konnten deinem Charme doch gar nicht widerstehen“, feixte der Baron.
„Da kann ich unserem Benedict nur zustimmen“, schlug auch Caspar von Löwenstedt in dieselbe Kerbe.
„Ich weiß gar nicht, was ihr habt? Die sind doch beide ganz süß“, versuchte sich Richard zu verteidigen.
„Da bin ich ganz auf Richards Seite. Ich würde der Drallen schon gerne einmal meine Referenzen offenbaren“, verkündete Tolksdorf im Brustton der Überzeugung.
„Es ist mir vollkommen schleierhaft, wieso ich mich stets mit solchen einfältigen Lustmolchen umgebe?“, empörte sich Baron Benedict in gespielter Entrüstung.
„Ich glaube, wir müssen ein wenig Rücksicht auf unseren zartbesaiteten Baron und seiner klösterlichen Erziehung nehmen“, warf Graf Richard lächelnd ein, was ein lautstarkes Prusten bei Oswald Tolksdorf hervorrief.
„Der Baron und klösterliche Erziehung. Das glaube ich doch wohl nicht. Dann aber ganz bestimmt nur im Nonnenkloster.“
Die fröhliche Runde wurde nur von den beiden Schankmädchen unterbrochen, die Bier und einen kräftigen Eintopf servierten.
Die vier Reiter fielen in der ausgelassenen Atmosphäre der Wirtschaft kaum auf. Fuhrleute, Kaufmänner, Forstarbeiter und Bauern bildeten eine bunte Mischung. Dass sich hinter der derben Kleidung Leute von Adel verbergen würden, konnte keiner erahnen. Richard Graf von Frankenthal genoss es immer wieder, sich von seinen familiären und dienstlichen Verpflichtungen abzusetzen. Mit Caspar Graf von Löwenstedt und Baron Benedict von Arlewatt war er bereits lange Jahre befreundet. Auch sie ließen nur zu gern zeitweise ihre adligen Fesseln hinter sich. Um nicht aufzufallen, genügte es, sich einfach zu kleiden und in seinen Handlungen und Worten die Gepflogenheiten eines Edelmannes zu Hause zu lassen. Mit Oswald Tolksdorf hatten sie zudem einen Freund, der ihnen gerne vor Augen führte, wie sich ein Mann aus dem Volke benahm. Diese im ersten Augenblick ungewöhnlich wirkende gesellschaftliche Bindung hatte letztlich einen sehr verständlichen und menschlichen Ursprung.
Da Richard als zweitgeborener Sohn der Gräfin und des Grafen von Frankenthal nicht die Erbfolge seines Vaters antreten konnte, war er bereits in jungen Jahren Soldat geworden und diente gegenwärtig als Hauptmann in einem schwedischen Regiment. Gemeinsam mit dem Sergeanten Oswald Tolksdorf hatte er an verschiedenen Kriegen teilgenommen. Bei einer mörderischen Schlacht nahe Leipzig war Richards Pferd verletzt worden und gestürzt. Die trommelnden Pferdehufe und das gnadenlose Säbelschwingen des Feindes wären Richards sicheres Ende gewesen, wenn nicht Tolksdorf seinen verletzten Hauptmann beherzt ergriffen und ihn auf sein Pferd gezerrt hätte. Richard verdankte dem Sergeanten sein Leben. Ihre Verbundenheit wuchs im Laufe der Jahre aufgrund der weiteren gemeinsamen kriegerischen Erlebnisse bis zu einer aufrichtigen Freundschaft, die auch Richards Freunde anstandslos teilten. Zumal Tolksdorf sich seiner gesellschaftlichen Stellung im Verhältnis zum Adel voll bewusst war. Gleichwohl genoss er die Gemeinschaft mit den drei Söhnen aus adligen Häusern. Auch weil diese bei allen Scherzen über Herkunft und Abstammung ihm stets das Gefühl gaben, uneingeschränkt dazuzugehören.
„Das muss man dieser trostlosen Behausung lassen, Bier und Speisen sind durchaus genießbar.“ Richard lehnte sich zufrieden zurück und streckte die Beine unter den Tisch. „Wenigstens ein Lichtblick in diesen trüben Tagen.“
„Du klingst nur begrenzt beglückt, Richard. Schon bei der Begrüßung heute Morgen hatte ich den Eindruck, dass Tolksdorf und du nicht bester Laune wart.“ Caspar von Löwenstedt sah seinen Freund herausfordernd an.
Richard schüttelte den Kopf. „Ich will uns die Stimmung nicht vermiesen. Es ist der übliche Ärger unter Soldaten ...“
„Du kannst den beiden ruhig verraten, dass unser Regiment ein Scheißhaufen ist und allen voran der General“, unterbrach Tolksdorf seinen Hauptmann.
Caspar und Benedict schienen überrascht zu sein. Das waren Töne, die sie von ihren beiden Freunden noch nie gehört hatten.
„Was soll das heißen? Bisher habt ihr doch begeistert für die Sache gekämpft und den katholischen Kaiserlichen immer wieder Paroli geboten“, wandte Benedict ein.
Richard runzelte die Stirn, nahm einen Schluck Bier und blickte anschließend eine Weile wortlos in den Krug. „Wir wollen uns nicht beklagen und herumjammern, aber Tolksdorf hat recht. Die Zustände im Regiment sind unerträglich.“
„Das wundert mich“, warf Caspar ein. „Woher kommt euer Gesinnungswandel?“
„Mit Gesinnung hat das nichts zu tun“, meldete sich jetzt der Sergeant. „Ich bin nach wie vor gerne Soldat. Aber das was sich gegenwärtig die Herren Offiziere leisten, schreit zum Himmel. Allen voran dieser aufgeblasene General.“
„Tolksdorf meint Generalmajor Wrangel und seine Generalstabsoffiziere“, ergänzte Richard die Bemerkung des Sergeanten. „Ihre Fähigkeiten als Heerführer wollen wir gar nicht kritisieren, aber ihr Umgang mit den Soldaten ist nicht zu akzeptieren.“
„Die Jungs haben seit Monaten keinen Sold bekommen. Einige von ihnen laufen wie die letzten Lumpensammler herum, und wer sich auf die Verpflegung durch die Truppe verlässt, wäre längst verhungert. Es ist einfach zum Kotzen“, ereiferte sich Tolksdorf erneut.
Richard nickte bestätigend. „Unruhe unter den Soldaten gab es schon seit geraumer Zeit, aber seit Wrangel den Oberbefehl hat, rumort es unter den Soldaten immer mehr. In manchen Truppenteilen soll es sogar schon zur Meuterei gekommen sein.“
„Das ist ja auch kein Wunder. Die Herren Offiziere sonnen sich in ihren soldatischen Erfolgen. Wer aber hat die denn erkämpft? Doch nicht die Lackaffen in ihren brockatgeklöppelten Kleidern und bunten Federn am Hut. Der Mann in vorderster Reihe hat seinen Kopf hingehalten. Und wenn er ihm nicht weggeschossen worden ist, kann er doch wohl zumindest auf angemessenen Sold und vernünftige Verpflegung hoffen. Aber nein, die hohen Herren füllen ihre feisten Bäuche mit Wein und Braten in ihren Prachtzelten, während der gemeine Soldat sich Eier beim Bauern klauen muss, um zu überleben.“
Tolksdorf wollte sich nicht beruhigen. Unterbrochen wurde er nur von lautstarkem Gebrüll der Zecher am Nebentisch. Es waren Bauern, die ihre Rinder auf dem Markt verkauft hatten und jetzt ihren Erfolg seit geraumer Zeit begossen, wie eines der Schankmädchen berichtet hatte.
„Was bedeutet denn diese prekäre Lage in der Truppe für euch?“, hakte Benedict nach.
Richard zuckte resignierend mit den Schultern. „Welche Alternativen haben wir? Wir sind Soldaten. Wir gehorchen Befehlen. Wir kümmern uns um unsere Nachgeordneten, so gut es geht. Das schließt nicht aus, dass sie auch von ihren frustrierten Kameraden angesteckt werden und irgendwann anfangen zu meutern.“
„Und was meint ihr, wer von der Generalität dann ganz schnell als Schuldiger ausgemacht wird?“, wollte Tolksdorf wissen, ohne eine Antwort zu erwarten. „Führer der Kompanien und der Schwadronen, die ihre Männer nicht im Griff haben. Also wir. An die eigene versoffene Nase fassen sich diese arroganten Lackaffen doch nicht.“
„Das hört sich alles nicht sehr erfreulich an“, stellte Caspar mit betretener Miene fest. „Da wir die Lage jedoch gegenwärtig nicht ändern können, sollten wir noch eine Runde Bier bestellen.“
Sein Vorschlag wurde begeistert aufgenommen und kurze Zeit später stießen die vier Freunde erneut an. Kaum hatten sie die Krüge wieder abgesetzt, blickten sie fast zeitgleich verwundert auf die Eingangstür der Wirtschaft. Irgendetwas passte hier nicht zueinander. In die graue verschwommene Masse der verschwitzten Leiber im Schankraum war ein Störenfried eingedrungen, der das Auge irritierte. In der Tür standen vier Herren in auffälliger vornehmer Kleidung. Ihre roten Samtmäntel waren von goldenen Bordüren eingefasst. Hellbraune Stulpenstiefel und federgeschmückte breitkrempige Hüte rundeten dieses ungewöhnliche Bild ab. Wobei sich ein jüngerer Mann von ihnen hervortat, da die anderen ihm besonderen Respekt entgegenbrachten. Der Wirt eilte den hohen Herren beflissen entgegen und räumte mit dem Zartgefühl eines Ochsen einen Tisch in einer Nische frei. Einen solchen Besuch hatte seine Kaschemme vorher offensichtlich nicht gesehen.
Richard sah seine Freunde fragend an. „Wisst ihr, wer das ist?“
Alle drei schüttelten die Köpfe.
„Wenn es jemand wissen müsste, wärst du es doch“, spottete Benedict grinsend. „Geht deine Familie nicht in allen berühmten Fürstenhäusern ein und aus?“
„Nur in Schlössern von Königen und Kaisern“, fügte Tolksdorf höhnisch lächelnd hinzu.
„Was habe ich bloß für Freunde? Aber im Ernst. Hat einer von euch eine Erklärung dafür, was diese edlen Herren in eine solche Kaschemme verschlägt?“
Richard warf erneut einen interessierten Blick zum Tisch der ungewöhnlichen Gäste.
Der Wirt und seine beiden Schankmädchen schwirrten um die auffällige Gesellschaft herum wie die Motten ums Licht. Was auch nicht den Zechern und anderen Gästen in der Schankwirtschaft verborgen blieb. Gespräche verstummten und Hälse wurden gereckt. Als nach kurzer Zeit das Stimmengewirr wiedereinsetzte, waren auch einige spöttische Bemerkungen unüberhörbar.
„Ich denke, die gehören auf irgendeine Weise zum herzoglichen Hof in Gottorf“, stellte Caspar mit gesenkter Stimme fest. „Was sie allerdings geritten hat, hier einzukehren, ist schon mehr als verwunderlich. Richard, und du weißt wirklich nicht, wer das sein könnte?“
„Nein. Ich bin nur vor Jahren ein- oder zweimal in Gottorf gewesen. In erster Linie pflegen meine Eltern den Kontakt zur Familie des Herzogs.“
„Wenn wir sie nicht kennen, kennen sie uns ja auch nicht. Also keine Gefahr, dass wir in unserer Verkleidung entdeckt werden“, folgerte Benedict zufrieden.
„Wirt, wo bleibt unser Bier? Oder hast du keine Zeit mehr für das einfache Volk, weil du damit beschäftigt bist, den Hochwohlgeborenen in den Arsch zu kriechen?“ Am Nebentisch war einer der vorher schon lautstarken Zecher aufgestanden. In Sekundenschnelle trat absolute Stille ein.
Bevor der Wirt reagieren konnte, erhob sich einer der vornehmen Herren und wandte sich an den pöbelnden Säufer.
„Es tut uns leid, wenn wir Eure Geselligkeit durch unsere Anwesenheit stören, aber das Wort Gastfreundschaft wird doch sicherlich auch für Euch ein verständlicher Begriff sein. Also mäßigt Euch in Eurer Wortwahl.“
Der aufbrausende Zecher starrte den Edelmann fassungslos an. Es war nicht erkennbar, ob er in seinem umnebelten Hirn die gesprochenen Wörter überhaupt erfasst hatte. Mit seinem erhobenen Bierkrug in der Hand stolperte er auf den Tisch der adligen Gesellschaft zu. Vereinzelte Gäste sprangen ebenfalls von ihren Stühlen auf und beschimpften die Edelleute, die die wütenden Hitzköpfe entgeistert anstarrten. Sie wirkten wie gelähmt.
Vergeblich versuchte der Wirt, die vordringenden Unruhestifter von dem Tisch der Edelleute fernzuhalten. Es gelang ihm trotz seines mächtigen Körpers nicht. Die erregten Zecher schoben ihn kurzerhand zur Seite.
Richard fuhr hoch. „Ich glaube, wir müssen dort wohl einmal korrigierend eingreifen, bevor die edlen Herren unter die Räder geraten.“
Ohne ein weiteres Wort sprangen auch seine Freunde auf und drängten sich durch die erhitzten Leiber. Allen voran Tolksdorf, der mit Ellenbogen und kräftigen Seitenhieben den Weg freimachte.
Der anführende Schreihals war inzwischen bis zu dem Wortführer der Edelleute vorgedrungen. Er packte ihn am Revers und hob seinen Bierkrug. Bevor er zuschlagen konnte, fiel ihm Tolksdorf in den Arm. Gleichzeitig verpasste er dem Zecher einen brutalen Faustschlag mitten ins Gesicht. Der torkelte nach hinten und krachte wie eine gefällte Eiche zwischen die Stühle zu Boden. Auch Richard, Caspar und Benedict hatten sich derweil zwischen die Raufbrüder und die adligen Gäste gedrängt. Diese wussten gar nicht, wie ihnen geschah. Verschüchtert versuchten sie, den Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen, in dem sie sich verzweifelt in die Nische zurückzogen.
Die vier Freunde hatten einige Mühe die aufgebrachte Menge mit gezielten Schlägen unter Kontrolle zu halten. Der eine oder andere Angreifer krümmte sich bereits auf dem Boden.
„Rapier!“ Richards lauter Befehl führte in Sekunden zu einer veränderten Lage. Mit blankem Entsetzen wichen die Randalierer zurück, als die vier Verteidiger ihre Degen zogen und gegen sie richteten.
„Noch einen Schritt weiter und es gibt Tote“, verkündete Richard laut. Anschließend wandte er sich an die Edelleute. „Ich schlage vor, verehrte Herren, Ihr verlasst jetzt diese wenig gastliche Stätte. Wir werden Euch nach draußen begleiten.“
„Wir sind Euch zu übergebührendem Dank verpflichtet“, wandte sich der Wortführer der Edelleute an Richard, kaum hatten sie das Wirtshaus verlassen. Seine drei Begleiter stiegen bereits eilig in die wartende Kutsche. „Wem haben wir diese heldenhafte Tat zu verdanken?“
„Ich glaube, entscheidend ist, dass Ihr unbeschadet Euren Weg fortsetzen könnt. Vielleicht solltet Ihr in Zukunft diesen Ort meiden. Denn nicht immer ist eine schützende Hand garantiert.“
Bevor der Angesprochene reagieren konnte, drehte sich Richard um und folgte seinen drei Freunden, die bereits vor dem Stallgebäude auf ihn warteten.
„Junge. Marsch! Marsch! Sattle unsere Pferde“, pfiff Tolksdorf den Stallburschen an.
Richard klopfte seinem Sergeanten auf die Schulter. „Du hast recht, Tolksdorf, wir sollten so schnell wie möglich verschwinden, bevor die Saufbrüder bewusst registrieren, was eben passiert ist.“
Da die vier beherzt mit anfassten, waren die Pferde in kurzer Zeit gesattelt. Richard rief den Stalljungen zu sich. „Hör zu, Junge! Du gehst jetzt ohne großes Aufsehen zum Wirt, holst unsere Mäntel und bezahlst unsere Zeche. Und das Ganze im Geschwindschritt.“ Dabei drückte er dem Jungen einige Münzen in die Hand, der sich sofort umdrehte und eilig verschwand.
Es dauerte keine drei Minuten, als er wieder mit den Mänteln über dem Arm zurückkehrte. Die Männer warfen sich ihre Mäntel über. Richard drückte dem Jungen eine Münze in die Hand und schwang sich auf sein Pferd. Dann zögerte er. „Junge, weißt du, warum die edlen Gäste hier angehalten haben?“
„Der Kutscher hatte Probleme mit dem Zaumzeug. Da war irgendetwas gebrochen und musste gerichtet werden.“
„Und weißt du auch, wer die Leute waren?“ wollte Tolksdorf jetzt wissen.
Der Stalljunge nickte aufgeregt. „Habt Ihr denn das herzogliche Wappen auf der Kutsche nicht gesehen? Das war Christian Albrecht, der Sohn vom Herzog.“
Kapitel 2
Es zogen dunkle Wolken über die Dächer des Schlosses in Gottorf. Es lag nicht allein an den bedrohlichen Gebilden am Himmel. Auch innerhalb des Hauses des Herzogs von Schleswig-Holstein-Gottorf braute sich etwas zusammen. Ein Zustand, den man nicht als ungewöhnlich bezeichnen konnte. Es gab kaum einen Tag, in dem nicht die unterschiedlichen Auffassungen über ein entscheidendes Thema aufeinanderprallten. Wieder einmal ging es ums Geld.
Herzog Friedrich ging in seinem Kabinett unruhig auf und ab. „Ihr wollt Uns doch nicht ernsthaft glauben machen, Kielman, dass die herzogliche Kasse eine Erweiterung Unserer Gärten nicht erlaubt? Das ist doch vollkommener Unsinn.“
„Vergebt mir, Hoheit, aber die Summen, die Euer Hofgärtner Clodius dafür verlangt, stehen in keinem Verhältnis zu notwendigen Ausgaben.“
Johann Adolph Kielman von Kielmannseck stand schon einige Jahre in den Diensten von Friedrich III. von Schleswig-Holstein-Gottorf. Die Fähigkeiten als Diplomat wollte der Herzog seinem Hofkanzler nicht absprechen. Das hatte er in der Vergangenheit häufig genug bewiesen. Seine ständigen Einwände wegen der Finanzen behagten dem Herzog hingegen in keiner Weise. Wie sollte ein Herrscher seinen Hof repräsentativ gestalten, wie geistige Größen einladen und fördern und wie den fortschrittlichen Wissenschaften dienen, wenn ständig ein penetranter Pfennigfuchser versuchte, großartige Pläne und Ideen im Keime zu ersticken? Kielman war einfach nur lästig.
„Wollt Ihr ernsthaft Unsere Pläne für die Gestaltung Unseres neuen Gartens infrage stellen?“ Der Herzog hatte seine Schritte unterbrochen und war unmittelbar vor seinem Hofkanzler stehengeblieben. Seine Augen verwandelten sich in schmale Schlitze, als er die Person vor sich kritisch musterte. „Uns ist zu Ohren gekommen, dass Ihr entgegen Unserer Weisungen die Erweiterung Unserer Bibliothek behindert, indem Ihr dem Hofbibliothekar Olearius die entsprechenden Gelder zum Ankauf neuer Bücher verweigert habt. Ich hoffe nur in Eurem eigenen Interesse, dass Wir in dieser Angelegenheit irrtümlich falsch informiert worden sind.“
Der Hofkanzler hielt den musternden Blicken des Herzogs stand. „Erlaubt mir, Hoheit, untertänigst darauf hinzuweisen, dass Ihr mir in meiner Eigenschaft als Hofkanzler auch die Obliegenheiten der herzoglichen Finanzverwaltung übertragen habt ...“
„Wollt Ihr Uns ernsthaft suggerieren, dass Wir selbst daran schuld sind, dass Wir es mit einer Krämerseele als Hofkanzler zu tun haben?“, unterbrach der Herzog mit erhobener Stimme seinen Hofkanzler. „Kielman, Ihr überschreitet Eure Kompetenzen. Die herzoglichen Weisungen sind für Euch gleichermaßen bindend wie für alle Untertanen. Euer ständiges Gejammer über die vermeintlich leere Staatskasse ist Uns vollkommen unverständlich. Durch Erbschaften sind erst kürzlich bedeutende Ämter hinzugekommen, die regelmäßig Einkünfte abwerfen. Auch das Amt Barmstedt haben Wir sehr gewinnbringend an Graf Rantzau veräußern können. Wieso wollt Ihr Uns daher weismachen, dass die herzogliche Kasse leer ist?“
„Hoheit, ich komme nur meiner Pflicht nach. Mir bleibt nichts anderes übrig, als Einnahmen und Ausgaben gegenüberzustellen. Danach ist die Diskrepanz zwischen diesen beiden Positionen unübersehbar. Die Ausgaben überschreiten die Einnahmen um ein Vielfaches. Daher sehe ich es als meine Pflicht an ...“
Herzog Friedrich winkte mit der Hand ab, als wollte er eine lästige Fliege verscheuchen und drehte sich um. „Kielman, Ihr ermüdet Uns. Jeder an diesem Hof erfüllt seine Pflicht auf seine Weise. Eure vermeintliche Pflichterfüllung, auf die Ihr so gesteigerten Wert legt, scheint in Unseren Augen gegenwärtig äußerst beschränkt zu sein. Seht zu, dass Ihr Euren Pflichten nachkommt. Ihr seid doch sonst so erfindungsreich. Dann wird es Euch sicherlich auch keine Mühe machen, herauszufinden, in welchen undurchsichtigen Sümpfen Unsere Gelder versunken sind und auf welche Weise man neue Einkünfte akquirieren kann. Ihr könnt jetzt gehen.“
Die Mimik des Hofkanzlers verriet eindeutig seine Missstimmung. Seine pessimistisch wirkenden Mundwinkel bogen sich noch mehr nach unten. Wie es schien, rang er mit sich selbst, ob er den erregten Worten des Herzogs noch etwas entgegnen sollte. Nach kurzem Zögern entschied er sich dagegen, verbeugte sich dezent und zog sich zurück.
Herzog Friedrich war ungehalten. Diese wiederkehrenden unerfreulichen Gespräche mit dem Hofkanzler verärgerten ihn stets aufs Neue. Hatte er Kielman in der Vergangenheit zu viel Spielraum eingeräumt und zu viele Kompetenzen zugestanden? In erster Linie ärgerten den Herzog die unerträglichen Diskussionen über die Finanzen. Das staatspolitische Geschick seines Hofkanzlers stand außer Frage. Nicht nur einmal hatte er es verstanden, durch ausgefeilte Diplomatie zu verhindern, dass das kleine Herzogtum zwischen die Mühlenräder der großen Mächte geraten konnte. Erst kürzlich war es ihm gelungen, die Hochzeit zwischen dem schwedischen König Karl Gustav und der geliebten Tochter Prinzessin Hedwig Eleonora zu arrangieren. Auch wenn das zur erheblichen Unruhe am dänischen Königshof geführt hatte, so hielt Herzog Friedrich diese Entscheidung für durchaus friedensstiftend. Doch auch dieser Gedanke konnte seine gegenwärtige schlechte Laune nicht dämpfen. Energischen Schrittes verließ er sein Kabinett und die Audienzräume.
Die Hofdamen schreckten verwundert auf, als der Herzog so unvermutet und ohne Ankündigung die Räume der Herzogin betrat. Auch Maria Elisabeth sah ihren Gatten irritiert an. Sehr schnell erfasste sie seine gegenwärtige Stimmung und deutete mit einer leichten Handbewegung gegenüber ihren Hofdamen an, dass sie allein gelassen werden wollten.
Die Herzogin sah ihren Gemahl besorgt an. „Ihr scheint erregt zu sein, wenn ich Eure Miene richtig deuten sollte.“
„Ihr vermutet richtig, Verehrteste. Dieser Kielman bringt Uns noch um den Verstand.“ Auch hier in den Räumen der Herzogin wanderte der Herzog unaufhaltsam auf und ab.
Die Herzogin runzelte die Stirn. „Ich muss mich nicht wiederholen, Ihr wisst genau, was ich von Eurem Hofkanzler halte. Er ist nichts anderes als ein Emporkömmling von niederer Herkunft, der sich jetzt in Eurem Schatten aufplustert wie ein Pfau. Erinnert Euch, Friedrich, aus welchem Stall er kommt? Der Sohn eines Klosterhofmeisters. Und nur eine dubiose familiäre Verknüpfung und eine kaum nachvollziehbare Erhebung in den Grafenstand hat ihn nach oben gespült.“
„Ja, ja, das wissen Wir doch alles.“ Der Herzog reagierte unwirsch und fuchtelte abweisend mit den Händen herum. „Es ist ja nicht das erste Mal, dass Ihr mir diese Entscheidung, dass Wir ihn zum Hofkanzler gemacht haben, vorwerft. Aber er ist nun einmal ein geschickter Diplomat. Und Ihr wart doch die Letzte, die gegen eine Verbindung unserer Tochter mit dem schwedischen König opponiert habt.“
Die Herzogin schüttelte den Kopf. „Ich weiß. Und was hat Euch heute gegen Euren so hochgelobten Hofkanzler aufgebracht?“
Herzog Friedrich unterbrach seine unruhigen Schritte und setzte sich seiner Gemahlin gegenüber in einen Sessel. „Er behauptet, Wir hätten in der herzoglichen Kasse kein Geld für die Gestaltung des neuen Gartens. Zudem hat er Olearius entgegen Unserer Weisung den Kauf von Büchern untersagt. Eine Impertinenz sondergleichen.“
„Friedrich, Ihr müsst ihn in seine Schranken weisen. Mir wurde zugetragen, dass er auch die Gelder für unsere Söhne während ihrer Grand Tour verweigert haben soll. Wisst Ihr davon?“
Der Herzog erhob erschrocken seinen Kopf und starrte die Herzogin ungläubig an. Prinz Friedrich und Prinz Johann Georg befanden sich seit einiger Zeit auf jener Kavalierstour, die für Söhne aus hohen Fürstenhäusern üblich war. Gemeinsam mit ihrem Reisehofmeister Graf von Leberecht und einem kleinen Gefolge bereisten sie mehrere Länder und verweilten an unterschiedlichen fürstlichen Höfen. Diese Bildungstouren unterlagen in der Regel einem strengen Ritual. Sie dienten dazu, die Horizonte der Prinzen zu erweitern, fremde Sprachen zu erlernen, sich im Fechten und Tanzen zu üben, gleichwohl aber auch die Gepflogenheiten und gesellschaftlichen Formen an einem hochherrschaftlichen Hof zu erfahren. Die Aufgabe des Reisehofmeisters lag darin, dass Lernen der Prinzen zu überwachen, die eigentliche Reise zu organisieren und den Herzog regelmäßig per Depesche über das Wohlergehen seiner Söhne zu informieren.
„Was sagt Ihr da? In seiner letzten Nachricht hat von Leberecht davon nichts erwähnt ..."
„Wann habt Ihr denn eine Depesche bekommen?“, unterbrach die Herzogin ihren Gatten. „Ich habe so lange schon nichts mehr von unseren Söhnen gehört. Sind sie schon in Paris angekommen? Diese Ungewissheit besorgt mich ungemein. Könnt Ihr nicht von Leberecht anweisen, sich öfter zu melden. Sie fehlen mir doch sehr. Alle meine Kinder verlassen mich. Nun ist auch meine liebe Hedwig Eleonora nach Stockholm entschwunden. Und von Christian Albrecht höre ich unaufhörlich nur wenig erfreuliche Nachrichten.“
„Maria Elisabeth, ich bitte Euch eindringlich, hört auf mit diesem Gejammer. Wir haben wahrhaftig andere Sorgen, als Uns um das Wohlergehen unserer erwachsenen Kinder zu kümmern. Sie sind alt genug. Es reicht Uns vollkommen, wenn dieser lästige Hofkanzler Uns um schlaflose Nächte bringt. Und was ist mit Christian Albrecht?“
Die Herzogin schlug die Augen nieder. „Er macht mir einfach nur Sorgen. Er führt ein so unbekümmertes Leben. Ohne Halt, ohne Würde. Stellt Euch vor, erst kürzlich soll er in eine Rauferei geraten sein.“
„Und was erwartet Ihr jetzt von Uns? Sollen Wir ihn einsperren? Sollen Wir ihn ins Kloster schicken? Oder wäre es Euch lieber, wenn er als Soldat in den Krieg zieht?“
Herzogin Maria Elisabeth war den Tränen nahe. Sie griff zu einem bestickten Taschentuch und betupfte sich die Nase.
„Ihr versteht einfach nicht die Unruhe einer besorgten Mutter. Das Wohl Eurer Kinder muss doch auch Euch am Herzen liegen.“
Herzog Friedrich erhob sich abrupt. „Da könnt Ihr ganz sicher sein, Uns liegt das Wohl und Ansehen Unseres Herzogtums weitaus mehr am Herzen, als ihr vermutet. Das Haus Schleswig-Holstein-Gottorf ist gut bestellt. Die Förderung der Künste, der Neubau der Gärten und die Erweiterungen Unserer Kunstsammlung und Bibliothek sorgen dafür, den hervorragenden Ruf Unseres Herzogtums in alle Länder zu tragen, was nicht zuletzt auch Unseren Nachkommen und deren Erben zu Gute kommt.“
Herzog Friedrich deutete eine leichte Verbeugung an und verließ ohne ein weiteres Wort die Gemächer der Herzogin.
Kapitel 3
Während in den Gemächern des Herzogs und der Herzogin sich stimmungsmäßig Gewitterwolken zusammenbrauten, schien wenige Flure weiter im Gottorfer Schloss strahlender Sonnenschein die Räumlichkeiten zu erhellen. Musik erklang und es wurde gesungen und gelacht. Obwohl erst die frühen Abendstunden angebrochen waren, herrschte im Nordwestflügel ein ausgelassener Trubel.
„Durchlaucht, Ihr müsst uns unbedingt noch einmal von der jungen Gemahlin Eures Onkels in Eutin erzählen“, flehte Christina von Ansbach Prinz Christian Albrecht an. Begeisterte Ausrufe und Klatschen bestätigten den Wunsch der jungen Gräfin. Mehrere Hofdamen und Höflinge waren bereitwillig der Aufforderung zum fröhlichen Zeitvertreib des jungen Prinzen gefolgt. Wohl wissend, dass es ein vergnüglicher Abend werden würde. Allein schon dadurch, dass kulinarische Köstlichkeiten und edle Tropfen serviert wurden, denen man uneingeschränkt zusprechen konnte.
„Gräfin, Euer Wunsch soll mir Befehl sein“, antwortete der Prinz mit einem verschmitzten Lächeln. „Doch welche Belohnung habe ich von Euch zu erwarten, wenn ich Euch diesen Wunsch erfülle?“
Es schien, als ob die junge Gräfin von Ansbach erröten würde. „Durchlaucht, welchen Wunsch könnte eine Person mit ihren begrenzten Möglichkeiten wie meine Wenigkeit Euch erfüllen, wo Euch doch die Welt zu Füßen liegt?“
„Oh, verehrte Gräfin, wenn ich das Füllhorn meiner Träume über Euch ausschütten würde, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass allein schon der Gedanke an die Erfüllung des einen oder anderen Wunsches bei Euch zu einem freudigen Entzücken führen könnte.“
Durch die Schar der Hofdamen und Höflinge ging ein Raunen und Kichern, was die Verlegenheit der Gräfin noch erhöhte.
„Gräfin, ihr steht tief in unserer Schuld“, schaltete sich Graf von Perleberg zur Belustigung aller ein. „Wir sind unendlich gespannt auf die Erzählung seiner Durchlaucht. Doch nur die fehlende Beglückung durch Euch hält uns fern von diesem Hochgenuss. Ein Kuss wäre das Mindeste, was nicht nur das Herz seiner Durchlaucht erfreuen, sondern uns alle dem wahren Ziele nahebringen würde.“
Die Wangen der jungen Gräfin erglühten förmlich. Zumal der Vorschlag des Grafen auf ungeteilten Zuspruch und Beifall fiel.
„Perleberg, Ihr versteht es immer wieder, aus misslichen Situationen das Beste zu machen. Nach reiflicher Überlegung könnte ich Eurer Empfehlung durchaus einen gewissen Reiz abgewinnen.“ Prinz Christian Albrecht sah die Gräfin auffordernd an. Wie ein aufgescheuchtes Reh schwebte sie dem Prinzen entgegen, hauchte ihm einen Kuss auf die Wange, vollführte einen Hofknicks und zog sich eilig in die Reihe der Hofdamen zurück. Ein wohlwollendes Nicken des Prinzen, anerkennende Laute und euphorische Begeisterung waren die Folge.
Prinz Christian Albrecht ergriff einen Sektpokal, den ihm ein Lakai auf einem Tablett serviert hatte, und erhob ihn.
„Lasst uns zunächst auf das hohe Eheglück meines verehrten Onkels Johann trinken. Möge er diesen Schritt nie bereuen, sein Glück mit seiner Gemahlin Julia Felicitas finden und viele Nachkommen zeugen.“
Beifälliges Stimmengewirr begleitete den wohlwollenden Trinkspruch.
„Wie Ihr alle wisst, bekleidet der Bruder meines Vaters, Herzog Johann, seit einigen Jahren das angesehene Amt des Fürstbischofs von Lübeck. Er hat es vorgezogen, die Behaglichkeit unserer bescheidenen Behausung in Gottorf zu ignorieren, und in das prachtvolle Schloss in Eutin zu ziehen.“
Die letzte Bemerkung des Prinzen wurde mit einem hämischen Gelächter bedacht. Allen Anwesenden war bekannt, dass das herrschaftliche Gemäuer in Eutin sehr begrenzt war und einem Vergleich mit Gottorf nicht standhielt.
„Inzwischen ist meinem geliebten Onkel eine weitere Ehre angetragen worden“, fuhr der Prinz mit süffisantem Unterton fort. „Das Eutiner Volk hat ihm einen ganz intimen Titel verliehen. Sie rufen ihn seit neuestem 'Bischof Hans'.“
Die Verwunderung und teilweise auch helles Entsetzen der Hofgesellschaft waren unübersehbar. Was hatte das zu bedeuten? Liefen solche Vertrautheiten nicht auf Kumpanei zwischen Herrschaften und einfachem Bürgertum hinaus? Oder wollte sich der Fürstbischof in Eutin sogar dem einfachen Volke anbiedern. Unvorstellbar. Erste erregte Stimmen wurden laut.
Prinz Christian Albrecht hob beschwichtigend die Hände. „Bewahrt Contenance. Mein geschätzter Onkel hat diesen Namen aus einem ganz besonderen Grund erhalten. Die Bürger Eutins verehren ihn, da er ein äußerst fürsorglicher Bischof ist. Nicht nur, dass sie es ihm hoch anrechnen, dass er in Eutin residiert, das Schloss renovieren und einen Schlosspark anlegen ließ, er hat auch kürzlich eine aufwendig geschnitzte Kanzel für das Eutiner Gotteshaus gestiftet.“
Aufgeregt tuschelten die Hofdamen. „Und wie ist die neue Ehefrau Eures Onkels?“
Prinz Christian Albrecht schmunzelte. „Ich habe sie selber noch nicht gesehen. Man sagt, sie sei eine Schönheit. Ihr Liebreiz hingegen soll Grenzen haben. Wie mir versichert wurde, soll sie die Schatztruhe des Bischofs bereits stark bemüht haben.“
„Erlaubt mir, Durchlaucht, dass ich Eure Erkenntnisse ein wenig ergänze“, erhob Graf von Perleberg mit bedeutender Miene erneut das Wort. Er gehörte seit geraumer Zeit zum Gefolge des Prinzen. Ein hagerer aufrechter Aristokrat, der sich selber als Berater empfand. Der Prinz duldete ihn in seiner Nähe, da er offensichtlich über weitreichende und nützliche Verbindungen und Quellen verfügte. Großzügig sah er zudem über die Leidenschaft des Grafen hinweg, sich stets auffällig und farbenfroh zu kleiden.
Prinz Christian Albrecht stutzte. „Perleberg, woher nehmt Ihr eigentlich immer Eure vertrauten Botschaften. Gibt es da einen Vogel, der Euch die Geheimnisse ins Ohr zwitschert oder einen anderen Boten, der Euren Geist beflügelt?“
Ein helles Gelächter erschallte in den Räumen des Schlosses. Graf Perleberg hielt den amüsanten Einwand des Prinzen dagegen nicht für erheiternd.
„Das Wissen eines Vertrauten in Eurer Nähe, Durchlaucht, kann nicht groß genug sein, will man Euch stets auf gebührende Weise zu Diensten sein.“ Dabei sah der Graf sich bedeutungsvoll um, als wollte er der Hofgesellschaft mitteilen, dass auch sie sich an ihm ein Beispiel nehmen könnte.
„Perleberg, schwadroniert nicht viel herum, sondern lasst uns an Eurem unerschöpflichen Wissen teilhaben“, unterbrach der Prinz den Grafen, da er von ihm noch weitere vollmundige Erklärungen befürchtete.
Graf Perleberg zögerte nur kurz. „Wie Ihr schon erwähntet, Durchlaucht, liebt Herzogin Julia Felicitas auf auffällige Weise wertvollen Schmuck und teure Kleider. Dabei soll das Brautgeld von ihrem Vater, dem Herzog von Württemberg-Weiltingen, in Höhe von 20.000 Gulden auch noch nicht entrichtet worden sein.“
„Ihr seid fürwahr gut im Bilde, mein lieber Perleberg. Wir werden sehen, ob die Entscheidung meines verehrten Onkels sich als richtig erwiesen hat. Allerdings, wenn ich die Worte des weisen Dichters Partenius bedenke, könnten mir Zweifel kommen. Denn er sagt: Dem lockend Werben der Sirenen folgt der Manne ihrem Ruf. Sich im siebten Himmel wähnend, endet meistens er im Suff.“
Die Hofgesellschaft geriet vollkommen außer Rand und Band. Ihr ungehemmtes und ausgelassenes Gelächter schwebte durch die Räume des Schlosses. Der Prinz genoss die Huldigungen und Lobgesänge seiner Hofdamen und Höflinge. Ein Ansporn für ihn, sie stets mit Tänzen, Maskeraden, Theateraufführungen, Ballett sowie Reiter- und Federballspielen zu unterhalten. Nicht alle Bewohner des Schlosses in Gottorf teilten die Begeisterung für dieses ungezügelte Treiben. An diesem Tag sollte es jedoch auf tragische Weise ein unerwartetes und abruptes Ende finden.
Prinz Christian Albrecht folgte soeben dem übermütigen Vorschlag seiner Hofdamen und ließ bereits zum Tanz aufspielen, als ein störendes Übel die überschwängliche Hofgesellschaft in ihrer Ausgelassenheit unerwartet bremste.
In der Tür des Tanzsaals stand eine Person im schwarzen Gewand. Sie verfolgte mit griesgrämigem Gesicht, aus dem abgrundtiefe Abscheu sprang, dass unbekümmerte Treiben. Erst als mehr und mehr Hofdamen und Höflinge sich diesem unwillkommenen Eindringling zuwandten und die Musik mit einem Missklang endete, wurde auch der Prinz auf diese Störung aufmerksam. Stirnrunzelnd ging er auf die Person zu. Wenige Meter vor ihr blieb er stehen und musterte den Kirchenmann abfällig von oben bis unten. „Habt Ihr Euch verirrt, Dekan, oder wie soll ich Eure Anwesenheit deuten?“
Prinz Christian Albrecht mochte diesen Mann nicht. Ohnehin hatte er ein ambivalentes Verhältnis zu den „Schwarzkitteln“, wie er die Geistlichkeit sehr gerne titulierte.
„Seine Hoheit, der Herzog, bat mich, Eure Durchlaucht aufzusuchen und Euch darüber zu informieren, dass seine Hoheit Euch unverzüglich zu sehen wünscht.“
Prinz Christian Albrecht holte tief Luft. „Dekan, ich glaube Ihr habt Euren Kopf zu häufig und zu lange in die Bibel gesteckt, dass Euch neben der geistlichen Erleuchtung die weltliche verloren gegangen ist. Ein Herzog bittet keinen einfachen Kirchenmann um einen Dienst. Er weist ihn an oder befiehlt ihm einen Auftrag. Ich hoffe, dass Euch dieser kleine aber doch bedeutende Unterschied bewusst ist. Und welchen Grund gibt es nun dafür, dass Ihr stört und der Herzog mich sehen möchte?“
Dekan Augustinus von Melsungen missbilligender Gesichtsausdruck änderte sich nicht. „Es liegt nicht in meinen Befugnissen, den Grund seiner Hoheit zu erläutern. Ich bin lediglich der Überbringer dieser Nachricht. Welcher Pflicht ich hiermit nachgekommen bin. Ich empfehle mich.“
Der Dekan wandte sich um, ohne auf eine Reaktion des Prinzen zu warten. Ein Affront, den selbst einige Hofdamen und Höflinge nicht kommentarlos übergingen.
„Erscheint es nicht irgendwie ungewöhnlich, Durchlaucht, dass der Dekan sich zu einem Botengang herablässt?“ Graf von Perleberg war an die Seite des Prinzen getreten und sah dem Kirchenmann gleichermaßen verwundert hinterher.
„Ihr habt recht, Perleberg, diesen Dienst hätte jeder geringste Lakai erfüllen können. Ich werde wohl dem Ruf meines Vaters umgehend folgen. Sorgt dafür, Perleberg, dass die fröhliche Stimmung erhalten bleibt, bis ich wiederkehre.“
Als Prinz Christian Albrecht die Gemächer des Herzogs betrat, wunderte er sich über die absolute Stille, die hier herrschte. Gewöhnlich zeichneten sich diese Räumlichkeiten durch die Anwesenheit zahlreicher Personen aus, die in der Regel eine betriebsame Hektik verbreiteten.
Betroffen blieb der Prinz stehen, als er das Kabinett des Herzogs betrat. Sein Vater thronte nicht wie sonst üblich hinter seinem Schreibtisch, sondern saß vornüber gebeugt in einem Sessel und stützte seinen Kopf in beide Hände. Wenige Schritte neben ihm standen sein Kammerherr Graf von Saalfeld und der Hofkanzler Graf Kielman. Beide starrten den Herzog todernst mit undurchdringlichen Mienen an.
Nur bedächtig hob der Herzog den Kopf, als er seinen Sohn eintreten hörte. Mit Entsetzen sah der Prinz, dass sein Vater Tränen in den Augen hatte. Er konnte sich nicht erinnern, den Herzog je zuvor in einem so derangierten Zustand gesehen zu haben. Mit wenigen Schritten war der Prinz bei ihm und kniete sich vor dem Herzog nieder. „Was ist geschehen, Vater, dass Euch derart eschauffieren konnte?“
Der Herzog legte seinem Sohn die rechte Hand auf die Schulter. „Wir haben soeben erfahren, dass dein Bruder Friedrich in Paris verstorben ist.“
Der Herzog senkte erneut den Kopf. Seine Schultern zuckten. Prinz Christian Albrecht sah seinen Vater ungläubig an. Nur langsam drang die grausame Nachricht zu ihm durch. Friedrich. Der Erbprinz. Tot. Langsam erhob der Prinz sich und ging auf den Hofkanzler zu. Der wies wortlos auf eine Depesche, die auf dem Schreibtisch lag. Christian Albrecht ergriff das Papier und las es.
Der Reisehofmeister Graf von Leberecht teilte lediglich in wenigen Worten mit, dass ein Fieber in Paris gewütet hätte und Erbprinz Friedrich diesem erlegen wäre. Am Ende der Depesche kündigte er einen Bericht für die nächsten Tage an. Der Prinz legte das Papier wieder zurück. Erneut wandte er sich an den Hofkanzler. „Weiß die Herzogin schon von dieser schrecklichen Nachricht?“
Hofkanzler Kielman nickte. „Der Hofdekan hat seiner Hoheit die erschütternde Botschaft überbracht und weilt auch jetzt gemeinsam mit dem Hofkaplan bei ihr.“
Kapitel 4
Der Ausflug in den Garten bedeutete für Agnes einen Höhepunkt in ihrem sonst arbeitsreichen Alltag in der herzoglichen Schlossküche. Das Leben als Küchenmädchen war kein Zuckerschlecken. Es gab kaum eine Stunde, in der sie nicht gefordert wurde. Rüben mussten geputzt und Hühner gerupft werden. Am wenigsten hatte sie Freude am Schrubben von Töpfen und Pfannen. Nicht selten fiel sie spät am Abend völlig erschöpft in ihr Bett, um nach wenigen Stunden Schlaf am frühen Morgen wieder geweckt zu werden. Umso mehr freute sie sich darüber, wenn die erste Köchin Berta, die alle nur Mamsell nannten, Agnes und ihre Freundin Trine beauftragte, neue Kräuter aus dem Garten zu holen. Wie auch an diesem Morgen.
„Agnes, hast du dir es gemerkt, was ich dir gesagt habe?“ Berta, die Köchin, stand vor den beiden Küchenmädchen mit beiden Händen in die ausladenden Hüften gestemmt. „Noch einmal. Ich brauche reichlich Petersilie. Dazu Basilikum, Thymian, Dill und Kerbel.“
Agnes nickte eifrig. „Jawohl, Mamsell, das habe ich verstanden.“
„Es ist gut. Und du, Trine, passt auf, dass nur frische Kräuter geschnitten werden und der Gärtner uns nicht wieder verwelkte Blätter abschneidet. So, und nun los ihr beiden. Und trödelt nicht wieder so lange herum. Außerdem wartet Jakob schon mit der Karre vor der Küchentür.“
Als Agnes und Trine auf den Hofplatz vor der Küche traten, strahlte sie Jakob an. Der Junge war ungefähr fünfzehn Jahre alt. Von kräftiger Statur, aber seine eng zusammenstehenden Augen und sein einfältiger Gesichtsausdruck verrieten seinen beschränkten Geisteszustand. Agnes wusste nicht, wieso man Jakob am herzoglichen Hof duldete. Da hier sehr genau darauf geachtet wurde, dass alles seine Ordnung hatte. Von irgendjemandem hatte sie gehört, dass der Junge möglicherweise der Sohn eines höhergestellten Bediensteten sein könnte. Auch wer seine Mutter war, wollte niemand verraten. Auf jeden Fall hatte die Köchin Berta den Jungen unter ihre Fittiche genommen. Agnes mochte Jakob. Er war eine treue Seele. Die meisten am Hofe nahmen den Idioten nicht ernst. Sie belachten ihn oder trieben sogar üble Scherze mit ihm. Nicht so Agnes. Anfangs war sie der Auffassung, wie alle anderen auch, dass Jakob taub und stumm wäre. Doch sehr bald stellte sie fest, dass, wenn sie ihn ansah und direkt mit ihm sprach, er sie sehr wohl verstand und auch folgerichtig reagierte. Durch Zufall bekam sie wenig später mit, dass er auch sprechen konnte. Er hatte ein junges Kätzchen gefunden. Er hielt es und streichelte es in seinen großen Händen. Dabei sprach er sehr liebevoll mit dem jungen Tier, auch wenn Agnes nur wenige Worte verstehen konnte.
Kichernd verließen Agnes und Trine das Torhaus, das die Schlossanlage gen Süden abschloss, als die Wachsoldaten ihnen neckende Wörter hinterherriefen. Jakob kommentierte die Avancen der Soldaten mit einem grimmigen Brummen. Agnes genoss den Ausflug in den alten Garten, der außerhalb der Schlossinsel lag. Immer wieder blieb sie unter den Alleebäumen stehen, die die Promenade säumten, und sah sich neugierig um. Fasziniert beobachtete sie das geschäftige Treiben auf der Halbinsel zur Schlei, wo unzählige Arbeiter und Gärtner dabei waren, Erdwälle zu schaufeln, Bäume und Sträucher zu pflanzen. Auch Trine hielt an und betrachtete verwundert die eifrigen Arbeiten. „Was machen die da, Agnes? Weißt du das?“
„Ich habe gehört, es sollen überall neue Gärten entstehen. Der Herzog möchte sogar einen Irrgarten haben, hat mir Hildegard, die Zofe der Herzogin, erzählt.“
Trine blickte ihre Freundin verwirrt an. „Was ist denn ein Irrgarten?“ Verlegen drehte sie sich zu Jakob um. Der war aber genauso wie die beiden Küchenmädchen von den Gartenbauarbeiten fasziniert.
Agnes musste lachen. „Nein, Trine, nicht was du denkst. Das ist ein Garten mit hohen Hecken durch die ganz viele Wege führen, in denen man sich verirren kann.“
„Und wenn einer nicht wieder herausfindet?“, fragte Trine besorgt.
„Dann irrt er bis an sein Lebensende im Irrgarten herum. Es sei denn, es erscheint eine gute Fee und weist ihm den Weg“, antwortete Agnes lachend. „Aber jetzt müssen wir uns beeilen, sonst meckert die dicke Berta wieder.“
„Agnes, du bist gemein. Aber heute Abend musst du mir noch mehr über diesen Irrgarten erzählen.“
„Welch ein angenehmer Besuch. Mein Garten strahlt bereits in üppiger Blütenpracht, aber durch euch erhält er ein ganz besonderes liebreizendes Leuchten“, begrüßte der alte Gärtnermeister die Küchenmädchen freundlich.
Agnes lachte und Trine errötete. „Meister Engelbrecht, Ihr macht uns ganz verlegen. Wir sind doch keine Hofdamen.“
Der alte Gärtner schmunzelte. „Glaube mir, liebe Trine, ich habe in meinem Leben schon so viele junge Blüten gesehen und ich weiß genau, aus welchen eine prachtvolle Schönheit erwächst. Aber ich nehme an, ihr seid nicht nur zu mir gekommen, um euch Komplimente eines alten Gärtners anzuhören.“
„Ihr habt recht, lieber Onkel, Berta schickt uns. Wir benötigen wieder verschiedene Kräuter in der Küche.“
„Das habe ich mir schon gedacht. Trine, geh doch schon mal mit Jakob nach hinten zum Gartenhaus. Da triffst du auch Konrad, meinen Gehilfen, an. Der soll euch schon einmal das gewünschte Kraut aussuchen und schneiden.“
Trine wirkte im ersten Augenblick verwundert, winkte dann aber Jakob zu und folgte dem Wunsch des Gärtners.
Auch Agnes war ein wenig irritiert und sah den Gärtnermeister beunruhigt an. „Gibt es einen bestimmten Grund, Onkel, dass Ihr mich alleine sprechen wollt?“
„Nein, nein, mein Kind, keine Angst. Ich möchte dir nur einen guten Rat geben. Du bist ein hübsches und kluges Mädchen. Doch das herzogliche Schloss ist ein Löwenkäfig. Hinter jeder Ecke lauern Bestien und Untiere in Menschengestalt. Nicht immer kann man ihre bösen Absichten gleich erkennen. Ich möchte dich nur bitten, wachsam zu sein.“
Agnes sah den alten Gärtner ängstlich an. „Gibt es einen bestimmten Grund, weshalb Ihr mich warnen müsst?“
Der Gärtner schüttelte den Kopf. „Nein, es ist nichts Konkretes. Aber aus meiner langjährigen Lebenserfahrung und Tätigkeit bei Hofe weiß ich, wovon ich spreche. Ich möchte dir keine Angst bereiten. Aber hübsche Mädchen in deinem Alter werden von manchen Männern als Freiwild angesehen. Und da mache ich keinen Unterschied zwischen einem derben Pferdeknecht und einem eleganten Höfling. Gib auf dich acht und prüfe genau, wem du deine Gunst schenkst. Aber nun genug der ernsten Worte. Schauen wir mal, wie weit die anderen mit ihrer Kräuterernte sind.“
Nachdenklich folgte Agnes ihrem alten Onkel durch die Gänge. Er war ihr einziger Verwandter. Liebevoll hatte er sich nach dem plötzlichen Tod ihrer Eltern um sie gekümmert. Schon als kleines Kind war sie mit ihm durch den Schlossgarten gewandert. Sie kannte alle Pflanzen. Agnes wusste, welche von ihnen Sonne bevorzugten oder welche besser im Schatten wuchsen. Wann sie begossen werden mussten oder einen radikalen Schnitt benötigten und ob sie von Schädlingen befallen wurden. Nur zu gerne hätte sie, als sie älter wurde, bei ihrem Onkel in der Schlossgärtnerei gearbeitet. Doch der Beruf des Gärtners blieb den Männern vorbehalten. So hatte ihr Onkel dafür gesorgt, dass sie eine Anstellung in der Schlossküche erhielt. Wobei sich auch sein guter Draht zur Köchin Berta als vorteilhaft erwiesen hatte.
Nachdem Agnes gemeinsam mit Trine Jakobs Karre mit den Kräutern beladen und noch einmal sorgsam auf die Vollständigkeit kontrolliert hatte, verabschiedeten sich die drei bei Gärtnermeister Engelbrecht.
Auf dem Rückweg zum Schloss konnte Trine ihre Neugier nicht mehr zügeln. „Agnes, nun erzähle schon, was wollte denn Meister Engelbrecht von dir?“
„Ach, nichts Besonderes. Er hat nur gesagt, wir sollen die zu forschen Burschen in die Schranken weisen. Mein alter Onkel macht sich Sorgen um unser Seelenheil.“ Agnes hatte nicht vor, Trine von ihren beunruhigenden Gedanken zu erzählen, die ihr nach den Worten Ihres Onkels in den Kopf gekommen waren. Je mehr sie darüber nachdachte, umso deutlicher wurden ihre Erinnerungen an so manche Begegnungen im Schloss, denen sie bisher keine große Bedeutung beigemessen hatte. Die üblichen Neckereien der Wachsoldaten belustigten sie eher. Auch mancher zufällige Blick eines Höflings beunruhigte sie ebenfalls nicht. Allerdings die Aufdringlichkeit der Pferdeknechte, allen voran Valentin Haber, bereitete ihr Sorgen, je länger sie darüber nachdachte.
Als ob er Agnes' Gedanken gespürt hatte, versperrte der Pferdeknecht den beiden Küchenmädchen und Jakob den Weg, als sie vorbei an dem Marstall dem hinteren Kücheneingang zustrebten. „Agnes, wie schön, dass ich dich hier treffe. Ich habe unbedingt mit dir etwas zu besprechen. Schick doch die beiden Dumpfbacken mal vor, dann haben wir genügend Zeit für uns beide.“
Agnes' Augen verwandelten sich in schmale Schlitze. „Geh uns aus dem Weg, Valentin. Mit dir habe ich nichts zu besprechen.“
Der Pferdeknecht ging hämisch grinsend einen weiteren Schritt auf Agnes zu und streckte die Arme nach ihr aus. „So kratzbürstig heute? Wie ein junges Fohlen.“ Dabei fasste er sich anzüglich in den Schritt.
Weiter kam der Pferdeknecht nicht. Bevor er den nächsten Schritt nach vorne machen konnte, stellte sich Jakob ihm mit grunzenden Lauten in den Weg. Agnes glaubte so etwas wie „Hau ab!“ verstanden zu haben.
Valentin Haber schreckte zurück. Wie es schien, hatte er mit einer solchen Reaktion nicht gerechnet. Er fing sich aber schnell wieder. „Verpiss dich, du Idiot.“
Aber Jakob reagierte nicht. Im Gegenteil. Er breitete seine Arme wie schützende Flügel aus, als wollte er die Mädchen vor lästigem Unheil bewahren. Als Jakob auf den Pferdeknecht zugehen wollte, legte Agnes ihm ihre Hand auf die Schulter. „Es ist gut, Jakob. Wir sollten uns nicht mehr als nötig um eine Schmeißfliege kümmern.“
Es dauerte eine ganze Weile, bis Jakob verstanden hatte, was Agnes wollte. Währenddessen beschimpfte der Pferdeknecht die drei unaufhaltsam. „Das werdet ihr noch bereuen, ihr hochnäsiges Weiberpack. Und du verblödeter Grützkopf wirst keine ruhige Nacht mehr haben. Das verspreche ich dir.“
Agnes nahm Jakob an die Hand und drehte sich um. „Kommt, wir müssen die Kräuter abliefern.“
Jetzt schien auch Trine aus ihrer Erstarrung zu erwachen. „Was wollte der denn von dir? Das war ja widerlich.“
„Wie es scheint, wollte mein Onkel uns genau vor solchen Gefahren warnen. Wohl dem, der einen solchen tapferen Beschützer hat.“ Dabei klopfte Agnes Jakob dankend auf die Schulter. Was dieser mit einem Brummen und einem schiefen Mund beantwortete, was einem Lächeln ähnlich kam.
Innerhalb von wenigen Stunden hatte sich ein dunkler Nebel über das herzogliche Schloss in Gottorf gesenkt. Die Nachricht vom plötzlichen Tod des Erbprinzen Friedrich ließ alle Uhren stillstehen. Kein fröhliches Gelächter klang mehr über die Flure, keine lauten Befehle wurden mehr erteilt. Beklemmende Stille durchzog die Räume des Schlosses.
„Ich kann dieses Drama und seine Folgen gar nicht erfassen. Das Bild, das ich vor Augen habe, ruft in mir ein erbarmungsloses Grauen hervor.“ Mit beschwörenden Händen befummelte Dekan Augustinus das Kreuz, das er an einer Kette um den Hals trug.
„Ich gebe Euch recht. Der plötzliche Tod des Erbprinzen Friedrich erschüttert mich ebenfalls über Gebühr. Gottes Wege sind unergründbar.“ Der Hofkaplan begleitete seine Worte mit einer übertrieben betretenen Miene.
„Nun, gestorben wird immer. Warum nicht auch in Fürstenhäusern? Aber ich frage mich, Kaplan Martinus, was erregt Euch dermaßen. Ihr als gefestigter Gottesmann solltet doch dem Tod eher gelassen gegenüberstehen“, gab jetzt Hofrat von Tuttlingen zu Bedenken.
Die beiden Geistlichen und der Geheime Hofrat, Anselm Graf von Tuttlingen, saßen im Kabinett des Dekans. Es war nicht das erste Mal, dass die drei ihre Köpfe zusammensteckten, um sich über das Wohlergehen des Herzogtums zu beraten. Es verband sie eine geistige Verwandtschaft, in der nicht selten auch persönliche Interessen im Vordergrund standen.
Dekan Augustinus schüttelte missbilligend den Kopf. „Darum geht es doch gar nicht. Nun gut, der Erbprinz ist tot. Das ist nun einmal der Lauf der Dinge. Aber habt ihr Euch denn nicht auch einmal gefragt, welche Folgen sein Ableben haben wird?“
Der Hofrat hob uninteressiert die Schultern. Hofkaplan Martinus sah dagegen den Dekan bestürzt an. „Unabhängig von einer Trauerfeier und einem späteren Begräbnis wird sich das Leben hier am Hofe doch grundlegend nicht verändern.“
„Bruder Martinus, Ihr seid mir bisher nicht durch übermäßige Einfältigkeit aufgefallen. Ist Euch denn nicht bewusst, welches Schreckensszenario uns bevorsteht?“
„Bruder Augustinus, ich möchte Euch doch sehr bitten. Eure Wortwahl ruft bei mir ein sehr befremdliches Empfinden hervor. Ich wüsste nicht, auf welche Weise ich Euren unverkennbaren Zorn provoziert haben sollte.“ Der Hofkaplan wirkte verschnupft.
Der Dekan fegte den Einwand des Hofkaplans mit einer hastigen Handbewegung zur Seite. „Nun reagiert nicht wie eine Mimose. Es ist viel wichtiger, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir das drohende Unheil abwenden können.“
„Es tut mir sehr leid, aber die von Euch vermuteten Abgründe erschließen sich mir auch nicht“, warf der Hofrat ebenfalls ein.
„Erkennt Ihr denn nicht die Tendenzen, die einem gottesfürchtigen Leben entgegenwirken?“ Dekan Augustinus erhob beschwörend die Hände. „Wendet doch Euren Blick einmal Richtung Eutin. Welche Höllenschlunde sich dort öffnen, muss jeden ehrbaren Christen vor Furcht erschüttern lassen.“