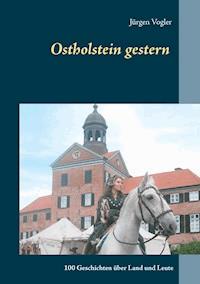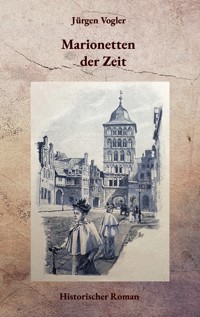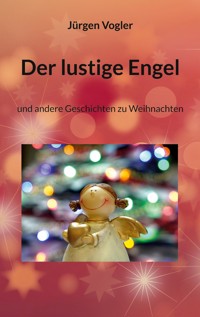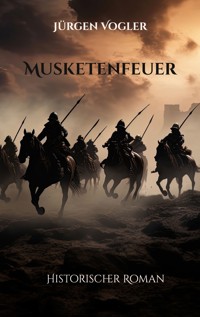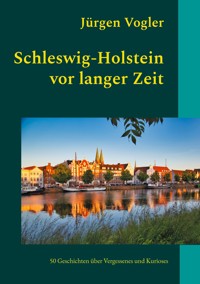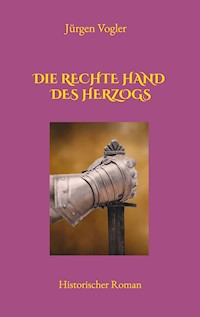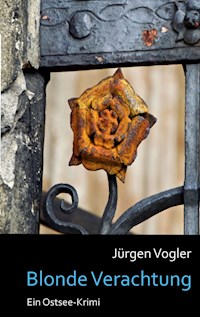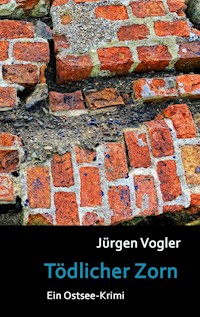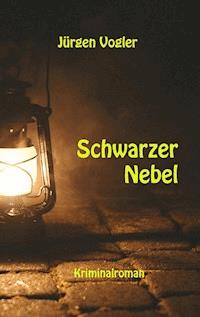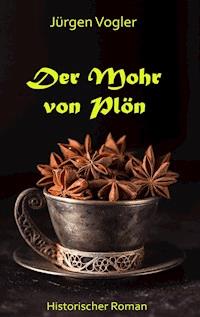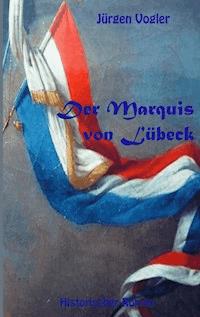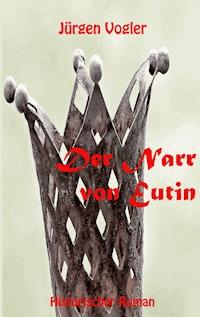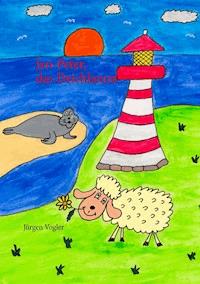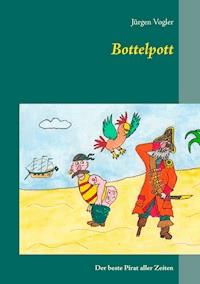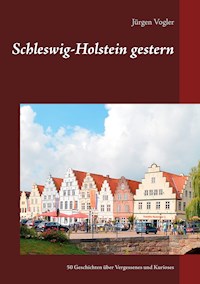
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Schleswig-Holstein verfügt über eine sehr abwechslungsreiche Vergangenheit. Die 50 Geschichten über Vergessenes und Kurioses erlauben auf ganz besondere Weise einen Blick zurück. So kommen abenteuerliche Ereignisse ans Licht wie auch bedeutende Persönlichkeiten und ihre Eigenarten. Allerdings kennzeichnen auch menschliche Abgründe und traurige Schicksale die Geschichte des Landes zwischen den Meeren. Ein bunter Bilderbogen voller historischer Überraschungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die Franzosenzeit in Lübeck
Königliche Brieftaubenstation
Von der Ostsee in die Südsee
Ein steinreiches Land
Admiral Hansens kläglicher Versuch
Die erste Kunststraße
Madonna oder Mörderin
Klare Worte der Petuh-Tanten
Explosive Sprengkraft an der Elbe
Der große Schnee
Ein liebenswerter Narr
Elvira Madigan -Eine tragische Liebe-
Dreieckstuch und Eisbeutel
Schleswig-Holstein -Flagge und Wappen-
Der Betrug im Gotteshaus
Nackt zu Kaisers Zeiten
Klein Erna kommt groß heraus
Nord-Ostsee-Kanal und seine Tücken
Freiheitskämpfer oder Räuber
Salz unter dem Kalkberg
Teufel und Maus in der Kirche
Ein ausgetrockneter Mann
Die Waschmagd und der Turm
Der zerbrochene Schlagbaum
Fanny zu Reventlow -Die Skandalgräfin-
Ein Sturz mit grausamen Folgen
Tödliche Grenze
Unsere kleine Welt ganz groß
Eine Insel wird gerettet
Ein herrschaftlicher Maler
Menschliche Skulpturen aus Bronze
Katharina und die Milchsuppe
Als die großen Fluten kamen
Die Schleswig-Holsteinische Flottille
Schloss mit anrüchiger Vergangenheit
Der Traum vom Unterseeboot
Ein Haus mit Geschichte
Angst vor der Technik
Der Mohr von Plön
Ein Unternehmer voll Elan
Napoleons Kriegshafen an der Ostsee
Der letzte Gang des Johann Lau
Der vergessene niederdeutsche Dichter
Die sprechenden Grabsteine
Ein Lord kämpft um die Insel
Gottesfurcht und gute Sitten
Name ist Schall und Rauch
Neocorus schreibt eine Chronik
Ein Ostseebad versinkt in den Fluten
Durch Walfang zum Reichtum
Autor
Vorwort
Schleswig-Holstein verfügt über eine abwechslungsreiche Geschichte. Nun liegt es in der Natur des Menschen, dass er schnell vergisst. Aus diesem Grund kam ich auf die Idee, ein wenig in der Vergangenheit des Landes zwischen den Meeren herumzustöbern. Wie schon in „Ostholstein gestern“ -100 Geschichten über Land und Leute- bin ich bei meinen Recherchen auch jetzt immer wieder über Gebäude, Menschen und Ereignisse gestolpert, die Fragezeichen aufwarfen. Je mehr ich bei der Suche nach Antworten nachforschte, umso öfter stieß ich auf abenteuerliche Begebenheiten, bemerkenswerte Persönlichkeiten und nicht selten auch auf menschliche Abgründe und traurige Schicksale. So entstand ein Kaleidoskop voller historischer Überraschungen. Wer in diesem Buch eine chronologische Abhandlung über die geschichtliche Entwicklung Schleswig-Holsteins sucht, den muss ich leider enttäuschen.
Wenn Sie so wollen, begeben wir uns auf einen Ausflug durch das Land. An den unterschiedlichsten Orten machen wir eine kurze Rast und blicken zurück in die Vergangenheit. Dabei wird Ihnen sicherlich so manches Haus und der eine oder andere Name bekannt vorkommen. Aber können Sie sich noch an die wahren Geschichten, die sich dahinter verbergen, erinnern? Oder haben Sie davon möglicherweise noch nie etwas gehört?
Wer weiß, vielleicht tragen meine 50 Geschichten über Schleswig-Holstein dazu bei, dass Sie sich bei Ihrem nächsten Ausflug selber auf die Spurensuche begeben. Und sei es nur, um sicher zu gehen, dass ich Ihnen nichts Falsches erzählt habe. Es würde mich freuen.
Jürgen Vogler
Die Franzosenzeit in Lübeck
Die Lübecker nennen sie „Franzosenzeit“. Es ist die Epoche zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als Napoleons Truppen in die Hansestadt einfallen und sie sieben Jahre lang besetzen. Umso mehr erstaunt es, dass gerade ein gebürtiger Franzose sich um das Wohl der Lübecker kümmert, sich für sie einsetzt und versucht, ihr Leid zu lindern. Sein Name ist Charles de Villers.
Selbstbewusst sendet die Freie Reichs- und Hansestadt Lübeck 1804 ihren Senator Matthäus Rodde mit den besten Wünschen zur Kaiserkrönung Napoleons nach Paris. Vollmundig bedankt sich dieser schriftlich bei den Honoratioren der Stadt, mit dem Versprechen, stets seine schützende Hand über sie zu halten. Eine Beteuerung, die der selbsternannte Kaiser der Franzosen im Herbst 1806 offensichtlich vergessen hat. Mit einer Truppe in Stärke von 53.000 Mann unter Führung der Marschälle Bernadotte, Murat und Soult fallen die Franzosen am 6. November in die Stadt ein. Sie vertreiben General Blücher, der am Tag zuvor unter Missachtung der Neutralität mit seinen Soldaten Lübeck besetzt hat. Einen Tag später muss er in Ratekau kapitulieren.
Im Haus des bedeutenden Kaufmanns und Senators Matthäus Rodde und dessen Ehefrau Dorothea Schlözer lebt zu der Zeit als Hausgast Charles de Villers. Sie führen dort eine klassische Ménage á trois. Als ehemaliger Artilleriehauptmann in napoleonischen Diensten, muss er aufgrund seiner kritischen und satirischen Schriften über die Folgen der Revolution Paris verlassen. Bei seiner Flucht vor napoleonischen Häschern findet er hier Unterschlupf. Charles de Villers ist ein gebildeter Mann, der mit seinen philosophischen
Charles de Villers (1765-1815)
Ansichten und Werken über alle Grenzen hinaus Aufmerksamkeit erregt und regelmäßig mit Geistesgrößen seiner Zeit wie auch Johann Wolfgang von Goethe verkehrt. Als die napoleonischen Truppen Lübeck erobern und marodierend durch die Straßen ziehen, wirft sich Charles de Villers seinen alten Militärmantel über, schnallt sich einen Säbel um und stellt sich schützend vor das Haus des Senators Rodde. Mit barschen Befehlen und der Lüge, dass er das Haus bereits für einen der französischen Marschälle requiriert habe, kann er die plündernden Soldaten fernhalten.
Wenig später zieht tatsächlich der Oberbefehlshaber der Franzosen, Marschall Bernadotte, in das Haus des Senators ein. Nachdem er erfährt, wer Charles de Villers ist, erklärt er ihn aufgrund seiner Kenntnisse über militärische Belange, sein Wissen über die Lübecker Verhältnisse und die Beherrschung der deutschen Sprache zu seinem persönlichen Berater. Ein Umstand, der für die Lübecker Bevölkerung sehr schnell zum Vorteil wird. Der Siegesrausch der französischen Soldaten nimmt kein Ende. Unaufhaltsam wird gemordet, vergewaltigt und geplündert. Erst als sich Charles de Villers nachdrücklich an die Marschälle wendet und diese einen Befehl erlassen, wonach solche Untaten mit dem Tode bestraft werden, endet das Martyrium für die Lübecker. Auch während der Besatzungszeit setzt er sich unaufhaltsam zum Wohl der Bürger der Hansestadt ein. In einem langen Brief an Gräfin Fanny de Beauharnais, einer Tante der französischen Kaiserin Josephine, schildert Charles de Villers die katastrophalen Ereignisse in Lübeck detailliert und macht kein Hehl daraus, dass er sich für das Verhalten seiner Landsleute schämt. Dieses Schreiben lässt die Gräfin veröffentlichen. Es wird zu einem viel beachteten Dokument in Europa zu jener Zeit. Charles de Villers droht danach jedoch erneut eine Verhaftung durch die Franzosen.
Der Senat der Hansestadt hat Matthäus Rodde, der inzwischen zum Bürgermeister aufgestiegen ist, mit der Verwaltung der Finanzen beauftragt. Da er nicht getrennte Bücher über das eigene und das Stadtvermögen führt, verliert er den Überblick und muss 1810 die Zahlungsunfähigkeit erklären. Nur mit Mühe kann Charles de Villers einen Teil des Vermögens von Dorothea Schlözer, Roddes Ehefrau, retten. Gemeinsam müssen sie Lübeck verlassen und begeben sich nach Göttingen.
Charles de Villers wird zum Professor für Philosophie an die Georgia Augusta Universität berufen. Er stirbt am 11. Februar 1815 nach einem Schlaganfall und wird auf dem Albani-Friedhof in Göttingen beigesetzt. Seine Grabstätte ist nicht erhalten. Lediglich ein schlichtes Marmorschild in der Langen Geismarstraße weist auf den Aufenthalt in seinen letzten Lebensjahren hin.
Wer einen Hinweis in der Hansestadt auf Charles de Villers und sein segensreiches Wirken für die Lübecker finden will, wird vergeblich suchen. Weder eine Gedenktafel noch ein Straßenname würdigen die Verdienste jenes Franzosen, der sich in der größten Not der Hansestadt selbst in Gefahr brachte und sich uneigennützig für seine Bürger eingesetzt hat.
Königliche Brieftaubenstation
Nachrichten, die wir versenden wollen, haben heute keine Mühe in Bruchteilen von Sekunden das andere Ende der Welt zu erreichen. Noch vor wenigen Jahrzehnten ist das kaum möglich. Verzerrte Wortfetzen und Morsezeichen quälen sich durch den rauschenden Äther oder man muss sich auf die Post verlassen, die die Briefe auf manchmal geheimnisvollen Wegen an den Adressaten bringt. Blicken wir einmal in das 19. Jahrhundert zurück, als auch Brieftauben zum Einsatz kommen, um wichtige Nachrichten zu transportieren.
Die Königliche Brieftaubenstation in Tönning an der Nordsee mag als Beweis dafür gelten. Sie wird von 1877 bis 1912 betrieben. Naturgemäß fragt man sich, wieso haben Brieftauben eine so wichtige Bedeutung, dass selbst ein königliches Amt dafür eingerichtet wird? Ein Auszug aus dem „ministeriellen Centralblatt der preußischen Bauverwaltung“ bringt uns der Antwort näher. Dort heißt es: „Es ist eine Verbindung der an besonders gefährdeten Stellen in der Nähe der Küste liegenden Leuchtschiffe mit dem Festlande und den Lootsenstationen mittelst Brieftauben zu erreichen. Die durch eine solche Verbindung ermöglichte Vermittlung von Nachrichten bei stürmischer See zwischen den Leuchtschiffen und dem Lande ist nicht nur für die weit draussen vor Anker liegenden Leuchtschiffe in Gefahrfällen von grosser Bedeutung“. So hat man bereits 1876 erste Versuche unternommen, Tauben für die Übermittlung von Nachrichten zwischen den Feuerschiffen in der Deutschen Bucht und dem Festland einzusetzen. Doch die Experimente mit den fliegenden Boten enden kläglich. Während die Tauben an Land noch ihr Ziel erreichen, verirren sich die meisten auf dem Wasser und in Küstennähe. Als man sieben Seemeilen vor Borkum 30 Tauben aufsteigen lässt, kommen nur acht von ihnen auf dem Leuchtturm der Insel an. Ein erneuter Versuch vor der Eidermündung allerdings bringt den Erfolg. Man setzt 21 Tauben mit Depeschen 36 Seemeilen von Tönning ab und alle erreichen wieder ihr Ziel. Die schnellsten Flieger schaffen die Strecke in nur 30 Minuten. Woran liegt es? Eingesetzt werden für diesen Versuch nur Tauben, die an der Küste aufgezogen wurden und an das Seeklima gewöhnt sind.
Die Eidermündung bei Tönning hat zu dieser Zeit für die Schifffahrt große Bedeutung, da sie über die Eider und den Schleswig-Holstein-Kanal die Verbindung zwischen Nord- und Ostsee darstellt, bevor der Nord-Ostsee-Kanal gebaut wird. Zwei Feuerschiffe kennzeichnen den Seeweg. 36 Seemeilen vor Tönning liegt das Feuerschiff „Außeneider“ und zehn Seemeilen von der Küste entfernt das Feuer- und Lotsenschiff „Eidergaliote“. Mit Jollen werden die Tauben von Tönning aus zu den Feuerschiffen gebracht. Von dort aus sendet man die Tauben mit den Mitteilungen für die Lotsen, Brieftaubendepesche Nr.8 vom 25.4.1897 von der Kgl.“Eider-Galiote“ nach Tönning: „An das Königl. Lotsen-Comptoir: Ein holländischer Schoner, mit Lotse Stolley besetzt, sitzt auf der Linnenplate fest. Rettungsboot mit Thöming, Jensen und Laßen ist unterwegs nach ihm. Bitte Triton II zur Hilfe. Captain: Ahrens sowie über einlaufende Schiffe und deren Ladungen an die Lotsenstation in Tönning. Wie bedeutungsvoll diese Nachrichtenverbindung ist, zeigt sich auch, als bei einem Orkan die Stationskette des Feuerschiffes „Außeneider“ bricht und das Schiff abtreibt. Sofort schickt man vier Tauben mit der Notdepesche zur Lotsenstation nach Tönning. Ungeachtet des Orkans kommen alle vier Tauben nach 58 Minuten in Tönning an, sodass unverzüglich der Staatsdampfer eingesetzt wird, der das havarierte Feuerschiff sicher in den Hafen schleppen kann.
Wie in Preußen üblich, ist auch das Betreiben der Königlichen Brieftaubenstation in Tönning im Einzelnen geregelt. Dem „Unternehmer ist die ganze Zucht, Wartung und Einübung der Thiere für den Dienst zu übertragen. Er hat einen Bestand von 80 Flugtauben stets vollständig zu erhalten; jeder entstehende Verlust ist sofort durch Einstellung neuer, zum Depeschendienst geeigneter Tauben zu decken“.
Während von 1877 bis 1893 Gastwirt B. A. Bump diese Aufgabe übernimmt, leitet danach bis 1912 Uhrmacher Hinrich Wohlenberg die Königliche Brieftaubenstation in Tönning. Auch die Einrichtung des heimatlichen Taubenschlages, zu dem die Tiere von den Feuerschiffen zurückkehren, ist genau vorgeschrieben. „Die Ankunft der Flugtauben am Schlage wird durch ein Läutewerk gemeldet, welches beim Auffliegen auf das am Flugloch befindliche Trittbrett durch elektrische Leitung in Bewegung gesetzt wird und so lange in Thätigkeit bleibt, bis der Taube die an einer Feder befestigte Depesche abgenommen ist; das Flugloch ist derart construirt, dass die Tauben nur hinein, nicht aber zurück können“.
Mit dem technischen Fortschritt endet auch 1912 die Königliche Brieftaubenstation in Tönning. Bereits im Preußischen Staatsvertrag von 1894 unter Paragraph 11.3 ist zu lesen: „Der Vertrag ist aufzuheben, wenn mittels elektrischer Telegraphie eine Verbindung mit den Feuerschiffen hergestellt und dadurch die Brieftaubenverbindung überflüssig wird“.
Von der Ostsee in die Südsee
Es liegt wohl in der Natur des Menschen, dass er bei aller Dramatik einer Geschichte sich doch letztlich nach einem glücklichen Ende sehnt. Kaum ein Erlebnis aus der Vergangenheit der Ostseeinsel Fehmarn erfüllt diesen Wunsch auf so erstaunliche Weise, wie das Schicksal des damals zwölfjährigen Fritz Kruse.
Bereits am 12. November 1872 entfesselt sich über der Ostsee ein gewaltiger Sturm aus Nordost. In der darauf folgenden Nacht steigert sich das Unwetter zu einem Orkan mit Regen- und Schneeschauern. Eine Sturmflut bricht über die Insel Fehmarn und die Küste der Lübecker Bucht herein. Ortschaften versinken in den Wassermassen, Häuser werden fortgespült, Tiere und Menschen ertrinken in den Fluten.
Auch das Haus des Sundlotsen Kruse auf Fehmarn hält den Naturgewalten nicht stand. Die Familie hat sich noch auf das Dach retten können, doch die unbarmherzig hereinbrechenden Wellen spülen Vater, Mutter und Bruder fort. Lediglich dem zwölfjährigen Fritz Kruse gelingt es, sich am Dachfirst festzuklammern. Während der Sturm unaufhörlich wütet, wird das Dach des einstigen Lotsenhauses fort von der Insel auf das offene Meer getrieben. Fritz Kruse lässt nicht locker. Unbeirrt von den an seinen Kleidern reißenden Sturmböen, den über ihn hinweg brechenden Wellen und der tiefschwarzen Nacht hält er sich an dem Dachbalken fest. Im Morgengrauen des nächsten Tages, nachdem ihn der Sturm durch die Kieler Bucht getrieben hat, glaubt er, den Leuchtturm der dänischen Insel Langeland zu sehen. Doch wenig später verlangt ein ganz anderes Ereignis seine Aufmerksamkeit. Die Besatzung der französischen Brigg „Locquirec“, die sich von St. Petersburg auf der Fahrt nach Dünkirchen durch den Sturm kämpft, entdeckt den Jungen 15 Seemeilen nordöstlich von Kiel auf dem dahintreibenden Dach. Nachdem sich drei Matrosen bereit erklärt haben, den Jungen zu retten, lässt Kapitän Carbon ein Beiboot aussetzen. Unter Einsatz ihrer Leben bergen sie den völlig erschöpften Fritz Kruse und bringen ihn sicher an Bord. Mehr als 27 Stunden hat der Junge Wind und Wellen getrotzt. Die Brigg steuert den Hafen von Kiel an, wo er in die Obhut fürsorglicher Hände gegeben wird.
Fritz Kruses Schicksal bewegt die Menschen jener Zeit über Gebühr. Nicht zuletzt auch angesichts der verheerenden Folgen der Sturmflut. 271 Menschen sterben an der Ostseeküste, knapp 3.000 Häuser werden zerstört und 15.000 Personen obdachlos.
Fritz Kruse
Fritz Kruses abenteuerliche Rettung geht durch alle Zeitungen des Landes. Selbst Kaiser Wilhelm I. erfährt von seinem Schicksal und ordnet eine Patenschaft für den Waisenjungen an. Auch Kapitän Carbon und seine heldenhafte Besatzung der Brigg „Locquirec“ aus Morlaix werden nach ihrer Rückkehr mit Orden und Ehrenzeichen belohnt. Trotz der verhängnisvollen und bedrohlichen Erlebnisse folgt Fritz Kruse der Tradition seiner Familie. Er wird zum Seemann und Navigator ausgebildet und bereist später als Kapitän die Weltmeere.
1885 landet er bei einer seiner Reisen auf der Südseeinsel Samoa. Dort verliebt er sich in Luse, die er heiratet und mit ihr eine große Familie gründet. Als Erinnerung an seine Heimat benennt er das Hotel, das er mit seiner Ehefrau wenig später erbaut, „Insel Fehmarn“. Das Hotel besteht heute noch und wird von seiner Urenkelin geführt.
So findet Fritz Kruses Geschichte nach einer abenteuerlichen Reise mit schicksalshaften Wendungen letztlich doch ein glückliches Ende.
Ein steinreiches Land
Man kann ohne Übertreibung behaupten, dass Schleswig-Holstein steinreich ist. Höhere Bergzüge sind jedoch in der norddeutschen Tiefebene bis auf die „stattliche Erhebung“ des Bungsbergs mit seinen knapp 168 Metern nicht zu erwarten. Wohl aber hat die letzte Eiszeit einige beeindruckende Zeugen hinterlassen. Findlinge werden die großen Steine genannt, die vor langer Zeit eine beachtliche Reise hinter sich gebracht haben.
Wer durch Schleswig-Holstein reist, wird immer wieder einmal über mächtige Felsbrocken stolpern. Nicht selten hat man sie -abhängig von ihrem Gewicht- an exponierter Stelle aufgestellt. Sind sie doch typische Zeichen des Landes zwischen den Meeren. Doch woher kommen sie?
Während der letzten großen Eiszeit in Nordeuropa, sind die östliche Hälfte von Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und große Teile Brandenburgs vor rund 22. 000 Jahren von einer mächtigen Eisschicht bedeckt. Der Eisrand verläuft in Schleswig-Holstein ungefähr entlang einer Linie von Flensburg über Schleswig, Hamburg und Ratzeburg. Vor etwa 13. 000 Jahren ist die gesamte Ostseeküste schon wieder eisfrei. Zurück bleiben ausgedehnte Sanderflächen, die bis heute der Ursprung der Kiesgruben sind. Auch die Seen in der Holsteinischen Schweiz entstehen aus dem abfließenden Gletscherwasser. Ihre gewichtigsten Hinterlassenschaften allerdings sind Findlinge und Steine. Aufgrund ihrer Beschaffenheit ist es für Wissenschaftler ein Leichtes, ihren Ursprung festzustellen. Die meisten von ihnen beginnen ihre Reise Hunderte von Kilometern entfernt. Die Gletscher haben sie aus den Gebirgsformationen im Süden Schwedens herausgerissen und vor sich hergeschoben. Durch diese Bewegungen entsteht ein ständiger und gleichmäßiger Abrieb, der die glatten Oberflächen der Findlinge erklärt. Wer jedoch heute vor einem dieser tonnenschweren Kolosse steht, wird kaum ermessen können, wie groß er bei Antritt seiner Reise gewesen ist und wie viel von ihm auf dem langen Weg seiner Odyssee in den Süden liegen geblieben sein mag.
Der größte Findling in Schleswig-Holstein ist der Düvelstein bei Großkönigsförde unweit des Nord-Ostsee-Kanals. Er wiegt rund 180 Tonnen. Seinen Namen hat er von einer Legende, die berichtet, dass der Teufel versucht habe, mit dem Stein die St. Jürgen-Kirche im sieben Kilometer entfernten Gettorf zu zerschmettern. Doch Gott habe den Stein abgelenkt, sodass er nahe am Kirchturm vorbeiflog und in Großkönigsförde landet. Der Kirchturm in Gettorf steht daher heute noch schief.
Der Wandhoff-Findling in Kreutzfeld
Der zweitgrößte in der Sammlung der Großen ist der Wandhoff-Findling in Kreutzfeld bei Bad Malente. Erstaunlich ist, dass der Koloss mit seinen 126 Tonnen von Menschenhand bewegt wird, als man ihn in der angrenzenden Kieskuhle findet. Mit Kran, Tieflader und einem Bergepanzer bringt man den mächtigen Stein in die Nähe zur Straße, wo anschließend ein Findlingsgarten eingerichtet wird. Die Besucher werden hier mittels Schautafeln umfassend über Gesteinsarten und Herkunftsländer der Steine informiert. Wie schon der Düvelstein ist die Heimat des Wandhoff-Findlings auch das Småland im Süden Schwedens.
Der jüngste Fund ist der Fährmannstein in Wedel. Ihn fördern die Bagger während der Elbvertiefungsarbeiten 2019 an den Tag. Immerhin bringt auch er knapp 60 Tonnen auf die Waage. Damit gehört er jetzt zu den Top 3 in Schleswig-Holstein.
Aber der Steinreichtum an der Küste zeigt sich vor mehr als 200 Jahren auch auf ganz andere Weise. Bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts etabliert sich an der Ostseeküste das Gewerbe der Steinfischerei. Vorrangig in den Gewässern vor Eckernförde, Hohwacht, Fehmarn und in der Lübecker Bucht geht man dieser Profession nach. Anfangs wird nur küstennah gefischt. Dazu braucht man keine komplizierte Ausrüstung. Später jedoch, als das Steinfischen in Strandnähe aus Küstenschutzgründen verboten wird, benötigt man Taucher, schwerlasttragende Boote und Hebevorrichtungen, um die Steine vom Meeresgrund zu lösen. Keine ungefährliche Arbeit. Helmtaucher begeben sich in eine Tiefe von bis zu 20 Metern. Sie müssen die Steine mit Seilen und einer speziellen Steinzange fixieren. Auch während des Hebevorgangs besteht immer die Gefahr, dass sich der Stein wieder lösen und dadurch Leben und Gesundheit des Tauchers bedrohen kann. Verkauft werden die Steine für den Bau von Hafenanlagen und Häusern.
Aber nicht nur gefischte Steine kommen beim Bau von Gebäuden zum Einsatz. Auch die für die Landwirte störenden Findlinge auf den Äckern und Feldern werden verwandt. Ein Beispiel dafür ist der Bismarckturm auf dem Pariner Berg in der Nähe von Bad Schwartau. Die Findlinge werden Ende des 19. Jahrhunderts von den Bauern mit Pferdewagen zum Berg hochgefahren. Dort wartet ein Steenklopper (Steinhauer), der mit Hammer und Meißel aus den unförmigen Gebilden exakte Quader formt, die dann ein Maurer lückenlos zusammenfügt.
Ganz gleich, ob kohlkopfgroße Steine oder mächtige Findlinge, den Steinreichtum hat Schleswig-Holstein den Gletschern der letzten Eiszeit zu verdanken. Beeindruckende Zeugen, die vor langer Zeit im hohen Norden auf die Reise gegangen sind.
Admiral Hansens kläglicher Versuch
Auch in Schleswig-Holstein hat es Personen und Persönlichkeiten gegeben, die auf besondere Weise auf sich aufmerksam gemacht haben. Einige erinnern bis heute durch ihre Werke an ihre Schaffenskraft, anderen hat man wegen ihres bedeutenden Wirkens Denkmäler gesetzt. Es gibt allerdings auch Individuen, die in einer Form hervorgetreten sind, die man als skurril bezeichnen könnte, um sie nicht gleich merkwürdig und kurios zu nennen. Einer von ihnen ist Kapitän Peter Hansen, geboren 1787 in der Nähe von Arnis.
„Schon von meiner frühesten Jugend an war es mein Wunsch, mich dem Seemannsberufe zu widmen“, lautet der zweite Satz in der „Biographie des Schiffscapitains Peter Hansen“, die 1859 veröffentlicht wird. Allein die Tatsache, dass er es für nötig hält, in seiner Selbstbiographie „dem Publikum eine getreue Darstellung der wichtigsten Begebenheiten aus meinem Leben zu übergeben“, mag ein Hinweis für die Selbsteinschätzung des Peter Hansens geben. Ohne Frage ist sein Leben abenteuerlich und abwechslungsreich. Er segelt unter amerikanischer Flagge, vergnügt sich in New Orleans, betätigt sich als Blockadebrecher und hat auch keine Skrupel, regelmäßig die Küste Afrikas anzulaufen, um sich am Sklavenhandel zu bereichern.
Die spektakulärste Tat in seinem Leben ereignet sich jedoch im Mai 1848 im eigenen Land. Es ist die Zeit der Schleswig-Holsteinischen Erhebung. Jene Epoche, in der auch im Land zwischen den Meeren der revolutionäre Geist ausbricht und sich vorrangig gegen die Anektionsabsichten Dänemarks richtet. Die Herzogtümer Schleswig und Holstein erheben sich gegen den dänischen Gesamtstaat und kämpfen bis 1851 in mehreren Schlachten gegen das Königreich.
Während dieser Zeit blockiert die dänische Korvette „Galathea“ den Kieler Hafen. Kapitän Hansen wendet sich voller Tatendrang an die Provisorische Regierung in Kiel und unterbreitet ihr einen Plan, auf welche Weise er die „Galathea“ entern und so die Bedrohung beenden würde. Sein Vorhaben überzeugt die Herren und sie ernennen ihn zum „Admiral der deutschen Flotte“ bei einer Heuer von fünf Talern Courant pro Tag.
Seekapitän Peter Hansen