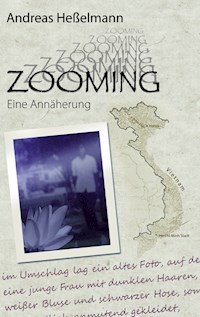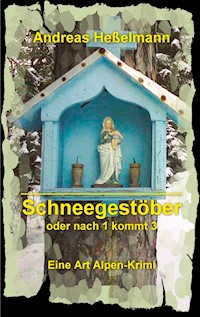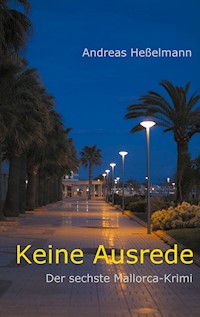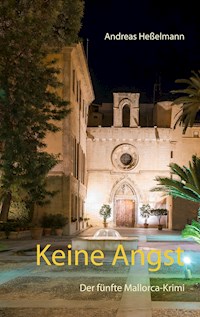Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nur noch wenige Tage bis zur Johannisnacht, den Hogueras de San Juan, eines der größten und buntesten Feste in Spanien. Doch ein grausamer Fund unter den Steinen der Flaniermeile Explanada de España in Alicante bedroht die Durchführung des Festes. Inspector Xarneracomte, manchmal etwas langsam, bisweilen ungelenk und viel zu lang schon allein, stößt bei seinen Ermittlungen zusammen mit seinem besten Freund und Kollegen und mit viel Intuition auf merkwürdige und ungewöhnliche Spuren. Ein aufwühlender und aktueller Krimi vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise in Spanien. "Kennen sie einen Afrikaner, der freiwillig nach Europa kommen würde? Das ist kein Wunschtraum, sondern nur der letzte Ausweg."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Caminante,
no hay camino, se hace camino al andar
Reisender,
es gibt keine Wege, Wege entstehen im Gehen
(Antonio Machado)
Inhaltsverzeichnis
Mittwoch
Donnerstag
Donnerstag
Samstag
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Beinahe drei Wochen später
Mittwoch
Ehrlich gesagt, gerate ich immer ein wenig aus der Fassung, wenn ich an den Ort eines schweren Verbrechens oder einer Bluttat komme. Zu oft kollidieren dann für mich – durch die sichtbar gewordene Gewalt – Wirklichkeit und meine Vorstellungen über den Hergang. Vor allem, wenn ich das Ergebnis eines Mordes sehe, wie ich es vor Minuten zu Gesicht bekommen habe. Einfach unfassbar, was ein Mensch einem anderen antun kann. Kaum ein Tier auf der Welt geht so mit seiner Beute um.
Wieder hatte ich für ein paar Minuten Mühe, mich zu orientieren. Mich aufs Wesentliche zu konzentrieren oder mit der angemessenen Neutralität Prioritäten für mein Vorgehen zu setzen. Aber diese offenkundige Brutalität ging mir wirklich an die Nieren. Nicht dass mir schlecht wurde. Nein! Dafür habe ich im Verlauf der Jahre schon zu viele Tote gesehen: Mutwillig überrollte, vom Meer angespülte, aufgeblähte Körper, von Kugeln zerfetzte Racheopfer, Abgeschlachtete.
Eine Leiche erzählt in der Regel von der letzten Sekunde des Lebens. Teilt den Grund des Todes mit. Krieg, Verzweiflung, Depression, Hunger, Liebe, Gier, Hass. Durch Fundort, Lage, Wunden und verbliebene Spuren. Das ausgehauchte Leben vor mir kannte aber ein anderes Ende, technisch erzwungen, durch unvorstellbare Kaltblütigkeit. Genau diese ließ in mir eine wilde, unbestimmbare und etwas hilflose Wut hochkommen. Eine Wut, die ich kaum in Worte fassen kann, nicht ausreichend genug für Erklärungen. Hier hatte man niemanden hingerichtet, sondern aus dem Weg haben und verstauen wollen.
Ein Toter ist für mich nun mal mehr als nur erloschenes Leben, leblose Hülle oder Effekt einer Tat, die Untersuchungen, Recherchen und Ermittlungen in Gang setzt. Leider sind damit auch allzu oft viele Stücke einer von nun an nicht mehr aufklärbaren Vergangenheit verschwunden. Ich weiß, bedauernde Überlegungen gehören nicht hier hin. Sie sind nicht sehr professionell in meinem Job. Ich sollte mit mehr Distanz rangehen und mich lieber darauf konzentrieren, was ich tun kann, um den Täter zu finden. Einfach durchatmen und die Sache nüchtern betrachten, bevor ich den Nervösen markiere, der ich leider allzu oft bin.
Spuren suchen.
Zusammenhänge ermitteln.
Fälle aufklären.
Diesem Leben da kann ich ohnehin nicht mehr helfen. Schon vorbei. Also durchatmen. Womöglich liegt es aber ganz einfach auch daran, dass ich mir jedes Mal einbilde, all die anderen: Kollegen, Journalisten und Abstauber, wären durch Verschwörungen und Heimlichtuerei schon Stunden vor mir dagewesen und hätten sich schon alle wichtigen Stücke des gerade entstehenden Falls unter den Nagel gerissen. Jeden Fingerabdruck, jedes halbwegs taugliche Beweisstück, jede mögliche Mordwaffe, weil sie, im Gegensatz zu mir, die Toten schlichtweg als Ware betrachten. Als starken Kaffee, der die Lebensgeister weckt. Als willkommene Gelegenheit, die eigene Karriere mit einer neuen Treibstufe in ungeahnte Höhen zu befördern.
Denn kaum habe ich sie am Tatort höflich mit ¡buenas! ¿que tal? begrüßt, präsentieren sie mir schon mindestens zwei Möglichkeiten und einen Verdächtigen, einen, der in ihre Vorstellungen und Vorurteile passt, um ihn für die eigenen Vorhaben, Artikel und Berichte zu missbrauchen; und wenn sich all diese Beteiligten zusammenrotten, verzögern sie jede Aufklärung. Weil sie unaufhörlich Einwände, Gegenargumente und Vorbehalte haben. Klassische Besserwisser. Nur mit dem falschen Beruf ausgestattet. Hätten besser Lehrer oder Politiker werden sollen. Oder gleich beides zusammen.
Ich hingegen wäre in diesem Moment am liebsten gleich mehrfach auf der Welt, multipel sozusagen, um alles zu sehen, zu notieren und überall dazwischen fahren zu können. Da mich die Umstände und das Warum, das Leben der Opfer und deren Intentionen interessieren und eben nicht mein berufliches Fortkommen. Ich war ohnehin am Ende der Leiter, wenn es darum ging, noch vor die Tür gehen zu dürfen. An Schreibtischen will ich nämlich nicht verhungern. Doch leider bin ich nicht multipel, sondern nur ein kleiner Inspector der CNP in Alicante, der den unrealistischen Ehrgeiz hat, die Welt ein wenig besser zu machen und deshalb stelle ich in meiner Naivität am Anfang zumeist auch etwas dumme Fragen, um an die höheren Ziele meines Daseins zu kommen:
„Noch mal! Was hat der gemacht?“
„Der? Wie kommst du denn darauf? Wer sagt denn, dass das nur einer war? Die, würde ich sagen!“
„Die? Woher weißt du? Hast du etwa schon jemanden in Verdacht?“
Mein Blick ging zu den weißen Buden. Drei von ihnen waren geschlossen, die anderen, durch einen Sichtschutz, der nicht viel taugte, von dem Geschehen abgeschnitten. Mit dem Kopf nickte ich in deren Richtung und rieb mir an der Nase herum, weil der Duft des offensichtlich alten Frittierfetts, der angebrannten Reiskörner und der wahrscheinlich nicht ganz echten Gewürze aus den provisorischen Restaurants an der Promenade, trotz des gehörigen Abstands, sogar noch hier die Schleimhäute reizte.
„... und von den traficantes, den Händlern da, hat keiner was mitbekommen. – Sensationell!“, stellte ich dabei fest und schniefte in eine Hand.
„Siehst doch, dass sie es mitbekommen haben, sonst hätten wir hier Freitagnacht, spätestens am Wochenende sicher die totale Sauerei gehabt.“
„Stell dich nicht so an! Ich meinte vor der ganzen Scheiße da“, sagte ich unwirsch.
Ich versuchte mir vorzustellen, was hätte passieren können, wischte die Hand an einer Socke ab und schaute im zugleich flirrenden wie sommerlichen Spiel der Schatten zwischen den Palmen und Verkaufsständen hin und her. Pablo und Ivan von der Policía Local hatten damit begonnen, Absperrbänder an Palmen, Büschen und herumstehenden Stühlen zu befestigen. Nebendran, zehn, höchsten fünfzehn Meter weiter, saßen im Schatten der hohen Palmen und unbeeindruckt von der großen Anzahl der Polizisten die bunt gekleideten Afrikanerinnen. Lässig, zumeist schwergewichtig, Kaugummis kauend und scheinbar gelangweilt auf viel zu kleinen Klappstühlen. In ihren Händen dünne, künstliche, mit Perlen und farbigen Bändchen geschmückte Zöpfe, die sie für ein paar Euros jungen Mädchen in die Haare flechten wollten, während Mama und Papa sich gleich nebenan eine der jetzt billigen aber zuvor angeblich sündhaft teuren Sonnenbrillen anschauten. Alle geklaut oder billigste Plagiate. Das Styropor nicht wert, in dem sie nun mit den Enden der Bügel steckten. Deren Verkäufer Verwandte der schwarzen Frauen sein mochten und sich meist zwischen diesen platzierten. Seit ein paar Jahren wundere ich mich, wie viele von ihnen mit den scheißbilligen Dingern Geld verdienen wollen. So viele Köpfe und sonnenempfindliche Augen kann es doch gar nicht geben. Dennoch treiben sich mindestens zwei Dutzend von ihnen Tag für Tag am Strand und zwischen dem Casa Carbonell, Plaza Canalejas und hier auf der Explanada herum.
Irgendwann hatten sie ihr letztes Geld ausgegeben, um die richtigen Leute, auch auf unserer Seite, zu schmieren, damit sie genau in diesem Dreieck landen durften. Nachdem sie Jahre auf ihrem Kontinent herumgeirrt waren. Na ja, ganz so einfach war es für die sicher nicht gewesen, aber meine Landsleute denken ganz anders darüber, beziehungsweise genau so. Die meisten von ihnen glauben, Spanien würde inzwischen aufgrund der bisher regelmäßig gewährten Amnestien Einladungen aussprechen. Aber wer von denen liest schon die langen Artikel in den Tageszeitungen, die alles erklären sollen, das Leben, die Umstände, die Entbehrungen, die Flucht, und das auch noch auf Seite Weiß-Gott-Wo. Da können El Mundo, El Pais oder die hiesige Infomación schreiben, was sie wollen, jeder der Zeitungskäufer winkt nur ab. Interessiert mich doch nicht. Und ich kann mich dabei nicht einmal ausschließen.
Komischerweise hatten die Africanos nun keine Scheu vor uns, im Gegenteil, eine jüngere und nicht ganz so schwere Frau in einem gelben und buntgemusterten Kleid hatte sich vor ein paar Minuten sogar extra einige Meter dichter an das Geschehen gesetzt und schaute jetzt möglichst ungerührt, dafür umso neugieriger zu uns herüber. Sie saß etwas steif auf ihrem Klappstuhl und trug in ihren Haaren die beste Werbung, nämlich die gleichen Zöpfchen, die sie in der Hand hielt. Nur fehlte ihr jetzt die Kundschaft. Doch das war ihr, wie den vielen Polizisten, egal.
Aber wenn die Kollegen der Policía Local an anderen Tagen speziell für sie und die übrigen Ramsch-Händler von mehreren Seiten anrückten, um die Aufenthaltsgenehmigungen oder andere Papiere der inmigrantes zu kontrollieren, nahmen alle Reißaus. Doch genau diese Kollegen hatten im Moment etwas anderes zu tun und blickten zum Teil aus zwanzig Meter Entfernung in ein Loch, genauso umweht von den Paella-Duftwolken der ziemlich teuren Brutzelstände weiter vorne. – Unter uns, falls Sie mal wegen des Festes hierherkommen sollten und Paella oder Arroz brut essen wollen, geht das besser und vor allem preiswerter. Wir haben jede Menge Kneipen und Pinten in der Stadt. Die alten Stadtviertel sind voll davon. Und jede von ihnen kann es besser. Einen Namen verrate ich Ihnen: Juan. Hinterm Ayuntamiento. Wenn er, beziehungsweise seine Mutter, gut drauf ist, steckt er jeden in die Tasche.
Die mit kleinen Steinen in drei verschiedenen Farben gepflasterte Schneise der Explanada zwischen den Palmen betrachtend, schaute ich wieder zu der von Uniformierten belagerten Verkaufsbude zurück, der mittleren der drei. Übermorgen, in der Nit del foc, würden um Mitternacht Zigtausende an dieser Stelle unterwegs sein, um an dem alljährlichen Spektakel so nah wie möglich teilzunehmen und sich dabei vielleicht noch Kleider und Haare zu versengen. Weil die mehr als mannshohen Feuerteufel und Drachen trotz der Absperrungen kreuz und quer durch die Massen tanzten und durch in ihren Ärmeln versteckten Leitungen zischende Flammen versprühten. Ein Donnerschlag in dem ganzen Rauch und Qualm, verbunden mit Feuer und Geprassel, wäre im ersten Moment dann nichts Ungewöhnliches gewesen. Hätte allenfalls Erstaunen und Bewunderung hervorgerufen. Denn jedes Jahr dachten sich die Organisatoren etwas Neues aus.
Für wenige, aber im Nachhinein unerklärlich lange Minuten, nur erstaunte Reaktionen, weiter nichts. Erst die anschließende Panik aufgrund der Wirkung einer solchen Explosion, nicht der Knall, wäre überhaupt ein Alarmzeichen für die Sicherheitskräfte gewesen. Allein bis diese sich dann organisiert hätten, wäre viel zu viel Zeit vergangen. Hätte eine riesige Anzahl von Leben gekostet. Durch ein derartiges Chaos schließlich noch schnell genug rettende Wege zu finden, unmöglich. Ich wollte mir das Ganze wirklich nicht vorstellen.
Von seinem Sockel drüben hatte mir gerade der bronzene Canalejas schulterzuckend und bestätigend zugenickt. Er, der ehemalige Ministerpräsident, den man vor knapp hundert Jahren wegen seines liberalen, aber zu halbherzig durchgeführten Programms einfach aus den Weg geräumt und über den Haufen geschossen hatte, weil er zwar den katholischen Pfaffen in den Hintern treten und deren Macht beschränken wollte, aber dabei die demokratischen Reformen vergaß. Trotzdem mochten ihn viele von uns. Jetzt blickte er wieder auf den Real Club de Regatas, den Wassersportclub und die im ruhigen Wasser dümpelnden Boote in der Marina. Mit denen er die angestrebte große Freiheit, nun jedoch draußen auf dem Meer, leicht finden könnte. Canalejas’ Gesichtsausdruck schien der Feststellung schon mal zuzustimmen. Siehste Junge, es kommt alles wieder, meine hingerichtete Leiche mal hundert und du weißt, wie es hier ausgesehen hätte. Und mit Demokratie hat das dann auch nichts zu tun. In der Tat, weiß Gott! Eine Mordssauerei wäre dieser Anschlag gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes. Nur, was der oder die oder wer auch immer damit bewerkstelligen wollten, ist natürlich zu so einem Zeitpunkt noch völlig unklar. Nirgendwo hing ein Bekennerschreiben mit den nötigen Erklärungen.
Aber nach allem, was in dem Loch vorgefunden wurde, war ein verheerendes Attentat geplant gewesen. Ein immenses Blutvergießen durch unvorstellbare Kaltblütigkeit. Eines mit einer gewollt großen Anzahl von Toten und Verletzten. Das war neu. Damit änderte sich die Ausgangslage. Dabei fielen mir die Berichte ein, die uns damals, während der Polizeiausbildung, in Ávila erreichten. Seinerzeit, im August 1989, flog in San Juan, einem Stadtteil von Alicante, auf dem Parkplatz des Supermarktes Pryca ein kleiner Lieferwagen in die Luft. Acht Menschen wurden in den Tod gesprengt und über zwanzig Menschen lebensgefährlich verletzt. Eine im Radio gemachte Äußerung, unbedacht herausgeplappert, führte damals zu der Annahme, es drehe sich um einen Anschlag der ETA. Wer den Parkplatz gesehen hatte, hielt diese Meldung für wahr. Dieser glich einer Verwüstung. Einem Bild aus einem Krieg, aus unserem Bürgerkrieg zu Beispiel. Stunden später war klar, nachdem in einem unfassbaren Durcheinander blutende Körper sogar in Einkaufswagen zu Ärzten gefahren worden waren, dass lediglich eine komplette und vollkommen ungesicherte Lieferung von Feuerwerkskörpern infolge der sommerlichen Hitze explodiert war. Aber was heißt schon lediglich?
Allerdings war die damals noch fälschlich genannte ETA dann Jahre später tatsächlich Schuld, als im Juli 2003 vor dem Hotel Bahia in der Gravina, unweit des Playa Postiguet und quasi am anderen Ende meiner Straße, ich war gerade in meine neue Wohnung gezogen und kaufte in einem der riesigen Einkaufszentren in Vistahermosa ein, fünfzig Kilo Sprengstoff für ein Chaos und zahlreiche Verletzte sorgten.
Diese Idioten kannten sich in spanischer Geschichte nicht aus, sonst hätten sie nicht ausgerechnet die Stadt und den Strand für ihre kruden Gedankenspiele ausgesucht, wo einst der Spanische Bürgerkrieg begann und durch dessen Verlauf das Schicksal vieler freiheitsliebender Menschen besiegelt wurde. Also auch oder vielmehr insbesondere, das der Basken. Auch wenn es hochgradig unvorstellbar war, fielen mir jetzt ETA, al-Qaida und somalische Piraten auf Rachefeldzug als erstes ein und erschienen mir als Täter im gleichen Moment wieder als reiner Schwachsinn. Denn der Bürgerkrieg war seit Jahren vorbei, die ETA rastete unabhängig der damals betroffenen Ortschaften und entgegen ihrer Versprechungen immer noch aus und Alicante war nicht Afghanistan oder ein anderer politisch empfindlicher Schauplatz. Wir hatten im Moment weiter nichts als eine gigantische Wirtschaftskrise zu überstehen. Darüber hinaus fehlten Bekennerbriefe, Videobotschaften oder vorherige Androhungen im Internet oder per Telefon. Auch das heute Morgen unter der Bude gefundene Waffenarsenal passte nicht. Alte spanische Handgranaten aus Francozeiten, ein selbst gebastelter Fernzünder, ein Kanister mit Benzin und ein kleinerer mit einer brisanten Komposition aus Düngemittel und Ammoniumnitrat. Zugegebenermaßen eine verdammt explosive Mixtur, wenn man sie in die Luft jagen würde.
Das alles lag meines Erachtens ziemlich durcheinander verteilt auf dem zerteilten Körper von Jorge Duol, eigentlich George Duol. Den aber jeder hier ohnehin nur Duela, Fassdaube nannte, wie ich ziemlich schnell erfuhr, weil er stets, ähnlich einem uralten Mann, mit rundem Rücken weit vornübergebeugt herumgelaufen war. Nur ohne Stock. Dabei war er nicht einmal fünfzig geworden. Achtundvierzig, um genau zu sein. Bis vor wenigen Tagen war er Besitzer des Explanada Puesto 47. Eine der weißen Verkaufsbuden auf eine der schönsten Promenaden Spaniens. Verkäufer von Tüchern, Kettchen, Ringen und Lederartikeln aller Art. Bis vor ein paar Stunden kannte ich nicht mal seinen Namen. Hatte ich nicht einmal abgespeichert, dass er ein Schwarzer war. Obwohl ich mir unlängst an seinem Stand ein dunkelbraunes, aus Leder geflochtenes Armband gekauft hatte. Weil so etwas mittlerweile jeder trug.
Vor ungefähr drei Tagen, plus minus einem, wenn ich die Verletzung am Kopf als entscheidend betrachte, meinte der Arzt, der, wie es die Vorschriften wollen, seinen Tod festgestellt hatte, was angesichts der Situation nicht sonderlich schwer gewesen war, hat man ihm diese Wunde beigebracht, und, weil es in diesem Moment keine Alternative gab und er dann besser in das ausgehobene Loch passte, mit einem scharfen Gegenstand, Axt, Säge, Machete, noch habe ich keine Ahnung, etwas kleiner gehackt. Ich betrachtete einen der abgetrennten Arme und bastelte ein paar, wahrscheinlich haltlose Vermutungen über das Geschehen zusammen. Vielleicht hatte er die Attentäter überrascht oder von dem Ganzen gewusst und etwas dagegen gehabt, vielleicht war er auch nur zu früh aufgetaucht und hatte ihr Vorhaben gestört. Es würde schwer werden, das herauszufinden.
Ich schau mir nicht gern Tote an. Auch nicht nach so vielen Jahren als Polizist, der gezwungenermaßen immer wieder mit Toten zu tun hat. Schon gar nicht, wenn sie zerstückelt sind und das Ganze aussieht, als würde ich aus dem Kühlregal ein folienverpacktes und zusammengehacktes Hühnchen holen. Abgetrennte Flügel und Schenkel, aus denen noch die Knochen ragen und obendrein noch das ganze Blut an den einzelnen Teilen klebt. Und in einem Menschen sind viele Liter davon. Leichen können mir auch nicht die Dinge erzählen wie diesem Doktor vorhin. Weder durch die Wunden, die man ihnen zugefügt hat, noch durch die angeblich sichtbaren Ursachen. All diese Details sind schlechte Zeugen für mich. Ich bin ein gewöhnlicher Inspector und kein Pathologe oder so etwas. Ich weiß, was Forensik ist, kenne ihre Bedeutung für unsere Arbeit, muss ich deswegen hart gesotten sein oder bereits ganze Theorien aufstellen können? Wie, warum und in welcher Reihenfolge? Todesursache war eine Axt, aus einer linken Hand von schräg oben geschwungen oder ähnliches?
Auch bin ich nicht durch regelmäßiges Zuschauen bei Leichenöffnungen in solchen Dingen geübt. Ach, schauen sie sich das mal an, unterhalb der Schläfe ist noch ein frisches Hämatom. Er muss beim Fallen mit dem Kopf irgendwo aufgeschlagen sein. Ein Zeichen dafür, dass er nicht gleich tot war und noch einige Zeit gelebt hat. Leichenflecken sehen nämlich anders aus. Die gibt es nicht so isoliert. Meine Erfahrungswerte greifen genauso wenig auf eine unglaubliche Anzahl von Toten zurück. Wir leben zwar in unsicheren Zeiten, aber Morde finden hier nicht täglich statt. Die letzten Toten, mit denen wir uns beschäftigen mussten, waren alte Menschen, die an Stränden der Umgebung leider dem heißen Wetter zu Opfer fielen. Und mit dem letzten Mord hatte meine Dienststelle nicht einmal was zu tun. Vor mir lag erst Nummer Acht der echten Morde in dieser Stadt des laufenden Jahres. Damit sogar zwei unter Vorjahr.
„Was ist denn das in der Hand?“, fragte ich, nachdem ich mich mit einem Taschentuch vor dem Mund zu dem Arm und den nebeneinandergelegten Körperteilen hinuntergebeugt hatte und es schaffte, nicht zugleich das Gesicht des Toten anzusehen. Gerade hatten sie den Kanister mit Benzin entfernt, der darauf gelegen hatte. Ich wendete meinen Kopf hin und her und versuchte mich dabei nur auf den Inhalt der Hand zu konzentrieren, auf ein kurzes Stück geflochtenes Leder, obwohl ein Blitzlichtgewitter genau in diesem Moment jeden Quadratmillimeter des Lochinhaltes besonders gut ausleuchtete. Für mich sah es aus wie ein Armband. Eines wie ich es hatte und wie es von fast allen in den Puestos hier verkauft wurde.
„Vielleicht könnte der Herr seine Nase und Finger da wegnehmen?“, meckerte mich ein wichtigtuerischer Jüngling von der Seite an und holte mich mit seinem rüden Ton aus der Welt der Toten ins Diesseits zurück. Ich musterte ihn kurz von oben bis unten und hätte fast laut gelacht. Er sah zum Piepen aus. Plastikhandschuhe an den Fingern, Plastiktüten über den Füßen und an den Kopf geklatschte Haare. Was hatte er in die reingeschmiert? Olivenöl, Bratfett oder Allzeitschleim. Dazu trug er eine Weste, die so mit Werkzeugen ausgestopft war, als sei er ein Archäologe auf Ausgrabungstour irgendwo mitten in Ägypten und keiner von der científica.
Kein Fall, bei dem von der Spurensicherung auch nur ein Mal dieselben Leute kamen. Dauernd hatten sie neue Hiwis, billige Jünglinge von der Uni, die mal wichtig sein wollten. Deshalb nahm ich ihn mit aller Entschlossenheit ins Visier. Zumindest den da hatte ich noch nie gesehen. Meinen Blick passte ich entsprechend an und richtete mich wieder auf. Ich feuerte mit meinen Augen eine volle Breitseite ab und deutete gleichzeitig mit unbestimmten Handbewegungen auf herumliegende Sachen.
„Vielleicht werft ihr dafür ein Auge auf das, was ihr macht und haltet es schön sauber per Kamera, Diktiergerät und Protokoll fest. So wie man das mal gelernt hat. Dass er nämlich was in der Hand hat, steht hier nicht auf eurem Zettel ...“, ich warf ihm das Klemmbrett vor die Füße, das vorher auf der Theke des Verkaufsstandes gelegen hatte, „... nachher buddelt ihr ihn aus und schmeißt das Ding weg. Ach, das ist ja nur ein ...“
„Halt mal! Stopp! ¡Tranquilo! Ganz ruhig! Hier wird gar nichts weggeschmissen.“
Das Bübchen richtete sich auf und guckte mich mit seinen kleinen Augen genauso angriffslustig an wie anno dazumal George Foreman, von seinem Schäferhund begleitet, die Journalisten vor seinem Kampf gegen Muhammad Ali mitten im Dschungel von Afrika. Und ich fühlte mich nun mindestens so gut wie Ali. Denn solche schlau plappernden Milchgesichter waren für mich die reinsten Banausen und die besten Aufputschmittel, um wieder Boden unter die Füße zu bekommen. Vor allem, wenn ich sehe, dass so ein Typ Plastikbeutel hat, in die er am Tatort alles zusammen, und damit meine ich alles zusammen, als sogenannte Spurensicherung hineinwirft. Dann kann ich die Leiche auch gleich mit dem Kot der über uns kreisenden Möwen beschmieren und behaupten, das Opfer sei auf hoher See umgebracht worden. Die halbe Portion würde nicht einmal die erste Runde überstehen.
„Wo ist Antonio?“, fragte ich mit dem ungeduldigsten Vibrieren in der Stimme, das ich zur Verfügung hatte.
„Was willst du denn von dem?“
„Pass mal auf mein Junge ...“, fing ich an.
Sie müssen jetzt noch wissen, ich bin wahrlich kein Riese, aber dank meines seit Jahren langsam sprießenden Bauchs, der mir leider inzwischen wieder eine neue Kleidergröße beim Kauf von Hosen abverlangt und mich nun knapp über vierundachtzig Kilo wiegen lässt, bei gerade mal eins sechsundsiebzig, kann ich zu einem imposanten und einschüchternden Gegenüber werden. Hätte ich jetzt noch eine Brille gehabt, hätte ich diese, um meine Autorität zu unterstreichen, in eine Hand genommen und mit der anderen meine Nasenwurzel massiert. So durchlöcherte ich seine Stirn lediglich mit meinem Blick und sagte, „... ich bin zwar nur ein kleiner Inspector hier in der Stadt, aber wenn ich Auszubildende duze, bin ich immer noch für diese ein Dienstgrad, den man anspricht und siezt. Und bevor du jetzt irgendeinen Blödsinn redest, sagst du mir, wo Antonio ist!“
Aber was regte ich mich auf? In eineinhalb Minuten würde der da Vergangenheit für mich sein. Sein Gesicht würde ich morgen schon nicht mehr wiedererkennen und er könnte in seiner Uni über mich herziehen, wie er wollte. Dieser Nachwuchsarchäologe musste ja nicht unbedingt wissen, dass ich im normalen Leben eher ein Weichei war, das Spinnen in der Küche oder über der Dusche mehr aus Respekt über ihr erschreckendes Aussehen als aus Wissen über ihren Nutzen leben ließ. Mein Gegenüber hatte schnell gelernt und deutete zu der Konzertmuschel schräg gegenüber, keine zwanzig Meter von uns weg. Vielleicht wollte er mich auch nur loswerden. Ich nickte leicht und tippte im Vorbeigehen Primo auf die Schulter und machte ihm ein Zeichen.
Pedro Primogénito de Madre, was übersetzt in alle Sprachen der Welt Pedro Mutters Erstgeborener heißt, schaute mich etwas irritiert an. Ein für ihn normaler Blick. Denn er erwartet in solchen Situationen immer den üblichen, meist seltsamen Kommentar von mir, während er ja ganz allein gelassen tief in den Ermittlungen steckt. Um ihm keine Chance für eine dusselige Bemerkung zu geben, las ich mit tippendem Zeigefinger, den schwarz gestickten Namenszug auf seinem Uniformblouson. Primo hingegen ließ er sich nur von seinen Freunden nennen, weil er seinen vollen Namen, er hieß tatsächlich so, dämlich fand. Dass er damit auch an den Gründer der Falange, Primo de Rivera y Orbaneja, erinnern könnte, war im schnurzegal. Ich bin Polizist und nicht Historiker! Jeder, der ihn hörte, fragte nämlich, ob er einen auf den Arm nehmen wollte und Pedro schüttelte den Kopf. So machte man das manchmal bei uns in Kolumbien, wenn keiner 'ne Ahnung hat, wie der Vater heißt, muss ja was in den Papieren stehen, kann ja nicht jeder deswegen Sanchez heißen, war dann seine Antwort, von der keiner so richtig wusste, ob sie der Wahrheit entsprach. Dabei war alles an ihm, außer seiner Mutter, nicht aus Kolumbien und sein Nachname im Endeffekt nicht schlechter als meiner: Xarneracomte. Alex mit Vorname. So heißt normalerweise auch keiner bei uns. Xarneracomte, meine ich.
Primo ist aber nebenbei nicht nur mein Kollege, sondern auch Kumpel, Kumpan und Halbbruder. Einer für dick und dünn, für Bier und Wahrheit. Für Schulterklopfen und Schienbein. Für Alltag, Beruf und manchen Sonntag. Freund wäre mir in diesem Zusammenhang schon zu wenig. Solche tragen selten Verantwortung, wenn’s wirklich drauf ankommt. Du weißt ja, falls du Hilfe brauchst, kannst du mich ja anrufen, wenn du willst. Wissen tue ich viel, aber Sätze, die mit falls anfangen, höre ich nur – und schwups sind sie schon vergessen. Deren Inhalt kümmert mich nicht.
Seit Jahren sind wir für die meisten Stunden des Tages ein unzertrennliches Team, siamesisch veranlagt sozusagen, sowohl durch den Job auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen, als auch mit Spaß an der Freud. Die haben wir vor allem nach jedem dingfest gemachten Halunken. Und das ist ein Spaß, der nie ein Ende haben wird. Da gleicht unser Beruf dem der Totengräber, der Nachschub ist gesichert. Eine Festnahme ist für uns gleichbedeutend mit einem Sieg unserer beiden FCs, Barcelona und Valencia. Es fehlen nur die Fähnchen und Schals. Dann bringen wir laut und johlend bis weit nach Mitternacht die Wirte und ihre Gäste durch unsere heldenhaften Schilderungen zur Verzweiflung und setzen uns aufgrund der Wirkung verschiedenster Glasinhalte für ein, zwei Tage außer Gefecht. Im Übrigen die einzigen Tage, an denen wir uns nicht sehen.
Während solcher Feierlichkeiten versuchen wir dann des Öfteren, unsere zweite Belohnung abzuholen. Vielmehr ich versuche es und Primo schafft es. Immer wieder. Man muss nämlich nun noch wissen, dass ein solcher Alltag uns beiden bisher keine echten, vor allem dauerhaften Liebesverhältnisse bescheren konnte. Wie auch, außer wir verliebten uns in eine attraktive Taschendiebin, Drogendealerin oder Mörderin. Die gut aussehenden Frauen in der Dienststelle waren nämlich längst in festen Händen oder sogar unter der Haube. Da will man nicht unnötig neue Gefechtsfelder eröffnen. Auch wenn alle meinten, das seien nur dumme Ausreden. Draußen liefen doch genug herum. Ja doch, wir waren ja schon dabei.
So mustern wir von unserem Platz an der Theke die Frauen für einen anstehenden Zeitvertreib und locken die eine oder andere mit einem gefüllten Glas oder einem Augenzwinkern zu uns herüber. Theoretisch haben die chicas freie Wahl, also auch ich eine Chance, doch in diesen Momenten wird hundertprozentig Primo ausgewählt. Zudem trägt er einen gefährlichen Virus in sich, den keine Medizin behandeln kann. So leidet er geduldig an chicadependencia, an Mädchensucht.
Schauen Sie sich ihn nur an, einen akkuraten, auf vier Millimeter gestutzten Vollbart, ein Kreuz wie ein Preisboxer, ein Lächeln mit so vielen zusätzlich lächelnden Fältchen, dass man beim Zählen außer Atem kommt und die Besinnung verliert – und nicht ein Gramm Fett. Auf seinem Bauch kann man sicher Kartoffeln hobeln oder die Finger weich rubbeln. Dabei tut er nichts dafür. Außer an Ostern mit anderen starken Männern die schwere Monstranz durch die schmalen, mit Kacheln gekennzeichneten Gassen und steilen Treppen der Barrios zu tragen. Cuesta abajo y cuesta arriba a hombros de costaleros1 … Und, wie schon gesagt, ständig so freundlich zu grinsen. Ich hingegen gleiche bestenfalls einer nach oben hin, also zum Kopf hin, gleichmäßig schlanker werdenden Dorischen Säule. Bin optisch also unterlegen. Darum hat er dauernd eine weibliche Begleitung und ich – nie. Das Einzige, was mich besänftigt, ist, dass er eigentlich schon alle guapas der Stadt durchhaben müsste, in den nächsten Runden also ich an der Reihe sein sollte. Seine Vollzugsmeldungen versiegen nämlich allmählich und kommen nicht mehr nach jedem zweiten oder dritten Tag. Und tatsächlich sehe ich einen ganz leichten Silberstreif am Horizont und der hat nichts mit freier Wahl und den diversen Glasinhalten zu tun.
Wie auch immer, er schaffte es bislang nicht, dass am zweiten oder dritten Morgen dieselbe Schöne an seinem Frühstückstisch saß. Zum Ausgleich oder Erholen, je nachdem wie man es nimmt, steht Primo am Wochenende, wenn es denn der Dienstplan gestattet, unterhalb der Straße nach Murcia, ganz in der Nähe des ETAP-Hotels, nur ein paar Kilometer von hier entfernt, zwischen Steinen, aufgehäuften Trümmern und angeschwemmtem Müll mit seiner Angelrute in der Mündung des an 360 Tagen im Jahr ausgetrockneten Amargo am Meer und wässert wohl lediglich den Haken. Denn Geschichten über brauchbare Fänge, die er zudem noch genüsslich verspeist hätte, sind mir bis heute unbekannt. Es wären ja auch nur kleine Fische und keine Meerjungfrauen.
Das alles habe ich Ihnen jetzt aber nur erzählen können, weil ich wieder mal auf ihn warten musste. Es dauert leider immer, bis er sich von weiblichen Gegenübern fortreißen kann. Jetzt musste ihn gerade eine junge Polizistin aushalten. Und da er sich nicht umdrehte, zupfte ich ihn am Ärmel und zerrte ihn mit.
„Falls du Lust hast, kannst du mitkommen, wenn du willst?!“, sagte ich im Nebenbei.
Keine drei unbeantworteten Fragen von ihm später standen wir endlich bei Antonio Sanchez, der auch tatsächlich so hieß. Seines Zeichens einziger beständiger Bestandteil der über vierzigköpfigen, untersuchenden, pathologischen Meute in der Stadt und der Einzige von denen, der fähig war, im größten Getümmel die Übersicht zu behalten, ehe die Nassauer der Staatsanwaltschaft jedes Körnchen nochmals umdrehten und für ihre Zwecke ganz anders interpretierten. Für mich war es in so einem Augenblick wichtig, seine Meinung zu hören. Denn am Ende waren wir es, die dann für die Löcher in den Leichen und deren Aufklärung zuständig waren.
Antonios Familie war prädestiniert für derlei Dinge. Er hatte es gewissermaßen in den Genen. Sein Vater war Leiter eines Institutes für forensische Chemie in Madrid und seine Mutter dort im Hospital Universitario Ramón y Cajal in der Chirurgie tätig. Selbst sein Bruder hatte in Palma de Mallorca, also der Stadt auf diesem Touristenfloß im Mittelmeer, keinen besseren Einfall gehabt und den gleichen Beruf gewählt wie wir. Und damit die Parallelen noch deutlicher werden, sei gesagt, der auf Mallorca hat wie Primo deutlich mehr Erfolg bei den Frauen als ich. Zum Beweis zeigte Antonio uns unlängst Bilder der Hochzeit von seinem Bruder Miguel und Inés. Ist doch eine scharfe Braut, findet ihr nicht auch? Fast so gut wie meine Alícia. Spätestens seit diesen Bildern finde ich lange Haare klasse. Sie geben einem schönen Gesicht den würdigen Rahmen und einer schönen Frau das angemessene Ausrufezeichen. Mit ihnen kann sie nach Lust und Laune spielen. Vorhang auf, Vorhang zu. Haare hoch. Zopf. Knoten. Verführen und verstecken. Großer Auftritt, umtoster Abgang. Am liebsten hätte ich ihm eines der Bilder abgeschwatzt, zum Träumen und Sehnsucht haben. Zum Beispiel das, auf dem ihr Kleid im Licht einiger Kerzen fast genauso golden glänzte wie die Haut in ihrem von Tränen benetztem Gesicht, denn das machte mich besonders wehmütig. Und das Warum erklärt sich im Folgenden von alleine.
Damit hätte ich auch vorerst alle wichtigen Personen, bis auf eine, erwähnt: Primo, Antonio, den alle Sunny nannten, und mich. Ich weiß, es war nun alles etwas atemlos erzählt, aber wie schon angedeutet, kommen in den ersten Minuten eines neuen Falls und vor allem eines solchen Falls, so viele Dinge auf einen zu, dass man selber kaum mitkommt und manches auch durcheinanderwirbelt. – Apropos mitkommen, wir sind während meiner Ausführungen bei dem besagten Musikpavillon angekommen. Wenden wir uns also wieder dem Fall zu.
„Dein Hiwi ist nicht besonders firm in euren Tätigkeiten?“, frotzelte ich und Sunny, also Antonio der Leicheninspecteur, verdrehte die Augen.
„Das liegt wohl eher daran, dass du manchmal recht erfolgreich nerven kannst, Alex.“
„Na hör mal, guck dir den Inhalt seiner Plastikbeutel an. Da liegen Dinge mit wahrscheinlich wichtigen Gencodes, also Kippen und Stofffetzen, neben Straßenstaub, den keiner interessiert, und Stücken der Zündschnüre. Oder soll er gleich beim Vertuschen helfen?“
Augenbrauen heben, Stirnrunzeln oder den Mund verziehen, sind neben den irritierten Blicken die zweithäufigsten Reaktionen meiner Gesprächspartner auf meine Entdeckungen, Anmerkungen und Beiträge. Sie können sich nun eine davon aussuchen, bis Sunny antwortet:
„Deine Gencodes sind schon längst auf dem Weg ins Labor und die Stücke der Zündschnüre sind Verschlussdrähte für die Tütchen. Er sammelt nur noch Vergleichsproben ein, von denen ich wie er überzeugt bin, dass sie weder mit dem Opfer noch mit dem Täter etwas zu tun haben. Umfelderfassung nennt man so was, falls du es noch nicht weißt. Damit wir eingrenzen können, wo die Täter überall herumgefuchtelt haben und wir vielleicht auch noch herauskriegen, wo sie vorher waren. – Und glaub ja nicht, dass das hier lange dein Fall sein wird. Die Hyänen der Staatsanwaltschaft sehe ich schon in den Startlöchern stehen. Hier ist unter Umständen politischer Zündstoff drin. Hast du dir mal die Knallbonbons angeschaut?“
Ich reagierte mit einer der anderen drei Verhaltensweisen und fügte leise zu Primo gewendet hinzu:
„Nein, aber das Teil in der Hand des Toten haben die nicht erfasst.“
Während also weiterhin in den Teilen der Leiche und im Erdreich herumgestochert wurde, begannen Primo und ich mit unserem klassischen Pensum der Befragungen. Duela hatte links und rechts von seinem Stand genug Mitstreiter und Kollegen, die Souvenirs und ähnliches unter die Leute bringen wollten. Daher gab es vielleicht auch den einen oder anderen, der seinen Kommentar zu dem ganzen Wirbel loswerden wollte. Leider ist der zeitliche Aufwand, auf diese Weise an brauchbares Material zu kommen, unverhältnismäßig zeitraubend. Leider jedes Mal. Bis einem der selbsternannten Zeugen wieder ein entscheidendes Detail eingefallen ist, sind häufig genug Tage vergangen. Das kenne ich von vielen anderen Fällen. Plötzlich klingelt eine Woche später das Telefon und Señor X oder Señora Y möchte noch schnell die neueste Erinnerung mit einem ganz persönlichen Verdacht, Geschichtchen oder einem an einen Beweis grenzenden Einfall garnieren.
Ich atmete tief ein und machte ihm ein Zeichen. Dann nahm ich mir die Buden Richtung Plaza Canalejas vor, auch in der Hoffnung etwas mehr Abstand zu dem Paella-Nebel zu bekommen, und Primo die zur anderen Seite. Schon der erste Puesto war ein voller Erfolg. Ein Engländer, der vor Jahren in Alicante hängen geblieben war und sich nun optisch mit einem Cowboy-Hut und einer Fransenweste an die neue Heimat angepasst hatte, meinte voller Überzeugung: Duela sei ein unheimlich netter Kerl gewesen, freundlich und hilfsbereit. Aber da er ja ein Schwarzer war, hat ihn sicher ein Teil seiner Vergangenheit eingeholt.
„Die brauchen doch für ihren Krieg da unten dauernd Waffen, wahrscheinlich haben den Oppositionelle oder Geheimdienstler mit seiner eigenen Munition in die Luft sprengen wollen. – Wir wissen doch alle, was über solche Theken gehandelt wird.“
Also auch über deine, dachte ich.
„Sie wissen, dass er bereits vorher ermordet wurde?“, sagte ich.
„Ach, das ändert doch an den ganzen Tatsachen nichts.“
Bevor ich mich auf eine Diskussion einlassen musste, ich hätte ja tatsächlich fragen können, was er selbst so verkauft, bedankte ich mich und tat, als wenn ich nun einen halben Roman aufschreiben müsste. Der Cowboy wuchs mit jeder Zeile, die ich vorgab zu schreiben, um einen halben Zentimeter und meinte:
„Jederzeit wieder. Gerne!“
Ich steckte den Zettel mit den notierten Sachen, die ich heute noch irgendwann einkaufen wollte, unter die anderen und lächelte den Auskunftsfreudigen an. Duela, ein unheimlich netter Kerl, war auch an den nächsten beiden Ständen die Standardbeschreibung. Und, der hat ja auch schon viel erlebt.
„Ein richtiger Abenteurer war der ja. Drei Jahre durch ganz Afrika ist er gezogen. Ganz alleine. Aber bei uns hat er es ja jetzt gut. Er arbeitet auch fleißig. Ich glaub, der war noch nie krank. Stimmt’s, Alfonso?“
Alfonso nickte und fügte schüchtern hinzu:
„Eigentlich schade um ihn. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass er so krumme Dinge gemacht hat. Der war doch mittlerweile Spanier wie wir.“
In einem Buch, das ich gelesen habe, durfte der Inspector an einer ähnlichen Stelle schreien, um sich zu beruhigen. Aber ich glaube, Sie verstehen auch so, was ich vorher mit Señor X und Señora Y meinte.
Ich ging noch eine halbe Stunde von Stand zu Stand und schrieb hier und da ein paar Sachen auf. Nur ein Mal hörte ich genauer hin, als am letzten Stand von einem Mann mit einer Aktentasche berichtet wurde und der sich erst letzte Woche länger bei Duela aufgehalten haben soll. Die etwas alternativ verkleidete Frau war die Einzige, die ihn gesehen hatte und behauptete, er hätte einen Umschlag eingesteckt. Das musste noch nichts Ungewöhnliches sein, aber ein Kettchenkäufer war der sicher nicht gewesen.
Zweihundertachtundsechzig der über sechseinhalb Millionen kleinen roten, weißen und schwarzen Steinchen hatten sie quer zu den farbigen Wellen des Mosaiks unter der Bude herausgeklopft. Damit genau die zweihundertachtundsechzig Steine, die überhaupt auf dem über sechshundert Meter langen Teilstück der Explanada fehlten und dadurch eine Fläche von circa einhundertfünf auf fünfundsiebzig Zentimeter. Die wiederum war bis zu fünfundachtzig Zentimeter tief ausgehoben worden. Den Inhalt hatten sie entweder zum Teil mitgenommen oder entsorgt. Womöglich im Hafenbecken. Denn in den Kartons und Eimern unter der Verkaufstheke waren höchstens ein Fünftel des Erdreichs beziehungsweise des Unterbaus. Mehr Platz war auch nicht vorhanden. Denn in dem Loch hatten sie Duols Beine unter einem Abwasserrohr nebeneinander gequetscht, daneben den Oberkörper mit dem Kopf. Darüber liefen irgendwelche Strom- oder Telefonleitungen. Da, wo eine Lücke war, waren die alten Handgranaten hineingestopft. Dann hatten sie noch ungefähr zwanzig Zentimeter Luft nach oben, es reichte für die Kanister und die zwei Arme, die sie jeweils an ein Ende quer zu den anderen Sachen gelegt hatten. Um die Fläche eben zu machen, waren die übrigen Löcher mit dem ausgehobenen Erdreich aufgefüllt. Darüber lag ein Holzrost und auf ihm ein Teppich. Bevor Duol angefangen hätte, seinen Verwesungsgeruch durch all das hindurch, nach oben zu verteilen, wäre er in die Luft geflogen. Keine Ahnung ob Antonio und der Archäologe dann noch hätten feststellen können, dass man ihn zuvor gevierteilt hatte.
Herausgekommen war die Sache nicht durch aufmerksame Passanten, Händler oder afrikanische Brillenverkäufer, sondern weil ein Hund am untersten Rand der Budenwände wie verrückt zu schnüffeln angefangen hatte und von den kleinen Marmorsteinchen etwas aufleckte. Als sich endlich der Hundebesitzer um seinen Köter kümmerte, begann der Hund auch noch laut zu bellen und zwischen den Passanten herumzuspringen. Das Tier ließ sich nicht beruhigen und der amo, ein militärisch wirkendes Herrchen rief einen Mann eines privaten Sicherheitsdienstes zu sich, der dabei war Absperrungen für die Nacht der Feuerspuckervorzubereiten. Als sie endlich den Hund zur Seite nehmen konnten, sahen sie eine verdächtig rötlich braune Flüssigkeit unter der weißen Wand der Bude nach draußen fließen. Keiner von ihnen traute sich das auszusprechen, was er nun dachte und erst recht nicht hinter die Wände der Bude zu schauen. Also gaben die beiden Herren ihren gerade erhaltenen Joker weiter und verständigten die nächste Dienststelle. Nachdem die ersten Polizisten das Vorhängeschloss aufgebrochen hatten, war schnell klar, was passiert war.
Von einem Laster der Stadtreinigung war mit Hochdruck Wasser zum Säubern auf die Explanada gesprüht worden, war auf der einen Seite unter die Bude gelaufen und hatte Duelas Blut in der Grube aufgeweicht und mit Verzögerung zur anderen Seite herausgespült. Der Hund, eine Terrierrasse, hatte es erschnüffelt und reagierte artgerecht. Sein Herrchen dagegen verlor allen militärischen Drill und übergab sich, als er neugierig den Polizisten über die Schulter geschaut hatte zwischen zwei Palmen zur Freude einiger speisender Gäste in der gleich danebenliegenden Bar.
Erster angewendeter Merksatz, um möglichst bald an das Ende einer Ermittlung zu gelangen, ist für Primo und mich schlicht und einfach Geheimniskrämerei. Mehrere Erfahrungen hatten dazu geführt und eine Gewohnheit daraus werden lassen. Manche der Kollegen sprudeln oftmals wie ein Brunnen und wundern sich darüber, wohin überall Wasser dann fließen kann. Daher belassen wir es bei stillem Sichten und Sammeln von Fakten und seien sie auch noch so geringfügig und unscheinbar. Wenn keiner weiß, wie weit man ist, kann keine Lösung schon falsch sein. Decke nicht den Tisch, bevor du gekocht hast, würde meine Mutter sagen. Häufig reicht es, sich dumm anzustellen. Denken Sie nur an das Bändchen. Frühzeitig versuchen wir mit dem, was wir zusammengetragen haben, ein erstes größeres Stück des Puzzles zusammenzusetzen. Wir halten keine Details fest, schreiben nichts auf, trotz des Blocks den ich immer dabeihabe und in unseren Berichten ist zunächst keine Zeile darüber zu lesen. Die ganzen Ergebnisse behalten wir einstweilen für uns. So kann keiner abschreiben, Anmerkungen hinterlassen oder sich mit doofen Fußnoten wichtigmachen. Wir glauben, so einen größeren Spielraum für Lösungsansätze zu haben. Wir fantasieren uns, Dank eines guten Bauchgefühls, gewissermaßen ans Ziel. Dafür setzen wir uns für ein paar Minuten ab, verlassen den Tatort und sinnieren darüber, wie wir mit dem Gesehenen, sprich unserem individuell erworbenen Wissen weitermachen.
Auch jetzt tauschten wir an dieser Stelle einfach einen Blick und gingen bei José, dem Bronzenen, über den Zebrastreifen auf die andere Straßenseite der Explanda hinüber. Rechts von ihm hatten im Parque de Canalejas die ersten Kinder die Spielgeräte erobert. Keines von ihnen interessierte sich für die Blaulichter und Polizisten, die den Kreisverkehr um die Statue bevölkerten. Die waren zu alltäglich. Sie fuhren lieber auf Plastikpferden und Kutschen im Kreis oder schaukelten sich schwindelig. Wäre ein Räumkommando mit Baggern und Lastern angerückt, hätten zumindest die Jungen neugierig geguckt. Aber die stoisch blinkenden Blaulichter der Einsatzfahrzeuge waren nicht ungewöhnlich genug. Nicht für diese modernen Kinder, die im Gegensatz zu meiner Kindheit, kaum noch Räuber und Gendarm spielen.
Drüben setzten wir uns dann auf den Rand der Promenade. Unter unseren Füßen schwappte das Wasser der Marina in seinem ständig unappetitlichen Grün. Ein paar Sekunden starrten wir auf die kaum bewegte und etwas milchig glänzende Fläche. Trotz aller Bemühungen trieb an manchen Stellen ein schimmernder Ölfilm herum. Wir beobachteten eine Plastikflasche, die zur Hälfte mit einer seltsam gefärbten Flüssigkeit gefüllt vor uns herumdümpelte, während einige kleine Fischchen versuchten, den Fuß der Flasche durchzubeißen. Der Blick von unten durch das Wasser musste wohl verlockender sein. Das Etikett verkündete eine ausländische Marke in unbekannten Buchstaben.
„Mord oder Kollateralschaden?“, wollte ich von ihm wissen.
„Ich denke Letzteres. Mord funktioniert anders.“
Primo hob eine Hand und zielte mit seinem Zeigefinger auf eines der Boote an den Stegen und setzte ein Poff hinzu.
„Vielleicht hat ihn das mit dem Nitro gestört oder mit dem Fernzünder. Möchte zu gern wissen, wie die an das Zeug gekommen sind.“
„Manchmal bist du wirklich ein Einfaltspinsel aus grauer Vorzeit. Schon mal was von Internet gehört?“, maulte er.
„Ach, und da kann man das so einfach bestellen? Warum gibt’s dann eigentlich noch 'ne Rüstungsindustrie? Wenn Hans Wurst das Zeug doch schon ganz alleine herstellen und vertreiben kann.“
„Weil Hans Wurst zwar vielleicht einen Keller hat, um das Zeug zu lagern, aber keine Technik für ein sauberes Nitrieren besitzt. Die brauchst du nämlich, wenn du deine Dynamitstangen oder Nitratzünder selber machen willst.“
Ich verzog mein Gesicht. Im gleichen Moment rammte er mir seinen Ellbogen in die Seite und zeigte auf die Bootsstege.
„Ich zeig dir was!“
Ein Mundwinkel versuchte in seinem Gesicht ein Grinsen und ich kapierte sofort. Tat zumindest so. Das ist eine relativ nützliche Verhaltensweise, wenn man mit Primo zusammenarbeitet.
„Also auf“, entgegnete ich daher wie selbstverständlich, schaute zu den Fresstempeln auf der anderen Seite der Marina hinüber und wir gingen mit zackigem Schritt über die L-förmige Mole zu dem kleinen Wärterhäuschen, das fast an deren Ende gegenüber den Fisch-Restaurants stand. Unterwegs rätselte ich über Primos Einfall, den er mir nun zeigen würde. Keine zehn Minuten später war mir noch nichts eingefallen, aber dafür hatten wir ein kleines, volierenartiges Ding erreicht. Voll verglast. Es war höchstens doppelt so groß wie der Rettungszylinder, den sie letztes Jahr bei dem Grubenunglück in Chile gebraucht hatten. Wie praktisch! Bei der aktuellen Hitze ein Traum von Arbeitsplatz. Ein Typ von der policía portuaria ignorierte uns, als wir an ihm und seinem trockengelegten Aquarium vorbeigingen. Er zog es stattdessen vor mit einer Hand als Schirm vor seinen Augen zu dem Aufgebot der Uniformierten vor den Puestos zu stieren. Als wir das Ende des Stegs erreicht hatten, waren wir wieder bis auf achtzig Meter an unseren vorherigen Sitzplatz herangekommen. Wir waren zwar nahezu einen Kilometer gelaufen, aber bis auf diese wenigen Meter fast im Kreis.
„Allein die Distanz verwischt den Weg jedes Typen, der von hier zur Explanada läuft“, meinte Primo und deutete mit ausgestrecktem Arm auf die Strecke, die wir zurückgelegt hatten.
„Und was soll der deiner Meinung nach hier gemacht haben?“
„Zum Beispiel einen Knopf drücken. Da drüben liegt immerhin der Empfänger von einem Fernzünder.“
„Ach.“
„Tu doch nicht so! Der Laden fliegt in die Luft und drei Sekunden später rennen alle um ihr Leben. Und wahrscheinlich nicht in die Richtung, die er gerne hätte. Da mischt er sich lieber hier unter die Leute und Tschüss.“
„Er könnte aber auch mit dem Boot wegfahren, wenn du das meinst“, wendete ich ein.
„Niemals!“, widersprach er vehement, „der ist zu Fuß weg. Erstens ist jedes Boot hier fein säuberlich registriert. Ankunft, Eigner, Abfahrt, was weiß ich. Und zweitens würde es daher auffallen, wenn einer zur gleichen Zeit rausfährt, spätestens vorne bei der Ausfahrt. Dann wäre der Pier dort ruck zuck mit Polizisten voll. Wenn du den verschlafenen Kerl da gleich fragst, bestätigt der dir nichts anderes, als dass alle Boote sauber gemeldet sind und seit Tagen hier liegen. – Nein, das hatten die ganz einfach vor. Bei dem ganzen Zinnober, hopsenden Drachen und so, wäre der unbehelligt hierhergekommen, hätte seine Fernbedienung gedrückt und genug Zeit gehabt, in dem Chaos ganz gemächlich zu verschwinden.“
„Und?“, meine Begeisterung über diese Feststellung hielt sich in Grenzen.
„Wie und?“
„Für diese Erkenntnis habe ich nun Blasen an den Füßen.“
„Warts ab!“
Primo machte einen Schritt nach vorne und bückte sich neben einen der Poller runter. Dann fuhr er mit einer Hand unter dem Rand des hölzernen Stegs zwischen zwei Booten entlang. Auf den Knien vorwärtskriechend untersuchte er mehrere Zentimeter der Unterseite. Derweil sinnierte ich über seine turnerische Einlage. Gerade als ich zu dem Ergebnis kam, sie sei total bescheuert, sprang er auf und hielt ein schwarzes Teil in seiner Hand.
„Nä, Primo, das war jetzt zu einfach. Das hast du vorher dahin getan.“
Wild an meine Schläfe tippend wendete ich mich ab und ging schon in Richtung des immer noch neugierigen Hafenpolizisten.
„¡Alto! Stopp! Schau’s dir wenigstens an.“
Ich blieb mürrisch stehen und drehte mich mit einer abfälligen Handbewegung um. Das Ding in seinen Händen war nicht die vermutete Fernbedienung, sondern ein kleiner hohler Kasten mit zwei Leisten. Sah eher nach einer flachen Minischublade aus, die unter die Bohlen des Stegs geschoben werden konnte. Auf deren Boden lag ein Schlüssel. Was sollte das nun wieder? Das Gesicht verziehend schaute ich ihn an.
„Gehört Julio, 'nem Bekannten, ich hatte nur keine Ahnung mehr, wo genau er es montiert hatte. Der Schlüssel passt zur Tür auf seinem Boot. Wenn er einen übern Durst hat, pennt er schon mal hier seinen Rausch aus. Ist auf jeden Fall besser, als durch die Stadt zu torkeln. Das Ding ist kaum zwei Zentimeter hoch, fällt also selbst vom Wasser kommend kaum auf.“
„... und du nutzt es für deine Schäferstündchen“, stellte ich fest.
„Das ist überhaupt noch eine Idee, dann brauch ich vorher nicht mehr zu Hause aufzuräumen“, grinste er zurück.
„Meinst du etwa, dein Julio hat etwas damit zu tun?“, ich sah zur Explanada hinüber. Primo schob die kleine Box wieder an Ort und Stelle. Danach schaute er einem kleinen Katamaran hinterher, der zwischen uns und der Kaimauer drüben mit Motorkraft Richtung Meer schipperte.
„Dafür ist er trotz seiner gelegentlichen Sauferei zu anständig. Aber der Idiot ist leider auch total gutgläubig. Vielleicht hat er seinen Kahn in den letzten Tagen einem als Schlafstätte angeboten, damit der mal in Ruhe... na du weißt schon. Wir sollten ihn mal fragen.“
„Immer noch zu einfach. Was hältst du davon, wenn unser Attentäter beim Knopfdrücken einfach aus einem Fenster im Hotel Maritimo geguckt hätte. Liegt direkt dahinter. Oder vom Tryp Gran Sol mit bester Aussicht? Oder sogar mitten unter den Zuschauern stand? Dann brauchte er den Kilometer erst gar nicht zu laufen.“
Er schüttelte den Kopf.
„Stell dich nicht so an. Die Namen der Gäste haben wir seit Stunden auf einer Liste, auch die von denen man weiß, dass sie erst morgen oder übermorgen anreisen werden. Die Dinger sind seit Monaten ausgebucht. Spontan kann da also keiner übernachten. Und zwischen all den Menschen wäre das Risiko sowieso zu groß gewesen, irgendein Simpel schaut dir nämlich immer über die Schulter. Du sagst doch immer, dass in solchen Fällen alles viel einfacher ist. Jetzt würde es passen, alles andere wäre zu viel Organisation, hätte zu viele Mitwisser, zu viel Risiko. Dann kannst du auch die ganzen Anwohner filzen. Viel Spaß in den kommenden Tagen.“
„Also gut, nehmen wir mal an, der Sprengmeister sitzt auf dem Boot und ist ein guter Bekannter deines Julios. Glaubst du etwa, der könnte uns den Namen verschweigen, wenn wir ihn in die Mangel nehmen?“
„Auch den Namen des Freundes vom Freund des Freundes?“
Er musterte mich siegesgewiss.
„Ich sag doch Julio ist zu leichtgläubig. Wer hier schon mal erfolgreich und in Ruhe seine Liebste vögeln konnte, gibt den Tipp doch gerne weiter.“
Ich beharrte auf meiner Meinung:
„Zu einfach, um wahr zu sein! – Mich wundert, dass noch keiner das Boot geklaut hat.“
Primo verzog den Mund, zuckte mit den Schultern und meinte:
„Den Kahn? Ganz bestimmt nicht. Skipper achten aufeinander und der da vorne ist ja nicht immer so blind wie heute. – Abgesehen davon, weiß ich nicht, ob der überhaupt fünfzig Meter Fahrt übersteht.“
Diesmal verzog ich den Mund.
Es war tatsächlich ein Armband. Vielmehr ein Teil davon. Der Verschluss und knapp zwei Zentimeter geflochtenes Leder. Echte Designerware. Ein elegantes Stück. Nichts Billiges. So eines hatte ich bei Duela nicht erstanden. In Sunnys Dienststelle drehte ich später das durchsichtige Tütchen in meinen Händen hin und her und betrachtete den Bajonettverschluss. Sunny meinte, es bestünde Hoffnung, dass man da noch Spuren finden würde. Zur Abwechslung hob ich die Augenbrauen und runzelte die Stirn. Diese kriminologischen Untersuchungen waren für mich immer noch eine Wunderwelt. Ich legte das Teil auf eine schwarze Ledermappe auf seinem Schreibtisch und fotografierte mit meinem altertümlichen Nokia das mit sichtlich äußerster Gewalt abgerissene Stück. Unsere Mädels in der Abteilung lasen so viele Modeblätter, dass sie bestimmt eine Ahnung hatten, wo man solche Sachen in unserer Stadt erstehen könnte. Oder nach hartnäckigem Suchen im Internet fände man wenigstens die dahinterstehende Marke heraus. Dann schaute ich zu Sunny rüber und meinte:
„Lass das aber nicht deinen Lehrling machen.“
Er drehte sich um und stemmte mit einem breiten Grinsen seine Hände in die Hüfte.
„Ach, du meinst Doctor Ortega. Der Mann ist wirklich gut. Ein toller Pathologe. Meine Chefin Señora Conde und ich sind glücklich, dass er nicht dem Ruf gefolgt und nach Valencia oder Madrid gegangen ist. Seine Arbeit über forensische Daktyloskopie ist wirklich lesenswert. Und seine Aufklärungsquote vom letzten Jahr kann sich wirklich sehen lassen.“
Irgendein verrückt gewordener Insektenschwarm hätte nun leicht eine neue Heimat gefunden. Ich schaute ihn mit offenem Mund an und erwiderte lediglich:
„Der?“
Sunnys Antwort war ein Nicken, Schulterzucken und:
„Tut mir leid.“
Meine Ration an Fettnäpfchen hatte ich für heute bereits durch. Aber ich wollte mich nicht geschlagen geben.
„Hat er auch schon was zu dem Bändchen hier gesagt?“
Ich schwenkte wieder das Plastiksäckchen hin und her.
„Alex. Nerv nicht! Wir haben Stofffetzen, Blutspuren, Haare, Hautpartikel, Finger- und Schuhabdrücke, Lacksplitter, Metallspäne, tausende angefasster Souvenirs und was weiß ich gefunden. Womöglich alles tatrelevant. Dazu hochexplosives Material von zweifelhafter Herkunft. Das Ganze auch noch vollkommen unprofessionell zusammengestöpselt. Dein Bändchen kommt daher vielleicht erst nächste Woche dran.“
Beim letzten Satz grinste er.
„Aber …“, versuchte ich erneut, „... so ein Teil trägt nicht jeder.“
„Glaubst du etwa, die haben Kundenlisten? Oder videografieren jeden, der so’n Scheiß kauft, um beim nächsten Kauf was passendes oder einen Ölwechsel als Kaufprämie anzubieten. Du darfst dich gerne darum kümmern. – Aber lass es hier, ja?“
Hatte ich schon das mit den unaufhörlichen Einwänden, Gegenargumenten und Vorbehalten erwähnt?
Primo hatte nicht unbedingt mehr Erfolg gehabt, sondern nur mehr Zeit verbraucht. Als ich nach ihm sah, bevor ich Sunny den Besuch abstattete, war er keine zwei Buden weitergekommen. Mit einem Blick war mir klar, dass es dauern würde. Ich hatte keine Lust zu warten und war deshalb schon vorgegangen. Er war nämlich an einem Stand hängengeblieben, in dem gut sichtbar der ansehnliche Grund für sein verzögertes Eintreffen stand. Chicadependencia.
Endlich von der Explanada zurück, erstattete er Bericht. Duela hatte demnach äußerst wichtige und unbedeutende Beziehungen. Stammkunden und Touristen. Als ich Primos Augen sah, konnte ich mir denken, was wohl wichtig gewesen sein könnte. Ohne auf mein Grinsen einzugehen, setzte er sein Referat fort:
„Ich hab mal die bisherigen Aussagen zusammengefasst. Das Meiste kennst du ja auch schon. Was bei den von mir befragten Budenbesitzern noch auffällt: alle anderen haben jemanden, der aushilft. Ehepartner, Kinder, Verwandte oder Freunde. Er hingegen war immer allein am Stand. Ein echter Einzelgänger. Nicht mal einer seiner Landsleute, also dieser negros, hatte so guten Kontakt, dass er eine Hilfe hätte sein können. Montags und dienstags hatte er je nach Saison schon mal zu oder machte erst am frühen Abend auf. An den übrigen Tagen öffnete er manchmal eine halbe Stunde später als die anderen. Aber das war es dann auch schon fast. Einmal im Jahr ließ er für eine Woche die Bude zu und fuhr angeblich zu Verwandten in der näheren Umgebung. Da sollten wir bei den anderen Verkaufsständen nachhaken.“
„Dann mal los.“
„Drei Stände weiter arbeitet eine junge Frau. So ein südamerikanischer Typ ...“, er fuhr mit seinen Händen in der Luft die Konturen einer Frau nach und wackelte mit dem Hintern. Es entsprach ungefähr dem, was ich beim Vorbeigehen kurz gesehen hatte. Primo pfiff durch die Zähne, „... eine echte Granate.“
„Na, sie wird doch nicht beteiligt sein?“
„Blödmann! Cristina heißt sie, kommt wie ich aus Kolumbien. Die hat mir das im Grunde alles erzählt.“
„Du kommst ja auch aus der kolumbianischsten Stadt Kolumbiens, ¿no? Ich hoffe du hast ihr keine Lügen aufgetischt? Oder warum hast du so lange bei ihr gebraucht?“
„Immerhin heißt mein Geburtsort Cartagena, schon vergessen?“
Ich schüttelte lachend den Kopf und hatte schon die Türklinke in der Hand, als mir einfiel:
„Wann sagte der Arzt, sei Duela umgebracht worden? Vor drei Tagen, oder?“
Primos Nicken übersah ich und meinte: