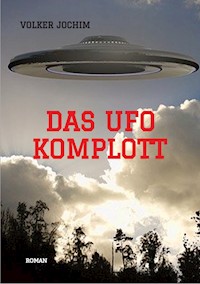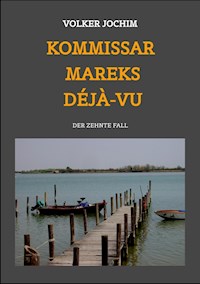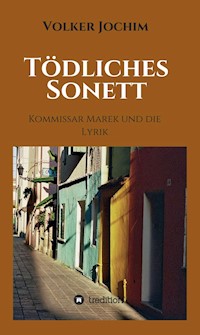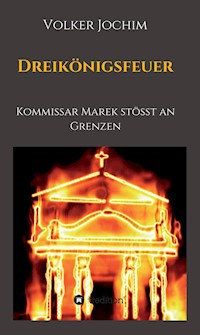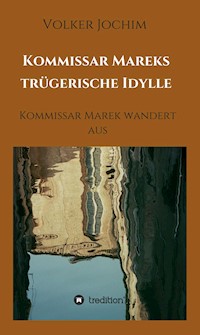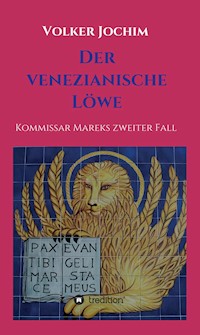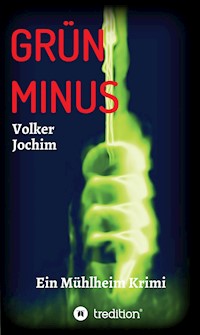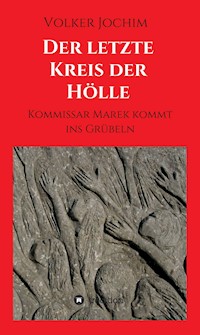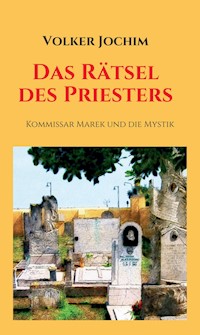Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und -auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2010 novum publishing gmbh
ISBN Printausgabe: 978-3-99003-174-2
ISBN e-book: 978-3-99003-637-2
Lektorat: Dipl.-Theol. Christiane Lober
Gedruckt in der Europäischen Union auf umweltfreundlichem, chlor- und säurefrei gebleichtem -Papier.
www.novumpro.com
AUSTRIA · GERMANY · HUNGARY · SPAIN · SWITZERLAND
1
Alfredo Zorzi streifte ziellos durch die Straßen von Triest. Vor drei Wochen hatte er seinen Job als Koch in der Trattoria DaNardi in Eraclea verloren und war einfach vor die Tür gesetzt worden. Dabei wusste er eigentlich bis zum heutigen Tag nicht, warum.
Unbewusst näherte er sich dem Bahnhof an der Piazza della Libertà.
Ihm war lediglich aufgefallen, dass nur ein bis zweimal wöchent-lich eine Lieferung Fisch eintraf, obwohl das Restau-rant eine reichhaltige Fischkarte vorhielt. Merkwürdig musste außerdem der Umstand erscheinen, dass die Lieferung aus dem entfernten Triest kam. Dabei gab es in der näheren Umgebung von Eraclea, zwischen Jesolo und Caorle, jede Menge fangfrischen Fisch zu kaufen.
Unvermittelt stand er vor dem Bahnhof. Es war schon spät am Nachmittag, und der einsetzende Berufsverkehr machte das Überqueren der Straße zum Abenteuer.
Zorzi sah sich um und lenkte seine Schritte dann nach links in Richtung Corso Cavour zum Hafen.
Er hatte seinen Chef nur gefragt, warum er den Fisch nicht täglich und in der Region kaufen könnte.
„Das geht dich nichts an“, war die barsche Antwort, „du wirst hier fürs Kochen bezahlt.“
Der Fehler, den er begangen hatte, bestand wohl darin, dass er nicht locker ließ; aber es ging ihm gegen den Strich, Fisch zu verarbeiten, der schon drei bis vier Tage im Kühlhaus lag.
Die Diskussion mündete in einen lautstarken Disput, an dessen Ende er sich seine Papiere abholen konnte: Er war gefeuert.
Sicherlich hätte er nicht so emotional reagieren dürfen, aber letzten Endes wollte er doch nur die Qualität der Küche verbessern. Es war schon seltsam, wie man ihn behandelte, und er konnte es nicht verstehen. Nach dem Rauswurf ging er zurück in seine Heimatstadt Triest und fand erst einmal Unterschlupf bei seiner Mutter.
Hier streifte er nun täglich ziellos durch die Straßen – auf der Suche nach einem neuen Job, wie er sich einredete. Aber so richtig gesucht hatte er eigentlich bisher nicht. Er ließ sich einfach treiben. Irgendwann würde er schon Glück haben, dessen war er sich ganz sicher.
Zorzi blieb plötzlich stehen.
„Das gibt es doch nicht! Was treibt der denn hier?“, murmelte er vor sich hin.
Einige Meter vor ihm bog sein ehemaliger Chef eilig in die Via Milano ein.
„Komisch“, dachte er, „der ist doch nie selbst hierher gefahren! Alle Bestellungen wurden telefonisch abgewickelt. Mal sehen, was der hier treibt.“
Er lief los, um ihn nicht aus den Augen zu verlieren, und als er in die Via Milano einbog, sah er ihn gerade noch in eine Seitenstraße verschwinden. Zorzi sprintete bis zur Ein-mündung der Straße und spähte dann vorsichtig um eine Hausecke. Sein Herz raste ob der ungewohnten körperlichen Anstrengung, und sein Hemd klebte am Körper.
Marco Nardi blieb vor einem alten Haus aus der Zeit der österreichischen Besatzung stehen und zündete sich eine Zigarette an.
Es gab Schwierigkeiten bei der Lieferung. Aber er selbst hatte auch Termine, die er einhalten musste. Verzögerungen konnte er sich nicht leisten. Dieses Problem musste er selbst lösen. Da konnte er niemand anderen schicken.
Er sah sich um, schnippte seine angerauchte Zigarette auf die Straße und betrat das Haus. Den jungen Mann an der Ecke hatte er nicht bemerkt.
„Wenn mich nicht alles täuscht, ist das doch ein Luxus-Puff“, dachte Alfredo Zorzi und schob sein Handy wieder in die Jackentasche.
„Vielleicht ist ja heute mein Glückstag.“
Gut gelaunt machte er sich auf den Heimweg. Zu Hause angekommen, rief er nur ein kurzes „Ciao, mamma!“ in die Küche, verschwand in seinem Zimmer, das seine Mutter immer für ihn bereithielt, und schaltete seinen Computer an.
2
Marco Nardi verließ etwa eine Stunde später wieder das Gebäude, sah sich um, zündete sich eine Zigarette an und wandte sich in Richtung Via Giosuè Carducci.
Er war halbwegs zufrieden mit dem Ergebnis seiner Unterredung, und entsprechend spiegelte sein Gesichts-ausdruck diese Zufriedenheit wider.
Heute war Montag. Die nächste Lieferung wurde ihm für Mittwoch zugesagt. Daher hatte er noch Zeit, alles für den Transport nach Deutschland zu organisieren.
Ein paar Minuten später betrat er das Café San Marco in der Via Cesare Battisti. Hier wollte er in gediegener Jugendstil-atmosphäre bei einem Caffè noch etwas entspannen, bevor er den Heimweg antrat.
Er angelte sich den Corriere della Sera vom Zeitungsständer und setzte sich im hinteren Teil des großen Raums an einen kleinen Tisch mit Marmorplatte.
Dann schlug Marco Nardi die Zeitung auf und überflog die Schlagzeilen. Die schlechte Wirtschaftslage stellte das beherr-schende Thema dar, zu dem in verschiedenen Inter-views Politi-ker unterschiedlichster Couleur in den immer gleichen Sprechblasen zum Besten gaben, wie sie der Lage Herr werden wollten. Waren sie dann in verantwortliche Positionen gewählt, blieb sowieso alles beim Alten.
„Glücklicherweise sind meine Geschäfte unabhängig von Rezessionen und der allgemeinen Wirtschaftslage“, dachte Nardi.
Auf der nächsten Seite erregte ein anderer Artikel seine Aufmerksamkeit: „Großer Schlag gegen die Drogenmafia in Genua“, lautete die Schlagzeile.
„Die sind auch nicht mehr, was sie mal waren“, dachte er bei sich. Nachdem er seinen Caffè ausgetrunken hatte, faltete er die Zeitung zusammen, legte einen Schein auf den Tisch und ging nach draußen. Dort steckte er sich erst einmal eine Zigarette an, die er gerne zum Caffè geraucht hätte. Aber das war ja leider nicht mehr möglich. „Man sollte diese ganzen EU-Bürokraten zum Teufel jagen und die Politiker in Rom gleich mit.“
Langsam schlenderte er zu seinem Wagen und fuhr zurück nach Eraclea. Dort wollte er in seinem Restaurant noch kurz nach dem Rechten sehen und dann nach Hause zu Lydia fahren. Selten genug hatte er die Möglichkeit, so früh nach Hause zu kommen.
Nardi hatte seine Frau vor etwa fünf Jahren in seiner Disco-thek kennengelernt.
Er stand damals neben dem Tisch des Discjockeys und sah der tanzenden Menge zu, als eine schlanke, fast weißblonde Schönheit sich langsam, fast wie in Trance, aus der Masse herauslöste und auf ihn zu tanzte.
Er war damals wie hypnotisiert und konnte nicht einmal ausweichen, als sie gegen ihn stieß. Dabei kippte er ihr den Inhalt seines Cocktailglases über das T-Shirt, unter dem sich, von der Nässe begünstigt, ihre Brustwarzen abzuzeichnen begannen.
Unfähig, etwas zu tun, starrte er sie an, doch statt zu schimpfen oder sich zu beschweren, legte sie nur den Kopf auf die Seite und lächelte ihn an.
Noch an diesem Abend nahm er sie mit zu sich nach Hause – er lebte damals noch in einer kleinen Eigentumswohnung in Jesolo –, und ein halbes Jahr später fand die Hochzeit statt. Seither ging es geschäftlich nur noch steil bergauf. Mittlerweile gehörte er zu den reichsten Männern der gesamten Region. Lydia hatte ihm Glück gebracht.
Zur gleichen Zeit verließ Alfredo Zorzi die Wohnung seiner Mutter. Er wollte unbedingt noch einen Briefumschlag zur Post bringen. Die hatte zwar mittlerweile schon geschlossen, aber glücklicherweise hatte seine Mutter immer einen Vorrat an Briefmarken in der Schublade des Küchentischs. Er hätte den Brief auch an der nächsten Ecke einwerfen können, doch war er sich nicht sicher, ob der Kasten überhaupt in der nächsten Zeit geleert werden würde. An die angegebenen Leerungs-zeiten hielt sich hier sowieso niemand. Auf dem Postamt war das etwas anderes, da wurde garantiert dreimal täglich geleert. Sein Brief war wichtig und duldete keine Verzögerung. Zu viel hing für Alfredo davon ab, vielleicht sogar seine ganze Zukunft.
Als er vor dem Postamt stand, sah er sich vorsichtig nach allen Seiten um aus Angst, jemand könnte ihn beobachten. Aber wer sollte das tun? Außer ihm wusste ja niemand, was sich in diesem Umschlag befand, und was konnte daran verdächtig sein, einen Brief auf dem Postamt abzuschicken?
„Jetzt fängst du schon an zu spinnen“, dachte er und steckte den Umschlag entschlossen in den Schlitz des Briefkastens.
Die letzte Leerung erfolgte um neunzehn Uhr. Der Brief könnte spätestens übermorgen seinen Adressaten erreichen. Dann würde man weitersehen.
Nardi fuhr auf den Parkplatz seiner Trattoria und betrat das Lokal durch den Hintereingang. Er hatte jetzt keine Lust zur Konversation mit seinen Gästen.
Er sah gerade noch Gustavo im Lagerraum verschwinden und ging ihm nach. Gustavo Bossi war nicht nur Geschäftsführer der Trattoria und als solcher mit absoluter Handlungsfreiheit ausgestattet, sondern auch Nardis engster Vertrauter. Er schloss die Türe hinter sich, denn was er mit Bossi zu besprechen hatte, war für niemandes Ohren bestimmt.
Fünfzehn Minuten später war Nardi bereits wieder unterwegs. Er musste Lydia noch vom Ergebnis der Unterredung mit den Lieferanten in Triest berichten, die er durch die Vermittlung ihrer Brüder in Dubrovnik kennengelernt hatte. Daraus hatte sich eine bis dato erfolgreiche und mehr als einträgliche Geschäftsverbindung ergeben. In letzter Zeit hatte die Zu-verlässigkeit etwas gelitten, deshalb musste er selbst heute mit seinen Partnern einmal Klartext reden – mit Erfolg, wie er meinte.
Wie von Zauberhand öffnete sich das Tor zur Garageneinfahrt, noch bevor Nardi mit seinem schwarzen Mercedes sein Haus erreicht hatte. Langsam und fast geräuschlos rollte die schwere Limousine in die Garage, und ebenso geräuschlos schloss sich wieder das Tor.
Nardi betrat durch eine Seitentür die große Wohnküche seines Hauses.
„Ciao, bella!“
Seine Frau kam mit zwei gefüllten Gläsern auf ihn zu.
„Ciao, Marco – einen Prosecco?“
„Danke.“
Nardi nahm das Glas und ging voraus ins Wohnzimmer, wo er sich auf einen Sessel warf und die Krawatte lockerte.
„Wie ist es gelaufen?“, wollte sie wissen und setzte sich ihm gegenüber auf die Couch. Dabei zog sie die Beine an und schenkte ihm einen erwartungsvollen Blick.
„Salute“, Nardi nahm einen Schluck, „diesmal noch gut.“
„Du hast hoffentlich die Mädchen in Ruhe gelassen?“, fragte sie gespielt eifersüchtig und grinste ihn an.
„Ich habe mir die Lokalität nicht ausgesucht. Ich hoffe nur, dass mich niemand gesehen hat, der mich kennt.“
„Ich habe Slaven auch schon gesagt, dass dies ein sehr ungünstiger Platz für das Büro sei. Er sieht sich nach etwas Neuem um. Wenn da eine Razzia stattfindet, ist er dran.“
„Du musst mal mit deinem Vater reden. So geht das nicht weiter! Noch mal solche Schwierigkeiten, und die Deutschen springen ab. Dann kann ich wieder die Buchhaltung in der Trattoria machen.“
„Hatte ich auch vor; aber so schlimm, wie du tust, ist es doch auch wieder nicht.“
„Du kennst doch die Deutschen: Wenn da nicht alles plan-mäßig und pünktlich abläuft, drehen die durch.“
„Das meinte ich auch nicht. Du hast doch noch drei weitere gut gehende Firmen. Du wirst also nicht als Buchhalter enden, mein Schatz. Aber wie wäre es jetzt mit Essen? Hast du Hunger?“
„Wie ein Wolf. Was hast du denn gezaubert?“
„Als Primo gibt es Prosciutto di Parma auf Melone, danach Crostini con Fegato …“
„… und zum Nachtisch?“, fiel er ihr ins Wort und nahm das Funkeln in ihren Augen wahr.
„… und zum Nachtisch …“
3
Marco Nardi war wie immer schon wach, bevor der Wecker ihn aus dem Schlaf reißen konnte. Er küsste Lydia sachte auf die Stirn und stand auf, um Caffè zu kochen.
Nachdem er die Caffettiera gefüllt und auf den Herd gestellt hatte, ging er zum Briefkasten, um die Post von gestern herauszuholen. Der Briefträger kam in dieser Gegend zu keiner bestimmten Zeit, und so konnte es durchaus sein, dass die Post erst am Nachmittag eingeworfen wurde. Wenn er morgens das Haus verließ, war sie ohnehin noch nicht da, und wenn er abends nach Hause kam, vergaß er häufig, nach-zusehen, und Lydia vergaß es sowieso meistens.
Neben einem guten Dutzend Geschäfts- und Werbebriefen fiel ihm ein mittelgroßer brauner Umschlag auf. Die Anschrift war mit Kugelschreiber in einer ungelenken Handschrift gekritzelt, der Absender fehlte ganz.
Sein durch seine Geschäfte geschärfter Instinkt sagte ihm, dass dies nichts Gutes verhieß. Er sah sich um, ob vielleicht irgendjemand ihn beobachtete, konnte aber niemanden ausmachen. In seinem Arbeitszimmer warf er die übrige Post auf seinen Schreibtisch und wollte gerade den ominösen Umschlag öffnen, als er einen üblen Geruch wahrnahm.
„Verdammt, der Caffè!“
Er rannte in die Küche. Dort blubberte die Caffettiera vor sich hin und ergoss einen Schwall brauner Brühe auf den Herd. Nardi drehte fluchend das Gas ab und wollte die Kanne vom Herd nehmen. Dabei verbrannte er sich die Finger und ließ die Kanne auf die Arbeitsplatte fallen, wo sich dann der restliche Inhalt verteilte.
„Scheiße, der Tag fängt ja gut an!“, maulte er und fing an, mit einem Küchentuch die Schweinerei zu beseitigen.
Lydias Meckerei konnte er jetzt nicht gebrauchen. Als alle Spuren seines Missgeschicks beseitigt waren, ging er wieder in sein Arbeitszimmer und nahm das Kuvert in die Hand. Vorsichtig tastete er es ab. Es war nichts Verdächtiges zu ertasten. Dann nahm er ein Klappmesser vom Schreibtisch, das ihm als Brieföffner diente, und schnitt vorsichtig eine Seite des Umschlags auf. Zum Vorschein kamen ein Blatt Papier und einige kleinformatige Fotos. Zuerst nahm er die Bilder zur Hand. Das erste zeigte ihn vor dem Haus in Triest, in dem er vorgestern seine Verabredung hatte. Schnell blätterte er die anderen Fotos durch. Alle zeigten annähernd das Gleiche. Einmal sah er direkt in die Kamera, einmal in die entgegengesetzte Richtung. Ein Bild zeigte ihn beim Anzünden einer Zigarette, auf einem anderen blickte er an der Fassade empor. Das letzte Bild zeigte ihn beim Betreten des Gebäudes.
„Verdammter Mist!“, fluchte er. „Welches Arschloch war das?“
Er faltete das Blatt Papier auseinander und wurde blass. Jemand versuchte, ihn zu erpressen. Der Brief war mit aufgeklebten Buchstaben geschrieben, die man aus einer Zeitung ausgeschnitten hatte.
„Da hat wohl einer zu viele Krimis gesehen“, murmelte Nardi, als er sich wieder einigermaßen gefangen hatte.
„Bringen Sie mir einhunderttausend Euro in kleinen Scheinen am Samstag um zweiundzwanzig Uhr zum Wasserwerk an der Straße zwischen San Donà und Duna Verde. Kommen Sie alleine! Keine Polizei! Rechts neben dem See ist ein Weg mit einer Betonrinne. Legen Sie das Geld in die Rinne, und verschwinden Sie dann. Wenn Sie nicht zahlen, erfahren Ihre Frau und die Presse, dass Sie im Puff waren. Ich meine es ernst.“
„Amateur“, brummte Nardi, „der weiß nicht, mit wem er sich anlegt.“
„Wer weiß nicht, mit wem er sich anlegt?“
Nardi fuhr herum. In der Tür stand Lydia in einen weißen Bademantel gehüllt, der zusammen mit ihren hellblond gefärbten Haaren die Blässe ihrer Haut noch mehr betonte. Ihre dunklen Augenbrauen, die ihre eigentliche Haarfarbe zeigten, bildeten die einzigen Farbtupfer.
„Wie eine Porzellanfigur!“, dachte Nardi, als er sie dort stehen sah.
„Jemand hat mich vorgestern in Triest gesehen und fotografiert, als ich in das Haus gegangen bin. Jetzt versucht er, mich damit zu erpressen. Ich habe es dir schon oft genug gesagt, dass die sich ein anderes Domizil suchen sollen. Jetzt haben wir den Ärger.“
„Jetzt beruhige dich mal wieder! Ich habe dir doch gesagt, dass sie etwas anderes suchen. Außerdem lautet doch die Frage, womit er dich denn erpressen will! Will er mir die Fotos schicken, wenn du nicht zahlst? Ich wäre dann außer mir.“
„Das weiß ich ja, aber er will es auch an die Presse geben, und diese Art Publicity kann ich mir nicht leisten.“
Sie stand noch immer in der Tür, neigte den Kopf leicht zur Seite und setzte ein strahlendes Lächeln auf.
„Dann weißt du, was du tun musst – zahlen!“
Dabei drehte sie sich um und schwebte hinaus.
Nardi blickte ihr nach. „Außen ein Engelsgeschöpf und innen kalt wie ein Eisblock und gefährlich wie eine Viper“, dachte er.
„Gibt es heute Morgen keinen Caffè?“, rief sie aus der Küche.
„Bin noch nicht dazu gekommen“, log er.
„Dann ist die Kanne wohl von gestern noch so heiß.“
Ertappt.
„Ich koche gleich welchen, cara mia.“
„Lass nur, ich bin schon dabei!“
„Was gedenkst du zu tun?“, fragte Lydia, als sie beide rauchend in der Küche saßen.
„Weiß noch nicht. Werde mal mit Gustavo darüber reden. Nur eins braucht sich das Schwein nicht einzubilden …“
„… dass wir klein beigeben“, vollendete sie seinen Satz und setzte dabei ein vielsagendes Lächeln auf. Ihr Mann wünschte sich in diesem Moment zu wissen, was hinter ihrer hübschen Stirn vorging.
Eine Stunde später saß Marco Nardi in seinem Büro in der Trattoria, als es an der Tür klopfte.
„Pronto.“
Die Tür öffnete sich, und Gustavo Bossi betrat den Raum. Er war ein mittelgroßer, schlanker Mann von etwa fünfundvierzig Jahren. Seine dunkelbraunen Haare trug er kurz geschnitten, und seine Gesichtsfarbe war die eines Mannes, der schon lange kein Sonnenlicht mehr gesehen hatte.
„Sie wollten mich sprechen, Chef?“
„Ja. Schließ die Tür und setz dich!“
Nardi erzählte Bossi von dem Brief mit den Fotos und dem Erpresserschreiben. Bossi hörte interessiert zu.
Als er vor etwas über einem Jahr aus dem Gefängnis entlassen wurde, hatte Nardi ihm eine Chance gegeben, und das würde Bossi ihm nie vergessen. Er wäre bereit, für ihn durchs Feuer zu gehen. Nardi musste das wohl wissen, denn warum sonst hatte sich ein so enges Vertrauensverhältnis entwickelt?
„Was meinst du? Was sollen wir tun?“, endete Nardi und sah seinen Mitarbeiter erwartungsvoll an.
„Mmh, ich würde vorschlagen, Sie besorgen das Geld und legen es, wie vom Erpresser gewünscht, in diese Rinne.“
„Ich dachte, du hättest einen besseren Vorschlag!“, fuhr Nardi wütend auf.
„Ich bin ja noch nicht fertig“, erwiderte Bossi ruhig. „Ich werde mich gegenüber diesem Wasserwerk auf die Lauer legen. Dort gibt es ein paar Meter weiter einen Feldweg. Ich kenne die Gegend sehr gut. Wenn Sie also das Geld abgeliefert haben und weggefahren sind, warte ich, bis dort ein Fahrzeug herauskommt. Um diese Zeit ist es dort stockdunkel. Da falle ich nicht auf. Ich werde ihm also folgen, bis ich weiß, wo er wohnt oder wer er ist. Dann holen wir die Jungs aus Jesolo und heben ihn aus. Was halten Sie davon?“
Nardi saß zurückgelehnt in seinem Schreibtischsessel und kaute an seinen Fingernägeln. Auf einmal schnellte er nach vorne und schlug mit der flachen Hand auf den Schreibtisch.
„Bene. Wir machen es so. Aber dass das klar ist: Ich will mein Geld und dieses Schwein haben. Ich verlasse mich auf dich.“
„Können Sie, Chef. Ciao!“
Nachdem Bossi gegangen war, verließ auch Nardi das Lokal und fuhr zu seiner zwischen Eraclea und Jesolo gelegenen Manufaktur, in der Gips- und Terracottafiguren hergestellt wurden. Das meiste war für den Export bestimmt. So schmückten weiße Gipslöwen aus seinem Betrieb die Garageneinfahrten betuchter Menschen in Deutschland und Österreich, und nicht wenige Statuen römischer und griechischer Gottheiten aus seiner Fertigung verzierten deren Gärten.
Heute musste eine Lieferung nach Deutschland rausgehen, und er wollte noch mal sicherstellen, dass es keine Prob-leme gab.
„Ciao, Alberto!“
„Ah, buon giorno, signor Nardi.“
Alberto Sgorlon, der Leiter der Manufaktur, war einstmals Bildhauer mit eigenem Atelier gewesen, bis er in angetrunkenem Zustand bei einem Streit einem Kunden eine seiner Tonskulpturen auf dem Schädel zertrümmert hatte. Dafür durfte er wegen schwerer Körperverletzung einige Jahre absitzen. Nach seiner Entlassung besaß er weder Geld für ein Atelier noch bekam er einen Job – bis er bei Nardi unterkam.
Das hatte zwar wenig mit Kunst zu tun, aber er hatte ein gutes Auskommen und fühlte sich wohl. Und so stellte er auch keine Fragen, wenn regelmäßig eine Ladung venezianischer Terracottalöwen aus Triest angeliefert wurde, die man doch hier im Betrieb auch hätte herstellen können.
„Die Lieferung aus Triest muss jeden Moment eintreffen. Ist der Lastwagen schon da?“
„Ja, der steht im Hof und ist schon vorgeladen. Wir warten nur noch auf die Ware aus Triest.“
„Bravo. Dann werde ich ja hier nicht mehr gebraucht. Ciao, Alberto.“
„Ciao.“
Zufrieden setzte sich Nardi in seinen Wagen und fuhr los. Auf seine Mitarbeiter war Verlass. Ein Blick auf die Uhr sagte ihm, dass es Zeit war, zur Bank zu fahren. Er musste ja noch das Geld für die Übergabe ordern, und die Filialen hier hatten meist solche Beträge nicht vorrätig.
Der Rest der Woche verlief ziemlich ereignislos. Am Samstagabend stand Marco Nardi in seinem Arbeitszimmer vor seinem Schreibtisch und betrachtete die gebündelten Geldscheine, bevor er sie in einen Plastiksack stopfte und den Sack verschnürte. Er sah auf die Uhr: Es war kurz vor halb zehn – Zeit, um sich auf den Weg zu machen. Lydia war mit einer Freundin unterwegs, was ihm nur recht war. Er konnte sich in Ruhe auf das konzentrieren, was er nun erledigen musste.
In gemächlichem Tempo fuhr Nardi in Richtung Duna Verde. Um diese Zeit war diese Gegend richtig gespenstisch. Nur hier und da tauchte ein Lichtpunkt in der Landschaft auf, sonst herrschten nur Dunkelheit und Einsamkeit. Während der ganzen Fahrt begegnete ihm kein einziges Fahrzeug.
Plötzlich bremste er abrupt ab. Zu seiner Linken lag das Wasserwerk hinter einem kleinen See. Beinahe wäre er daran vorbeigefahren. Rechts neben dem See ging ein relativ breiter, unbefestigter Weg ab und verschwand im Dunkel zwischen dichtem Baumbestand. Das musste der beschriebene Übergabeort sein. „Gut gewählt“, dachte Nardi, „der Erpresser war doch nicht so dumm.“ Langsam setzte er ein Stück zurück, bog dann in den Weg ein und rollte so weit, bis man ihn von der Straße aus nicht mehr sehen konnte. Verlassen lag der Weg vor ihm im Scheinwerferlicht.
Nardi nahm den Sack vom Beifahrersitz und stieg aus. Die Scheinwerfer ließ er vorsichtshalber an. Direkt neben ihm verlief die beschriebene Rinne aus halbierten, aneinanderge-reihten Betonrohren, in der das Regenwasser gesammelt und unter der Straße hindurch in den Kanal auf der anderen Seite abgeleitet wurde. Er warf den Sack hinein und wollte gerade wieder einsteigen, als er ein knackendes Geräusch vernahm. Er blieb stehen, zog seine Beretta aus der Jackentasche und lauschte in die Dunkelheit. Über ihm flog eine in ihrer Ruhe gestörte Eule davon. Sonst war nichts mehr zu hören. Beruhigt steckte er die Waffe wieder ein, setzte sich in seinen Wagen und rollte rückwärts zurück auf die Straße.
Irgendwo dort drüben auf der anderen Seite musste Bossi auf der Lauer liegen. Zu sehen war nichts.
Bossi sah auf seine Armbanduhr. Es waren schon zwanzig Minuten vergangen, seit der Chef das Geld abgeliefert hatte, doch es tat sich noch immer nichts. Er war schon versucht, hinüberzugehen, um nachzusehen, ob das Geld schon abgeholt worden war, als er einen Lichtschein hinter den Bäumen auf der anderen Seite wahrnahm. Was war da los? Die Lichter tanzten hin und her und verschwanden dann wieder, um plötzlich an der Straße wieder aufzutauchen und in Richtung Duna Verde abzubiegen.
Bossi startete den Motor und fuhr hinterher. Die Scheinwerfer ließ er erst einmal ausgeschaltet. Er kannte die Gegend wie seine Westentasche und fand sich auch im Dunkeln zurecht. „Verdammt, das sind ja Motorräder!“, fluchte Bossi, als er ein Stück aufgeholt hatte. „Hoffentlich bleiben die zusammen.“
Doch diesen Gefallen taten sie ihm nicht. Als die Straße in einem Kreisel endete, bog eine Maschine nach rechts in Richtung Eraclea Mare ab, die andere nach links in Richtung Porto Santa Margherita.
„Scheiße, wer hat jetzt das Geld?“
Er bog nach rechts ab. Auf dieser Strecke gab es weniger Seitenstraßen, in die das Motorrad hätte verschwinden können. An der Einmündung zur Straße nach Jesolo blieb der Motorradfahrer plötzlich stehen, als müsste er sich noch überlegen, wohin er fahren wolle. Bossi hielt auch an. Jetzt konnte er sehen, dass es sich um eine Gelände-maschine handelte, deren Nummernschild nach oben gebogen und deshalb nicht zu entziffern war.
In diesem Moment gab der Motorradfahrer Gas. Die Maschine bäumte sich kurz auf, schoss quer über die Straße, flog über einen kleinen Graben und verschwand in den dahinterlie-genden Feldern.
Bossi war zu überrascht, um gleich reagieren zu können. Dann sprang er aus dem Wagen und rannte über die Straße. Sehen konnte er nichts. Er vernahm nur das immer leiser werdende Brummen des Motors in der Dunkelheit.
„Verdammter Mist! Der hat mich wohl doch bemerkt“, schimpfte er, als er zu seinem Auto zurückging. Jetzt kam die unangenehmste Aufgabe – er musste seinen Chef über den Fehlschlag informieren.
„Was?“, brüllte Nardi in den Hörer. „Komm sofort zu mir! Ich erwarte einen detaillierten Bericht!“
Das Gespräch war beendet. Bossi schluckte. So wütend hatte er seinen Chef noch nie erlebt – oder doch: vor ein paar Wochen, als er den Koch entlassen hatte.
Nardis Villa war hell erleuchtet, als Bossi vorfuhr. Die Tür sprang auf, noch bevor er den Klingelknopf drücken konnte.
Am Eingang empfing ihn sein Chef mit wütendem Gesichts-ausdruck und zog ihn in sein Arbeitszimmer. Dort drückte er ihn in einen Sessel. Er selbst wanderte nervös rauchend auf und ab.
„Was ist schiefgelaufen?“
„Das war schon alles sehr seltsam, Chef“, fing Bossi seinen Bericht an.
„Wie meinst du das?“, fiel ihm Nardi ins Wort.
„Nachdem Sie weggefahren sind, passierte zwanzig Minuten lang gar nichts. Es kam niemand vorbei, kein Auto, nichts. Dann sah ich plötzlich Lichter weiter hinten hinter den Bäumen. Der Erpresser musste also schon dort gewesen sein, bevor ich kam. Die Lichter bewegten sich ungewöhnlich hin und her. Ein Auto konnte das nicht sein. Dann kamen Scheinwerfer aus dem Weg heraus und bogen in Richtung Duna Verde ab. Ich bin sofort hinterher – ohne Licht, versteht sich. Als ich ein Stück aufgeholt hatte, sah ich, dass es zwei Enduros waren. Vorne am Kreisel haben sie sich dann getrennt. Einer fuhr in Richtung Porto Santa Margherita und der andere in Richtung Eraclea Mare. Dem bin ich dann nachgefahren bis zur Straße nach Jesolo. Dort blieb er kurz stehen, dann gab er Gas, sprang über den Straßengraben und verschwand über die Felder. Da konnte ich natürlich mit dem Wagen nicht folgen.“
„Schon gut, Gustavo! Ich mache dir keinen Vorwurf. Du konntest nichts dafür. Ich habe die Situation unterschätzt.“
„Also ich habe das Gefühl, dass mehr dahintersteckt.“
„Wie meinst du das?“
„Na ja, die Erpressung selbst wirkte ziemlich amateurhaft, aber die Durchführung hatte schon etwas Professionelles. Ich meine die Nummer mit den Enduros: Das war schon durchdacht. Wir sollten mal Ihre Türsteher am Lido fragen. Die haben doch alle solche Maschinen.“
„Du meinst …“
„Nein, nein, Chef. Die könnten sich aber in der Szene mal umhören. Diese Motorradtypen kennen sich doch alle untereinander.“
„Lass mal, darum kümmere ich mich selbst! Danke, Gustavo, du kannst gehen.“
Nachdem Bossi das Haus verlassen hatte, blieb ein nachdenklicher Marco Nardi in seinem Arbeitszimmer zurück.
„Was ist los? Ist etwas schiefgelaufen?“
Nardi erschrak, als Lydia plötzlich in der Tür auftauchte.
„Das kann man sagen. Es waren zwei – auf Motorrädern. Sie haben Gustavo abgehängt. Das Geld ist weg.“
„War ja zum Glück nicht so viel“, meinte Lydia. Sie hatte den Kopf wieder seitlich auf die Schultern gelegt und ihr undefinier-bares Lächeln aufgesetzt.
„Na also …“
„Ich meine, es hätte schlimmer kommen können; und die Hunderttausend machen dich nicht arm, caro, oder?“
Damit schwebte sie wieder hinaus, und Nardi wünschte sich einmal mehr zu wissen, was in ihrem Kopf vorging.
4
Giovanni Toso hatte an diesem Sonntag Frühdienst. Seit über zehn Jahren arbeitete er schon als Techniker im Wasserwerk. Der Job machte ihm Spaß, obwohl er keine großen Anforderungen an ihn stellte. Es war eben nur ein kleines, provinzielles Werk. Aber er hatte ein relativ gutes Einkommen, und von seinem Haus in Caorle waren es nur ein paar Minuten.
Leise schlich er aus dem Schlafzimmer. Er wollte seine Frau nicht aufwecken, denn sie arbeitete in einem Supermarkt und hatte am Samstag Spätdienst. Sie brauchte den Schlaf.
In der Küche öffnete er das Fenster, klappte den Laden auf und sog tief die kühle Morgenluft ein. Es war neblig – die ersten Vorboten des Herbstes. Fröstelnd schloss er das Fenster, füllte Caffè und Wasser in die Caffettiera und stellte sie auf den Herd. Bis der Caffè fertig war, konnte er eine schnelle Dusche nehmen und sich ankleiden.
Ein paar Minuten später saß er in der Küche, rauchte eine Zigarette, sah aus dem Fenster und dachte über sein Leben nach. Eigentlich verlief es ja in geordneten Bahnen. Er hatte einen guten Job, ein hübsches Häuschen, eine Frau, die er liebte, und einen kleinen Sohn, den er vergötterte. Andererseits, dachte er, war sein Leben doch ziemlich ereignislos. Aber was sollte hier schon Aufregendes passie-ren? Da hatte es im Frühsommer diese Mordserie gegeben, welche die Stadt erschütterte, und er hoffte, dass so etwas nie wieder vorkommen möge; aber daran nahm er auch nur über die Zeitungsberichte teil. Er selbst in persona – Giovanni Toso – erlebte nie etwas Aufregendes.
Er sah auf die Uhr. Es war höchste Zeit zu gehen. Vorsichtig schlich er noch ins Schlafzimmer und hauchte seiner Frau einen Kuss auf die Stirn, darauf bedacht, sie nicht aufzuwecken. Dann sah er noch kurz nach seinem Sohn im Kinderzimmer, der friedlich schlafend in seinem Bettchen lag, und verließ das Haus.
Sonntagmorgens um diese Zeit wirkte die ganze Stadt noch wie ausgestorben – die Straßen waren menschenleer. Der Bodennebel hielt die Felder mit einem weißen Tuch bedeckt. Erst hinter Porto Santa Margherita begegnete Toso einigen älteren Männern, die mit ihren Motorrollern in der Morgendämmerung auf dem Weg zu ihren Angelplätzen waren. Nachdem er das kleine Örtchen Brian passiert hatte, konnte er in der Ferne schon die Baumgruppe ausmachen, hinter der das Wasserwerk lag.
Toso reduzierte die Geschwindigkeit und bog langsam in den Schotterweg ein. Hier war der Nebel noch dichter, sodass sich das Licht der Scheinwerfer darin verlor. Plötzlich trat er auf die Bremse. Irgendetwas hatte er in dieser Suppe gesehen, konnte aber nicht mit Bestimmtheit sagen, was es war. Langsam rollte er zurück, konnte aber nichts ausmachen. Er nahm den Gang heraus, zog die Handbremse an und wollte aussteigen. Dabei schlug die Wagentüre gegen etwas Metallisches. Er ließ den Wagen noch etwas weiter zurückrollen und stieg aus.
Der Gegenstand, den er im Scheinwerferlicht gesehen hatte, stellte sich als ein Fahrrad heraus. Das Vorderrad war ziemlich verbogen. Wahrscheinlich war der Fahrer gegen den dicken Ast geprallt, der dort lag, und hatte dann das Rad einfach liegen lassen. Toso drehte sich um und wollte zu seinem Auto zurückkehren. Als sein Blick die Betonrinne streifte, die parallel zum Weg verlief, stockte ihm der Atem: In der Rinne lag ein verkrümmter Körper; ein lebloser Körper, wie es den Anschein hatte.
„Scheiße, wieso muss das jetzt ausgerechnet mir passieren?“
Aber hatte er nicht vor gerade einmal einer halben Stunde darüber sinniert, dass ihm auch einmal etwas Aufregendes widerfahren könne? Aber doch nicht so etwas. So war das nicht gemeint gewesen. Diese Gedanken schossen ihm durch den Kopf, während er überlegte, was zu tun sei. „Die Polizei. Ich muss die Polizei anrufen.“
Er ging zur Straße zurück, während er sein Handy aus der Tasche zog.
„Polizia?“
„Sì, hier ist die Caserma der Carabinieri in Caorle. Was wünschen Sie?“
„Kommen Sie schnell! Ich glaube, hier liegt ein Toter.“
„Sind Sie sicher?“
„Sicher – was?“
„Sind Sie sicher, dass er tot ist? Woher wissen Sie überhaupt, dass es sich um einen Mann handelt?“
„Ich weiß es ja nicht.“
„Ah, und warum rufen Sie dann um diese Uhrzeit an?“
Toso platzte langsam der Kragen.
„Verdammt noch mal! Schicken Sie endlich jemanden hierher und auch einen Arzt!“
„Also nicht in diesem Ton! Sie haben wohl getrunken? Ich …“
„Soll ich Ihre Kollegen in Jesolo anrufen? Vielleicht nehmen die ihren Job etwas ernster als Sie!“
Es entstand eine kurze Pause. Der Mann in der Telefonzentrale überlegte wahrscheinlich gerade, welche Konsequenzen es für ihn hätte, wenn sich der Anruf als echte Meldung einer Straftat erweisen würde. Das wäre nicht sonderlich gut für ihn.
„Na gut“, meinte er gönnerhaft, „ich hoffe für Sie, dass es kein Scherz ist.“
Toso gab den Fundort durch. Dann ging er zu seinem Wagen und schaltete den Motor aus. Jetzt konnte er nur noch warten. Er blieb vorne an der Straße stehen, da ihm die Nähe dieses leblosen Körpers zu unheimlich war.
Etwa zwanzig Minuten später, für Toso eine gefühlte Ewigkeit, konnte er von Weitem die Sirenen hören, und kurz darauf sah er durch den sich auflösenden Nebel die Blaulichter auf-tauchen.
Die beiden Einsatzfahrzeuge kamen mit quietschenden Reifen zum Stehen und wirbelten dabei mächtig Staub auf.
„Wie oft soll ich euch noch sagen, dass ihr euch vorsichtig einem potenziellen Tatort oder Unfallort nähern sollt und nicht in dieser Hollywoodmanier!“, brüllte Sergente Ghetti seinen Fahrer an.
Dann stieg er aus und pfiff seine Leute zurück, die schon übereifrig den Schotterweg hinaufstürmen wollten.
Ghetti ging zu Toso und ließ sich alles genau berichten. Zwischenzeitlich kam noch ein Wagen mit den Leuten der Spurensicherung und dem Arzt.
„Hallo, Dottore!“, rief Ghetti. „Der Mann von der Frühschicht hat einen leblosen Körper in der Rinne dort vorne gefunden. Oben liegt noch ein Fahrrad. Scheint gestürzt zu sein.“
Der Arzt kletterte in die Rinne, um den Körper zu untersuchen.
„Was ist?“, rief Ghetti.
„Männlich und tot“, erwiderte der Dottore trocken, „sieht tatsächlich so aus, als sei er mit dem Fahrrad gestürzt und habe sich dabei das Genick gebrochen.“
„Ja, die Spuren deuten darauf hin: das verbogene Vorderrad und der dicke Ast, der hier liegt. Scheint in der Dunkelheit dagegengefahren zu sein. Wie lange liegt er schon da?“
„Würde sagen: fünf bis zehn Stunden, aber ich kann mich dabei auch um ein bis zwei Stunden vertun. Jedenfalls war er sofort tot.“
Ghetti half dem Dottore aus der Rinne und ließ die Leute von der Spurensicherung ihre Arbeit tun.
„Sucht bitte den ganzen Weg genau ab!“
„Wonach sollen wir denn speziell suchen?“
„Nach Spuren möglicher Fremdeinwirkung.“
„Aber das war doch ein Unfall!“, maulte einer seiner Kollegen, der die vage Hoffnung hegte, doch noch einmal ins Bett kriechen zu können.
„Sieht so aus, könnte aber auch Fremdverschulden sein, und ich will mir nicht nachsagen lassen, ich hätte etwas übersehen. Basta!“, beendete Ghetti die Diskussion.
Mittlerweile war auch der Krankenwagen eingetroffen, und nachdem der Fotograf seine Arbeit erledigt hatte, gab Ghetti die Anweisung, den Toten ins Ospedale nach Porto-gruaro zu bringen. Er würde später Dottore Lovati bitten, sich die Leiche noch einmal genauer anzusehen. Einer der beiden Kriminaltechniker brachte Ghetti einen Beutel, in dem sich eine schmale Brieftasche befand.
„Haben Sie schon hineingesehen?“
„Führerschein, Ausweis und etwas Geld, etwa zwanzig Euro.“
„Ich notiere mir nur die Anschrift, dann könnt ihr sie ins Labor mitnehmen.“
„Wieso ins Labor? Ich denke, es ist ein Unfall!“, erwiderte der Mann ungläubig, während Ghetti seine Gummihandschuhe anzog, die Brieftasche aus dem Beutel zog und die auf dem Ausweis angegebene Anschrift notierte.
„Sicher ist sicher. Man kann nie wissen“, meinte Ghetti und legte alles zurück in den Beutel. „Ich erwarte dann Ihren Bericht; sagen wir: bis heute Nachmittag.“
Damit ließ er den angesäuert dreinblickenden Mann stehen, rief seine Leute zusammen und gab Auftrag, zurück in die Caserma zu fahren.
Schön, es war Sonntag, dazu noch früh am Morgen, und er wäre auch lieber im Bett geblieben. Allerdings konnte man ja die Ermittlungen nicht einfach auf den nächsten Tag verschieben, egal, ob es sich um einen Unfall handelte oder nicht.
Der Nebel hatte sich gelichtet, und zögernd zeigte sich die Herbstsonne am immer noch milchigen Himmel.