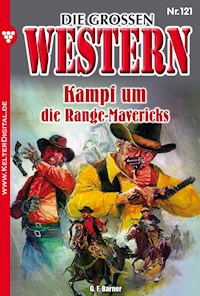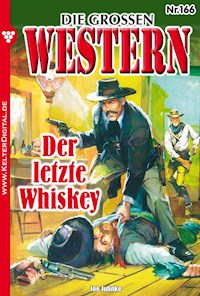Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Der Autor steht für einen unverwechselbaren Schreibstil. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. Er scheut sich nicht detailliert zu berichten, wenn das Blut fließt und die Fehde um Recht und Gesetz eskaliert. Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). »Wir haben Quemado bald«, hatte Finch Osborn vor drei Wochen schon seinem Begleiter Aron Fox prophezeit, als sie bei Austin den Colorado River durchquerten, und er gab sich alle Mühe, sein Wort zu halten. Aber der flüchtige Philippo Quemado, dem die Angst vor dem berüchtigten Jäger in den Knochen saß, entwickelte unnatürliche Kräfte und zog trotz schlechtester Vorbereitungen und Vorräte – Quemado floh über Nacht aus seiner Hütte – den Brazos hoch bis ins Mündungsgebiet. Finch Osborn, der seinem Wild bis auf zwei Tage nahe war, schüttelte unwillig den Kopf, als er Quemados Absichten erkannte. »Es ist Selbstmord«, hatte Finch damals zu seinem Begleiter gesagt, »der Mexikaner reitet einen halblahmen Gaul und hat weder Vorräte noch einen Wassersack, um die Llanos Estacados zu bewältigen.« Aron Fox hatte nur erwidert: »Philippo Quemado ist ein toter Mann, so oder so.« Doch der Mexikaner machte das Unmögliche möglich und tauchte drei Wochen später in Fort Bascom, New Mexico, auf. Zu Tode erschöpft, aber noch lange nicht tot. Freunde, bei denen Quemado Unterschlupf fand, brachten ihn wieder auf die Beine, und anstatt nun westwärts über die Rockies zu ziehen, wählte Quemado die östliche Richtung und zog den Canadian River hinunter bis Fort Elliot. Das war sein Verhängnis. Armer Teufel, dachte Aron Fox, als er den Mann im staubigen Gras knien sah, der mit seinem erschöpften Tier sprach. Sein Blick streifte Finch Osborn, der seinen Triumph, am Ende seiner Fährte zu stehen, nicht verbergen konnte. Dabei hatte Finch es nur dem Zufall zu verdanken, daß sie Quemados Fährte wiedergefunden hatten. Vor zwei Tagen war Quemado auf ihr nächtliches Lager gestoßen, und als er voller Schrecken erkannte, daß er dem Teufel begegnet war, wandte er sich zur Flucht. Doch diesmal war es zu spät. Finch war ein Satan, der auch in der Nacht zu sehen vermochte, denn er brach das Lager ab und folgte dem Flüchtigen in der Dunkelheit. Und mit dem neuen Tag hatte er den Mexikaner am Red River in die Enge getrieben, so daß der Mann keine Chance mehr hatte. Aron Fox betrachtete das erschöpfte Pferd, das sich für seinen Herrn zu Tode gelaufen hatte. Gleich würde Philippo Quemado neben dem Schecken liegen, mit einer Kugel im Schädel oder in der Brust.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 150
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western – 342 –
Der Witwenmacher
Unveröffentlichter Roman
Joe Juhnke
»Wir haben Quemado bald«, hatte Finch Osborn vor drei Wochen schon seinem Begleiter Aron Fox prophezeit, als sie bei Austin den Colorado River durchquerten, und er gab sich alle Mühe, sein Wort zu halten. Aber der flüchtige Philippo Quemado, dem die Angst vor dem berüchtigten Jäger in den Knochen saß, entwickelte unnatürliche Kräfte und zog trotz schlechtester Vorbereitungen und Vorräte – Quemado floh über Nacht aus seiner Hütte – den Brazos hoch bis ins Mündungsgebiet. Finch Osborn, der seinem Wild bis auf zwei Tage nahe war, schüttelte unwillig den Kopf, als er Quemados Absichten erkannte.
»Es ist Selbstmord«, hatte Finch damals zu seinem Begleiter gesagt, »der Mexikaner reitet einen halblahmen Gaul und hat weder Vorräte noch einen Wassersack, um die Llanos Estacados zu bewältigen.«
Aron Fox hatte nur erwidert: »Philippo Quemado ist ein toter Mann, so oder so.«
Doch der Mexikaner machte das Unmögliche möglich und tauchte drei Wochen später in Fort Bascom, New Mexico, auf. Zu Tode erschöpft, aber noch lange nicht tot. Freunde, bei denen Quemado Unterschlupf fand, brachten ihn wieder auf die Beine, und anstatt nun westwärts über die Rockies zu ziehen, wählte Quemado die östliche Richtung und zog den Canadian River hinunter bis Fort Elliot. Das war sein Verhängnis.
Armer Teufel, dachte Aron Fox, als er den Mann im staubigen Gras knien sah, der mit seinem erschöpften Tier sprach. Sein Blick streifte Finch Osborn, der seinen Triumph, am Ende seiner Fährte zu stehen, nicht verbergen konnte.
Dabei hatte Finch es nur dem Zufall zu verdanken, daß sie Quemados Fährte wiedergefunden hatten.
Vor zwei Tagen war Quemado auf ihr nächtliches Lager gestoßen, und als er voller Schrecken erkannte, daß er dem Teufel begegnet war, wandte er sich zur Flucht. Doch diesmal war es zu spät. Finch war ein Satan, der auch in der Nacht zu sehen vermochte, denn er brach das Lager ab und folgte dem Flüchtigen in der Dunkelheit.
Eine Nacht – einen Tag – eine Nacht…
Und mit dem neuen Tag hatte er den Mexikaner am Red River in die Enge getrieben, so daß der Mann keine Chance mehr hatte.
Aron Fox betrachtete das erschöpfte Pferd, das sich für seinen Herrn zu Tode gelaufen hatte. Gleich würde Philippo Quemado neben dem Schecken liegen, mit einer Kugel im Schädel oder in der Brust. Beides war das gleiche, denn Osborn kannte für einen Outlaw keine Gnade, und seine Treffsicherheit war tödlich.
Dabei hatte der arme Teufel nur eine Ziege gestohlen, um seiner Pepita, seiner kleinen Tochter, eine Freude zu bereiten.
Aber McDea, ein reicher Grundbesitzer am Colorado, geriet über den Diebstahl derart in Rage, daß er nach Finch Osborn schickte, der gerade in der nahen Stadt einen toten Viehdieb ablieferte und die Kopfprämie kassierte.
Tausend Dollar hatte McDean als Prämie ausgesetzt, wenn Osborn den Dieb stellen würde, und Aron, der seinen Freund zur Ranch begleitete, hatte verwundert den Kopf geschüttelt.
»Tausend Dollar für eine Ziege, das ist absurd«, hatte er seinen Freund gewarnt, doch McDean hatte darauf wie ein Choleriker reagiert und geschrien: »Mit einer Ziege fängt es an! Dann ist es ein Kalb und schließlich ein Rind. Aus einem Rind wird eine Herde und aus einem kleinen Dieb eine Diebesbande.«
Finch Osborn hatte gelassen die Schultern gezuckt. Tausend Dollar waren tausend Dollar, und ein Dieb war ein Dieb…
Ja, daran mußte Aron denken, als der Mexikaner sich erhob, seinen alten Colt spannte und mit einem Schuß die Qualen seines Schecken beendete. Gewehrt hatte der arme Teufel sich schon. Das mußte man ihm lassen. Doch was nützte das nun?
»Laß das arme Schwein sausen«, sagte Aron in einer Anwandlung von Moralgefühl, doch Finch Osborn hörte nicht auf seine Worte. Er war ein Jäger, und das Wild war gestellt. Er hatte eine Aufgabe übernommen und war bereit, sie auszuführen.
»Greaser«, rief er dem hageren Mann zu, der vielleicht dreißig war und aussah wie fünfzig, »du hast deine Eisen in der Hand, nutze also deine Chance.«
Quemados Blicke hetzten zwischen den beiden Männern hin und her. Auch diesmal schien er einen Ausweg zu suchen. Diesen breitschultrigen Mann, der sich abwandte und in die Sonne blinzelte, hatte er nicht zu fürchten. Nur den mit den schmalen Lippen und den kalten Augen fürchtete er.
»Gringo«, sagte der hagere Mexikaner erschrocken, und die Hand, die den alten Colt hielt, zitterte leicht, »ich habe noch nie auf einen Menschen geschossen. Verzeihen Sie, Señor.«
Finch Osborns Augen zeigten keinen Ausdruck. Sie blieben kalt, ohne Gefühl. Der Mexikaner war für ihn kein Mensch, nur ein Preis. Eintausend Dollar.
»Ich werde dich töten, so oder so. Du hast deine Chance, Greaser.«
Und eine schwangere Frau und ein Kind, dachte Aron Fox verbittert. Warum dachte Finch nicht daran? Armer Finch Osborn.
Vier Jahre schon ritten sie zusammen. Es gab kein Land, kein Territorium, das ihre Füße nicht gestreift hatten. Es waren vier unruhige Jahre gewesen, immerfort getrieben von der Jagd nach lohnender Beute. Menschen, die zu Verbrechern wurden, Viehdiebe, Eisenbahnräuber, Mörder. Wo ein Pamphlet hing, dessen Preis Osborns Vorstellungen entsprach, stieg er in den Sattel. Und er, Aron Fox, ebenfalls.
Es waren vier wilde Jahre gewesen, und es hatte sich eigentlich gelohnt. Osborn mußte eine stattliche Summe angespart haben, und er, Fox, träumte bereits seit einiger Zeit von einem kleinen stillen Tal, einer festen Hütte und einem Garten davor. Verdammt, er wurde fünfundvierzig, und seine Knochen setzten Rost an. Sie wurden langsam steif. Da war es schon an der Zeit, an die Zukunft zu denken.
»Señor, ich kann nicht«, jammerte der Mexikaner. »Ich habe Señor McDean eine Ziege gestohlen, gut, ich werde sie bei ihm abarbeiten. Ich werde Peso für Peso zurückzahlen. Aber meine Frau…«
»Du vergibst deine Chance«, unterbrach Osborn, und Fox hörte an seiner Stimme, daß der Augenblick gekommen war, wo neben Philippo Quemado der Tod seine Arme ausbreitete. »Ich zähle bis drei. Eins…«
»Señor…«
»Zwei…« Unerbittlich klang Finch Osborns Stimme.
Aron Fox schloß die Augen. Er war ein rüder Bursche, fast so wie Finch Osborn. Sie hatten ohne Gewissen Menschen vom Leben zum Tode befördert. Aber dieses arme Schwein hier, das nur eine Ziege klaute, um seinem Kind einen Becher Milch geben zu können. Oder seinem Weib… Fox sah sie noch vor sich, als sie vor Monaten die Hütte betreten hatte. Eine abgearbeitete, verhärmte Frau mit schwangerem Leib.
»Finch!« schrie Aron Fox.
»Drei…«, sagte Finch Osborn kalt. Seine Rechte zuckte abwärts zum weiten, offenen Halfter. Flink, so schnell, daß es mit dem Auge kaum wahrnehmbar war.
Fox sah, daß der Mexikaner die Arme hochriß, nicht etwa, um Finch Widerstand entgegenzusetzen. Das Entsetzen hatte seine Arme in die Höhe getrieben und die tödliche Furcht vor dem Fremden, der ihn monatelang wie einen räudigen Bastard durch das Land gehetzt hatte.
Ein einzelner Schuß fiel, der hagere Mexikaner streckte sich.
Dann sah Aron Fox den armen Teufel umkippen. Er lag neben seinem Schecken. Tot wie der Schecke. So, wie es Finch vorausbestimmt hatte.
»Das war nicht nötig, Finch. Er war ein armer Kerl«, sagte Aron leise.
Finch Osborn schob die Patronenhülse aus der Trommel. »Was ist los, Aron? Wirst du alt? Du bist doch sonst nicht so zimperlich. Das hier war ein Geschäft, es ging um tausend Dollar. Hast du das vergessen?«
Aron Fox schwieg. Seine Hände fuhren durch das filzige ergraute Haar, und er spürte die Feuchtigkeit an den Handballen. Waren das Zeichen des Altwerdens?
Finch Osborn trat zu dem Toten und drehte ihn mit der Stiefelspitze auf den Rücken. Zwei dunkle, gebrochene Augen, die ihren Glanz verloren hatten, blickten Osborn entgegen. Stumm und anklagend. Aber Finch Osborns Herz schien hart wie Stein zu sein. Er zeigte keinerlei Regung, als er den Toten am breiten Gurt erfaßte und durch das verdörrte Gras zu seinem Wallach schleppte. Er wuchtete den Erschossenen quer vor den Sattel und stieg in die Bügel.
»Nimm seinen Sattel und das Zaumzeug, Aron«, sagte Osborn und stieß dem Wallach die Sporen in die Flanken, »es gehört seiner Witwe.«
Ein schönes Erbe, dachte Fox und zerrte den verwitterten alten Sattel unter dem Schecken hervor. Schweigend folgte er Osborn, und irgendwie begann er Osborns Kaltschnäuzigkeit zu hassen. Auch in der Nacht und am folgenden Tag lag eine Barriere zwischen ihnen, die zu einem unüberwindlichen Hindernis anwuchs.
Am Nachmittag des folgenden Tages erreichten sie eine windschiefe Hütte in einer von karger Vegetation bewachsenen Mulde. Ein kleiner Bastardhund lief ihnen bellend entgegen und sprang an Osborns Pferd hoch, wo noch immer der Tote quer vor dem Sattel lag. Ein Kind spielte im Sand, und als sie an der Hütte vorbeiritten, folgten ihnen die Blicke der Mexikanerin. Aron Fox würde diese anklagenden dunklen Augen nie vergessen. Er trieb seinem Fuchs die Sporen in die Flanken, um Abstand zu gewinnen, und ließ dabei den Sattel in den Staub fallen.
Ein mageres Erbe für ein entbehrungsreiches Leben, dachte Aron und hoffte, daß die Frau die fünfhundert Dollar in der Satteltasche finden möge. Sein Anteil an der Jagd.
*
Sie folgten dem Colorado und stießen auf saftiges Weideland. Einige tausend gebrannte Kühe grasten hier. Sie begegneten Cowboys, an denen sie schweigend vorüberzogen, und bei Anbruch der Nacht ritten sie durch das offenstehende Tor, über dessen Querholm ein gebleichter Schädel hing und darunter das Zeichen der McDean Ranch.
Sie trabten den Weg hinauf zu dem langgestreckten, weithin leuchtenden Gebäude auf dem Hügel, und als sie nahe genug heran waren, erhob sich McDean aus seinem Schaukelstuhl, und einige neugierige Männer eilten aus der Mannschaftsbaracke.
Osborn zügelte den grobknochigen Wallach und ließ den toten Mexikaner vor die Füße des Ranchers fallen.
»Ihr Dieb, Mister McDean«, sagte Osborn, und Fox, der vom Pferd stieg, sah, daß McDean einen Augenblick die Fassung verlor. Vielleicht hatte er die Tragweite nicht erfaßt, als er tausend Dollar für den Mann ausgesetzt hatte. Vielleicht wollte er ihn auch nur lebend, um ihn angemessen bestrafen zu können.
McDean streckte sich, und Fox spürte, daß der Rancher ein harter Mann war, weil nur ein starker Mann ein Land wie das von McDean aufbauen und erhalten konnte.
»Wir werden sein Weib benachrichtigen. Kommen Sie ins Haus, Finch Osborn.« McDean wandte sich ab, und Osborn folgte.
Aron Fox blieb bei den Pferden und blickte südwärts, wo aus den Schatten des sinkenden Tages eine Frau auf einem Murro näher kam.
»Es braucht niemand zu Quemados Witwe zu reiten. Dort kommt sie bereits.« Aron setzte sich auf die unterste Stufe der Terrasse und begann, sich eine Zigarette zu drehen.
Voller Trauer und dennoch trotzigen Gesichtes, ritt sie an den Männern vorbei, stieg vom Rücken des Maultieres und fand noch die Kraft, die tote Hülle ihres Mannes über den Rücken des Tieres zu schieben.
Osborn trat aus dem Haus. Er hielt ein dickes Dollarbündel in der Faust und blickte verwundert auf die Mexikanerin, die über den Murro und ihren toten Mann hinweg Finch Osborn anblickte. Stumm, anklagend, mit einem Funken unversöhnlichen Hasses in den Augen.
Sie erfaßte die verrotteten Zügel des Murros und wandte sich zum Tor. Aron Fox blickte hinter der Frau her, und es würde lange dauern, bis er ihren Blick vergessen sollte.
Osborn zählte die bunten Scheine und schob dem Freund seinen Anteil zu. Fox steckte das Geld in die Brusttasche, weil er Philippo Quemados Frau seinen Anteil an der Jagd zurückgelassen hatte.
Osborn saß im Sattel, und Fox folgte dem Freund in den sinkenden Tag. Die Barriere, die zwischen ihnen aufwuchs, wurde höher und höher, bis Finch Osborn in einer der folgenden Nächte das Schweigen brach.
»Du denkst zu viel an diesen mexikanischen Dieb, Aron.«
»Ich denke an seine Witwe«, widersprach Aron Fox verbittert. »Sein Leben hatte nicht den Wert einer Ziege.«
»Er war nur ein Dieb. Heute eine Ziege, morgen ein Rind und übermorgen eine Herde, Aron. Wo ist der Unterschied?« fragte Osborn ungerührt.
Aron Fox glaubte diese Worte schon einmal gehört zu haben. »Du sprichst wie dieser Rancher McDean.«
»Richtig. Aber es liegt ein Sinn in McDeans Worten. Sie fingen alle klein an, diese Ganoven und Diebe, die sich zu mächtigen Rustlern entwickelten und zur Gefahr für ein aufstrebendes Land wurden. Vergessen wir ihn. Wir werden neue Aufgaben finden, die einen ganzen Mann erfordern.«
In dieser Nacht lag Aron Fox mit wachen Augen unter seiner Decke und blickte zum sternenklaren Himmel empor. Er lauschte den fremden und dennoch vertrauten Geräuschen, welche die nächtliche Prärie bevölkerten, und immer wieder sah er die dunklen Augen der Mexikanerin.
*
In den folgenden Wochen und Monaten verblaßte das traurige Schicksal eines kleinen mexikanischen Viehdiebes aus Aron Fox’ Erinnerungen, und auch die Barriere zwischen Fox und Osborn baute sich ab.
Neue Ereignisse traten in den Vordergrund, die einen ganzen Mann mit Logik und klarem Verstand forderten.
In Garrett waren sie auf einen Mann gestoßen, der sich Stanford nannte und Präsident der Central Pacific Corporation war. Stanford schien großes Vertrauen in Osborn zu setzen. Er sprach lange mit Osborn über den Bau der Eisenbahn, ihren Fortschritt zum Wohle der Menschheit und den Schwierigkeiten, die dies alles mit sich brachte, und erst zum Schluß kam er auf den eigentlichen Kern der Dinge zu sprechen.
»Zwischen Tascosa und Trinidad wurde innerhalb von zwei Monaten dreimal der Expreß überfallen und ausgeraubt. Nicht nur, daß die Sicherheit der Strecke gefährdet ist, Mister Osborn, die Gesellschaft trifft auch erhebliche finanzielle Verluste. Sie, Mister Osborn, und Ihr Begleiter, Mister Fox, sind uns von Freunden in Fort Worth wärmstens empfohlen worden. Man sagte, die Aufgaben, die Sie übernehmen, wären auch schon gelöst.«
Und während Stanford weitersprach, saß Aron Fox im bequemen Ledersessel, betrachtete die riesigen Ölgemälde in prunkvollen Rahmen an der Wand, betastete die bunten dicken Teppiche unter seinem Sessel und schien geblendet vom Glanz der mächtigen Lüster an der Decke. Er dachte mit gewisser Mißgunst: Mister Stanford ist sicher so reich, daß er die Höhe seines Vermögens nur ahnen kann. Wie lohnend für ihn der Fortschritt ist, den die Zivilisation westwärts über die Sierra trägt.
Und Aron Fox, der immer noch von einem Stück umzäunter Weide träumte und von einem Garten vor dem Haus, spürte unbewußt, daß er zwar ein freies Leben genossen, am eigentlichen Leben jedoch vorbeigetrieben war.
»Zwanzigtausend Dollar würde die Gesellschaft es sich kosten lassen, um Übel und Ärger aus der Welt zu schaffen«, hörte er Stanford sagen.
Zwanzigtausend, klingelte es in Arons Ohr, und sein eingebildetes Land wie auch das kleine Haus, vor dem er einmal zu sitzen träumte, wuchs um ein beträchtliches.
Er floh aus seinen Träumen und sah gerade noch, daß sein Freund Osborn den Auftrag mit Handschlag annahm. Und er fühlte sich in Trance über die dicken Perserteppiche aus dem Stanfordschen Palast getragen.
»Sagte er zwanzigtausend?« Aron hielt sich an Osborns Schulter und blinzelte in die flimmernde Luft, die seit einigen Tagen wie eine heiße Glocke über Texas stand.
Finch Osborn lächelte. »Ja, Aron, zwanzigtausend Dollar. Sie bringen dich deinen Träumen ein beträchtliches Stück näher.«
Aron spürte, daß Finch seine innersten Gedanken wohl längst erkannt hatte. »Darauf könnte ich ein Bier vertragen, Finch. Meine Kehle ist plötzlich so trocken.«
»Ich kann es verstehen«, erwiderte Osborn, und in Gedanken ging er sein Leben durch. Sie hatten gejagt und gewonnen, sie hatten geschwitzt und geflucht, sie hatten getötet und Verbrecher dem Gesetz ausgeliefert. Für hundert Dollar Prämie, für zweihundert oder vielleicht auch schon für tausend Dollar. Aber zwanzigtausend Dollar? »Es wird nicht einfach sein, Aron.«
Es wird das letzte Mal sein, daß ich auf Menschenjagd gehe, dachte Aron Fox zuversichtlich und stieß mit dem Fuß die Schanktür zum nächsten Saloon auf.
Mädchen saßen an den Tischen, standen an der Theke oder beim Roulette. In kurzem Mieder und bunten Strapsen an den Schenkeln. Schlanke mit enger Wespentaille, kräftige mit prallem Busen, die einladend aus den Miedern ragten. Und sie alle lächelten den Eintretenden entgegen.
»Finch«, sagte Fox heiser, als sie am Tresen standen und auf ihr Bier warteten, »es wird sich nicht umgehen lassen, daß ich nach einem kräftigen Schluck noch etwas Kräftigeres brauche.« Dabei äugte er zu einer vollbusigen Rotblonden am Nachbartisch, die ganz seinen Erwartungen entsprach und nicht abgeneigt schien, die Nacht mit einem rostenden Eisen, das er nun war, zu teilen.
Vielleicht konnte er von ihr ein Dessous erwischen, so, wie es früher war, als er über die Rinderstraße trailte und seine Eroberung stolz am Sattelhorn flatterte, so lange, bis es in Wind, Sonne und Regen zerfiel.
Aron Fox schloß die Augen. Waren das noch Zeiten.
*
Irgendwann endete die Zeit zuckersüßer Träume, und sie strebten in engen, überfüllten Waggons westwärts über Fort Worth, Wichita Falls, Panhandle nach Tascosa.
Unter Arons verschwitztem Hemd klebte der zarte Hauch eines Dessous aus feiner Seide und Spitze, und in seinem Herzen lebte die Erinnerung an eine stürmische Nacht.
Der Zug ratterte über die Schienen. Die Männer auf den Bänken schnarchten lautstark oder fluchten über die strenge Hitze im Panhandle Valley. Ihr Schweiß klebte an den Bänken und Wänden, und sie stanken abscheulich.
»Daß es Leute gibt, die für diese Tortur noch zahlen…« Aron schüttelte unverständlich den Kopf. Er konnte es nicht begreifen.
»Leute, die zahlen, reisen im Pullman, Aron. Wir sind Streckengeher, Schwellenhauer und Schienenleger. Dies ist der Job, in dem wir unbemerkt in ihre Kreise gelangen, denn ich vermute stark, daß die Informanten der Rustler unter dem Personal der Central Pacific zu suchen sind. Gehen wir auf den Perron.«
Sie zwängten sich durch die engen Sitzreihen zum hinteren Ausgang und stellten sich auf die offene Plattform, hinter der die Flachwagen mit Material und Güter fuhren. Ganz am Ende, dort, wo der Bremser auf einem hohen Bock saß, schaukelte der geschlossene Waggon mit den Pferden. Wenn auch draußen die Hitze unerträglich erschien, war der Zugwind wie mildernder Balsam.
Zwei Männer saßen auf der Einstiegtreppe. Der Wind spielte mit ihrem langen Haar. Einer von ihnen blickte ihnen freundlich entgegen. »Im Wagen ist es vor Hitze nicht auszuhalten.«
»Du sagst es«, erwiderte Osborn und drehte mit geschickten Händen eine Zigarette, die er Aron zwischen die Lippen schob. »Arbeitest du schon lange für die Central Pacific?« fragte er den Mann, der ihn angesprochen hatte.
Dieser erhob sich und trat zu den Freunden. »Zwei Jahre«, sagte er und musterte die Männer. »Ihr seid neu auf der Strecke?«