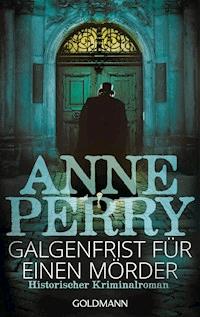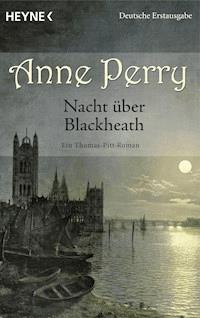7,99 €
Mehr erfahren.
Unheimliche Dinge ereignen sich in London. Drei rätselhafte Mordfälle in der feinen Oberschicht lassen Inspektor Pitt verzweifeln. Doch dann kommt plötzlich Licht in das Dunkel – die Spur führt in ein Edelbordell, das von einem Politiker geführt wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 392
Ähnliche
Das Buch
Unheimliche Dinge ereignen sich in London. Drei rätselhafte Mordfälle in der feinen Oberschicht lassen Inspektor Pitt verzweifeln. Doch dann kommt plötzlich Licht in das Dunkel – die Spur führt in ein Edelbordell, das von einem Politiker geführt wird.
Die Autorin
Anne Perry, 1938 in London geboren und in Neuseeland aufgewachsen, lebt und schreibt in Schottland. Ihre historischen Kriminalromane zeichnen ein lebendiges Bild des spätviktorianischen London. Weltweit haben sich die Bücher von Anne Perry bereits über zehn Millionen Mal verkauft.
Inhaltsverzeichnis
Für MEG für ihre Hilfe
1. Kapitel
Der Nebel wallte dicht und naßkalt durch die Straße, verschleierte ihre Konturen und ließ die Gaslaternen über ihr nur gedämpft leuchten. Die Luft war klamm und feucht und legte sich auf die Atemwege, vermochte aber die Begeisterung des Publikums, das aus dem Theater strömte, nicht abzukühlen. Einige der Besucher ließen sich sogar dazu hinreißen, ganz spontan ein paar Ohrwürmer aus Gilbert und Sullivans neuer Operette Der Mikado zu singen. Ein Mädchen bewegte sich wie die kleine japanische Heldin graziös hin und her, bis es von seiner Mutter scharf zurechtgewiesen und aufgefordert wurde, den Anstand walten zu lassen, den ihre Familie von ihr erwarten konnte.
Ein kurzes Stück davon entfernt gingen Sir Desmond und Lady Cantlay langsam auf den Leicester Square zu, um eine Droschke anzuhalten. Sie waren nicht in ihrer eigenen Kutsche gekommen, weil es schwierig war, eine passende Stelle zu finden, wo man sie stehen lassen konnte. In solch einer Januarnacht wollte man die Pferde nicht unnötig herumstehen oder in der Gegend herumtraben lassen, bis man zum Einsteigen bereit war. Es war zu schwierig, wieder zwei wirklich gut zusammenpassende zu bekommen, als daß man ihre Gesundheit auf eine so unnötige Weise gefährdet hätte. Es gab ja reichlich Droschken, und die kamen natürlich in die Nähe der Theaterausgänge.
»Die Aufführung hat mir wirklich gut gefallen«, sagte Lady Gwendoline mit einem Seufzer der Freude, der zu einem Erschaudern wurde, als eine feuchtkalte Nebelschwade sich auf ihr Gesicht legte. »Ich muß mir die Noten besorgen, um sie selber spielen zu können; die Melodien sind einfach entzückend. Besonders das Lied, das der Held singt.« Sie holte tief Atem, hustete erstmal und sang dann mit lieblicher Stimme: »Ein wandernder Musikant bin ich, ein Wesen aus Flicken und Flecken – ah – wie ging es weiter, Desmond? Ich kann mich gut an die Melodie erinnern, aber die Worte sind mir entfallen.«
Er ergriff ihren Arm, um sie vom Bordstein wegzuziehen, weil gerade eine Droschke vorbeiratterte und mitten durch den Pferdemist fuhr, den der Straßenkehrer, der offenbar vorzeitig nach Hause gegangen war, nicht weggeräumt hatte.
»Ich habe den Text auch vergessen, meine Liebe. Aber ich bin sicher, er wird bei den Noten stehen. Es ist wirklich eine lausige Nacht und das Gehen kein Vergnügen. Wir müssen sehen, daß wir sofort eine Droschke bekommen. Da kommt eine. Warte hier, ich rufe sie heran.« Er trat auf die Straße hinaus, als die zweiräderige Droschke aus dem Nebel auftauchte. Das Geklapper der Hufe wurde durch die alles erstickende Feuchtigkeit gedämpft, und das Pferd zog mit hängendem Kopf, doch wie es schien, in keine bestimmte Richtung.
»Nun kommen Sie schon!« rief Sir Desmond irritiert. »Was ist los mit Ihnen? Wollen Sie sich kein Fahrgeld verdienen?«
Das Pferd kam bis auf seine Höhe heran, hob den Kopf und stellte die Ohren nach vorne, als es seine Stimme hörte.
»Kutscher!« rief Desmond scharf.
Es kam keine Antwort. Der Kutscher saß bewegungslos, mit hochgeschlagenem Mantelkragen, der den größten Teil seines Gesichts verdeckte, auf seinem Sitz; die Zügel hingen schlaff in seinen Händen.
»Kutscher!« Desmond wurde zusehends ärgerlicher. »Ich nehme an, Sie sind nicht besetzt. Meine Frau und ich wollen zum Gadstone Park fahren.«
Der Mann machte immer noch keine Anstalten, das Pferd, das sich langsam vorwärts bewegte und von einem Fuß auf den anderen trat, zu lenken oder anzuhalten, so daß es für Gwendoline gefährlich gewesen wäre, in die Droschke einzusteigen.
»Um Himmels willen, Mann! Was ist denn los mit Ihnen?« Desmond streckte den Arm aus, ergriff den Mantel des Kutschers und zog heftig daran. »Bringen Sie endlich Ihren Gaul zum Stehen!«
Zu seinem Entsetzen neigte sich der Mann ihm entgegen, bekam das Übergewicht, kippte von seinem Sitz und fiel über ein Rad vor seine Füße auf das Pflaster.
Desmonds erster Gedanke war, der Mann müsse sinnlos betrunken sein. Er wäre ja bestimmt nicht der einzige Kutscher gewesen, der sich gegen die endlosen Stunden in dem kalten Nebel mit mehr Alkohol gewappnet hatte, als er vertragen konnte. Verdammt ärgerlich war das, aber er war nicht ganz ohne Verständnis für so etwas. Wäre er nicht in Gwendolines Hörweite gewesen, hätte er laut geflucht, aber so war er genötigt, sich zu beherrschen.
»Besoffen«, sagte er verbittert.
Gwendoline kam hinzu und schaute ihn an.
»Können wir denn gar nichts tun?« Sie hatte keine Vorstellung davon, was es hätte sein können.
Desmond beugte sich über den Mann und rollte ihn auf den Rücken. Im selben Moment blies der Wind den Nebel ein wenig auseinander, so daß das Gaslicht auf sein Gesicht fiel.
Es war auf schockierende Weise offensichtlich, daß der Mann tot war – und zwar schon seit einiger Zeit. Noch schrecklicher als das fahle, aufgedunsene Fleisch waren der süßliche Geruch der Verwesung und ein kleiner Klumpen Erde in seinem Haar.
Einen Moment lang herrschte völlige Stille; lange genug, um Atem zu holen, lange genug für die Welle des Aufbäumens. Dann schrie Gwendoline auf, doch ihre hohe, schwache Stimme wurde sofort von der Nacht verschluckt.
Desmond stand langsam auf, und obwohl sich ihm sein Magen umdrehte, versuchte er, seinen Körper zwischen sie und die Leiche auf dem Pflaster zu bringen. Er hatte damit gerechnet, daß sie ohnmächtig werden würde, und wußte nun doch nicht, was er tun sollte. Sie war schwerer als erwartet, als sie gegen ihn sank, und er konnte ihr Gewicht auf Dauer nicht halten.
»Hilfe!« rief er verzweifelt. »Helfen Sie mir!«
Das Pferd war an den unbeschreiblichen Lärm der Londoner Straßen gewöhnt, und Gwendolines Kreischen berührte es kaum. Desmonds Rufe bewirkten bei ihm überhaupt keine Regung.
Er schrie wieder mit erhobener Stimme und versuchte zu verhindern, daß sie seinem Griff entglitt und auf das schmutzige Pflaster rutschte. Zugleich versuchte er, sich vorzustellen, was er mit dem Toten, der hinter ihm lag, anfangen sollte, ehe sie wieder zu Sinnen kam und vollkommen hysterisch wurde.
Mehrere Minuten schienen schon vergangen zu sein, in denen er fröstelnd vor den undeutlichen Umrissen der Droschke stand und in denen alles still war, bis auf das Schnauben des Pferdes. Dann, endlich, waren da auch Schritte, eine Stimme, eine Gestalt.
»Was ist denn los? Was fehlt denn?« Ein riesiger Mann, mit flatterndem Mantel und in einen Wollschal gewickelt, tauchte aus dem Nebel auf. »Was ist passiert? Sind Sie überfallen worden?«
Desmond hielt immer noch Gwendoline, die sich jetzt wieder zu regen begann. Er schaute den Mann an und sah ein intelligentes, humorvolles Gesicht von unbezweifelbarer Offenheit. Im Schein der Gaslaterne war er jetzt auch nicht mehr so riesig. Groß, aber nicht riesig. Seine bunt zusammengewürfelte Kleidung sah nicht unbedingt korrekt aus.
»Hat man Sie überfallen?« wiederholte der Mann ein klein wenig schärfer.
Desmond zwang sich zu klaren Gedanken.
»Nein.« Er zog Gwendoline enger an sich heran und kniff sie dabei, ohne es zu wollen. »Nein – aber der Kutscher ist tot.« Er räusperte sich und hustete, als ihn der Nebel wieder packte. »Ich fürchte, er ist schon seit einiger Zeit tot. Meine Frau ist von dem Anblick ohnmächtig geworden. Wenn Sie so freundlich sein und mir helfen wollten, Sir! Ich will versuchen, sie wieder zu Bewußtsein zu bringen, und dann, glaube ich, sollten wir die Polizei holen. Ich nehme an, die interessiert sich für solche Dinge. Der arme Mann ist grauenhaft anzusehen. Man kann ihn nicht einfach hier liegenlassen.«
»Ich bin Polizist«, antwortete der Mann und schaute dabei an ihm vorbei auf die Gestalt am Boden. »Inspektor Pitt.« Er fischte geistesabwesend nach einer Karte und brachte ein Taschenmesser und ein Knäuel Schnur zum Vorschein. Resignierend gab er den Versuch auf und bückte sich hinunter zu der Leiche, berührte mit seinen Fingern einen Moment lang das Gesicht, dann die Erde im Haar.
»Er ist tot«, begann Desmond. »Eigentlich – eigentlich sieht er fast so aus, als ob er schon beerdigt gewesen wäre – und dann wieder ausgegraben wurde.«
Pitt richtete sich auf und fuhr sich mit den Händen über die Seiten seines Mantels, wie um etwas abzuwischen.
»Ja, ich glaube, Sie haben recht. Eklig. Sehr eklig.«
Gwendoline erlangte jetzt ihr volles Bewußtsein wieder und richtete sich auf. Wenigstens wurde so ihr Gewicht von Desmonds Arm genommen, obgleich sie sich immer noch an ihn lehnte.
»Es ist gut, meine Liebe«, sagte er schnell und versuchte dabei, sie von Pitt und der Leiche fernzuhalten. »Die Polizei wird sich darum kümmern.« Während er dies sagte, schaute er grimmig zu Pitt hin und versuchte, aus seinen Worten so etwas wie eine Aufforderung zu machen. Es war an der Zeit, daß der Mann etwas Zweckdienlicheres unternahm, als nur mit ihm über das Offensichtliche übereinzustimmen.
Ehe Pitt antworten konnte, tauchte eine Frau aus der Dunkelheit auf, hübsch anzusehen und mit einer Ausstrahlung, der sogar die feuchtkalte Januarstraße nichts anhaben konnte.
»Was ist denn los?« Sie sah Pitt geradeheraus an.
»Charlotte«, er zögerte und überlegte einen Moment lang, wieviel er ihr sagen sollte, »der Kutscher ist tot. Es sieht so aus, als ob er schon etwas länger tot wäre. Ich werde sehen müssen, daß etwas unternommen wird.« Er wandte sich Desmond zu. »Meine Frau«, erklärte er und ließ die Worte in der Luft hängen.
»Desmond Cantlay.« Desmond ärgerte sich, daß er sich der Frau eines Polizisten vorstellen mußte, aber die Höflichkeit ließ ihm keine andere Wahl. »Lady Cantlay.« Er drehte seinen Kopf ruckartig zu Gwendoline hin.
»Sehr erfreut, Sir Desmond«, antwortete Charlotte bemerkenswert gefaßt. »Lady Cantlay.«
»Sehr erfreut«, sagte Gwendoline schwach.
»Wären Sie bitte so freundlich und würden mir Ihre Adresse geben?« fragte Pitt. »Für den Fall, daß es etwas nachzufragen gibt. Ich bin sicher, Sie wollen eine andere Droschke nehmen und nach Hause fahren.«
»Ja«, stimmte Desmond hastig zu. »Ja – wir wohnen in Gadstone Park, Nummer dreiundzwanzig.« Er wollte noch deutlich machen, daß er unmöglich irgendwelche Auskünfte geben konnte, da er den Mann ja vorher nicht gekannt oder auch nur die winzigste Idee hatte, wer er war oder was mit ihm geschehen war, aber er erkannte im letzten Augenblick, daß es wohl besser wäre, diesen Gedanken jetzt nicht weiter zu verfolgen. Er war nur zu froh, den Ort einfach verlassen zu können und kam gar nicht eher auf den Gedanken, bis er in einer anderen Droschke saß und den halben Weg nach Hause bereits zurückgelegt hatte, daß die Frau des Polizisten ihren Weg alleine machen oder zusammen mit ihrem Mann warten mußte, bis der Leichenwagen kam, um ihn und die Leiche schließlich zu begleiten. Vielleicht hätte er ihr seine Hilfe anbieten sollen. Wie auch immer – jetzt war es zu spät. Das beste war wohl, die ganze Angelegenheit so bald wie möglich zu vergessen.
Charlotte und Pitt standen auf dem Pflaster neben der Leiche. Pitt konnte Charlotte nicht alleine im Nebel auf der Straße stehenlassen; er konnte aber auch die Leiche nicht unbeaufsichtigt zurücklassen. Er durchsuchte wieder seine Taschen und fand auch bald seine Trillerpfeife. Er pfiff, so laut er konnte, wartete eine Weile und pfiff noch mal.
»Wie ist es denn bloß möglich, daß ein Kutscher länger als eine Stunde oder zwei tot herumfährt?« fragte Charlotte ruhig. »Würde ihn das Pferd denn nicht zurück nach Hause bringen?«
Pitt verzog sein Gesicht, so daß sich Falten um seine lange, gebogene Nase bildeten. »Das würde ich auch meinen.«
»Wie ist er denn gestorben?« fragte sie weiter. »Vor Kälte?« Mitleid war aus ihrer Stimme zu hören.
Er streckte seine Hand aus und berührte sie sanft; eine Geste, die mehr besagte, als er ihr mit Worten in einer Stunde hätte mitteilen können.
»Ich weiß es nicht«, antwortete er sehr leise. »Aber er ist schon lange Zeit tot, vielleicht eine Woche oder noch länger. Und es ist Erde in seinem Haar.«
Charlotte starrte ihn mit erblassendem Gesicht an. »Erde?« wiederholte sie. »In London?« Sie sah die Leiche nicht an. »Wie ist er denn gestorben?«
»Ich weiß es nicht. Der Polizeichirurg...«
Aber noch ehe er Zeit hatte, seinen Gedanken zu vollenden, tauchte ein Constable aus der Dunkelheit auf und einen Moment später folgte ihm ein zweiter nach. Pitt erklärte kurz, was geschehen war, und übertrug ihnen die Verantwortung für die ganze Angelegenheit. Es dauerte zehn Minuten, bis er eine andere Droschke bekam, aber um viertel nach elf waren er und Charlotte zurück in ihrem eigenen Heim. Im Haus war es ruhig und warm nach der bitteren Kälte der Straße. Jemima, ihre zwei Jahre alte Tochter, verbrachte die Nacht bei Mrs. Smith gegenüber. Charlotte hatte es vorgezogen, sie dort zu lassen, anstatt sie zu dieser späten Stunde noch zu stören.
Pitt zog die Tür zu und sperrte die Welt hinaus; die Cantlays, tote Kutscher, den Nebel, alles außer der nachklingenden Musik, der Fröhlichkeit und den Farben der Operette. Als er Charlotte geheiratet hatte, hatte sie ohne ein Wort den Komfort und den Status ihres Vaterhauses aufgegeben. Dies war erst das zweite Mal, daß es ihm möglich war, sie in ein Theater in der City zu führen, und es war ein Anlaß zum Feiern. Den ganzen Abend über hatte er auf die Bühne und dann wieder auf ihr Gesicht geschaut, und die Freude, die er darin sah, war die ganze Sparsamkeit, jeden Penny, der dafür zur Seite gelegt worden war, wert. Er lehnte sich rückwärts gegen die Tür, lächelte und zog sie zärtlich zu sich heran.
Aus dem Nebel wurde Regen und aus dem Regen Graupelschauer. Zwei Tage später saß Pitt an seinem Schreibtisch im Polizeirevier, als ein Sergeant mit Sorgenfalten im Gesicht zu ihm hereinkam. Pitt schaute auf.
»Was gibt es, Gilthorpe?«
»Sie erinnern sich an den toten Kutscher, den Sie vorletzte Nacht fanden, Sir?«
»Was ist mit ihm?« Pitt hätte vorgezogen, diese Sache zu vergessen; eine Tragödie, aber eine der üblichen, abgesehen von der langen Zeit, die er schon tot war.
»Nun«, Gilthorpe trat von einem Fuß auf den anderen, »nun, es scheint, er war gar kein Kutscher. Wir haben ein offenes Grab gefunden ... «
Pitt erstarrte. Irgendwo im Hintergrund seines Bewußtseins hatte er so etwas befürchtet, als er das aufgedunsene Gesicht und die feuchte Erde im Haar gesehen hatte; etwas Häßliches und Obszönes, aber er hatte es ignoriert.
»Wessen?« sagte er ruhig.
Gilthorpes Gesicht glättete sich. »Ein Lord Augustus Fitzroy-Hammond, Sir.«
Pitt schloß seine Augen, als ob auch dies verschwinden würde, wenn er Gilthorpe nicht sah.
»Er starb erst kürzlich, vor drei Wochen, Sir«, fuhr Gilthorpes Stimme unerbittlich fort. »War zwei Wochen lang begraben. Große Beerdigung, sagt man.«
»Wo?« Pitt fragte ganz mechanisch weiter, während sein Gehirn immer noch nach einem Ausweg suchte.
»In St. Margaret, Sir. Wir haben natürlich eine Wache hingestellt.«
»Wozu denn das?« Pitt öffnete seine Augen. »Was kann denn jemand einem leeren Grab antun?«
»Gaffer, Sir«, sagte Gilthorpe, ohne eine Miene zu verziehen. »Es könnte jemand hineinfallen. Ziemlich schwer, wieder herauszukommen aus so einem Grab. Die Seiten sind steil und zu dieser Jahreszeit auch noch glitschig. Und der Sarg ist natürlich auch noch da.« Er richtete sich ein wenig auf, um damit anzudeuten, daß er fertig war und auf Pitts Anweisungen wartete.
Pitt schaute zu ihm auf.
»Ich glaube, es ist am besten, wenn ich die Witwe aufsuche und sie die Leiche von der Droschke identifizieren lasse.« Er erhob sich seufzend auf seine Füße. »Sagen Sie den Leuten vom Leichenhaus, sie sollen sie so annehmbar wie möglich herrichten! Es wird ohnehin eine ziemlich üble Sache für die Dame werden. Wo wohnt sie denn?«
»Gadstone Park, Sir, Nummer zwölf. Alles sehr große Häuser dort; ziemlich reich, würde ich sagen.«
»Bestimmt«, stimmte Pitt trocken zu. Eigenartig, ging ihm durch den Kopf, das Paar, das die Leiche fand, wohnt auch dort. So ein Zufall! »Also gut, Gilthorpe. Gehen Sie und sagen Sie den Leuten vom Leichenhaus, Seine Lordschaft zur Besichtigung fertig zu machen!« Er nahm seinen Hut, drückte ihn sich fest auf den Kopf, schlang seinen Schal um den Hals und ging hinaus in den Regen.
Gadstone Park war, wie Gilthorpe gesagt hatte, eine sehr wohlhabende Gegend mit großen Villen, die von der Straße zurückgesetzt waren, und einem sehr gepflegten Park in der Mitte, in dem Lorbeer- und Rhododendronbüsche standen und eine sehr schöne Magnolie – soweit sich das ohne Blätter sagen ließ. Der Regen war wieder zu einem Graupelschauer geworden, und der dunkle Tag kündete von kommendem Schnee.
Er erschauderte, als das Wasser seinen Nacken hinunterlief und kalt über seine Haut rieselte. Egal, wie viele Schals er sich umwickelte, es war immer dasselbe.
Nummer zwölf war ein klassisches georgianisches Haus mit einer geschwungenen Auffahrt, die sich bis zu einem säulenbestandenen Eingang erstreckte. Seine Proportionen taten seinem Auge wohl. Wenn er auch nie wieder – seit seiner Kindheit als Sohn eines Wildhüters – in so einem Haus wohnen würde, so erfreute es ihn doch, es zu sehen. Solche Häuser waren eine Zierde für die ganze Stadt und lieferten jedermann den Stoff für Träume.
Als ein Windstoß einen riesigen Lorbeerbusch vor dem Eingang rüttelte und ihn mit Wassertropfen überschüttete, drückte er seinen Hut tiefer ins Gesicht. Er zog an der Klingel und wartete.
Ein Diener, ganz in Schwarz, erschien. Durch Pitts Kopf flackerte der Gedanke: verfehlter Beruf – die Natur hatte ihn wohl als Leichenbestatter vorgesehen.
»Ja, Sir?« Die Worte kamen ausgesprochen zögernd, denn der Mann hatte ihn als einer niedrigeren Klasse zugehörig erkannt, der eigentlich hätte wissen müssen, daß der hintere Eingang für ihn da war.
Pitt kannte diesen Gesichtsausdruck seit langem und war darauf vorbereitet. Er hatte keine Lust, seine Zeit mit mehrfach übermittelten Botschaften zu verschwenden, und außerdem war es weniger grausig, die Sache einmal und in aller Klarheit vorzubringen, als sie nach und nach durch die Hierarchie der Dienerschaft sickern zu lassen.
»Ich bin Inspektor Pitt von der Polizei. Das Grab von Lord Augustus Fitzroy-Hammond wurde geschändet«, sagte er mit sachlicher Stimme. »Ich würde gerne mit Lady Fitzroy-Hammond darüber sprechen, damit die Angelegenheit so bald wie möglich und so diskret wie möglich erledigt werden kann.«
Der Diener verlor vor Überraschung seine Begräbnismiene. »Es – es wäre angebracht, Sie kämen herein.«
Er machte einen seitlichen Schritt nach hinten, und Pitt folgte ihm nach. Er war noch zu bedrückt von dem vorher Gehörten, als daß er über die Wärme im Innern des Hauses hätte froh sein können. Der Diener geleitete ihn in das Zimmer, das für die vormittäglichen Besuche vorgesehen war, und ließ ihn dort alleine zurück; wahrscheinlich, um die erschütternde Neuigkeit dem Butler mitzuteilen und ihm die Last der nächsten Entscheidung aufzubürden.
Pitt mußte nicht lange warten. Lady Fitzroy-Hammond kam bleich herein und blieb stehen, als sie noch kaum durch die Tür war. Pitt hatte jemand beträchtlich Älteren erwartet. Der tote Mann auf der Droschke mußte wenigstens sechzig gewesen sein, vielleicht noch älter, aber diese Frau konnte unmöglich über die Zwanziger hinaus sein. Nicht einmal das Schwarz der Trauer konnte die Farbe und Feinheit ihrer Haut und die Geschmeidigkeit ihrer Bewegungen verbergen.
»Sie sagen, es gab eine – Schändung, Mr....?« sagte sie ruhig.
»Inspektor Pitt, Madam. Ja, es tut mir sehr leid. Jemand hat das Grab geöffnet.« Der Sachverhalt ließ sich nicht auf angenehme Weise darstellen, keine Höflichkeit konnte die Häßlichkeit zudecken. »Aber wir haben einen Leichnam gefunden, und wir würden sie bitten, uns zu sagen, ob es sich dabei um Ihren verstorbenen Gatten handelt.«
Einen Moment lang dachte er, sie würde gleich ohnmächtig werden. Es war dumm von ihm; er hätte warten sollen, bis sie sich gesetzt hatte, vielleicht sogar nach einem Mädchen schicken sollen, das ihr zur Seite stehen würde. Er tat ein paar Schritte nach vorne, um sie auffangen zu können, falls sie zusammensank.
Sie sah ihn ängstlich verstört an, verstand ihn nicht.
Er war sich ihrer Angst bewußt und blieb stehen.
»Kann ich ein Mädchen für Sie rufen?« sagte er ruhig und ließ die Arme wieder sinken.
»Nein.« Sie schüttelte ihren Kopf und nahm sich so weit zusammen, daß sie langsam an ihm vorbei zum Sofa gehen konnte. »Danke. Es geht mir schon besser.« Sie holte tief Luft. »Ist es wirklich unbedingt erforderlich, daß ich...?«
»Wenn nicht noch jemand anderer aus der engeren Familie da ist«, antwortete er und wünschte, er hätte etwas anderes sagen können. »Gibt es vielleicht einen Bruder oder...« Beinahe hätte er ›Sohn‹ gesagt, aber er erfaßte noch rechtzeitig, wie taktlos das gewesen wäre. Er wußte nicht, ob sie die erste oder zweite Frau war. Genaugenommen hatte er versäumt, Gilthorpe nach dem Alter Seiner Lordschaft zu fragen. Es war aber anzunehmen, daß Gilthorpe mit der Sache überhaupt nicht zu ihm gekommen wäre, wenn nicht die Wahrscheinlichkeit bestand, daß er der Mann auf der Droschke war.
»Nein.« Sie schüttelte den Kopf. »Da sind nur Verity, die Tochter von Lord Augustus, und seine Mutter, aber die ist schon sehr alt und auch behindert. Es bleibt schon an mir hängen. Kann ich vielleicht ein Mädchen mitnehmen?«
»Ja, natürlich; es wäre sogar sehr gut, wenn sie es täten.«
Sie stand auf und zog an der Klingelschnur. Als ein Mädchen kam, schickte sie es zu ihrer Kammerzofe. Sie solle ihr ihren Mantel bringen und sich selbst zum Weggehen fertigmachen. Die Kutsche wurde angefordert. Sie wandte sich wieder Pitt zu.
»Wo – wo haben Sie ihn gefunden?«
Es hatte keinen Sinn, ihr die Einzelheiten zu erzählen, egal ob sie ihn nun geliebt hatte oder ob es eine reine Zweckheirat war.
»In einer Droschke, Madam.«
Falten traten auf ihr Gesicht. »In einer Droschke? Aber – was soll das bedeuten?«
»Ich weiß es nicht.« Als er Stimmen in der Halle hörte, öffnete er die Tür für sie, führte sie hinaus und half ihr in die Kutsche. Sie fragte nicht mehr weiter, und sie fuhren schweigend zum Leichenhaus. Das Mädchen nestelte an ihren Handschuhen, und ihre Augen vermieden es geflissentlich, auch nur einen zufälligen Blick auf Pitt zu werfen.
Die Kutsche hielt an, und der Diener half Lady Fitzroy-Hammond beim Aussteigen. Das Mädchen und Pitt folgten ohne Assistenz nach. Ein kurzer Weg führte von der Straße zum Leichenhaus; er war überdacht von kahlen Bäumen, die jedesmal, wenn der Wind in sie fuhr, erschreckend eisiges Wasser versprühten.
Pitt zog an der Glocke, und gleich darauf öffnete ein junger Mann mit rosigem Gesicht die Tür.
»Inspektor Pitt mit Lady Fitzroy-Hammond.« Pitt trat zur Seite, damit sie hineingehen konnte.
»Ah, ja. Guten Tag, guten Tag.« Der junge Mann führte sie gutgelaunt hinein und durch einen Gang in einen Raum voller Tische, die alle diskret mit Tüchern zugedeckt waren. »Sie kommen wegen Nummer vierzehn.« Er glühte vor Reinlichkeit und professionellem Stolz. Ein Korbstuhl stand in der Nähe des Tisches, vermutlich für den Fall, daß der Anblick die Verwandten überwältigen würde, und eine Kanne mit Wasser und drei Gläser standen auf einem kleinen Tisch am Ende des Raumes bereit.
Das Mädchen nahm vorsichtshalber ein Taschentuch heraus.
Pitt stand bereit, seine Unterstützung zukommen zu lassen, wenn es nötig werden sollte.
»Gut.« Der junge Mann drückte seine Brille fester auf die Nase und zog das Tuch zurück, um das Gesicht sichtbar zu machen. Der Kutscher war jetzt ohne Bekleidung, und seine spärlichen Haare waren ordentlich gekämmt, aber er war immer noch ein abstoßender Anblick. Die Haut war fleckig und löste sich an einigen Stellen vom Fleisch, der Geruch war ekelerregend.
Lady Fitzroy-Hammond schaute kaum hin, bedeckte dann ihr Gesicht mit den Händen, machte einen Schritt nach rückwärts und stieß dabei den Stuhl um. Pitt stellte ihn mit einer einzigen Bewegung wieder auf, und das Mädchen half ihr, sich darauf zu setzen. Niemand sprach ein Wort.
Der junge Mann zog das Tuch wieder hoch und trabte durch den Raum, um ein Glas Wasser zu holen. Er tat das so unerschütterlich, als ob es eine tägliche Gepflogenheit für ihn wäre – was es ja wahrscheinlich auch war. Er kam zurück und reichte es dem Mädchen, das es für seine Herrin bereithielt.
Sie nahm einen Schluck und umklammerte es dann krampfhaft, so daß die Knöchel ihrer Finger weiß hervortraten.
»Ja«, sagte sie atemlos. »Das ist mein Mann.«
»Ich danke Ihnen, Madam«, antwortete Pitt nüchtern. Das war zwar nicht das Ende des Falles, aber wahrscheinlich alles, was er je darüber wissen würde. Grabräuberei war natürlich ein Verbrechen, aber er machte sich keine wirkliche Hoffnung, daß er herausbekommen würde, wer diese obszöne Tat vollbracht hatte und warum.
»Fühlen Sie sich gut genug, daß wir gehen können?« fragte er. »Ich bin sicher, es geht Ihnen besser zu Hause.«
»Ja, danke.« Sie stand auf, schwankte einen Moment lang und ging dann, dicht gefolgt von ihrem Mädchen, ziemlich unsicher auf den Ausgang zu.
»War das dann alles?« wollte der junge Mann wissen. Seine Stimme war ein wenig leiser geworden, hörte sich aber immer noch heiter an. »Kann ich ihn dann als identifiziert kennzeichnen und für die Beerdigung freigeben?«
»Ja, das können Sie. Lord Augustus Fitzroy-Hammond. Die Familie wird Ihnen sicher sagen, welche Vorkehrungen sie wünscht«, antwortete Pitt. »Nichts Außergewöhnliches an dem Leichnam, wie?«
»Nein, überhaupt nicht«, sagte der junge Mann übereifrig, nun, da die Frauen jenseits der Tür und außer Hörweite waren. »Außer daß er schon vor mindestens drei Wochen gestorben ist und schon einmal beerdigt war. Aber ich nehme an, das wissen Sie.« Er schüttelte seinen Kopf und mußte danach seine Brille wieder zurechtrücken. »Ich verstehe nicht, warum jemand so etwas tut – einen Toten ausgraben, meine ich. Nicht daß ihn jemand seziert hätte oder so etwas, wie es Medizinstudenten schon getan haben – oder Leute, die irgendeiner schwarzen Magie anhängen. Er war völlig unberührt.«
»Kein besonderes Mal an ihm?« Pitt wußte nicht, warum er das fragte; er hatte nichts Derartiges erwartet. Es handelte sich hier um einen eindeutigen Fall von Pietätlosigkeit, weiter nichts. Die Tat irgendeines Irren mit bizarrer Gemütsverfassung.
»Nein, überhaupt nicht«, sagte der junge Mann bestätigend. »Ein älterer Herr, gut gepflegt, gut genährt, ein wenig korpulent, aber nicht ungewöhnlich für sein Alter. Weiche Hände, sehr sauber. Soviel ich weiß, habe ich vorher noch nie einen toten Lord gesehen, aber dieser hier sieht genauso aus, wie ich es erwartet hätte.«
»Vielen Dank«, sagte Pitt langsam. »In diesem Fall gibt es nicht mehr viel für mich zu tun.«
Pitt nahm selbstverständlich an der Wiederbestattung teil. Es war ja möglich, daß, wer auch immer diese Schändung begangen hatte, ebenfalls anwesend war, um die Auswirkung seiner Tat auf die Familie zu sehen. Vielleicht war das auch das Motiv: ein schwärender Haß, der immer noch nicht zur Ruhe gekommen war, auch nach dem Tode nicht.
Es war natürlich eine sehr stille Angelegenheit; man macht kein großes Aufsehen, wenn ein Mensch zum zweitenmal beerdigt wird. Trotzdem war eine beachtliche Zahl von Leuten da, die gekommen waren, um ihre Ehre zu erweisen – mehr wohl aus Sympathie für die Witwe. Sie trugen alle Schwarz, hatten schwarze Bänder an ihren Kutschen, zogen schweigend zum Grab und standen dort mit gesenkten Köpfen im Regen. Nur ein Mann war verwegen genug, als Zugeständnis an sein Wohlergehen seinen Kragen hochzuschlagen. Was bedeutete schon die kleine Unpäßlichkeit eisiger Tropfen, die den Nacken hinunterrieselten, wenn man hier dem ewigen Schweigen des Todes gegenüberstand?
Der Mann mit dem Kragen war schlank, ein wenig größer als der Durchschnitt, und sein feiner Mund wurde durch tiefe, spöttische Linien betont. Er hatte ein schiefes Gesicht mit geschwungenen braunen Augenbrauen, und es war beim besten Willen nichts Joviales darin zu entdecken.
Der Revierpolizist stand neben Pitt, um ihn auf eventuell anwesende Fremde aufmerksam zu machen.
»Wer ist das?« flüsterte Pitt.
»Mr. Somerset Carlisle, Sir«, antwortete der Mann. »Wohnt im Park, Nummer zwei.«
»Was macht er?«
»Absoluter Gentleman, Sir.«
Pitt ließ die Sache auf sich beruhen. Sogar Gentlemen übten gelegentlich Tätigkeiten aus, die jenseits ihrer gesellschaftlichen Stellung lagen, aber das war jetzt nicht wichtig.
»Das ist Lady Alicia Fitzroy-Hammond«, fuhr der Constable völlig unnötig fort. »Schon sehr traurig. Sie waren erst ein paar Jahre verheiratet, wie man sagt.«
Pitt knurrte; der Mann hatte die Mittel, sich seine Wünsche zu erfüllen. Alicia wirkte blaß, aber ziemlich gefaßt und war wahrscheinlich froh, daß sie die ganze Sache fast hinter sich hatte. Neben ihr stand, auch völlig in Schwarz, ein jüngeres Mädchen, vielleicht um die zwanzig, mit zurückgekämmtem honigbraunem Haar und sittsam niedergeschlagenen Augen.
»Miß Verity Fitzroy-Hammond«, kam ihm der Constable zuvor. »Eine ausgesprochen nette junge Dame.«
Pitt hatte das Gefühl, daß darauf keine Antwort nötig war. Seine Augen wanderten zu dem Mann und der Frau hinter dem Mädchen. Er war gut gebaut – wahrscheinlich Sportler in seiner Jugend – und stand immer noch sehr locker da. Seine Brauen waren breit, die Nase lang und gerade, und nur ein gewisser Zug um seinen Mund trübte den Eindruck völliger Harmonie. Aber er war trotz allem ein gutaussehender Mann. Die Frau neben ihm hatte schöne dunkle Augen und schwarzes Haar mit einem sehr attraktiven Silberstreifen, der von ihrer rechten Schläfe ausging.
»Wer sind die?« fragte Pitt.
»Lord und Lady St. Jermyn«, sagte der Constable etwas lauter, als Pitt es gewünscht hätte. In der Stille des Friedhofs war sogar das stetige Tropfen des Regens zu hören.
Das Begräbnis war vorüber, und einer nach dem anderen wandte sich zum Gehen. Pitt erkannte Sir Desmond und Lady Cantlay von der Straße vor dem Theater wieder und hoffte, sie seien taktvoll genug gewesen, ihre Rolle in der Angelegenheit nicht zu erwähnen. Vielleicht waren sie es; Sir Desmond hatte nicht den Eindruck eines unbesonnenen Mannes gemacht.
Die letzte Person, die – in Begleitung eines ziemlich stattlichen Mannes mit einem offenen, liebenswerten Gesicht – wegging, war eine große, sehr schlanke alte Dame mit großartiger Haltung und fast gebieterischer Würde. Sogar die Totengräber zögerten, tippten an ihre Hüte und warteten, bis sie vorbei war, ehe sie mit ihrer Arbeit begannen. Pitt sah sie nur einen Moment lang deutlich, aber dieser Moment genügte ihm. Er kannte diese lange Nase und diese strahlenden Augen hinter schweren Lidern. Mit achtzig hatte sie immer noch mehr von ihrer Schönheit behalten, als die meisten Frauen je haben.
»Tante Vespasia!« Vor Überraschung sprach er diese Worte laut vor sich hin.
»Verzeihung, Sir?« Der Constable stutzte.
»Ist das nicht Lady Cumming-Gould?« Pitt drehte sich zu ihm um. »Die letzte Dame, die jetzt gerade weggeht.«
»Ja, Sir. Wohnt in Nummer achtzehn. Ist erst im Herbst hierher gezogen. Der alte Mr. Staines ist im Februar 1885 gestorben, also vor knapp einem Jahr. Lady Cumming-Gould hat das Haus Ende des Sommers zurückgekauft.«
Pitt erinnerte sich sehr gut an den letzten Sommer. Damals hatte er während der Paragon-Walk-Auseinandersetzungen die Großtante Vespasia von Charlottes Schwester Emily kennengelernt. Genaugenommen war sie die Tante von Emilys Mann, Lord George Ashworth. Er hatte nicht damit gerechnet, sie wiederzusehen, aber es war ihm noch gegenwärtig, wie sehr ihm ihre Geradheit und ihre geradezu erschreckende Offenheit imponiert hatten. Kein Zweifel, wenn Charlotte in eine höhere Gesellschaftsschicht geheiratet hätte, anstatt in eine niedrigere, wäre aus ihr mit der Zeit vielleicht eine genauso unbequeme alte Dame geworden.
Der Constable starrte ihn mit skeptischen Augen an. »Sie kennen sie also schon, Sir?«
»Tut nichts zur Sache.« Pitt wollte keine Erklärung abgeben. »Haben Sie jemanden hier gesehen, der nicht im Park wohnt oder mit der Witwe oder der Familie bekannt ist?«
»Nein, niemand hier, den man nicht erwarten konnte. Vielleicht kommen Grabräuber nicht zum Ort der Tat zurück. Oder vielleicht kommen sie in der Nacht.«
Pitt war nicht nach Sarkasmus zumute, schon gar nicht von seiten eines Constables.
»Vielleicht soll ich Sie dann hier postieren«, sagte er bissig. »Für alle Fälle.«
Das Gesicht des Constables wurde lang, erhellte sich aber wieder, als ihm der Verdacht kam, daß Pitt bloß seine Schlagfertigkeit auf die Probe stellen wollte.
»Wenn Sie glauben, daß das etwas bringt, Sir«, sagte er steif.
»Nur eine Erkältung«, antwortete Pitt. »Ich will gehen und Lady Cumming-Gould meine Aufwartung machen. Sie bleiben den Rest des Nachmittags hier und beobachten weiter«, setzte er mit Genugtuung hinzu. »Nur für den Fall, daß jemand Neugieriger kommt.«
Der Constable schniefte und machte dann ein ziemlich unterdrücktes Niesen daraus.
Pitt ging hinweg und verlängerte seine Schritte, so daß er schon bald Tante Vespasia einholte. Sie ignorierte ihn. Auf Beerdigungen spricht man nicht mit jedermann.
»Lady Cumming-Gould«, sagte er mit gebührender Achtung.
Sie blieb stehen, drehte sich ihm langsam zu und schickte sich an, ihn mit einem einzigen Blick einfrieren zu lassen. Dann kam ihr etwas an seiner Größe und an der Art, wie sein Mantel hing und flatterte, bekannt vor. Sie fingerte nach ihrer Lorgnette und hielt sie vor ihre Augen.
»Liebe Güte! Thomas, was um Himmels willen tun Sie denn hier? Ah, ja, natürlich; ich vermute, Sie suchen denjenigen, der den armen Gussie ausgegraben hat. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, warum jemand so etwas tut. Einfach widerwärtig. Das ist eine Menge Arbeit für alle Betroffenen – und so unnötig.« Sie sah an ihm hinauf und hinunter. »Sie scheinen sich nicht verändert zu haben, abgesehen davon, daß Sie jetzt mehr anhaben. Können Sie denn keine Sachen bekommen, die zueinander passen? Wo haben Sie denn diesen Schal her? Der ist ja gräßlich. Emily hat einen Jungen, wissen Sie das? Doch, natürlich wissen Sie das. Sie werden ihn Edward nennen; nach ihrem Vater. Das ist auch besser als George. Es ist immer so irritierend, wenn ein Junge so heißt wie sein Vater. Man weiß dann nie, von wem eigentlich die Rede ist. Wie geht es Charlotte? Sagen Sie ihr, sie soll mich doch besuchen; die Leute hier im Park langweilen mich zu Tode, außer dem Amerikaner, der ein Gesicht wie ein Pfannkuchen hat. Der häßlichste Mann, den ich je gesehen habe, aber ganz charmant. Er hat nicht die leiseste Ahnung davon, wie man sich benimmt, aber er ist reich wie Krösus.« Ihre Augen tanzten belustigt. »Sie können sich hier nicht entscheiden, wie sie mit ihm umgehen sollen; ob sie höflich zu ihm sein sollen wegen seines Geldes oder ihn schneiden sollen wegen seiner Manieren. Ich hoffe sehr, daß er bleibt. «
Pitt ertappte sich dabei, daß er trotz des Regens, der ihm in den Nacken lief, und der nassen Hosenaufschläge, die an seinen Knöcheln klebten, lächelte.
»Also dann«, schnaubte Vespasia. »Sagen Sie ihr, sie soll frühzeitig kommen, vor zwei, dann trifft sie nicht auf die Höflichkeitsbesucher, die nichts anderes zu tun haben, als sich mit ihrer Garderobe zu übertreffen.« Sie verstaute ihre Lorgnette wieder, rauschte den Weg entlang und ignorierte dabei völlig, daß ihre Röcke den nassen Lehm streiften.
2. Kapitel
Am Sonntag stand Alicia Fitzroy-Hammond wie gewöhnlich kurz nach neun Uhr auf und nahm ein leichtes Frühstück mit Toast und Aprikosenmarmelade zu sich. Verity hatte schon gefrühstückt und schrieb nun Briefe im Damenzimmer. Die Mutter von Augustus, die Witwe Fitzroy-Hammond, würde sich ihr Frühstück wie immer hinaufbringen lassen. An manchen Tagen stand sie auf; weit öfter tat sie es nicht. Dann lag sie in ihrem Bett mit einem gestickten indischen Schal um ihre Schultern und las ihre alten Briefe wieder, die über fünfundsechzig Jahre bis zu ihrem neunzehnten Geburtstag am 12. Juli, genau fünf Jahre nach der Schlacht von Waterloo, zurückreichten. Ihr Bruder war Fähnrich in Wellingtons Armee gewesen. Ihr zweiter Sohn war im Krimkrieg gefallen. Und da waren auch noch Liebesbriefe von Männern, die längst nicht mehr lebten.
Des öfteren schickte sie ihr Mädchen, Nisbett, nach unten, damit sie nachsah, was im Hause geschah. Sie verlangte eine Liste, die über sämtliche Besucher Auskunft gab: Wann sie kamen und wie lange sie blieben, ob sie ihre Karte hinterließen und – das war ihr besonders wichtig – wie sie gekleidet waren. Alicia hatte gelernt, damit zu leben; sie fand es jedoch immer noch unerträglich, daß Nisbett andauernd ihre Nase in die Haushaltsführung steckte und mit ihrem Finger über die Möbel fuhr, um zu sehen, ob sie auch jeden Tag abgestaubt wurden, und den Wäscheschrank öffnete, wenn sie dachte, es sehe sie niemand, und die Laken und Tischtücher zählte und überprüfte, ob auch alle Ecken gebügelt und in Ordnung waren.
Dieser Sonntag war einer von den Tagen, an denen die alte Dame aufstand. Sie genoß es, in die Kirche zu gehen. Sie saß dann in der Gebetsbank der Familie und beobachtete alle, die da kamen und gingen. Sie täuschte auch vor, taub zu sein, obwohl sie in Wirklichkeit ausgezeichnet hörte. Es gefiel ihr, nicht sprechen zu müssen, es sei denn, sie verlangte nach etwas. Von bestimmten Dingen nichts wissen zu müssen, kam ihr manchmal gar nicht ungelegen.
Sie war jetzt ganz in Schwarz gekleidet und stützte sich schwer auf ihren Stock, als sie in das Speisezimmer kam, wobei sie den Stock heftig auf den Boden aufstieß, um Alicias Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.
»Guten Morgen, Schwiegermama«, sagte Alicia mit einiger Anstrengung. »Es freut mich, daß du dich gut genug fühlst, um aufzustehen.«
Die alte Dame schritt auf den Tisch zu, und die allgegenwärtige Nisbett rückte den Stuhl für sie zurecht. Sie starrte mit Mißfallen auf die Anrichte.
»Ist das alles, was es zum Frühstück gibt?« fragte sie.
»Was hättest du denn gerne?« Alicia war ihr ganzes Leben lang zur Höflichkeit erzogen worden.
»Dafür ist es jetzt schon zu spät«, sagte die alte Dame. »Ich werde mich mit dem begnügen müssen, was da ist. Nisbett, bringen Sie mir ein paar Eier und etwas von dem Schinken und den Nieren und reichen Sie mir den Toast! Du gehst doch zur Kirche heute morgen, Alicia?«
»Ja, Mama. Möchtest du auch gerne mitkommen?«
»Ich schwänze nie die Kirche, es sei denn, ich bin zu krank, um auf meinen Füßen stehen zu können.«
Alicia ließ dies unkommentiert. Sie hatte nie genau gewußt, was der alten Dame eigentlich fehlte, wenn ihr überhaupt etwas fehlte. Der Arzt kam regelmäßig und sagte ihr, sie hätte ein schwaches Herz, wofür er Digitalis verschrieb. Augustus war immer besorgt um sie gewesen; vielleicht aus lebenslanger Gewohnheit und weil er Unannehmlichkeiten haßte.
»Ich nehme an, daß du mitkommst«, sagte die alte Dame mit hochgezogenen Augenbrauen und schob eine Gabel mit einer enormen Portion Ei in den Mund.
»Ja, Mama.«
Die alte Dame nickte; ihr Mund war zu voll zum Sprechen.
Dit Kutsche wurde um halb elf gerufen, und Alicia, Verity und der alten Dame wurde nacheinander hineingeholfen und danach wieder heraus, als sie bei der St.-Margaret-Kirche angekommen waren, in der die Familie schon seit mehr als hundert Jahren ihre eigene Gebetsbank hatte. Noch nie hatte jemand, der kein Fitzroy-Hammond war, darin gesessen.
Sie waren frühzeitig angekommen. Die alte Dame liebte es, ganz hinten zu sitzen und zu beobachten, wie alle anderen hereinkamen, und dann eine Minute vor elf nach vorne zur Familienbank zu gehen. Heute war es nicht anders. Sie hatte alle Blutsverwandten – mit Ausnahme von Verity – überlebt; mit der überlegenen Fassung, die einer Aristokratin ansteht. Die Wiederbestattung von Augustus bildete keine Ausnahme.
Zwei Minuten vor elf stand sie auf und ging als erste nach vorne zur Familienbank. Am Ende des Ganges blieb sie plötzlich stehen. Das Unausdenkbare war geschehen. Es war bereits jemand anderer in ihrer Bank: ein Mann mit hochgeschlagenem Kragen, in Gebetshaltung, leicht nach vorne gebeugt.
»Wer sind Sie?« zischte die alte Dame. »Entfernen Sie sich, Sir! Dies ist eine Familienbank.«
Der Mann rührte sich nicht.
Die alte Dame stieß energisch den Stock auf, um ihn auf sich aufmerksam zu machen. »So tu doch etwas, Alicia! Sprich mit ihm!«
Alicia drückte sich an ihr vorbei und berührte den Mann leicht an der Schulter. »Verzeihen Sie...« Sie kam nicht weiter. Der Mann schwankte, fiel seitwärts auf den Sitz der Bank, mit dem Gesicht nach oben.
Alicia schrie, obwohl sie wußte, was die alte Dame und die Kirchengemeinde dazu sagen würden – aber sie konnte sich nicht anders helfen. Es war wieder Augustus mit seinem toten, fahlen, blutleeren Gesicht, der sie da von dem hölzernen Sitz aus anglotzte. Die grauen Steinsäulen rings um sie begannen zu schwanken, und sie hörte ihre eigene Stimme kreischen, als ob sie nicht zu ihr gehörte. Sie wünschte, daß sie aufhörte, aber sie schien keine Kontrolle darüber zu haben. Schwärze kam über sie, die Arme wurden an ihren Körper gedrückt, und etwas Hartes traf sie im Rücken.
Das nächste, was ihr bewußt wurde, war, daß man sie in die Sakristei gelegt hatte. Der Vikar – teiggesichtig und schwitzend – war vor ihr in die Hocke gegangen und hielt ihre Hand. Die Tür stand offen, und der Wind blies eiskalt herein. Die alte Dame saß ihr gegenüber; ihre schwarzen Röcke waren um sie herum aufgebläht wie ein an die Erde gefesselter Ballon. Ihr Gesicht war scharlachrot.
»Ist ja gut, ist ja gut«, sagte der Vikar hilflos. »Sie haben einen ganz schlimmen Schock erlitten, meine liebe Dame. Wirklich schlimm. Ich weiß nicht, was aus der Welt noch werden soll, wenn man den Irren gestattet, frei zwischen uns herumzulaufen. Ich werde an die Zeitungen schreiben und an meinen Abgeordneten im Parlament. Es muß wirklich etwas geschehen. Es ist einfach unerträglich.« Er hustete und tätschelte wieder ihre Hand. »Und wir werden natürlich alle beten.« Die eingenommene Stellung wurde ihm zu unbequem. Er verspürte einen Krampf in seinen Beinen und stand auf. »Ich habe nach einem Arzt für Ihre arme Mama geschickt. Es ist doch Dr. McDuff? Er wird jeden Moment eintreffen. Schade, daß er nicht in der Kirche war.« Ein leicht feindseliger Ton lag in seiner Stimme. Er wußte, daß der Arzt Schotte und Presbyterianer war, und das mißfiel ihm aufs äußerste. Ein Arzt hatte als Nonkonformist in einer Gegend wie dieser nichts zu suchen.
Alicia setzte sich mühsam auf. Ihre ersten Gedanken hatten nicht die alte Dame zum Gegenstand, sondern Verity. Sie hatte vorher noch nie einen Toten gesehen, und Augustus war doch ihr Vater, wenn sie auch kein sehr enges Verhältnis zueinander hatten.
»Verity«, sagte sie mit trockenem Mund, »was ist mit Verity?«
»Quälen Sie sich bitte jetzt nicht damit!« Die Stimme des Vikars wurde erregt bei dem Gedanken an eine drohende Hysterie. Er hatte keine Ahnung, wie er damit fertig werden sollte; noch dazu in einer Kirche. Der Gottesdienst war sowieso schon in eine Katastrophe ausgeartet: Die Mitglieder der Gemeinde waren entweder nach Hause gegangen oder standen draußen im Regen, gehalten von der Neugier, auch das neueste grausige Ereignis in dieser Affäre mitzubekommen. Die Polizei war direkt zur Kirche gerufen worden, und die ganze Angelegenheit artete in einen nicht wieder gutzumachenden Skandal aus. Er wünschte sich von Herzen, daß er nach Hause gehen und zu Mittag essen könnte; an einem wärmenden Feuer und zusammen mit einer vernünftigen Haushälterin, bei der sich nicht alles um ›Gemütsbewegungen‹ drehte.
»Meine liebe Dame«, begann er wieder, »seien Sie bitte versichert, daß man sich um Miß Verity mit der größtmöglichen Sorgfalt gekümmert hat. Lady Cumming-Gould hat sie in ihrer Kutsche nach Hause gebracht. Sie war natürlich sehr unglücklich und bestürzt, aber wer wäre das nicht – es ist alles so schrecklich. Aber wir müssen diese Last tragen, und die Gnade Gottes wird uns dabei helfen. Oh!« Sein Gesicht erhellte sich, als er sah, wie die dicke Gestalt von Dr. McDuff hereinkam und die Sakristeitür ins Schloß fallen ließ. Die Verantwortung konnte jetzt zumindest geteilt oder vielleicht sogar ganz übertragen werden. Schließlich mußte der Doktor sich um die Lebenden kümmern, und er selbst war für die Toten da, denn sonst war ja niemand dazu befähigt.
McDuff ging direkt auf die alte Dame zu und ignorierte die beiden anderen Anwesenden. Er nahm sie beim Handgelenk, fühlte mehrere Sekunden lang ihren Puls und schaute ihr dann ins Gesicht.
»Schock«, sagte er knapp. »Ernstlicher Schock. Ich rate Ihnen, nach Hause zu fahren und soviel Ruhe zu halten, wie Sie glauben, daß Sie brauchen. Lassen Sie sich alle Ihre Mahlzeiten hinaufbringen, und empfangen Sie keine Besucher außer den nächsten Familienangehörigen – und nicht einmal die, wenn Ihnen nicht danach zumute ist. Verrichten Sie nichts Anstrengendes, und lassen Sie sich unter keinen Umständen durch irgend etwas aus der Fassung bringen.«
Das Gesicht der alten Dame entspannte sich vor Zufriedenheit und nahm wieder eine normale Farbe an.
»Gut«, sagte sie und stand mit seiner Hilfe auf. »Ich wußte ja, daß Sie das Richtige wüßten. Ich kann so etwas nicht mehr länger ertragen. Ich weiß nicht, was aus der Welt noch werden soll, wenn das so weitergeht. In meiner Jugend hat es so etwas nicht gegeben. Die Leute wußten damals, wo sie hingehörten, und sind auch dort geblieben. Sie waren auch zu sehr mit ihrer Arbeit beschäftigt, um sich herumzutreiben und die Gräber von über ihnen Stehenden zu entweihen. Heutzutage wird viel zu viel Bildung an die falschen Leute verschwendet; das ist die Ursache, verstehen Sie? Wenn erst ihre Neugierde geweckt ist, bekommen sie Appetit auf etwas, das nicht gut für sie ist. Es ist einfach nicht natürlich. Schauen Sie nur, was hier geschehen ist! Nicht einmal die Kirche ist noch sicher. Es ist fast noch schlimmer, als wenn die Franzosen eingefallen wären.« Mit diesen Worten stakste sie hinaus und stieß dabei ihren Stock wütend gegen die Tür.
»Die arme gute Dame«, murmelte der Vikar. »Was für ein entsetzlicher Schock für sie – und noch dazu in ihrem hohen Alter. Man sollte meinen, sie hätte es verdient, von den Sünden dieser Welt verschont zu werden.«
Alicia saß immer noch in der Kälte auf der Sakristeibank. Es wurde ihr plötzlich deutlich bewußt, wie groß ihre Abneigung gegen die alte Dame war. Sie konnte sich an keinen einzigen Augenblick erinnern – seit ihrer Verlobung mit Augustus –, an dem sie sich in ihrer Gegenwart wohlgefühlt hätte. Bis jetzt hatte sie dies immer verdrängt, Augustus zuliebe. Aber das war jetzt nicht mehr länger nötig. Augustus war tot.
Mit Schaudern erinnerte sie sich an seinen Leichnam auf der Gebetsbank und auf dem Tisch in dem kalten Leichenhaus, in dem der kleine Mann im weißen Mantel auf eine so erschreckende Weise glücklich war zwischen all seinen Leichen. Gott sei Dank war wenigstens der Mann von der Polizei ein wenig sachlicher gewesen; genaugenommen sogar ganz angenehm, auf seine Art.
Die Tür flog auf, und als ob sie ihn durch ihre Gedanken herbeigerufen hätte, stand Pitt vor ihr und schüttelte sich wie ein nasser Hund, so daß die Wassertropfen von seinem Mantel sprühten. Sie hatte nicht mehr damit gerechnet, daß jemand von der Polizei kommen würde, und jetzt drängten sich alle Arten von düsteren Ängsten in ihrem Kopf. Warum das alles? Warum war Augustus wiederum aus seinem Grabe auferstanden wie eine beharrliche, obszöne Erinnerung an die Vergangenheit, die sie davon abhielt, diese hinter sich zu lassen und der Zukunft entgegenzugehen? Die Zukunft hatte so verheißungsvoll geschienen. Sie hatte neue Leute kennengelernt, insbesondere eine Person, schlank und elegant, voll Fröhlichkeit und Charme – Eigenschaften, die Augustus längst verloren hatte. Vielleicht war er in seiner Jugend auch so gewesen, aber damals hatte sie ihn ja noch nicht gekannt. Sie wollte gerne tanzen, Witze über harmlose Dinge machen, am Spinett etwas anderes singen als Hymnen und ernste Balladen. Sie wollte gerne jemanden lieben und aufregende Dinge flüstern und eine Vergangenheit haben, die es wert war, sich an sie zu erinnern; wie die alte Dame, die sich ihre Jugend aus Hunderten von Briefen nochmals erlas. Zweifellos lag Traurigkeit in ihnen, aber auch Leidenschaft, wenn etwas Wahres an dem war, was sie daraus erzählte.