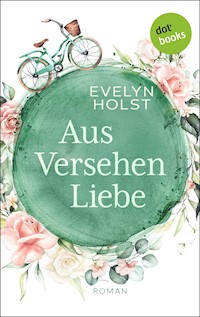4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Happy End mit Kleingedrucktem: Der vergnügliche Beziehungsroman »Du sagst Chaos, ich sag Familie« von Evelyn Holst als eBook bei dotbooks. Camilla und Mario führen eine Ehe ohne Fehl und Tadel – und haben sich so gemütlich in ihrer Beziehung eingerichtet, dass sie ihren langweiligen Sofakissen den Rang ablaufen. Doch dann begegnet Mario plötzlich Jette wieder – jene Frau, in die er sich vor 25 Jahren Knall auf Fall verliebt hat und die er bis heute nicht vergessen konnte. Nun ist sie zurück in Hamburg, im Schlepptau jede Menge Rätsel aus der Vergangenheit – sowie ihren Teenagersohn, der sich prompt in Marios Tochter verliebt. Damit ist Chaos vorprogrammiert! Und die Frage ist nicht nur, ob den beiden jungen Liebenden das Happy End beschert wird, das Mario und Jette verwehrt blieb … sondern auch, welches pikante Geheimnis Camilla so plötzlich vor ihrer Familie zu verbergen hat … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der turbulente Familienroman »Du sagst Chaos, ich sag Familie« von Evelyn Holst wird Fans von Hera Lind und Ildikó von Kürthy begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 583
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Camilla und Mario führen eine Ehe ohne Fehl und Tadel – und haben sich so gemütlich in ihrer Beziehung eingerichtet, dass sie ihren langweiligen Sofakissen den Rang ablaufen. Doch dann begegnet Mario plötzlich Jette wieder – jene Frau, in die er sich vor 25 Jahren Knall auf Fall verliebt hat und die er bis heute nicht vergessen konnte. Nun ist sie zurück in Hamburg, im Schlepptau jede Menge Rätsel aus der Vergangenheit – sowie ihren Teenagersohn, der sich prompt in Marios Tochter verliebt. Damit ist Chaos vorprogrammiert! Und die Frage ist nicht nur, ob den beiden jungen Liebenden das Happy End beschert wird, das Mario und Jette verwehrt blieb … sondern auch, welches pikante Geheimnis Camilla so plötzlich vor ihrer Familie zu verbergen hat …
Über die Autorin:
Evelyn Holst studierte Geschichte und Englisch auf Lehramt. Nach dem ersten Staatsexamen arbeitete sie dreizehn Jahre als Reporterin für den »Stern«, u. a. als Korrespondentin in New York. Für ihre Reportage »Es ist so still geworden bei uns« wurde sie mit dem Egon-Erwin-Kisch-Preis ausgezeichnet. Seitdem verfasste sie zahlreiche Romane, die auch verfilmt wurden, sowie Originaldrehbücher für Fernsehfilme. Evelyn Holst ist mit dem Filmemacher Raimund Kusserow verheiratet, mit dem sie gemeinsam zwei erwachsene Kinder hat.
Bei dotbooks veröffentlichte Evelyn Holst auch ihre Romane »Ein Mann für gewisse Sekunden«, »Aus Versehen Liebe«, »Ein Mann aus Samt und Seide«, »Ein König für gewisse Stunden«, »Gibt's den auch in liebenswert?« und »Der Mann auf der Bettkante«.
Ebenfalls bei dotbooks erscheint ihre Hamburg-Krimireihe:
»Die Sünde – Alexa Martini ermittelt«
»Der Verdacht – Alexa Martini ermittelt«
»Das Verlangen – Alexa Martini ermittelt«
***
eBook-Neuausgabe Juni 2022
Dieses Buch erschien bereits 2000 unter dem Titel »Verdammte Gefühle« bei Knaur.
Copyright © der Originalausgabe 2000 bei Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Kristin Pang, unter Verwendung von Motiven von Sarema / shutterstock.com, Anastasia Lembrik / shutterstock.com und MyStocks / shutterstock.com
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98690-180-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
In diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt und geschrieben wurde – und als solches von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Du sagst Chaos, ich sag Familie« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Evelyn Holst
Du sagst Chaos, ich sag Familie
Roman
dotbooks.
Kapitel 1
Der Verleger Mario Benedikt stand nackt vor dem Spiegel und machte eine kritische Bestandsaufnahme. Kühl, ohne Begeisterung musterte er seinen noch immer breiten, muskulösen Oberkörper, die großen, fast schaufelartigen Bauarbeiterhände, so ganz ungeeignet für seinen Beruf, den leichten Bauchansatz, er hatte in den letzten Jahren sein Tennis sträflich vernachlässigt, die langen, harten Oberschenkel, die dazu nicht passenden, fast weiblichen, leicht behaarten Waden. Neuerdings entdeckte er Haare, wo früher keine gewesen waren. Im Ohrläppchen ein wuscheliges Gestrüpp, an den Brustwarzen zwei lange graue Haare, auch der obere Teil der rechten Kniekehle war ohne seine Einwilligung zugewachsen. Was dachte sich die Natur dabei? Vielleicht ein Wärmeschutz für den Herbst des Lebens? Er schaute an sich hinunter. Zum Glück verwehrte ihm das Bäuchlein nicht den Blick auf seine Füße. Sie waren riesig, die Zehen lang, mit zweimal monatlich pedikürten Fußnägeln.
Ich bin fünfzig geworden, dachte Mario Benedikt, ein alter Mann! Mit dem heutigen Tag beginne ich meine sechste Lebensdekade. Wo war die Zeit geblieben? Er fühlte sich wie fünfunddreißig. An guten Tagen jedenfalls. Doch bald würde er eine Seniorenkarte im Schwimmbad beantragen können. Wie kam er nur auf diesen absurden Gedanken? Er ging nie in öffentliche Schwimmbäder. Beginn einer altersgemäßen Infantilität?
Die Vorstellung amüsierte und deprimierte ihn zugleich.
»Na, alter Mann«, sagte er zu seinem Spiegelbild und dimmte unwillkürlich das Licht, »gewöhn dich dran. Übrigens, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.«
Neben dem Badezimmerspiegel, auf einem stummen Diener, hatte Uschi, die Haushälterin, seine Abendgarderobe bereitgelegt. Während der Verleger in die handwarme Unterwäsche stieg, sein Smokinghemd zuknöpfte und dann die Beine zwischen die akkuraten Bügelfalten seiner Hose schob, dachte er mit Grauen an die bevorstehende Geburtstagsfeier.
Ich will gar nichts, hatte er gesagt, vergeßt den Tag, laßt mich in Ruhe, aber natürlich hatten sie gelacht. Nur Camilla hatte schmal gelächelt: »Nach der statistischen Lebenserwartung stehen dir noch rund fünfundzwanzig Jahre zu. Bei deiner Lebensweise vermutlich nur noch fünfzehn. Wahrhaftig kein Grund zum Feiern. Zumindest nicht für dich.«
Er hatte ihr Lächeln erwidert: »Aber für dich, mein Schatz, nicht wahr?«
Sie hatte auf diese Frage nicht reagiert, aber das leicht mokante Hochziehen ihrer perfekten, sichelförmig gezupften Augenbrauen, der kühle Blick aus den gletscherblauen Augen war Antwort genug.
Mario Benedikt bemühte sich, sowenig wie möglich an seine Ehe zu denken.
Auch berufliche Mißerfolge verdrängte er, so gut es ging. Eine Geschäftspolitik, die sich ausgezahlt hatte. Sein Handy vibrierte in der Hosentasche. Er fluchte, weil er vergessen hatte, auf Mailbox umzuschalten. »Ja?«
»Herr Benedikt?« Die männliche Stimme klang vorsorglich bedauernd. »Tut mir leid, Sie an Ihrem großen Tag stören zu müssen.« Kein großer Tag, ein alter Tag, du Depp, dachte der Verleger und wartete. »Hier ist Möller von der Verleger-Inkassostelle. Wir sind bei Europa leider nicht erfolgreich gewesen. Sie baten um persönliche Benachrichtigung, deshalb ...«
»Schon gut«, knurrte Benedikt, »ich melde mich.« Er stellte das Handy ab. Ärgerte sich. Mario galt als großzügig. Aber ein Jahr war zu lang. Jetzt mußten schärfere Geschütze her. Er griff wieder zum Handy. »Falko? Ich bin’s. Es geht um Europa. Nein, nicht den Euro, die Buchhandlung. Dreihundert. Natürlich Tausend. Ich weiß, du verhandelst nur Scheidungen. Mach für mich ’ne Ausnahme. Danke. Wir sehen uns heute abend.«
Als er danach an das Balkonfenster trat und auf den großen Garten blickte, sah er, wie seine Gattin aus ihrem Jeep stieg. Von weitem war sie noch immer dreißig, eine große, schlanke Frau mit streng aus dem Gesicht gegeltem, weißblondem Haar und vollen roten Lippen. Auch die Furchen, die ihr zweiundfünfzigjähriges Leben in ihr makellos geformtes Gesicht mit der hohen Stirn und den hohen Wangenknochen und einer aristokratischen, aber nicht überlangen Nase gegerbt hatten, waren bei wohlwollender Beleuchtung und dank der raffinierten Arbeit eines brasilianischen Schönheitschirurgen kaum zu erkennen. Sie war eine auffallend attraktive Frau, und auf dieselbe leidenschaftslose Art, mit der er vorhin seinen eigenen, fünfzigjährigen Körper betrachtet hatte, zollte er nun dem ihren Tribut. Sie sieht wirklich toll aus, dachte Mario, aber der Gedanke verflüchtigte sich sofort, als er vom Fenster zurücktrat und zum Eau de Cologne griff.
Jetzt hörte er sie auf der Treppe, sie rief der Haushälterin schnelle, kurze Anweisungen zu, ihr Schritt war leicht und federnd. Sie hatte vor kurzem das Rauchen endgültig aufgegeben und war seitdem fanatisch wie viele spätberufene Nichtraucher.
Vor seiner Tür hielt sie inne. Unwillkürlich warf er einen prüfenden Blick in sein Ankleidezimmer, ob es dort etwas gäbe, das die von ihr geforderte Makellosigkeit ihres Zuhauses störte, ein zerknautschtes Hemd, ein Söckchenball, ein Aschenbecher, womöglich mit einer noch glimmenden Zigarette!
Die Tür ging auf, Mario zuckte zusammen.
»Du bist schon fertig?« Noch nie hatte sich Camilla mit zeitraubenden Höflichkeitsfloskeln wie Begrüßungen unter Eheleuten aufgehalten, sie kam immer direkt zur Sache.
»Der Kummerbund sitzt zu eng. Du ißt zuviel, mein Lieber. In deinem Alter braucht der Körper nicht mehr soviel.«
Mario Benedikt sah seine Frau an, und für einen kurzen Augenblick wurde ihm das Herz schwer. Nicht weil diese Bemerkung ungewöhnlich war, sondern weil sie es eben nicht war. Sie entsprach dem Alltagsgrundton ihrer Ehe, deren silbernes Jubiläum sie im Vorjahr mit einem ebenfalls rauschenden Fest begangen hatten. Ein Grundton von ironischer Höflichkeit und Gleichgültigkeit, der von Jahr zu Jahr mehr erstarrte. Und er war machtlos dagegen, der einzige Bereich in seinem Leben, in dem er es war.
Meist gelang es ihm, seine Ehe zu verdrängen und in den wenigen Stunden, in denen er Camilla sah, die zusammengezimmerte Fassade von zivilisierter Freundlichkeit aufrechtzuerhalten. Selbst wenn sie ab zu noch miteinander schliefen, schaffte er es, ein kurz andauerndes Gefühl von Lust zu erzeugen, das ausreichte, um sie halbwegs zu befriedigen. Glaubte er. Hoffte er. Und bis jetzt war es ihm auch gelungen, seinen Körper in die dazu notwendige Verfassung zu zwingen. Aber jetzt war er fünfzig. Viagratime! Verdammt, es hatte auch ihn erwischt.
Er lächelte Camilla an, die an ihm vorbei zu ihrem eigenen Ankleidezimmer gegangen war und ungeduldig ihre noch im Reinigungszellophan geschützten Kleider hin- und herschob. »Was wirst du heute Aufreizendes für mich tragen?« fragte er und trat hinter sie, streichelte abwesend ihre alabasterschimmernde Schulter. Eine kurze, verblüffte Sekunde lang glaubte er, sie erschauern zu fühlen.
Dann drehte sie sich um. »Mach mir mal den Reißverschluß auf«, sagte sie. Sie ignorierte seine Frage, die sie zu Recht als lediglich höflich erkannt hatte, und stieg aus ihrem kurzen schwarzen Kleid. »Wir müssen uns beeilen, der Bürgermeister wird wie immer pünktlich sein, die Kultursenatorin kommt, wie du weißt, zu jeder Veranstaltung, die promigeile Schnepfe, wenn du Pech hast, auch der Polizeipräsident, laß mal sehen, was fehlt noch an dir?«
Sie stellte sich vor ihn, sah ihn prüfend an. Über ihrer Nasenwurzel bildete sich eine kleine Falte. »Für dein Alter siehst du nicht schlecht aus«, sagte sie dann, ganz ruhig, so als mustere sie ein antikes Sofa oder einen Rassehund, »nimm ein bißchen von meiner getönten Augencreme, man sieht sonst die Tränensäcke, wenn du fotografiert wirst.«
Er sah ihr nach, wie sie, ein langes, samtrotes Abendkleid über dem Arm, aus seinem Schlafzimmer in ihres ging, auf langen, tennistrainierten Beinen, zwischen denen ein ebenfalls trainierter und, wie er sich zu erinnern glaubte, auch noch erfreulich gerundeter Po wippte, und er stellte sich vor, wie es wohl sei, in diese Frau verliebt zu sein. Heiß-kalt, rasend, kniekehlenweich verliebt. So wie er es nie in sie gewesen war. So wie er es nur ein einziges Mal in seinem an Frauen wahrlich überreichen Leben erlebt hatte. Damals vor ... waren es wirklich schon fast dreißig Jahre?
»Seh ich präsentabel aus? Werde ich dir zu Ruhm und Ehre gereichen?« Camilla war zurückgekehrt, stand jetzt in einem tief ausgeschnittenen Kleid vor ihm und steckte sich eine Kreole ins Ohr. Nur in eins. Sie liebte den Hauch von Asymmetrie, die winzige optische Verblüffung. »Du siehst phantastisch aus«, antwortete er ehrlich. »Alle Männer werden mit dir schlafen wollen.«
»Davon geh ich aus«, meinte sie, kühl und kurz, und schlüpfte in ihre Stilettos, »alle, bis auf einen.«
Im Auto überlegte Camilla Benedikt, ob sie die Zeit des Ankleidens nicht besser für eine kurze eheliche Begegnung hätte nutzen sollen. Sie hatte es sich zur Angewohnheit gemacht, immer wenn sie von einem Liebhaber kam, sich gleich danach kurz und knapp ihrem Ehemann zuzuwenden. Nichts haßte sie mehr, als wenn sie in ihrem Bett lag, die Küsse und Liebkosungen von fremder Hand genüßlich nachschmeckte und Mario dann seine Forderungen anmeldete. Wobei sie ihm unterstellte, daß er es auch nur um des lieben Ehefriedens tat, was die Sache nicht besser machte. Früher hatte sie sich perverserweise gewünscht, er würde sich neben sie legen, den Geruch eines anderen Mannes riechen und vor Eifersucht rasend werden. Ach, ihn nur ein einziges Mal außer sich zu erleben, leidenschaftlich! Voller Gefühl für sie, auch wenn es nur Wut oder gekränkte Eitelkeit gewesen wäre!
Nur einmal, ein einziges Mal in seinen Augen etwas anderes zu sehen als diese kühle Freundlichkeit, als diese höfliche Beherrschung.
In ihren ersten Ehejahren hatte sie ihn so geliebt, daß sie ihn immer hartnäckiger provoziert hatte. Sie hatte sich Rosen schicken lassen, Telefonnummern auf Streichholzschachteln geschrieben und sie auf seinem Schreibtisch »vergessen«. Ihren Fitneßtrainer anrufen und, wenn Mario sich meldete, demonstrativ auflegen lassen. Aber nichts berührte, nichts bewegte ihn.
Sie betrachtete ihn von der Seite, musterte sein konzentriertes Profil, wußte nicht, woran er dachte, wußte nur eins: nicht an sie. Einmal hatte sie sexuell so gesättigte Stunden mit einem Mann verbracht, daß sie seinen Geruch mit nach Hause trug. Sie hatte Marios Arbeitszimmer betreten. Ihr Herz hatte geklopft. »Ich war unterwegs.« Ihre Stimme hatte leicht gezittert, trotz allem. Er hatte nicht einmal hochgesehen, hatte einfach weitergeschrieben. »Bin gleich fertig«, hatte er gemurmelt. Da war sie hinter ihn getreten und hatte ihm ihre Hände aufs Gesicht gelegt. Jetzt, hatte sie gedacht, mit fiebriger Angst und Genugtuung, jetzt ...
Doch es war nichts passiert. »Bringst du mir einen Whisky?«
Er hatte sich nicht mal umgedreht.
Danach hatte sie ihn aufgegeben. Es war fast eine Erleichterung. Aber nur fast.
Sie saßen im Auto und schwiegen. Wenigstens das konnten sie gut zusammen.
»Wer wird eigentlich alles dasein?« fragte er in die Stille, und seine Stimme klang so ergeben, daß er ihr fast ein bißchen leid tat. Sie wußte genau, wie sehr er große Feste haßte. Meist feierten sie deshalb ihre Geburtstage zu zweit in einem teuren Restaurant, gelegentlich begleitet von Maria, ihrem einzigen Kind, wenn diese nicht gerade irgendwo auf der Welt einer obskuren Aus-, Fort- oder Weiterbildung nachging. Im Augenblick saß sie in Arizona einem Indianer namens Joe Aptana zu Füßen, zumindest die monatlichen Schecks kamen dort immer an.
»Wie geht’s unserer Tochter?« fragte Mario jetzt. »Das Geld fürs Ticket scheint sie eingelöst zu haben. Feiert sie doch mit uns?«
Camilla seufzte. Was wußte sie von den Irrungen und Wirrungen ihrer nunmehr fünfundzwanzigjährigen Tochter Maria? Am Vortag ihres sechzehnten Geburtstages hatte sie morgens am Frühstückstisch verkündet: »So, ihr Süßen, ich betrachte mich ab heute als volljährig. Eure Erziehung war so gut, daß ihr sie hiermit als beendet betrachten dürft.«
Eine Woche später war sie ausgezogen. Vorher hatte sie ein h an ihren spießigen Vornamen gehängt, mußte ihn dann bei jeder Gelegenheit mehrfach buchstabieren, aber das nahm sie lächelnd in Kauf. »Mariah«, lächelte sie, »Ma-ri-ah.« Nach drei Jahren war sie zur Erleichterung ihrer Eltern wieder Maria. Sie war eben gerne etwas Besonderes. »Meine Oma ist aus Rußland und mein Opa aus Amerika«, hatte sie schon im Kindergarten verkündet. »Mama war beim Zirkus, und eines Tages ist sie vom Seil gefallen, und da hat Papa sie aufgefangen, und sie haben sich ganz doll verliebt.« Marias Spielkameraden staunten, Marias Eltern auch. Woher hatte dieses Mädchen eine solche blühende Phantasie?
Camilla lächelte, als sie an ihre Tochter dachte. Auch wenn es ihr zunehmend schwerer fiel, ein fast dreißig Jahre jüngeres Ebenbild von sich zu erleben, derselbe schlanke, harte Körper mit den langen, geraden Beinen, dieselben dicken blonden Haare, die eisblauen Augen. Sie in jung, doch das Leben noch vor sich. Wenn sie mit ihrer Tochter ein Restaurant betrat, teilte sich das Rote Meer, aber nicht mehr für Camilla Benedikt. Sie war unsichtbar neben Maria. Nur allein war sie noch sichtbar. Sie seufzte und griff ins Handschuhfach. Dort hatte sie, wie in jedem ihrer insgesamt fünf Automobile, ein scharfes Mundspray deponiert. Sie öffnete den Mund und sprayte, reichte dann ungefragt das Döschen weiter. »Du hast Mundgeruch«, sagte sie, was nicht stimmte, sondern nur eine ihrer kindischen kleinen Rachen war. Er sprayte wortlos.
Camilla sah aus dem Fenster. Sie fuhren an der Alster entlang, an deren Ufer die hellerleuchteten Fenster der feinen Jugendstilvillen blinkten wie riesengroße Glühwürmchen. Ein Anblick, der sie, obwohl in der Hansestadt geboren, immer noch erfreute. So schön ist mein Hamburg, dachte sie zärtlich, die schönste Stadt der Welt. Das konnte ihr keiner wegnehmen.
»Ich kann dir nicht sagen, ob unsere Tochter kommt«, sagte sie zu Mario. »Du kennst sie doch. Nichts haßt sie mehr, als sich festzulegen.«
In einer seltenen Anwandlung von Freundlichkeit legte sie die Hand auf seine Schulter, er drehte sich zu ihr und sagte ebenfalls freundlich: »Tut mir leid, daß mein fünfzigster Geburtstag nicht in die Reisepläne unserer Tochter paßt. Aber was soll’s. Leute werden ja genug dasein.«
Camilla zog ihre Hand zurück. Gern hätte sie jetzt doch eine Zigarette geraucht, aber da sie vor sechs Monaten in aller Öffentlichkeit damit aufgehört hatte und sich jetzt nur noch in fremden Betten eine postkoitale genehmigte, verzichtete sie wohlweislich darauf.
»Das will ich meinen«, murmelte sie statt dessen und musterte sich im Autospiegel, »wenn der Verlagschef des Göhlen Verlages ein halbes Jahrhundert wird, dann ist das wahrlich Grund genug für ein großes Fest.«
Mario Benedikt wußte, was nun unweigerlich kam. Und es kam.
»Auch wenn er in den Verlag nur eingeheiratet hat«, fuhr sie fort und zog sich die Lippen nach, »auch wenn es diesem Verlag im Augenblick nicht besonders gutgeht.«
Sie schraubte den Stift wieder zu, klappte den Spiegel zurück und sah aus dem Fenster. »Hast du mich eigentlich je geliebt«, ihre Stimme klang urplötzlich rauh, ungeschützt, »oder warst du lediglich auf den Verlag scharf?«
Er seufzte nur.
Kapitel 2
In der großen Küche des »Hamburger Renaissance Hotel« herrschte eine Stimmung von kollektivem Streßinfarkt, größter Anspannung und Konzentration. Zwanzig Köche und vierzehn Lehrlinge waren damit beschäftigt, den insgesamt zweihundertfünfzig Gästen des Göhlen Verlags ein Geburtstagsmenü vorzubereiten. Gundel Groth, die Chefköchin, ging zwischen den Herdreihen auf und ab und inspizierte ihre Mannschaft. Sie war erst seit vier Wochen im »Hamburger Renaissance Hotel« und mußte sich als erste Frau in dieser Männerbastion noch schwer beweisen. Dies tat sie gern.
»Rüdiger, nicht soviel Gelatine ans Kürbismousse!« Der schmale Küchenlehrling zuckte zusammen, als ihm Gundel den Rührbesen aus der Hand nahm und etwas Wasser in den großen Stahltopf schüttete. »Achte drauf, daß das Wasser kalt bleibt.« Zur Probe stiebte sie ihren Zeigefinger in die Flüssigkeit. »Immer noch zu warm, verdammt.«
Sie ging weiter, nahm die Parade der stumm arbeitenden, schwitzenden Männer ab. Sie war die einzige Frau in der Küche. Was sie wunderbar fand. Sie liebte Männer, hatte deshalb instinktsicher einen Beruf gewählt, wo es einen satten männlichen Überschuß gab. »Sind die Garnelen frisch?« schrie sie jetzt über den Lärm von unsanft abgestellten Töpfen, zischenden Kesseln und einander zubrüllenden Köchen hinweg und hielt die rosa schimmernden Krabben unters Licht. »Von heute morgen«, rief ein Koch, »frisch und feucht wie das Hamburger Wetter.«
»Oder wie die Muschi meiner Freundin«, murmelte Ollie, der zweite Lehrling, in den Topf, in dem er gerade den geschälten, entkernten Kürbis mit etwas Kürbisöl kurz anbriet. »Kurze Hitze, paß doch auf.« Gundel hatte ihn aus den Augenwinkeln beobachtet. Man nannte sie, in Unkenntnis griechischer Mythologie, die Zyklopin, doch sie hatte keineswegs ein Riesenauge, sondern ihre Augen überall. Jetzt riß sie den Topf vom Herd. »Milde Hitze, wo ist der Zitronensaft zum Ablöschen?«
Ollie flitzte, um den Zitronensaft zu holen. Seine heißumkämpfte Lehrstelle hatte er nur seinem Vater zu verdanken, der zwanzig Jahre lang als Souschef im Hotel gearbeitet hatte, bevor er sich mit einem Fischlokal im Hafen selbständig gemacht hatte. Er hatte seinem Ältesten ein Empfehlungsschreiben mitgegeben. Dies und sein guter Name gaben den Ausschlag.
Unter dem prüfenden Blick seiner anspruchsvollen Chefin tröpfelte Ollie jetzt vorsichtig ein paar Spritzer Saft auf die Kürbisstücke. »Nicht so jungfrauenhaft, junger Mann.« Energisch ergriff Gundel die Flasche, schüttete Saft in den Topf. »Wo ist der Fond, die Sahne?«
Sie verrührte die bereitgestellten Flüssigkeiten mit dem Kürbis, sah auf die große Uhr an der gegenüberliegenden Wand.
»Noch eine Stunde bis zur Vorspeise.« Jetzt brüllte sie.
»Beeilung, Männer, keine falsche Bewegung.«
Während Gundel ihre Mannschaft zu Höchstleistungen antrieb, schritt Jochen Waldherr, Chef der Abteilung »Gäste und Catering«, den großen Festsaal ab, in welchem Stammgast Mario Benedikt im Kreise von »zweihundertfünfzig engen Freunden«, so formulierte es die Einladung, seinen fünfzigsten Geburtstag begehen wollte. Nichts durfte also schiefgehen. Verlegergattin Camilla Benedikt war als gnadenlos bekannt, wenn etwas nicht ihren Erwartungen entsprach. Sie hatte das »Hamburger Renaissance Hotel« ein Jahr lang nicht betreten, nachdem einem Aushilfskellner der Teller mit dem Schokoladenmousse auf ihren Jil-Sanderbekleideten Schoß gerutscht war.
»Schön, schön, schön«, murmelte Waldherr erleichtert und strich mit dem Finger über die Tischkante. Keine Falte. Alles war perfekt.
Die langen Tafeln, hufeisenförmig, damastschwer, silberleuchtend, strahlten den Glanz gediegener Festlichkeit aus, der dem Anlaß angemessen war. Gieselher, der Oberkellner, polierte gerade die letzten Gläser, das Silber blitzte, die roten und weißen Gladiolen, auf denen Camilla Benedikt bestanden hatte, gaben der Tafel einen leicht dramatischen, sehr eleganten Touch.
»Haben wir uns nicht wieder selbst übertroffen?« sagte Jochen Waldherr, eigentlich zu sich selbst, aber Gieselher drehte sich trotzdem um. »Wie immer«, bestätigte dieser, und die Männer lächelten sich an. Sie arbeiteten seit fünfzehn Jahren zusammen, harmonisch und streßfrei, was man von ihren jeweiligen Ehen nicht behaupten konnte. Beide hatten deshalb zusammen rund zwei Jahre Resturlaub, den sie nie anzutreten gedachten.
In der angrenzenden Bar, in der ein großer Kamin flackerte, trafen gerade die ersten Gäste ein. »Wichtig, Tüchtig und Co.«, stellte Jochen Waldherr fest, was nicht ganz stimmte, denn die wirklich Wichtigen kamen auf die Sekunde oder etwas zu spät. Er rückte eine Dessertgabel gerade und warf einen Blick auf die festlich schimmernden Damen – Camilla hatte Schwarz ausdrücklich untersagt – und ihre Partner. Alle natürlich im Smoking. Manche, fand Waldherr, sahen darin wie dicke Pinguine aus. Wie seiner Frau wohl dieses Nichts aus Silber stehen würde, das eine große, rothaarige Frau in einem der Spiegel musterte? Sie würde vermutlich gar nicht hineinpassen, aber wenn? Er schob die Gedanken beiseite. Das waren andere Welten, andere Sonnensysteme.
»Ob sie wohl ihren Lover mitbringt?« fragte die Rothaarige ihren Mann, der hinter ihr stand und sie auf die Schulter küßte, »so wie beim letzten Mal, als sie ihren Fitneßtrainer eingeladen hatte, diesen Brasilero, und seine Platzkarte ihrer gegenüberstellte, damit sie den ganzen Abend mit ihm füßeln konnte.« Sie lächelte verklärt.
Der Mann nahm seinen Mund von ihrer Schulter, musterte sich jetzt seinerseits im Spiegel. »An seinem Fünfzigsten?« fragte er gelangweilt und strich sich mit dem angespuckten rechten Zeigefinger die buschigen Augenbrauen glatt. »So geschmacklos wird doch selbst sie nicht sein.«
Der einzige Ort, wo Camilla Benedikt ungestört telefonieren konnte, war das Damenklo, auf dem sie jetzt hockte und hastig die Tastatur ihres winzigen Handys drückte. Sie hatte ihre Lesebrille nicht dabei und konnte nur hoffen, daß sie die richtige Nummer erwischte.
»Hallo, ich bin’s«, sie überlegte kurz, ob sie dabei, ganz diskret natürlich, pinkeln sollte, entschloß sich dann dagegen, »tut mir leid, daß ich so früh gehen mußte. Eine Familienfeier. Ja, wir sehen uns morgen.«
Sie klappte das Handy zusammen und verließ die Toilette.
»Meine Schöne!« Mit ausgebreiteten Armen eilte Falko Fuhrmann auf sie zu, Hamburgs erfolgreichster Scheidungsanwalt und Marios Internatsfreund. Ein breitschultriger, raumverdrängender Mann, an dem alles groß war – Hände, Mund, Ohren ... und ... aber das war lange her. Jetzt stand er vor ihr, und sie sank ihm wie selbstverständlich an die breite Brust. »Wie geht’s?« fragte er, denn er kannte sie gut.
»Muß ja«, lächelte sie, »ich hab’s ja zum Glück schon hinter mir.«
Er lachte. »Den Fünfzigsten? Mach dir nichts draus. Du siehst keinen Tag älter aus als sechsunddreißig.« Sie reckte sich, küßte ihn auf die glattrasierte Wange: »Ach Falko, warum hab ich damals nicht dich geheiratet?«
»Weil du mich nicht geliebt hast«, sagte er nüchtern und schob sie von sich, »und jetzt muß ich mal für kleine Jungs. Auch eine Altersfrage.«
Camilla sah ihm nach und rückte ihr Lächeln zurecht. Das Lächeln einer glücklichen Frau, deren erfolgreicher Ehemann seinen fünfzigsten Geburtstag feierte.
Kapitel 3
Der Anruf ihrer Freundin Gundel erreichte Jette Glücklich auf dem Sofa, auf dem sie ausgestreckt lag, während Waltraud, ihre Fußreflexzonenmasseuse, kundig und mit Blick auf den laufenden Fernseher, in dem eine dieser versabbelten Talkshows lief, ihre Füße knetete. »Ich geh nicht ran«, flüsterte Jette mit geschlossenen Augen, die sie auch nicht öffnete, als der Anrufbeantworter ansprang: »Ich bin’s, Gundel, ich bin in höchster Todesnot.« Jette kannte die Dramatik ihrer besten Freundin, sie streckte Waltraud deshalb genüßlich ihren anderen Fuß hin. »... mein Küchenjunge hat die Kürbismousse versaut, sie ist ein Stein, ein fetter Stein, ungenießbar ...«
»Ja, ich bin’s.« Jette setzte sich seufzend auf und sprach ins Telefon. Mit einer Kopfbewegung bedeutete sie Waltraud, ihre Waden bitte etwas kräftiger zu massieren. »Ob ich Ersatz für deinen fetten Kürbisstein habe? Bist du vom Hahn gehackt? Für zweihundertfünfzig Leute?«
Sie knallte den Hörer auf. »Bitte noch ein bißchen was für meine verspannten Schultern, Walli«, sagte sie. Das Telefon klingelte wieder. Gundel mußte panisch sein. Jette überlegte. In einem der Kühlschränke ihres Partyservice SLOW FOOD lag eine fast fertige Entenleberpraline, die sie, in Riesling-Gelee eingebettet, für das zehnjährige Jubiläum einer Werbeagentur geplant hatte.
Es klingelte noch immer. »Ich bin in einer halben Stunde da«, rief Jette ins Telefon, »aber es werden kleine Portionen, winzige. Liliput.«
In der Hotelküche klappte Gundel ihr Handy zusammen und musterte ihre Männerschar mit schmalen Augen. »Noch mal Glück gehabt, Jungs. Meine Freundin bringt Ersatz. Tja, auf Frauen ist Verlaß.«
Sie warf einen Blick auf die Uhr. Noch fünfundvierzig Minuten bis zum Countdown. Dann mußten zweihundertfünfzig Portionen Vorspeise auf zweihundertfünfzig Tellern vor zweihundertfünfzig verwöhnten Gästen liegen. Sie spürte, wie sich ihr Magen zu einer schmerzhaften, harten Kugel krampfte. Wenn sie diese Feier in den Sand bzw. vor leere Teller setzte, konnte sie gleich ihren Hut nehmen. Alles hing jetzt von Jette ab.
»Papsilein!« Marias durchdringende Stimme ließ die Gäste zusammenschrecken. Ein großes blondes Mädchen bahnte sich den Weg durch die Menge, unbeeindruckt von dem Aufsehen, das sie erregte. Das tat sie regelmäßig, sie war es gewöhnt. Mario, der gerade den subtilen Annäherungsversuchen der Kultursenatorin »Ich würde gern über ein Buchprojekt mit Ihnen plaudern, bei einem Glas Wein?« lauschte, drehte sich um. Sie war also doch gekommen! Zum ersten Mal an diesem Abend wurde sein Herz weit.
»Maria, Mädchen, laß dich umarmen!« Mario fing seine einzige Tochter mit weit ausgebreiteten Armen auf, drückte sie fest an sich. Wie gut sie roch, immer noch, daran hatte sich nichts geändert, seit er sie als rosig zerknitterten Säugling auf der Wöchnerinnenstation erstmals vorsichtig aus den Armen ihrer Mutter hob. »Du bist das schönste Mädchen der Welt«, flüsterte er ihr jetzt ins Ohr, »nie zuvor und nie danach ...«
»... wird ein anderes Mädchen meinen Grad von Vollkommenheit erreichen«, unterbrach sie ihn lachend, »das sagst du immer, wenn du mich siehst ...«
»Weil es immer stimmt«, erwiderte Mario, »laß mich noch einmal an dir schnuppern ...«
Sie schaute auf zu ihm, und für einen Augenblick versank die Welt.
»Sie sehen aus wie ein Liebespaar«, raunte die Rothaarige ihrem Begleiter zu, der warnend seinen Kopf in Richtung Camilla reckte, die sich ihnen mit Gastgeberinnenlächeln näherte ...
»Hi, Camillchen, ein tolles Fest. Deine Tochter ist dir ja wirklich wie aus dem Gesicht ...«
Camilla unterdrückte das sekundenlange, heftige Bedürfnis, ihre Hände um den langen, plissierten Hals dieser Frau zu legen und einmal lächelnd zuzudrücken, einfach nur so, aus Daffke. »... geschnitten, ich weiß, Dorothee ...«, sagte sie statt dessen und folgte ihrem Blick. »Die beiden sind ein Herz und eine Seele.«
Schnell drehte sie sich um, weil unerwartete, ärgerliche Tränen in ihre Augen stiegen. Sie war heute ganz unerfreulich sentimental. »Maria wird immer schöner«, Falko Fuhrmann legte seinen Arm um ihre Taille, »das habt ihr gut hingekriegt, ihr beiden.«
»Neidisch?« fragte sie und bereute ihre Worte, als sie die Wehmut in seinen Augen sah. »Ach Ca ...«, begann er, »da kommt meine Frau.« Er lächelte und ging auf Gina Fuhrmann zu, die ihn unterhakte und davonzog. Camilla drückte die Schultern durch und ging strahlend auf ihre Familie zu.
»Genug geschnüffelt, Papsilein?« fragte Maria gerade. Der Verleger lachte etwas verlegen. Und schnüffelte noch einmal. Ein anderer Duft stieg in ihm auf, einer nach Weihnachten, nach Gewürzen, nach Pfeffer ... Er schob die Erinnerung beiseite.
Seit Marias Babyzeit war er süchtig nach ihrem Geruch. Immer noch hatte sie diese unverwechselbare Mischung aus Babyöl, Kamille, seit einigen Jahren jedoch leicht untermischt mit Nikotin. Was ihn, im Gegensatz zu Camilla, nie gestört hatte.
»Gut riechst du«, sagte er und küßte sie auf die Stelle, auf die er sie immer geküßt hatte, das kleine Grübchen an ihrer rechten Schulter, »schön, daß du es geschafft hast. Ich dachte schon, du hättest dein Ticket eingelöst.«
Empört sah sie ihn an, vage bewußt, daß aller Augen, vor allem die männlichen, sehnsüchtig auf ihr ruhten. »Und dein halbes Jahrhundert verpassen«, rief sie, »niemals. Ich will mit dir anstoßen. Mit dem attraktivsten Junggreis der nördlichen Hemisphäre.«
Alle lachten, am lautesten Mario Benedikt, auch wenn er innerlich zusammenzuckte. Die Hälfte meines Lebens ist vorbei, dachte er, die Hälfte?
Eher zwei Drittel. Besser nicht weiter drüber nachdenken.
»Störe ich die traute Zweisamkeit?« Camilla schaffte es nicht, den leisen Ton von Eifersucht aus ihrer Stimme zu verscheuchen, als sie ihrer Tochter auf die Schulter tippte.
»Mami, du siehst mal wieder phantastisch aus!« Maria umarmte sie, schlang dann ihre Arme rechts und links um ihre Eltern. »Ich sterbe vor Hunger«, lachte sie, »hoffentlich sind die Reden nicht so lang.«
Kapitel 4
Jette parkte ihren Kleinlaster direkt vor dem Service-Eingang des »Hamburger Renaissance Hotel«. Sofort trat eine Hoteluniform aus dem Dunkel: »Sie parken direkt ...« Jette hatte ihre Nase bereits im Kofferraum, tauchte nur kurz hoch: »Sie sind schlauer, als Ihre Uniform vermuten läßt, junger Mann, und jetzt helfen Sie mir mal mit den Platten.«
Ehe der Mann sich versah, hatte er zwei alufolienumwickelte Porzellanplatten auf dem Arm. Jette öffnete ihm die Tür zum Eingang, sie kannte sich hier aus. »In die Küche damit«, sagte sie nur, »ich komm mit dem Rest nach.«
Sie stellte die Warnblinkanlage an und hievte sich die drei restlichen Platten auf die Arme. Ihre Wildpastete war köstlich, das wußte sie, aber für zweihundertfünfzig Personen reichte sie nie und nimmer. Aber wahrscheinlich war der weibliche Teil der Gäste auf Dauerdiät und nippte eh nur an den Gängen. Was Jette, die eine Genießerin war mit immer ein paar Pfunden zuviel, völlig unbegreiflich war. »Wenn einer nicht gut ißt und trinkt, dann ist er meist auch eine Niete im Bett«, pflegte sie zu sagen. Und dachte kurz an den arbeitslosen Lehrer, der seinen Wein mit Selterwasser ruiniert hatte und zu allem Elend überzeugter Vegetarier war. Seine Liebestechnik entpuppte sich dann auch als dementsprechend fleischlos.
In der Hotelküche hatte Gundels Gesicht inzwischen die Farbe roter Beete angenommen. Sie riß Jette die Platten geradezu aus der Hand, danach die Alufolie ab und musterte besorgt die sehr überschaubare Minimenge.
»Mit wieviel Broten hat Jesus die fünftausend Hungrigen in der Wüste gespeist?« fragte sie und erwartete keine Antwort.
»Laß uns beten, Busenfreundin.«
Jette zuckte die Schultern. »Mehr war nicht«, sagte sie, »jetzt muß ich morgen etwas Neues zaubern. Für wen bring ich eigentlich dieses Opfer?« Gundel war bereits dabei, auf die mit üppigem Salatarrangement dekorierten Teller ein winziges Stück Wildparfait zu drapieren. »Irgend so ein blöder Verleger«, murmelte sie und schnitt die Stücke noch kleiner, »er wird fünfzig.«
Mario Benedikt hatte die Augen halb geschlossen und wünschte sich ganz weit weg. In ein kleines französisches Fischerdorf am Atlantik, Austernschlürfen, Weißweintrinken, barfuß. Neben ihm eine Frau mit wehenden Haaren, lachenden Augen. Und dann ins Hotel, zur blauen Stunde, während die Möwen in der Ferne kreischten und die Laken langsam zerknitterten unter ihren heißen, verschwitzten Körpern ... am anderen Tischende hielt sein Internatsfreund Falko Fuhrmann gerade eine launige Laudatio, die trotz ihrer Launigkeit, von der Mario wußte, wie mühsam sein Freund an ihr gefeilt hatte, wie ein Wolkengeschwader an ihm vorüberzog.
»... nur wenige Männer, von denen man wirklich sagen kann: Er ist mein Freund«, sagte Falko Fuhrmann in diesem Augenblick, »und es ist ein Privileg, das ich fast noch höher schätze als meine dritte Ehefrau ...«
Gina Fuhrmann lächelte mit ihren fünfundzwanzigjährigen, collagengepolsterten Lippen trotzdem schmallippig in die Runde, »mehr als meinen Porsche Cabriolet, mehr als meine Kanzlei, daß ich diesen Mann da ...«, er zeigte mit dramatischer Geste auf den Jubilar, der wie ertappt zusammenzuckte, weil er sich gerade überlegt hatte, welche Haarfarbe die Frau eigentlich hatte, mit der er dieses kleine Hotelzimmer zur blauen Stunde teilen wollte – rot vielleicht? »... meinen besten Freund nennen darf. Mario, komm, steh mal auf, laß dich feiern.«
Mario lächelte und erhob sich. Fünfzig, plötzlich hatte diese Zahl ein unheimliches Gewicht. Ein fast gelebtes Leben. WAR es denn ein gelebtes? Oder trotz allen Reichtums, aller Erfolge, aller verlegten Bestseller dennoch ein ungelebtes? Weil das wirklich Lebenswerte fehlte? Die Liebe? Das Glück? Wie durch einen Nebel sah er die lachenden Gesichter seiner zweihundertfünfzig Freunde, die jetzt die Champagnerkelche hoben, ihm zunickten. Er mußte ein paar Worte sagen. Das wurde erwartet. Etwas Lustiges, nicht zu Langes, trotzdem Tiefes.
Zu seinem Schrecken fiel ihm ein, daß er nichts vorbereitet hatte. Er hatte seinen Geburtstag einfach verdrängt.
Er verneigte sich: »Meine Damen und Herren, liebe Freunde und Kollegen, liebe Gattin und liebe Tochter«, vage lächelte er in die entsprechenden Richtungen, »wenn ich so in diese fröhliche Runde blicke, in all Ihre jugendlichen, faltenfreien Gesichter«, alle lachten, so war es auch geplant, »also dann weiß, daß ich wieder einmal der Älteste bin, zumindest der Gesichtsälteste, dann lassen Sie alle sich von mir beruhigen: Fünfzig mag nicht mehr die Mitte des Lebens sein, denn wer von uns wird oder will auch nur hundert werden. Aber es liegen wunderbare Jahre hinter mir, in denen ich den Verlag meines Schwiegervaters zu dem gemacht habe, was er trotz aller Schwierigkeiten noch ist, Jahre, in denen ich meine Ehefrau Camilla zumindest so glücklich gemacht habe, daß sie noch immer mit mir verheiratet ist, und daß es an Gegenangeboten nicht gefehlt hat, werden Sie alle nicht bezweifeln ...«
Da hast du recht, dachte Falko Fuhrmann und hob sein Glas in Richtung Camilla.
Die zweihundertfünfzig Teller mit dem Minihappen Wildpastete waren fertig und sahen im Schatten kunstvoll drapierter Salatblätter, einer Cocktailtomate und zweier Cornichons »richtig überzeugend« aus, meinte Gundel und küßte Jette auf die Stirn. »Du hast mich gerettet, mein Mädel. Wünsch dir was.«
Jette lachte. »Ich wünsch mir einen Kerl«, sagte sie, »nicht bemackt, nicht pervers, nicht scheintot, und daß ich die Platten noch in diesem Jahrtausend wiederkriege, weil ich sie spätestens morgen nachmittag für eine Jubiläumsfeier brauche. Und tschüs.«
Sie verließ die Küche, und warum sie nicht wie sonst durch den Service-Eingang direkt auf die Straße zu ihrem Auto ging und nach Hause fuhr, sondern die andere Tür nahm, die zur Hotellobby führte, hätte sie nicht zu sagen gewußt. Es war kein bewußter Entschluß, es war reiner Zufall, würde sie später sagen. Später, als sich alles in ihrem so mühsam geordneten Leben für immer und ewig verändert hatte.
Kapitel 5
Müde und bettreif ging Jette Glücklich die Treppe hoch, in die Lobby, an der Garderobe vorbei, spürte eine menschliche Regung und betrat die Damentoilette. Wie immer in sehr eleganten Hotels fühlte sie sich seltsam beklommen, seltsam fehlbesetzt, so als würde jeden Augenblick eine strenge Uniform herbeieilen, sie an Schlips und Kragen packen und mit den Worten: »Was macht denn eine Frau wie Sie in einem so vornehmen Hotel? Raus mit Ihnen!« auf die Straße setzen. Ich bin halt eben Bratkartoffel, dachte sie, auch wenn ich mein Leben mit Morchelschaum an Kaviarmousse verdiene. Sie betrat das Foyer.
Das elegante, hochpolierte Interieur dieses Hamburger Renommierhotels faszinierte sie und schüchterte sie gleichermaßen ein. Die Antiquitäten, die Kronleuchter an den hohen Decken, die mannshohen Vasen. Aus einer offenen Doppeltür drang die gedämpfte Stimme eines Mannes. Dann lautes Gelächter. Offensichtlich hatte er etwas Komisches gesagt. Unwillkürlich blieb sie stehen.
Der Concierge, ein freundlicher alter Mann mit kleinem Lockenkränzchen, sah ihren Blick und sagte: »Die einen feiern, die andern müssen arbeiten, was, junge Frau?«
Jette lächelte ihn an. Sie liebte es, junge Frau genannt zu werden. In ihrem Alter, mit sechsundvierzig, war diese Anrede für sie ein Kompliment, genauso wie das Pfeifen aus der Baugrube.
»Ein Fünfzigster, sagt meine Freundin«, bemerkte sie und nahm eine Zigarette aus der Schachtel, die ihr der Concierge entgegenhielt. »Eigentlich geb ich’s gerade auf«, sie inhalierte tief. »Man gönnt sich ja sonst nix«, meinte der Mann, »und solange mein Raucherbein noch mitmacht ...«
Nie würde Jette diesen Mann vergessen und nie den albernen Satz über sein Raucherbein, denn in diesem Augenblick drang aus dem großen Saal wieder lautes Gelächter, dem noch lauteres Klatschen folgte. Wie aufs Stichwort war Gundel aufgetaucht mit einer Armada von Kellnern und dirigierte ihre Truppe mit kleinen Bewegungen in den Saal. Sie sah ihre rauchende Freundin nicht, achtete auch nicht auf den hochgewachsenen Mann, der jetzt mit großen Schritten aus dem Saal in Richtung Herrentoilette eilte. Aber Jette sah ihn. Und ihr Herz blieb stehen. Er war es. Einfach so. Ohne Vorwarnung.
Mario Benedikt. Mario. Es konnte nicht wahr sein. Was für ein blödsinniger Zufall. Nach fast dreißig Jahren! Ihr Herz klopfte laut und schmerzhaft, Zigarettenrauch blieb in ihrer Lunge stecken, sie fing an zu husten, ihre Augen tränten. Schnell wandte sie sich ab. Als sie mit nassen Augen vorsichtig hochblickte, eilte er an ihr vorbei, nur fünf Meter Luft trennten sie. Merkte er denn nichts, spürte er sie nicht? Hörte er das laute Klopfen ihres Herzens nicht?
Sie sah ihm nach, seine hohe, gerade Gestalt, den stolzen Kopf, rechts und links schlenkerten die langen Arme – er war immer in Eile gewesen, immer ungeduldig –, sah, wie er die Toilettentür öffnete und hinter sich schloß, und sie wußte genau, wie er noch immer riechen und sich anfühlen würde. Sie hatte seinen Duft noch immer in der Nase, sie waren beide fanatische Geruchsmenschen. Auf einmal fiel ihr auf, daß sie nach ihm nie wieder einen Mann so gut hatte riechen können. Auch seinen Körper kannte sie genau. Die beiden Leberflecke hinterm linken Ohr und am Steißbein, den Knubbel mitten auf dem Rücken. Mario. Mario. Ihr wurde schwindelig, sie mußte sich festhalten.
»Ist Ihnen nicht gut, junge Frau?« Der Concierge musterte sie besorgt, sie rang sich ein gequältes Lächeln ab. »Danke, es geht schon wieder.« Aber es ging gar nichts mehr.
Alles war wieder da, alles, so als hätten sie sich nicht vor sechsundzwanzig Jahren getrennt, an einem ungewöhnlich heißen Apriltag 1973, sondern vor zwei Stunden.
Nicht SIE hatten sich getrennt, ER hatte sich von IHR getrennt. Dieser Mann, der jetzt vermutlich vor dem Urinal stand, hatte fast ihr Leben zerstört. Plötzlich spürte sie dieses sorgsam verschüttete Gefühl von damals wieder, wie ein kleines, angriffsbereites Tier mit spitzen Stacheln. Damals war der Schmerz so ungeheuerlich gewesen, daß sie fast ein Jahr gebraucht hatte, um nicht mehr jede Stunde, jede Minute an ihn zu denken. Eine ganze Minute Mario-freie Zeit war schon fast ein kleiner Sieg gewesen.
Energisch schob sie die Erinnerungen weg. Zwei Frauen gingen an ihr vorbei, mit den selbstbewußten Schritten, die frau sich nur auf sehr hohen Hacken leisten konnte. Eine große Blonde von kühler, selbstbewußter Schönheit und eine kleine Rothaarige.
»Camillchen«, sagte die Rothaarige und hinterließ eine schwere Duftwolke von Guccis »Envy«, als sie Jette fast streiften, »und Maria hat keine Lust, den Verlag zu übernehmen?« Die Blondhaarige zuckte die Schultern. »Es gibt leider keinen männlichen Erben, meine Liebe. Ein großes Problem. Und dein Sohn kommt ja auch nicht als Schwiegersohn in Betracht. Der ist ja so warm, daß er mit der flachen Hand bügeln kann.«
Was für eine grausame Frau! Jette zuckte bei ihren Worten unwillkürlich zusammen. Das konnte nur sie sein. Camilla Benedikt. Die waidwunden Augen der Rothaarigen waren das letzte, was sie sah, bevor sich die Tür der Damentoilette hinter den beiden schloß.
Camilla Benedikt. Die Frau, die ihr das Glück genommen hatte.
»Was machst du denn noch hier?« Gundel stand mit zwei leeren Tabletts hinter ihr und strahlte sie an: »Deine Pastete war der große Knüller. Kein Krümel ist übriggeblieben.«
»Das wär ja auch ein Wunder bei der Menge«, meinte Jette, »ich geh dann mal.« Aber sie ging noch nicht.
Gundel war wieder Richtung Küche verschwunden.
Ich warte noch eine Minute, dachte Jette und stellte sich hinter die Säule, von der aus sie die Tür der Herrentoilette im Blick hatte. Sie zündete sich eine Zigarette an und zählte ... achtundvierzig, siebenundvierzig, sechsund...
Die Tür ging auf, und er kam heraus. Er ging leicht vornübergebeugt, das hatte er damals schon getan. Dann hob er plötzlich das Gesicht und sah direkt an ihr vorbei. Seine Haare, früher fast flachsgold, waren jetzt graugesprenkelt, seine Augen umkränzten viele Fältchen, was bei einer Frau vielleicht verlebt, bei ihm jedoch so attraktiv wirkte wie ein gut eingesessenes Ledersofa. Die Welt war ungerecht.
Verdammt, sieht er noch gut aus, dachte Jette, und nichts hätte sie lieber getan in dieser einen heißen Sekunde, die es dauerte, bis er sich wieder abwandte, als mit ihren Händen durch seine Haare zu fahren.
Ich will’s nicht wieder, dachte sie in einer bittersüßen Mischung aus Aufregung und Wut und legte die Hand wie schützend auf ihr wild klopfendes Herz, ich will es einfach nicht. Einmal hat gereicht.
»Warte.« Mario und Jette drehten sich beide um. Camilla trat auf ihn zu, zupfte an seinem Smokinghemd, um ihm dann etwas ins Ohr zu raunen. Zu ihrem Ärger reichte der Anblick von Camillas Mund an seinem Ohr, um Jettes Puls eifersüchtig in die Höhe zu treiben. »Ich will es nicht«, flüsterte sie wütend und verzweifelt, »es soll wieder weggehen.« Aber es blieb.
Auf langen Beinen stöckelte Camilla an ihr vorbei in den Festsaal, Mario sah ihr nach. Sein Blick war unergründlich. Ob er sie noch immer liebt, dachte Jette, mehr als mich damals?
Sie verbot sich, diesen nutzlosen Gedanken zu Ende zu denken.
Sie ging zur Hoteldrehtür, dann zu ihrem Auto. Fuhr durch die leeren, nachtdunklen Straßen nach Hause. Drehte die Musik so laut, daß sie alle Fenster öffnen mußte.
»Mario«, schrie sie in die Nacht, »du Schuft, du Scheißkerl. Warum bist du wieder aufgetaucht? Ich hasse dich. Ich hasse dich.«
Kapitel 6
Zur selben Zeit saß Cleo Braake an ihrem Computer und tippte gelangweilt den ersten Satz des siebten Kapitels ihres neunten Romans in die Tasten. Er sollte Sag mir, wo die Männer sind? heißen. Gute Frage. Cleo hätte dies selbst gerne gewußt.
Sie gähnte. Ihr Verlag hatte wieder einmal auf einer 3F-Beziehungskomödie – frech, frivol, fröhlich – bestanden, weil diese Puddingepen trotz Hera Lind immer noch gut liefen. Die Zielgruppe – Hausfrau mit Realschulabschluß – konnte offensichtlich nicht genug kriegen von jungen, knackigen Superweibern, die derart massiv von bescheuerten Männern mit ständig erigierten Pimmeln bedrängt wurden, daß sie sich impotente Kerle wünschten, während sie, Laptop und Handy unter einem, ein kreischendes Baby unter dem anderen Arm, auf dem Weg zur Superfrau-Karriere waren. Daß diese Art von Schwachsinn meist von Frauen gelesen wurde, deren aus der Form gegangene Gatten oft schon vor der Tagesschau einschnarchten, während der nervige Nachwuchs im Etagenbett herumsprang, denn für zwei einzelne Kinderbetten war das Kinderzimmer zu klein, war eine Tatsache, der sich Cleo Braake so selten wie möglich stellte.
Sie lebte gut von ihren Büchern, obwohl sie beim Schreiben vor lauter Langeweile oft in Depressionen verfiel. Besonders die Sexszenen deprimierten sie.
Erstens war sie der Meinung, daß sich Menschen über dreißig, und das war sie selbst seit mehr als fünfzehn Jahren, nicht mehr zu etwas äußern sollten, das sie selbst nur noch sehr sporadisch ausübten, und zweitens gab es kaum deutschsprachige Schriftsteller, die erotisch fabulieren konnten. Der englische oder französische Sprachraum hatte es da wesentlich leichter. Faire l’amour, da kam Vorfreude auf. Let’s make love, gern, Liebling. Laß uns bitte Liebe machen. Gähn. Schnarch. Alle deutschen Worte klangen hölzern. Miteinander schlafen? Vögeln? Ficken? Pimpern? Rumrödeln? Rhabarber, Rhabarber machen?
Cleo Braake rettete sich deshalb schon seit Jahren in vage Andeutungen, gefolgt von beziehungsreichen Pünktchen. Sollte sich doch die deutsche Hausfrau am Bügelbrett gefälligst auch mal was ausdenken ...
Und so versank die Welt um sie herum ...
Und alles andere wurde unwichtig, als sie seine weichen Lippen spürte ...
Riß er sie in einen Strudel der Leidenschaft, aus dem sie nie wieder auftauchen wollte ...
Immer öfter ertappte sich Cleo dabei, daß sie während des Schreibens völlig andere Dinge machte. Fernsehen, nachdenken, träumen, Musik hören. Wenn sie dann abends die Ergüsse des Tages las, war sie oft selbst erstaunt, was sie da im Halbkoma unlustig zusammengeschrieben hatte.
Diese Ergüsse reichten immerhin für eine Fünfzimmereigentumswohnung in Hamburg-Winterhude, was ihrer Mutter nicht genug war.
»Es ist leider keine Gehirnchirurgie, mein Kind.« Diesen mütterlichen Satz konnte Cleo singen. Als wenn sie das nicht selber am besten wüßte. Wie oft schon hatte sie die Tatsache verflucht, daß sie nichts Richtiges gelernt hatte.
Studium der Germanistik und Geschichte, mit der Note »befriedigend« abgeschlossen, keine Glanzleistung, aber sie hatte gut gelebt während ihrer Studienzeit in den siebziger Jahren. Vor allem gut und vielseitig geliebt. Doch auch Ende der Siebziger war der Horizont für eine einunddreißigjährige Hochschulabsolventin mit Gesamtnote »Drei« nicht grenzenlos, und deshalb war Cleo Braake froh, als Volontärin beim Hamburger Anzeiger unterschlüpfen zu können, und schrieb statt über Frauenfiguren bei Goethe über Schäferhundevereine in Neu-Wulmstorf.
Wenn einer ihrer ehemaligen Kommilitonen, die meisten waren im Lehramt gelandet, sie nach ihrer Berufstätigkeit fragte, dann antwortete sie meist mit »Ich bin Stadtchronistin« – eine Formulierung, die viele Fragen und Deutungsmöglichkeiten ganz bewußt offenließ. Und so sah sie sich auch: nicht als popelige Schreiberelse, die unwichtige Terminchen hochschreiben mußte, damit die Leute zufrieden waren, weil eh nichts Spannendes passierte in Hamburg-Harburg, dem Stadtteil jenseits der Elbe, Wohnort von Rentnern, Arbeitslosen und Ausländern. Sie sah sich als Schriftstellerin der »Binnenexotik«, ein schönes Wort, das sich ihr Chefredakteur Dr. Hermann Funke, ein ebenfalls gescheiterter Akademiker, für die Redaktion ausgedacht hatte, um ihnen die Tatsache schmackhaft zu machen, daß ihre weiteste Dienstreise, wenn überhaupt, an der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein endete. »Ich möchte aber auch mal Außenexotik«, hatte der Nachrichtenchef einmal protestiert und war sofort unter dem bitterbösen Blick des Lokalchefs zusammengeschmolzen. »Dafür haben wir die Nachrichtendienste«, hatte der nur gesagt, »und wenn’s bei dir für mehr gereicht hätte, dann wärest du jetzt beim Stern oder Spiegel.«
Dafür hatte es auch bei Cleo Braake nicht gereicht, und im Laufe der Jahre wurde auch ihr privater Horizont immer enger. Männer kamen und gingen, meist schon nach kurzer Zeit, weil Cleo eine Frau war, deren Ansprüche und Erwartungen an Männer im gleichen Maße zunahmen wie die kleinen und größeren Fältchen um Nase, Mund und Augen. »Ich biete mehr als früher, ich fordere mehr als früher«, hatte sie kürzlich zu ihrer Freundin Viola-Renate gesagt, einer gestreßten Mutter von zwei anstrengenden Teenagern, deren Ehemann Rainer es sich auch nach einundzwanzig Ehejahren noch am liebsten jede Nacht »gemütlich« machen wollte und in deren Gästeklo ein Cartoon aus der Brigitte hing, auf dem ein Ehepaar im Bett liegt, über ihnen eine Sprechblase: »Ist es nicht schön, wenn’s mal wieder vorbei ist?«
»Dann wirst du als alte, vertrocknete Jungfer enden«, hatte Viola-Renate nur geantwortet, während sie den Milchschaum ihres Cappuccinos lustvoll aus der Tasse züngelte, was ihr viel mehr Spaß machte, als diese Zunge woanders züngeln zu lassen ... egal. »Als alte Frau mußt du pflegeleichter werden, weil dein Marktwert sinkt. Nur junge Frauen können sich Zickigkeit leisten, bei dir wird’s mit den Wechseljahren gleichgesetzt und ist nur noch peinlich.«
Cleo seufzte und schob vorsichtig Mirko, ihren fetten, kastrierten Kater von ihrem eingeschlafenen rechten Fuß, wo er sich schnurrend zur Ruhe gebettet hatte. Das einzige männliche Wesen, das mich nicht verläßt, ist kastriert, dachte sie und hob die Weinflasche hoch, um zu sehen, ob sie sich noch ein Glas genehmigen durfte. Sie durfte nicht. Zwei leere, zerknüllte Zigarettenschachteln gemahnten sie daran, daß in ihrem Alter die Kombination von Alkohol und Nikotin eine nicht empfehlenswerte war. »Da scheiß ich doch jetzt drauf«, murmelte Cleo und schenkte nach. Dann überlegte sie, ob sie ihn anrufen sollte oder nicht.
Es war eine Minute vor Mitternacht, die Feier würde vorbei und er wahrscheinlich im Auto auf dem Weg nach Hause sein. Es störte Cleo nicht, daß seine Ehefrau, diese blonde, verwöhnte Superzicke, neben ihm sitzen würde, im Gegenteil.
Schließlich war sie Hausautorin, der Göhlen Verlag verdiente viel Geld an ihr. Sehr viel Geld. Ihre Bücher liefen so gut, daß sie ständig von anderen Verlagen umschmeichelt wurde, die sie abwerben wollten. Bis jetzt hatte sie widerstanden. Seinetwegen. Der Verlag brauchte sie. Ob der Verleger dies tat, dessen war sie nicht so sicher.
Cleo schüttelte die Weinflasche, war sie eigentlich zu Beginn des Abends halb leer oder halb voll gewesen? Sie goß den Rest in das Glas, damit die liebe Seele Ruh’ hatte, außerdem schrieb sie leicht betäubt am besten.
»Frauchen dichtet noch einen Absatz, dann gönnt sie sich ihren Anruf«, ließ sie Mirko wissen, der inzwischen auf ihrem linken Fuß Platz genommen hatte.
Sie gähnte, riß die Augen auf, um sich auf das Geflimmer auf dem Computerschirm konzentrieren zu können, und hackte: »Ich will alles von einem Mann, alles«, schrie Gabrielle und stampfte mit ihren rotgelackten Highheels auf den teuren Parkettboden (jede Superfrau, die auf sich hielt, trug Highheels), »und wenn du mir das nicht geben willst, hier ist die Haustür, bitte mach keine Flecken auf der Politur!« Boris sah seine blutjunge Geliebte an und spürte zu seinem lustvollen Erschrecken, daß sich eine hartnäckige Erektion ...
Schluß für heute. Cleo klickte den Computer aus. Es deprimierte sie, über die Erektionen von ausgedachten Männern zu schreiben. Sie ging zum Telefon und wählte. Sie wollte eine nicht ausgedachte Stimme hören ... Seine ...
Kapitel 7
»Na, war’s schlimm?« Camilla hatte die Beine hochgezogen und musterte das Profil ihres seit drei Stunden und siebzehn Minuten fünfzigjährigen Ehemannes. Er gähnte nur und schwieg. Sie kannte seine präzise Geburtsminute, seit sie ihm vor Jahren einmal ein Horoskop, ausgestellt von der stadtbekannten Hamburger Hexe Attis Beyn, geschenkt hatte. Doch die Tatsache, daß bei ihm Jupiter 4 im achten Haus stand, daß deshalb Sexualität seine große Stärke war, er eine innige Beziehung zu Tod und Loslassen hatte, schien ihn nicht besonders zu interessieren. Er hatte das Horoskop jedenfalls nie gelesen. Deswegen kannte er auch seine Geburtsminute nicht.
Es erfüllte Camilla Benedikt mit klammheimlicher Genugtuung, daß sie jetzt endlich im selben Lebensjahrzehnt waren. So fielen die lächerlichen zwei Jahre, die sie älter war als er, nicht mehr so auf. Zumal sie seit geraumer Zeit, genauer gesagt, seit ihrem neununddreißigsten Geburtstag, auf die unhöfliche Frage nach ihrem Alter nur noch mit der Aufforderung »Schätzen Sie mich« reagierte. Die meisten waren verlegen, wechselten das Thema. Oder schätzten viel zu jung, wonach sie sich noch älter vorkam. Wenn sie sich dagegen richtig jung fühlen wollte, rief sie die Taxizentrale an und verlangte ausdrücklich einen schwarzafrikanischen Fahrer. Dann ließ sie sich herumfahren und fragte: »Was schätzen Sie, wie alt ich bin?« Die Männer lachten dann, betrachteten sie im Rückspiegel und sagten: »Du bist zwanzig. Vielleicht zweiundzwanzig.« Aus irgendeinem ethnologischen Grund konnten Pechschwarze das Alter von Schneeweißen nicht schätzen und umgekehrt.
Manchmal trieb Camilla das Spielchen auch ein bißchen weiter. Kondome hatte sie ja immer dabei.
»Ich bin froh, daß es vorbei ist.« Mario lächelte seine Frau an. Er war erleichtert, daß er die Feier überstanden hatte. Der wahre Katzenjammer über seinen Eintritt ins sechste Lebensjahrzehnt würde noch kommen, hatte ihm Falko prophezeit, wahrscheinlich morgen, und dann rund zwei Wochen dauern. »Dann hast du dich eingerichtet und bist froh, daß du noch nicht sechzig bist.« Na danke, dachte Mario und nahm sich vor, heute nacht mal wieder mit seiner eigenen Frau zu schlafen. »Wen gedenkt unsere Tochter eigentlich diese Nacht zu beglücken? Sie ist nach dem Dessert so schnell verschwunden.«
Camilla seufzte: »Keine Ahnung. Sie war noch nicht müde. Einen Hausschlüssel hat sie ja.«
Beiden Eltern war es lieber, wenn sie über die nächtlichen Aktivitäten ihrer lebenshungrigen Tochter im unklaren gelassen wurden. »Gott, ich freu mich auf mein Bett«, gähnte Mario. »Schlafen ist die Erotik des Alters.«
Das Autotelefon klingelte. Automatisch sah er auf die Uhr, während er den Hörer abnahm. Viertel nach zwölf, wer rief ihn um diese Zeit an?
»Ja?« Vorsichtshalber legte er soviel Ungeduld wie möglich in seine Stimme, denn er spürte Camillas forschenden Blick. »Geschäfte, mein Lieber, um diese Zeit?« fragte sie süffisant und verfluchte inständig, daß sie sich so öffentlich und penetrant das Rauchen abgewöhnt hatte. Jetzt eine Zigarette und sich dann genüßlich an seiner Verlegenheit weiden. Das Tüpfelchen auf dem Geburtstags-i. Denn daß es sich bei dem Anrufer um eine Frau handelte, war Camilla völlig klar. Sie kannte die Spielchen eifersüchtiger Weiber, spielte sie häufig genug selbst.
»Ich hab Sehnsucht nach dir«, hauchte Cleo ins Telefon, während sie sich in der Küche ein spätes Käsebrot bestrich und mümmelnd weitersprach, »und wenn ich Sehnsucht hab und du bist nicht da, dann kann ich nicht dichten. Also komm und befruchte deine Lieblingsautorin!«
Da es in der Leitung rauschte und knackte, wußte sie genau, wo er war. Im Auto, neben ihm die Alte. Herrlich. Als sie vor zwölf Jahren ihren ersten und bislang erfolgreichsten Roman Der nächste Mann, dieselbe Dame im Göhlen Verlag veröffentlichte, hatte sie bei einer Feier nur einen einzigen Blick auf ihn geworfen und sofort beschlossen: »Der ist fällig.«
Da sie selbst eine kleine, zur Fülle neigende Mittvierzigerin mit leicht nachgeholfenem Rothaar war, waren ihr die Männer am liebsten, die groß, blond oder blondgrau und so attraktiv waren, daß sich andere Frauen neidisch fragten: Wie hat sie den denn geschafft?
Cleo schaffte es durch eine sexuelle Unermüdlichkeit und Leidenschaft, die im Gegensatz zu anderen Frauen nicht vorgetäuscht war. Sie war eine der wenigen Frauen, die wirklich Spaß im Bett hatten. Das wirkte ansteckend, besonders bei Ehemännern mit jahrzehntelang angetrauten Migränegattinnen. Und Mario, das wußte Cleo bereits in der ersten Nacht, war so ein Zukurzgekommener. Also führte ihn Cleo in ihre gesamte Palette ein, zeigte ihm ihre Tricks, wann immer er sich Zeit für ein Schäferstündchen nahm.
Das war Cleos zweites Geheimnis – sie drängte sich nicht auf, sie machte sich rar, zumindest in der Anfangszeit. So trieb sie ihre Männer, meist zur Mittagszeit, weil sie dann eh nicht gut arbeiten konnte, zur absoluten Raserei, schickte sie dann ausgepumpt und happy wieder zu Mutti. Danach stellte sie ihren Anrufbeantworter an und ließ sie zappeln.
Bei Mario waren diese Spielchen nicht möglich gewesen. Er war ein Mann des öffentlichen Lebens mit sehr wenig außerhäusiger Spielzeit, also gab er die Zeiten vor, und sie folgte. Und leider war etwas passiert, mit dem sie nicht gerechnet hatte – sie hatte sich in ihn verliebt.
»Sie müssen die falsche Nummer gewählt haben«, sagte Mario und legte den Hörer auf. »Eine neue Dame?« fragte Camilla nonchalant, aber er wußte, daß diese Lässigkeit vermutlich vorgetäuscht war. Schon vor Jahren hatten sie zwar beschlossen, eine »offene«, aber zivile Ehe zu führen, trotzdem gab es immer wieder Momente wie diesen, in denen er ahnte, daß sich hinter der glattgestrafften Stirn seiner Frau vermutlich sehr unzivile Gedanken abspielten. Er beschloß, diese Gedanken nicht zu vertiefen.
»Nein, eine alte«, meinte Mario nur, als es wieder klingelte.
»Ich glaub dir kein Wort«, meinte Camilla spitz, »so schnell, wie du dich langweilst.«
Wortlos nahm er den Hörer ab und reichte ihn seiner Frau:
»Überzeug dich selbst«, seine Stimme klang völlig unbeteiligt, »und grüß sie schön.«
Camilla nahm den Hörer und legte ihn gleich wieder auf. Unerwartet war er da, der Druck auf ihrem Herzen, als ihr klar wurde, wie unwiderruflich kaputt ihre Ehe war. Was sie sich gegenseitig antaten. Was für ein Leben sie lebten, dieses reiche, erfolgreiche Ehepaar in ihrem Mercedes der Luxusklasse, auf dem Weg in ihre opulente Stadtvilla.
Wer hatte damit angefangen? War sie es gewesen, als sie begriff, daß er sie seinerzeit ohne Liebe nur aus Berechnung geheiratet hatte? Als sie das Foto dieses rothaarigen Mädchens in seiner Aktentasche gefunden und er rote Ohren bekommen hatte, obwohl sie angeblich nur eine Jugendliebe war, längst vergessen? Sie erinnerte sich an dieses schneidende Gefühl von Wut und Eifersucht, als sei es gestern gewesen.
Wie hatte sie ihn einmal geliebt – diesen spröden blonden Mann mit den graublauen Augen! Der ihr nie wirklich gehört, den sie deshalb verletzt, betrogen und gedemütigt, dem sie trotz allem eine Tochter geschenkt hatte und den Verlag ihres Vaters. Maria jedenfalls hatte ihn glücklich gemacht, was den Verlag betraf, war sie nicht so sicher. Sie wußte von dem Millionenvorschuß an einen geschaßten Politiker, der sich kurz danach in der Elbe ertränkte. Seine Witwe verschwand nach dem Begräbnis und mit ihr die Millionen. Heute morgen hatte sie in der Zeitung von dramatischen Umsatzeinbußen des Buchhandels gelesen.
Betrifft uns nicht, hatte er abgewehrt. Was betrifft uns überhaupt noch, hatte sie fragen wollen, aber er hatte das Haus schon verlassen.
»Warum tun wir uns das an, Mario?« Die Frage war herausgerutscht, ehe sie es verhindern konnte. »Warum quälen wir uns so?«
Ihre Stimme klang ruhig, traurig. Er nahm seine rechte Hand vom Steuerrad und legte sie auf ihre linke. Sie zog sie nicht zurück.
»Entschuldigung«, sagte er, während seine Finger ihre Hand streichelten, »das war geschmacklos von mir. Die Frau ist völlig unwichtig.« Er lächelte. »So unwichtig wie dein brasilianischer Fitneßtrainer.«
»Eine deiner Autorinnen?« fragte sie beiläufig.
»Ja«, sagte er einsilbig.
Sie bogen in die stille Seitenstraße ein, in der ihre Villa lag. Nur die Straßenlampen warfen ihr mondgelbes Licht auf das Kopfsteinpflaster, sonst war alles dunkel.
»Bestseller?« fragte Camilla weiter. So als mache dies einen Unterschied.
»Ja.« Mario wollte das Thema abschließen.
Er fuhr den Wagen durch das große Tor, hielt an, stieg aus und half seiner Frau aus dem Auto. Diese kleinen Gesten der Höflichkeit hatten sie sich bewahrt.
Sie gingen auf das Haus zu. In der Tür drehte Camilla sich um.
»Willst du heute nacht mit mir schlafen?« fragte sie. Er konnte ihren Blick nicht deuten. Nie würde er erfahren, wie wichtig ihr trotz allem seine Antwort war.
Mario lächelte. »Gern. Was für ein schönes Geburtstagsgeschenk«, sagte er und ging ins Haus. Seine Stimme klang so freundlich-unbeteiligt, als habe sie ihm ein Pfefferminz angeboten.
Kapitel 8
Als Cleo den Hörer auflegte, verspürte sie genau diese Mischung aus Wut und Adrenalin, von der sie wußte, daß sie ihr ein paar kreative Stunden bescheren würde. Das mußte ausgenutzt werden. Sie schrieb am besten in Wallung – Arger, Verliebtheit, Trauer, egal –, wenn sie wallte, dann tanzten ihre Finger über die Tasten, dann formten sich Gedanken und Wörter zu wunderbaren Sätzen und Paragraphen. Dann schenkte sie sich hinterher einen Champagner ein, las ihr soeben Geschriebenes und fragte sich: Warst du das wirklich, Cleo? Du schreibst ja richtig super.
Sie ahnte, daß Marios Leidenschaft, so sie denn jemals über den Bettpfosten hinausgereicht hatte, abgekühlt, kühl bis kalt geworden war. Er hatte sich ihrer sowieso nur bedient, weil sie sich ihm angeboten hatte, so wie man sich, eigentlich des Süßen überdrüssig, einen Pralinentrüffel zwischen die Lippen schiebt, weil man zu höflich ist, ihn abzulehnen. Und daß sie sich so verfügbar, so billig gemacht hatte, woran lag das? Trotz aller Vorsätze doch an der Demut einer mittelalterlichen Frau, deren Marktwert gesunken war?
»Ich bin unausgefüllt«, murmelte Cleo vor sich hin, während sie die Milch für einen zusätzlich aufputschenden Milchkaffee aufschäumte, »ich hab keinen festen Kerl, keine Kinder, keine Kollegen. Ich hab nur meine Bücher und meine Katze.«
Sie führte oft Selbstgespräche, das beruhigte sie. Am liebsten unter der Dusche oder beim Spazierengehen, wo sie manchmal verwunderte Blicke auf sich zog, was sie nicht kratzte. Sie war Schriftstellerin und nahm sich das Recht auf eine gewisse Schrulligkeit.
Sie ging mit der Milchschale zu ihrem Schreibtisch, stellte sie ab, setzte sich vor den Computer. Las den letzten Satz: »Und als er sich leidenschaftlich über sie beugte und mit seiner Zunge zärtlich ihre Lippen auseinanderdrückte, dachte sie nur: Sein Mundgeruch ist auch nicht besser geworden.«