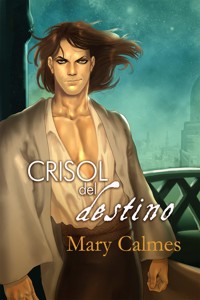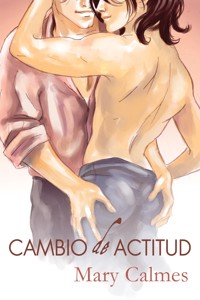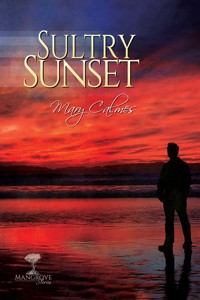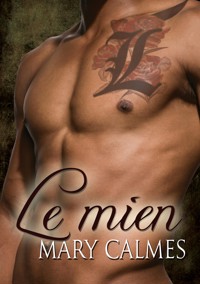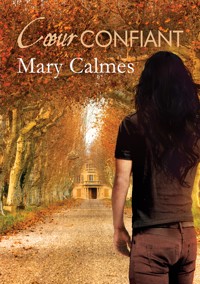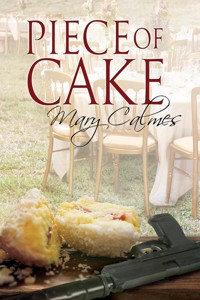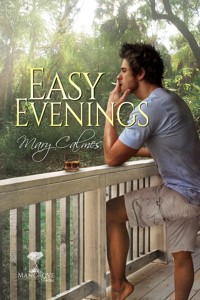Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dreamspinner Press
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Buch 2 in der Serie - Verliebte Partner Die Deputy US Marshals Miro Jones und Ian Doyle sind nun beruflich und privat Partner: Miros Gelassenheit und Professionalität bilden den idealen Ausgleich zu Ians Leidenschaft und hitzigem Temperament. In einem Beruf, in dem ein falscher Schritt den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten kann, ist Vertrauen alles. Aber jede Beziehung hat anfänglich ihre Schwierigkeiten und manchmal weiß Miro nicht, wo er bei seinem temperamentvollen Partner steht. Sind die Gefühlsbande, die sie erst seit so kurzer Zeit miteinander verbinden, bereits wieder im Begriff, sich aufzulösen? Diese neuen Bande sind ständigen Herausforderungen ausgesetzt: Überfälle der Familie, wohlmeinende Freunde, ihre eigenen Unsicherheiten, ihr gefährlicher Beruf – und dann kommt es zur Feuerprobe, als ein alter Fall Miros wieder auftaucht und sie heimsucht. Vielleicht reicht das aus, um Ian seine Entscheidung, sich zu binden, hinterfragen zu lassen und Miro kann nur hoffen, dass die Gefühlsbande, die sie geknüpft haben, stark genug sind, sie beide zu halten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Zusammenfassung
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Mehr Bücher von Mary Calmes
Biographie
Von Mary Calmes
Besuchen Sie Dreamspinner Press
Copyright
Ein Schlamassel kommt selten allein
Von Mary Calmes
Buch 2 in der Serie – Verliebte Partner
Die Deputy US Marshals Miro Jones und Ian Doyle sind nun beruflich und privat Partner: Miros Gelassenheit und Professionalität bilden den idealen Ausgleich zu Ians Leidenschaft und hitzigem Temperament. In einem Beruf, in dem ein falscher Schritt den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten kann, ist Vertrauen alles. Aber jede Beziehung hat anfänglich ihre Schwierigkeiten und manchmal weiß Miro nicht, wo er bei seinem temperamentvollen Partner steht. Sind die Gefühlsbande, die sie erst seit so kurzer Zeit miteinander verbinden, bereits wieder im Begriff, sich aufzulösen?
Diese neuen Bande sind ständigen Herausforderungen ausgesetzt: Überfälle der Familie, wohlmeinende Freunde, ihre eigenen Unsicherheiten, ihr gefährlicher Beruf – und dann kommt es zur Feuerprobe, als ein alter Fall Miros wieder auftaucht und sie heimsucht. Vielleicht reicht das aus, um Ian seine Entscheidung, sich zu binden, hinterfragen zu lassen und Miro kann nur hoffen, dass die Gefühlsbande, die sie geknüpft haben, stark genug sind, sie beide zu halten.
Einmal mehr für Lynn.
Danke.
1
ICH KONNTE meinen genießerischen Seufzer nicht unterdrücken. Wir waren draußen in Elmwood, wo wir so gut wie nie hinkamen und ich hatte gebeten und gebettelt, bis Ian zugestimmt hatte, bei Johnny’s Beef vorbeizufahren, sodass ich mir dort ein Sandwich kaufen konnte, bevor wir zu dem Haus weiterfuhren, das wir observieren sollten. Ich mochte Observierungen nicht; sie waren in der Regel sterbenslangweilig. Also nutzte ich sie als Vorwand dafür, um so richtig gut zu essen, anstatt mich wie sonst mit Fast Food zu begnügen. Okay, man konnte argumentieren, dass ein Sandwich, belegt mit italienischem Rindfleisch mit Paprika, nicht wirklich eine Gourmetmahlzeit war. Aber so etwas konnte nur jemand behaupten, der noch nie eines gegessen hatte. Allein die Verpackung zu öffnen und dann der Duft, der daraus hervorströmte … Mir lief das Wasser im Munde zusammen.
„Na, hoffentlich war’s den langen Umweg auch wert“, nörgelte Ian.
Kein Gemecker der Welt konnte meine Seligkeit beeinträchtigen. Und außerdem schuldete er mir etwas. Gestern, auf dem Weg zu exakt genau demselben Haus, hatte ich bei Budacki’s angehalten und ihm Hotdogs geholt – polnische, mit allem Drum und Dran, so wie er sie am liebsten mochte. Außerdem hatte ich die tätliche Auseinandersetzung zwischen einem Einheimischen und einem Auswärtigen über die Verwendung von Ketchup beendet, während ich dort gewesen war, und es dennoch geschafft, die Ware unfallfrei bei Ian abzuliefern. Also war bei Jonny’s vorbeizufahren das Mindeste, was er tun konnte.
„Möchtest du dein Sandwich vielleicht gerne ficken?“, fragte er abschätzig, während er seins, mit Rührei und Pfeffer, öffnete.
Ich hob den Blick zu ihm, ganz langsam und bewusst verführerisch, und hörte das tiefe Luftholen, auf das ich gehofft hatte. „Nein. Nicht das Sandwich.“
Er öffnete gerade den Mund, um etwas zu sagen, als wir die Schüsse hörten.
„Vielleicht war es nur eine Fehlzündung am Auto“, sagte ich hoffnungsvoll. Ich hatte bereits das Papier zurückgeschlagen und war bereit, den ersten Bissen zu nehmen. In dieser ruhigen, von Bäumen gesäumten Straße in einem Vorort von Chicago – mit weißen Palisadenzäunen, Menschen, die ihre Hunde Gassi führten, und kleinen Nur-Dach-Häusern mit Panoramafenstern – musste es nicht zwingend ein Pistolenschuss gewesen sein.
Seine Grimasse sagte mir das Gegenteil.
Kurze Zeit später raste ein Mann über die Straße und sprintete den Bürgersteig entlang an unserem Auto vorbei, das an jenem Dienstag kurz nach ein Uhr mittags harmlos am Bordstein dieser Bilderbuchstraße parkte.
„Die Sau“, stöhnte ich, legte mein Sandwich sorgsam auf das Armaturenbrett unseres Ford Taurus und war Sekunden später durch die Beifahrertür.
Der Typ war schnell, aber ich war schneller und ich holte auf. Bis er eine Pistole über seine Schulter richtete und abdrückte.
Es wäre ein Wunder gewesen, wenn er mich getroffen hätte – er war in Bewegung, ich war in Bewegung –, aber trotzdem musste ich ihn aufhalten. Irrläufer waren nicht gut, wie wir bei unserem letzten Taktikseminar gelernt hatten, aber was viel wichtiger war: Wir befanden uns in einer ruhigen, malerischen Wohngegend, in der es nachmittags um diese Uhrzeit vorkommen konnte, dass Frauen mit Kinderwagen vor sich und einem Beagle oder Labrador hinter sich Joggen gingen. Ich nahm mir vor, dafür zu sorgen, dass das grob fahrlässige Abfeuern einer Handfeuerwaffe mit in die Anklageschrift aufgenommen wurde, wenn ich den Typen erst mal erwischt hatte.
Er schoss ein zweites Mal auf mich, verfehlte mich erneut um Längen. Dennoch war sein blindes Herumgeballer gefährlich genug, dass ich meinen Kurs änderte. Abrupt bog ich in einen Garten voll dunkler Blätter ab, schlug mich durch zwei weitere – einen mit einem Schaukelgerüst, einen voller Wildblumen – und erwischte ihn an der nächsten Straßenecke. Den Arm in der klassischen „Clothesline“-Position ausgestreckt, wie ich sie von Rangeleien aus meiner Zeit in diversen Pflegefamilien noch gut in Erinnerung hatte, hatte ich ihn im Nu von den Füßen geholt und zu Boden gehen lassen.
„Scheiße, was ist passiert?“, fragte Ian, als er angesprintet kam. Er stellte einen Stiefel auf das Handgelenk des Typen und drückte es schmerzhaft fest aufs Pflaster des Bürgersteigs, als er sich hinunterbeugte, um die .38 Special aufzuheben. Da ich mich bereits in derselben Position befunden hatte, wusste ich, wie weh so ein Stiefel tun konnte. „Schau dir das an. So ein Ding hab ich schon seit Jahren nicht mehr zu Gesicht bekommen.“
Ich nickte abwesend und bewunderte meine Fiorentini + Baker Wildlederstiefel an seinen Füßen. Es war mir tatsächlich sogar egal, ob er sie verkratzte oder nicht, so sehr gefiel es mir, dass er alles, was mir gehörte, auch als sein Eigentum ansah.
„Das ist wirklich eine hübsche Waffe, mit der du da versucht hast, meinen Partner zu erschießen“, sagte Ian drohend und mit eisiger Stimme.
„Mir geht es gut“, erinnerte ich ihn. „Sieh mich an.“
Aber das tat er nicht. Stattdessen hob er die Waffe und stieß den Lauf gegen die Wange des auf dem Boden liegenden Mannes.
„Scheiße“, fluchte der. Seine Augen waren wild, als sie flehend zu mir hinüberhuschten.
„Wie wär’s, wenn ich dir das Ding in den Rachen ramme?“, knurrte Ian, riss den Flüchtigen vom Bürgersteig hoch und zerrte ihn näher zu sich. Er war wohl sehr viel wütender, als ich angenommen hatte. „Was, wenn du ihn getroffen hättest?“
Der Mann war entweder klüger, als er aussah oder er hatte einen außerordentlich stark ausgeprägten Überlebensinstinkt. Er vermutete korrekt, dass Ian Widerworte zu geben oder frech zu werden keine gute Idee war, und so hielt er den Mund.
„Es ist doch alles in Ordnung“, beschwichtigte ich Ian, während um uns herum diverse Polizeiwagen mit quietschenden Reifen zum Stehen kamen.
„Keine Bewegung!“, schrie der Polizist, der als Erster aus einem der Wagen sprang.
Statt dem Befehl Folge zu leisten, öffnete ich Ians olivgrüne Einsatzjacke, die ich trug, und zeigte ihnen meine Dienstmarke. „US Marshals, Jones und Doyle.“
Augenblicklich senkten sie ihre Waffen, und einen Moment später ergoss sich eine Flut von Uniformen um uns. Ian übergab ihnen den Gefangenen und die Waffe, und wies sie an, das grob fahrlässige Abfeuern einer Schusswaffe zusätzlich, zu was auch immer sie sonst noch gegen ihn in der Hand hatten, in die Anklage aufzunehmen.
Ich war überrascht, als er mich am Arm packte und hinter sich herzerrte, ein paar Meter die Straße runter, wo er stehenblieb und mich grob zu sich herumdrehte.
„Mir geht es gut“, versicherte ich ihm mit einem leisen Lachen. „Du musst mich nicht rumschubsen.“
Aber er ging auf Nummer Sicher und untersuchte mich, immer noch besorgt, von Kopf bis Fuß.
„Der Kerl hat mich komplett verfehlt.“
Ian nickte, hörte mich, hörte mir aber nicht zu; die Worte drangen nicht bis zu ihm durch. Ich wollte ihn schon aufziehen und mit einem Scherz seine Befürchtungen zerschlagen, als mir auffiel, dass er zitterte.
„Komm her“, befahl ich und zupfte an seinem Sweatshirt, zog ihn näher an mich. Mit so vielen Leuten in der Nähe und um uns herum konnte ich ihn nicht umarmen, also flüsterte ich ihm ins Ohr: „Ich bin okay, Baby, versprochen.“
Er murmelte etwas in sich hinein, aber seine Schultern entspannten sich und seine zusammengeballten Fäuste öffneten sich. Einen Moment später schien es ihm besser zu gehen. „Ich wette, dein Sandwich ist inzwischen kalt“, flüsterte er zurück.
„Mistkerl“, brummte ich und stampfte zu unserem Auto.
„Und, was haben wir daraus gelernt?“, zog er mich auf. Mein Genörgel hatte für ihn offenbar die Normalität wiederhergestellt.
„Nicht hinter anderer Leute Verdächtigen herzurennen, während wir essen.“
Ians belustigtes Lachen entlockte auch mir ein Lächeln.
VOR ETWAS mehr als acht Monaten waren wir noch Deputy US Marshal Miro Jones und Partner Ian Doyle gewesen – was damals allerdings etwas anderes bedeutet hatte, als es das heute tat. Damals hatte es bedeutet, dass jeder in seiner eigenen Wohnung wohnte, Ian mit Frauen ausging und ich mir wünschte, dass er schwul war, damit wenigstens der Hauch einer Chance bestand, dass ich ihn haben konnte. Anstatt jeden Mann, dem ich begegnete, mit meinem heterosexuellen und nicht zu habenden Partner zu vergleichen. Das alles hatte sich geändert, als ich endlich begriffen hatte, was es denn nun tatsächlich bedeutete, seine volle und ungeteilte Aufmerksamkeit zu haben. Und als er dann seinen Mut zusammengerafft und mir gestanden hatte, was er von mir wollte und brauchte, hatte ich mich Hals über Kopf ins Gefecht geworfen. Und zwar so schnell ich konnte, damit ihm keine Zeit blieb, darüber nachzudenken, ob er nicht vielleicht, da er ja erst vor Kurzem herausgefunden hatte, dass er bisexuell war, erst einmal experimentieren und ein paar andere Leute kennenlernen wollte, bevor er sich häuslich niederließ. Aber die Sache war die: Ian war einer der ganz wenigen Männer, der nur die eine Person wollte, die haargenau zu ihm passte und wie es sich herausstellte, war diese Person – ich.
Also war Ian in der Theorie zwar bisexuell, praktisch aber Miro-sexuell und nicht daran interessiert, zu experimentieren oder andere Leute kennenzulernen. Alles, was Ian wollte, war, mit mir zu Hause zu bleiben. Ich hätte nicht glücklicher sein können. Alles in meinem Leben lief nahezu reibungslos: Beruflich war ich in einer guten Position und privat war ich bereit, Ian einen Ring an den Finger zu stecken. Also, so richtig bereit. Vielleicht sogar zu bereit für Ian. Aber im Großen und Ganzen war mein Leben perfekt. Mit Ausnahme von so lästigen Routinearbeiten, wie wir sie im Moment machten.
Nachdem wir unser unterbrochenes Mittagessen beendet hatten, mussten wir zurück nach Chicago rein fahren, um vorschriftsgemäß in der Hauptwache der Polizei in der Innenstadt Bericht zu erstatten – wir waren es schließlich gewesen, die die Festnahme durchgeführt hatten –, dann durften wir umkehren und wieder den ganzen Weg zurück raus nach Elmwood fahren.
„Das wird dich lehren, zu helfen“, grollte Ian. Ich wusste, dass er das nicht ernst meinte, stimmte ihm aber im Grunde genommen zu; die Sache war in der Tat kolossal nervig und zeitraubend.
Eigentlich hätten wir vor dem Haus eines gewissen William McClain sitzen sollen, der wegen Drogenschmuggels gesucht wurde, aber ich erhielt einen Anruf von Wes Ching, einem der anderen Marshals aus unserem Team. Er bat uns, für ihn einen Haftbefehl in Bloomingdale zuzustellen, denn er und sein Partner, Chris Becker, waren bereits in anderer Mission in Elmwood, also konnten sie unsere dämliche Observation gleich mitübernehmen und wir dafür ihre – rein theoretisch – sehr viel interessantere Haftbefehlszustellung.
Ich war kein großer Fan der Vororte, egal um welchen es sich handelte, ob nun mit oder ohne arterienverstopfendes Essen oder der Stunden, die man brauchte, um von einem von ihnen zurück in die Stadt zu kommen. Verkehr in Chicago war tagein, tagaus chaotisch. Dazu kam, dass das Radio in unserem neuen Auto Ians Lieblingssender – 97,9 The Loop – nicht empfangen konnte und die beschissenen Stoßdämpfer ließen uns jeden noch so kleinen Hubbel in der Straße spüren. Da wir das fuhren, was während Razzien und Ermittlungsverfahren beschlagnahmt wurde, waren unsere Autos manchmal phänomenal – wie der Chevrolet Chevelle SS von 1971, den wir zwei Wochen lang gehabt hatten –, während ich mich andere Male fragte, ob ich vielleicht gestorben und in die Hölle gekommen war, ohne dass mir jemand Bescheid gesagt hatte. Der Ford Taurus, den wir derzeit fuhren, war jedenfalls nicht mein Fall.
„Er ist spritsparend“, provozierte Ian mich und legte eine Hand auf meinen Oberschenkel.
Sofort rutschte ich im Sitz weiter nach unten, sodass seine Hand auf meinem Schwanz zu liegen kam.
„Was machst du da?“, fragte er, das Schlitzohr, und drückte seine Handfläche gegen meinen bereits anschwellenden Schaft.
„Ich brauche Sex“, sagte ich zum dritten Mal an diesem Tag.
Das war allein seine Schuld.
Anstatt am Morgen wie üblich aus dem Bett zu springen, hatte er sich auf mich gerollt, mich in die Matratze gedrückt und mich geküsst, bis ich vergessen hatte, welcher Wochentag war. Dergleichen tat er sonst nie. Jeder Morgen verlief bei ihm strikt nach Schema F, er war ganz auf die bevorstehende Arbeit konzentriert und bellte Befehle. Aber aus irgendeinem Grund war Ian an diesem Morgen in träger Urlaubsstimmung gewesen, begehrlich und begierig, hatte mich überall berührt und mir Knutschflecken auf den Hals gemacht. So gar nicht der Kommissknochen, der er sonst war, bevor er die erste Tasse Kaffee intus hatte. Aber dann hatte unser Chef angerufen, und Ian war aus dem Bett gesprungen, ganz „Sir, jawohl, Sir!“ und hatte mich angewiesen, aufzustehen und mich im Bad zu beeilen.
„Was?“, hatte ich geschrien und mich im Bett aufgesetzt. Hatte fassungslos gehört, wie nebenan das Wasser anfing zu rauschen. „Komm sofort zurück und beende gefälligst, was du angefangen hast!“
Er hatte die Frechheit besessen, schallend zu lachen, als er unter die Dusche gesprungen war. Ich hatte gehört, wie er in sich hineinkicherte, während ich vor Wut schäumend im Bett saß. Ich hatte mich rücklings auf die Matratze zurückfallen lassen, entschlossen, die Sache selbst zu Ende zu bringen.
„Wag ja nicht, das anzufassen“, hatte er mir aus der Dusche zugerufen.
Ächzend hatte ich mich aus dem Bett aufgerappelt und war nach unten getappt, um den Kaffee anzustellen. Chickie Baby hatte sich gefreut, mich zu sehen. Hauptsächlich wohl deshalb, weil ich ihn fütterte. Dummer Hund.
„Es gab heute Morgen kein Happy End für mich“, beklagte ich mich jetzt bei Ian. „Du warst nicht sehr nett zu mir.“
„Was?“ Er lachte leise und legte seine Hand wieder aufs Steuerrad. „Ich habe dich ganz liebevoll … geweckt und … Scheiße.“
Ich wollte Ian, brauchte Ian, aber er war nicht bei der Sache, und als ich schließlich meinen Blick von seinem Profil losreißen konnte und nach vorne sah, gab ich dasselbe angewiderte Geräusch von mir wie er. Ohne zu fackeln, rief ich Ching an.
„Du Arsch“, sagte ich anstelle eines Hallos, als er dranging.
Ein geschnaubtes Lachen. „Was?“, sagte er, aber es war undeutlich, so als würde er kauen. „Ich und Becker machen eure Observation hier in Elmwood und dann gehen wir einem Hinweis der Eastern District Vollzugsbeamten nach.“
„Wo zum Teufel seid ihr?“, fauchte ich, während ich ihn auf Lautsprecher stellte.
Er sagte etwas, aber man konnte das Geräusch nicht wirklich als Wort bezeichnen.
Sofort war ich misstrauisch. „Seid ihr im Johnny’s Beef?“
„Wieso denkst du das?“
„Arschloch!“, brüllte ich.
„Oh, komm schon, Jones, sei kein Unmensch. Wir tun euch einen Gefallen oder etwa nicht?“
„Entschuldige bitte, was hast du gerade gesagt?“
Ich hörte nur Gelächter.
„Du weißt genau, dass wir lieber einem nutzlosen Hinweis nachgehen, als zusammen mit einem Einsatzverband einen Haftbefehl zuzustellen“, knurrte Ian neben mir. „Das ist doch scheiße, Wes, und das weißt du auch.“
„Ich habe keine Ahnung, wovon du da sprichst“, sagte Ching mit einem Gackern. „Ihr zwei dürft mit der DEA und der Chicagoer Polizei zusammenarbeiten, und das zum zweiten Mal heute. Das ist doch super.“
Ich hätte es wissen müssen, als er mir das Angebot gemacht hatte. Es war meine eigene Schuld.
Ian sprach meinen Gedanken beinahe wortwörtlich laut aus, was die Sache auch nicht besser machte. „Da kannst du dir selbst die Schuld für geben.“
Er parkte den Wagen und wir stiegen aus und gingen zum Kofferraum, wo wir unsere Einsatzwesten anzogen. Die Dienstmarken klemmten wir an unsere Gürtel, und Ian schnallte sich sein Oberschenkelhalfter um, in das er seine zweite Waffe steckte. Zusammen gingen wir zu einer Gruppe Beamte hinüber und Ian erkundigte sich bei ihnen, wer den Oberbefehl hatte. Es war genau so, wie wir es erwartet hatten: ein Riesenchaos, auch bekannt als Einsatzverband. Vertreter verschiedener regionaler und überregionaler Einheiten standen herum; diese Gruppe hier gehörte zu den ersteren, da ich in ihrer Mitte Mitglieder der örtlichen Polizei entdeckte. Dazu kamen natürlich noch die Jungs von der DEA, die alle entweder aussahen wie verdreckte Meth-Junkies oder wie GQ Models. Ein Mittelding gab es bei ihnen nicht. Bisher war ich allerdings noch keinem DEA-Typen begegnet, den ich hätte leiden können. Sie waren alle fest davon überzeugt, dass sie den härtesten Job der Welt hatten, und dazu noch den gefährlichsten. Sie waren ein Haufen Primadonnen, mit denen mir jegliche Geduld fehlte.
Ich fand es immer wieder faszinierend, wie viele Leute davon ausgingen, dass Marshals genau dasselbe taten wie andere Vollzugsbehörden auch. Sie nahmen an, dass wir Verbrechen untersuchten, Beweismittel sammelten und grübelnd vor Whiteboards saßen, um herauszufinden, wer von unserer Liste aus Verdächtigen wohl der böse Bube war. Was schlicht und ergreifend nicht stimmte. Ein Großteil unserer Arbeit war wie damals im Wilden Westen: Wir spürten die Verbrecher auf und sorgten dafür, dass sie vor Gericht erschienen. Das Resultat dessen war, dass wir, wenn wir nicht gerade an einen gemeinsamen Einsatzverband ausgeliehen wurden, den Großteil unserer Zeit damit verbrachten, Hinweisen nachzugehen oder Häuser zu beobachten, sprich zu observieren und zu überwachen. Das konnte ziemlich langweilig sein, von daher wurde es als eine willkommene Abwechslung angesehen, wenn die tägliche Routine von weniger alltäglichen Aufgaben unterbrochen wurde. Wie zum Beispiel in einen anderen Bundesstaat zu reisen, um dort einen Zeugen abzuholen oder in einer verdeckten Ermittlung mitzuwirken. Aber weder Ian noch ich sahen eine Zusammenarbeit mit der DEA als etwas Positives oder gar Wünschenswertes an.
Die Aufgabe dieses speziellen Einsatzverbands bestand darin, drei Männer mit Verbindungen zur Madero Verbrecherfamilie zu schnappen, die aus FBI Gewahrsam in New York entkommen waren und sich jetzt anscheinend bei einem entfernten Cousin eines der Typen hier in den Vororten von Chicago versteckten. Denn das war es, was `einen Haftbefehl zustellen` tatsächlich bedeutete. Im Grunde genommen war es Beamtenjargon für ´jemanden festnehmen´.
Der Plan sah eine volle Stürmung des fünfstöckigen Mietshauses vor. Razzien dieser Art mochte ich am allerwenigsten, aber ich verstand, warum wir hier waren. Normalerweise war es ein sogenanntes Fugitive Investigative Strike Team, bestehend aus FBI, Polizei und anderen staatlichen Einheiten, das einen Zeugen extrahierte, und eine solche FIST fiel in den Zuständigkeitsbereich der US Marshals. Ohne uns war es kein Einsatzverband, also hatte man unsere Dienststelle hinzugezogen.
Die Polizei betrat das Haus als erste, die Deppen von der DEA folgten. Ian und ich blieben im Erdgeschoss, bis wir aus dem Treppenhaus Schüsse hörten. Dann rannten wir los, während um uns herum die Leute schrien, dass Männer aufs Dach entkamen.
Ich schrie ihnen zu, den anderen Bescheid zu sagen und ließ den gebrüllten Befehl folgen, Verstärkung anzufordern. Da sich aber der Einsatzverband über alle Stockwerke verteilt hatte, waren nur Ian und ich noch übrig, um die Treppen hochzuspurten und zu versuchen, die Flüchtigen abzufangen, wer auch immer sie waren.
„Kein Schritt durch diese Tür!“, schrie ich Ian hinterher, der wie üblich vor mir war. Der einzige Grund, warum er bei der Verfolgungsjagd heute Mittag nicht vor, sondern hinter mir gewesen war, war der, dass der Typ auf meiner Seite am Auto vorbeigerannt war. In neun von zehn Fällen war ich es, der Ian in die wie auch immer geartete Situation hinein folgte.
Er platzte durch die schwere Metalltür, die aufs Dach führte und natürlich wurde sofort auf ihn geschossen.
Ich folgte ihm gerade rechtzeitig durch die Tür, um zu sehen, wie Ian seine Waffe hob und feuerte. Nur in Filmen schreien die Leute „Nicht schießen!“, während man gleichzeitig auf sie schießt.
Ein Typ ging zu Boden und der andere drehte sich um und rannte los. Er trug keine sichtbare Waffe bei sich, also rammte ich meine Pistole in ihr Halfter und rannte hinter ihm her, während Ian den Mann, den er erwischt hatte, auf den Rücken drehte und den Männern, die uns gefolgt waren, zubrüllte, ihn zu übernehmen.
Ich sprintete über das Häuserdach, dem Flüchtigen dicht auf den Fersen; meine Arme und Beine pumpten wie Maschinenkolben, um ihn einzuholen, bevor er das Ende des Daches erreicht hatte. Er rannte auf die niedrige Brüstung zu, ohne langsamer zu werden, und sprang. Ich hatte keine Ahnung, ob sich hinter der Brüstung, außerhalb meines Gesichtsfeldes, ein weiteres Haus befand oder nicht, aber da ich keine Schreie hörte, rannte ich schneller und sprang hinter ihm her ins Nichts.
Das Dach des vierstöckigen Gebäudes auf der anderen Seite einer schmalen Gasse war ein willkommener Anblick und ich landete problemlos, rollte mich ab, kam wieder auf die Füße und rannte hinter meinem Flüchtigen her. Der plötzlich abrupt stehen blieb und zu mir herumwirbelte. Vermutlich waren uns die Hausdächer ausgegangen. Er zog ein Klappmesser aus der hinteren Hosentasche, ließ es aufschnappen und kam geduckt näher.
Ich zog meine Glock 20 und richtete sie auf ihn. „Lassen Sie die Waffe fallen, knien Sie sich hin und verschränken Sie die Hände hinter dem Kopf.“
Er überlegte, was er tun sollte – ich konnte es ihm deutlich ansehen.
„Sofort“, befahl ich, und meine Stimme sank um etwa eine Oktave, wurde kalt und dunkel.
Er murmelte etwas in sich hinein, ließ aber das Messer fallen und kniete sich hin. Ich bewegte mich schnell und stand neben ihm, bevor er noch meinen letzten Befehl ausführen konnte, trat das Messer weg und zog die Kabelbinder aus meiner Einsatzweste. Ich stieß ihn mit dem Gesicht nach unten zu Boden und wartete auf Verstärkung.
Mein Handy klingelte, und ich zuckte ein wenig zusammen, als ich den Namen auf dem Display sah. „Hi.“
„Was zum Teufel war das denn bitteschön?“
„Das, mein Lieber, war das Ian-Doyle-Standard-Manöver“, scherzte ich in dem Versuch, die Stimmung ein bisschen aufzuheitern.
„Oh, nein, mein Freund! Nein, ich springe nicht von Gebäuden, Miro, nur du machst so einen Scheiß.“
Es gab in der Tat in meiner Vergangenheit ein paar derartige Vorfälle mehr als in seiner. „Ja, okay.“
„Bist du verletzt?“
„Nein, mir geht es gut“, erwiderte ich und lächelte ins Handy. „Versprochen. Wir sehen uns unten, sobald ich hier oben ein bisschen Unterstützung bekommen habe.“
Sein deutlich hörbares Schnauben brachte mich zum Lächeln.
Wenige Augenblicke später war ich umringt von Polizisten, die mir den Flüchtigen abnehmen wollten. Während wir die Treppenstufen wieder hinuntertrampelten, fragte ich den Polizisten vor mir, ob wir die Verdächtigen auf ihr Revier brachten, welches auch immer das sein mochte, oder ob wir sie zur Hauptwache transportierten.
„Ich glaube, die DEA nimmt alle drei in Gewahrsam.“
Was bedeutete, dass alle drei Männer verhört und demjenigen, der die meisten Informationen hatte, ein Handel angeboten werden würde. Die anderen beiden bekam dann die Polizei. Es war eine absolute Verschwendung meiner und Ians Zeit gewesen, herzukommen.
„Hast du gehört?“, grollte ich, als Ian auf mich zugesprintet kam. „Wir bekommen nicht mal –“
„Sei still“, knurrte er, packte den Armausschnitt meiner Weste und zerrte mich näher. Sein Blick huschte über meinen ganzen Körper und ich hörte, wie schwer und gepresst sein Atem ging.
„Oh, Baby, es tut mir so leid“, flüsterte ich und beugte mich näher zu ihm, damit er meine leisen Worte hören konnte, ohne ihn dabei aber zu berühren. Die Art, wie wir standen, ließ es so aussehen, als würde ich geheime Informationen mit ihm teilen, mehr nicht.
„Versteh mich bitte nicht falsch, ich habe Vertrauen in dich“, sagte er schnell. „Aber du weißt genau so gut wie ich, dass du gesprungen bist, ohne zu wissen, was hinter dem Haus war, und das war schlicht und ergreifend dumm.“
Er hatte ja recht.
„Mach das nicht noch mal.“
„Nein“, stimmte ich zu, lehnte mich zurück und sah suchend in sein Gesicht. „Also, ist mir vergeben?“
Er nickte, und endlich schenkte er mir den Hauch eines Lächelns.
Wir wollten uns gerade auf den Rückweg zur Dienststelle machen, um unseren Bericht zu schreiben, als wir die insgesamt drei Männer, die sie aus der Wohnung geholt hatten, am Straßenrand sitzen sahen.
„Was ist mit denen?“, fragte ich den am nächsten stehenden Polizisten und zeigte auf sie.
„Die lassen wir laufen.“
„Warum?“, fragte Ian knapp, hörbar verärgert.
„He, Mann“, erwiderte der Bulle müde, „wir haben schon beim NCIC nachgefragt wegen gegen sie ausstehender Haftbefehle, aber die drei sind sauber. Kein Grund, sie zu behalten.“
„Was dagegen, wenn wir sie noch mal überprüfen?“, fragte ich und versuchte, möglichst begütigend zu sprechen.
„Nur, wenn Sie sie auch in Gewahrsam nehmen“, entgegnete er mürrisch. „Ich hab keine Zeit, hier rumzustehen und Däumchen zu drehen, bis Sie fertig sind.“
„Kein Problem“, schaltete sich Ian mit seidenglatter, gefährlicher Stimme ein. „Übergeben Sie sie in unseren Gewahrsam.“
Das dauerte nur wenige Augenblicke, dann trabte der befreite Polizist davon, um seinen Vorgesetzten zu informieren. Der neigte den Kopf in unsere Richtung, offenbar der Meinung, dass wir DEA waren, da er die Rücken unserer Einsatzwesten nicht sehen konnte. Hätte er die Wahrheit geahnt, er hätte uns niemals grünes Licht gegeben. Niemand übergab jemals irgendjemanden an die Marshals, denn dank unseres Informationsnetzwerks konnten wir immer noch etwas finden, das andere übersehen hatten und niemand mochte es gern, vorgeführt zu werden. Uns um unsere Hilfe und Unterstützung zu bitten, wenn es darum ging, jemanden einzukassieren oder einem veralteten Hinweis nachzugehen, damit hatte nie jemand ein Problem. Aber am Tatort vor den Kollegen und womöglich noch anderen Rechtsvollzugsbeamten vorgeführt zu werden, das machte sie immer alle biestig.
Ian zückte sein Handy, während ich mich vor den ersten Typen hinhockte.
„Und wer zum Teufel sind Sie?“, fragte der.
„Marshal“, antwortete ich. „Wir überprüfen Sie noch einmal auf ausstehende Haftbefehle.“
Keiner von ihnen schien sonderlich besorgt.
Mike Ryan und sein Partner, Jack Dorsey, hielten heute Morgen die Stellung im Büro, was bedeutete, dass sie die Vorstrafenregister der drei auf der Bordsteinkante hockenden Männer aufrufen und überprüfen durften. Wir entließen die Verdächtigen einen nach dem anderen – Ryan und Dorsey schrieben am Telefon mit –, nahmen ihnen die Plastikhandfesseln ab und wünschten ihnen einen schönen Tag. „Geh zum Teufel“ war die beliebteste Antwort auf Ians Frohnatur, „Verpiss dich“ folgte an zweiter Stelle.
Dann fanden wir einen ausstehenden Haftbefehl wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung für den dritten Mann.
„Jackpot“, verkündete ich und grinste ihn an.
„Scheißmarshals“, fluchte Darito Batista. „Ich dachte, das wär ‘ne Razzia von der DEA.“
Ian lachte schadenfroh, als wir ihn auf die Füße zogen.
„Komm schon, Mann“, protestierte er. „Ich kann euch Informationen geben. Lass uns ‘n Deal machen.“
„Wir sind Marshals“, sagte Ian, während wir ihn zu unserem Taurus führten. „Wir machen keine Deals.“
Ich rief die zuständigen Stellen an, während Ian ihn auf die Rückbank stopfte.
„Was‘n das für ‘ne Scheißkarre?“, maulte Batista.
„Sie ist spritsparend“, erläuterte ich, legte die Kindersicherung an der hinteren Tür ein und glitt auf den Beifahrersitz.
„Gott, ich hasse diese Kiste“, knurrte Ian gereizt.
Ich versprach ihm, dass wir nach einem anderen Wagen Ausschau halten würden, sobald wir wieder in unserer Dienststelle angekommen waren.
ES STELLTE sich heraus, dass es Batista war, der für die Maderos, die Verbindungen zum Solo Kartell in Durango, Mexiko, hatten, die Geldwäsche betrieb. Mit dem Anreiz, einen Zeugen für die Anklagepunkte Geldwäsche und organisierte Kriminalität zu bekommen, wären die Jungs von der DEA vielleicht, vermutlich, in der Lage gewesen, ihn dazu zu überreden, über die Maderos auszupacken. Auch wenn die Sache wenig Aussicht auf Erfolg hatte, sie hätten es bestimmt gerne versucht. Aber die Polizei in San Francisco hatte erdrückende Beweise gegen ihn wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Und da San Fran den Haftbefehl gegen ihn ausgestellt hatte, und dieser Haftbefehl der Grund dafür war, warum wir ihn einkassiert hatten, steckten wir ihn in eine Zelle und informierten sie über seine Festnahme. Keine Stunde später saßen ihre Leute im Flieger, um ihn abzuholen. Und all das geschah in kürzerer Zeit, als die DEA benötigte, um herauszufinden, was mit ihrem potenziellen Informanten geschehen war.
Nachdem die Jungs dann endlich in die Gänge gekommen waren und von der Chicagoer Polizei die Information erhalten hatten, dass es die Marshals gewesen waren, die Batista in Gewahrsam genommen hatten, kreuzten sie gegen sechs Uhr abends schließlich bei uns auf.
Der leitende Agent war Corbin Stafford und er platzte zusammen mit vier seiner Männer in unsere Dienststelle und forderte, die Marshals zu sehen, die am Nachmittag in Bloomingdale gewesen waren.
Das war ein Fehler.
Wenn sie diplomatisch gewesen wären, sich respektvoll verhalten hätten, dann wäre die Sache vielleicht anders verlaufen. So aber kam mein Chef, der erst kürzlich zum Chief Deputy US Marshal beförderte Sam Kage, aus seinem Büro und wartete ungerührt, während Stafford ihn anschrie und ihm unzweideutig mitteilte, warum er Batista sofort an die DEA auszuhändigen hatte.
Kage wartete, bis er verstummte.
„Und?“, bellte Stafford.
„Nein“, erwiderte Kage ausdruckslos.
Es dauerte einen Moment, bis das Wort einsank. „Nein?“
Kage wartete.
„Was zum Teufel soll das heißen, nein?“
Kage stieß die Sorte Seufzer aus, vor der wir in der Regel die Flucht ergriffen. „Die US Marshals sind der ausführende Arm der meisten staatlichen Behörden, inklusive Ihrer, und wir behalten uns das Recht vor, Festnahmen nach unserem Erachten durchzuführen.“
Alle fünf öffneten den Mund, um etwas zu sagen oder vielleicht um etwas zu schreien, aber mein Chef hob eine Hand.
„Als oberste Strafverfolgungsbehörde haben wir eine größere Verfügungsgewalt, als es Ihnen in Ihrem eingeschränkten Verständnis unserer Behörde offenbar bewusst ist.“
„Ich –“
„Folglich halten wir es in diesem Falle für angebracht, Ihrer Forderung nicht Folge zu leisten.“
„Wir werden sehen, was Ihr Vorgesetzter dazu zu sagen –“
„Mein Vorgesetzter, Tom Kenwood, wurde erst vor einer Woche vom Senat in seinem Amt bestätigt und ist damit der neue US Marshal für den nördlichen Verwaltungsbereich von Illinois“, erklärte Kage, und ich konnte einen Funken Bosheit in seinem Lächeln aufglimmen sehen. „Ich bin mir sicher, er wäre hocherfreut, wenn die Einführung in sein neues Amt darin bestünde, dass Sie seine Wahl des Chief Deputy in Frage stellen.“
Im Raum wurde es sehr still.
„Aber sagen Sie Ihrem Vorgesetzten, dass er meinen Vorgesetzten von mir grüßen soll“, schloss er heiter.
Als Kage in sein Büro zurückkehrte, huschten Staffords Blicke durch den Raum.
Ich winkte.
Ian auch.
Das „Fick dich“ war darin enthalten.
2
ALS IAN und ich am Abend nach Hause kamen, gerieten wir uns erneut in die Haare. Ich hatte es diesmal nicht kommen sehen. Es war gut, dass wir den Konflikt nicht mit in unseren Arbeitsalltag nahmen – wir beide achteten peinlichst darauf, auf der Arbeit nicht über unser Privatleben zu sprechen –, aber kaum hatten wir die Türschwelle überschritten, flammte der schwelende Konflikt wieder auf.
Es war alles meine Schuld.
Ich wollte mehr, als er je auch nur in Betracht gezogen hatte und indem ich meinem Verlangen Ausdruck verliehen hatte, hatte ich alles ruiniert. Das Traurige daran war, dass ich immer so war. Ich wollte immer alles, anstatt mit dem glücklich zu sein, was ich hatte. Meine Freundinnen hatten verschiedene Theorien darüber, warum ich drängte und mehr forderte, wenn die Person, an der mir lag – oder wie in diesem Fall verzweifelt und wie verrückt liebte –, für etwas nicht bereit war. Die Nummer eins war, dass ich, weil ich als Pflegekind hin- und hergeschoben worden war, wie ein angreifender Bulle losstürmte, sobald ich mein und-sie-lebten-glücklich-bis-ans-Ende-ihrer-Tage als Ziel vor mir auftauchen sah. In Ians Fall musste ich ihnen recht geben. Aber auch nur in seinem. In der Vergangenheit hatte ich auf etwas Bestimmtes zu drängen oft als Test benutzt, um zu sehen, wie ernst es dem anderen war. Um zu sehen, ob er bleiben würde, wenn ich vorpreschte und zu schnell zu viel wollte. Aber bei Ian ging es mir nur darum, den Rest meines Lebens mit ihm zu verbringen. Ich konnte mir kein anderes Leben mehr vorstellen.
Zu meiner Verteidigung sollte gesagt sein, dass ich davon ausgegangen war, dass Ian mich nicht nur als seinen Partner wollte, beruflich und privat, sondern als mehr. Es hatte sich für mich so angefühlt, hatte für mich so ausgesehen, also hatte ich gewisse Dinge als gegeben vorausgesetzt. Es hatte seinen Grund, warum das nie eine gute Idee war und mein Fehler war es gewesen, mich nicht zu vergewissern.
„Es ist doch nicht so, als ob ich nicht dasselbe wollte wie du.“ Ian seufzte. Er saß mir gegenüber am Tisch und pulte das Etikett von einer leeren Flasche Gumballhead ab, das ich immer für ihn da hatte. „Ich versteh nur einfach nicht, warum es das sein muss.“
„Du verstehst nicht, warum ich für Immer und Ewig will, bis dass der Tod uns scheidet?“
„Nein, das versteh ich. Ich versteh nur nicht, warum man dafür einen Ring und ein Stück Papier braucht.“
Vielleicht war es dumm, aber ich konnte meine Gefühle genauso wenig ändern wie er. Und das war es, was mich innerlich umbrachte.
Das Problem, sagte er, war nicht, dass er nicht heiraten wollte. Das Problem war, dass er nicht verstand, warum ich es so sehr wollte.
„Vergiss, dass ich gefragt habe“, fuhr ich ihn an und begann, den Abendbrottisch abzuräumen.
„Wie, bitteschön, soll ich das denn machen?“, entgegnete er gereizt und folgte mir in die Küche. „Du willst etwas, du hast mich gefragt, ich hab nein gesagt, und jetzt ist alles am Arsch.“
„Also ist es alles allein meine Schuld“, erwiderte ich scharf und wirbelte zu ihm herum.
„Na ja, sicher, das weißt du.“
„Willst du damit sagen, dass es dumm von mir war, um etwas zu bitten, das ich will?“
„Nein, aber es ist nicht so gelaufen, wie du es gerne gehabt hättest, und jetzt sagst du, vergiss es, aber wie soll das gehen? Du kannst die Sache nicht einfach löschen und so tun, als wäre nichts gewesen. Du willst etwas und du hast es laut ausgesprochen und jetzt müssen wir irgendwie damit klarkommen.“
Ich verschränkte die Arme. „Warum willst du mich nicht heiraten?“
Schweres Seufzen. „Du weißt, warum.“
„Sag es mir noch mal.“
„Weil es dich einschränkt und mein Leben schwerer macht.“
„Auf welche Weise?“
„Sie werden dich nie befördern“, sagte er, und seine Stimme war unwirsch und hart vor Ärger.
„Das glaube ich nicht.“
„Du bist ein Idiot.“
„Schön, ich bin ein Idiot. Mir egal.“
„Aber mir nicht! Die Kameraden in meiner Einheit haben vielleicht kein Problem damit, dass ich schwul bin, aber alle anderen werden es haben. Du verlangst quasi von mir, meine Militärlaufbahn zu beenden, nur damit du dein verdammtes Stück Papier haben kannst!“
„Es ist nicht nur ein Stück Papier“, argumentierte ich mit brüchiger Stimme. „Es ist sehr viel mehr als das.“
„Für mich nicht“, entgegnete er kalt. „Es wird nichts an meinen Gefühlen ändern, ich werde dich deswegen nicht mehr oder weniger lieben. Es bedeutet mir nichts und es nimmt mir einen Teil dessen, was ich bin, was ich tue und wie weit ich gehen kann.“
Seine Worte ließen eine tiefe Leere in mir entstehen und für einen Moment tat es körperlich weh wie ein Faustschlag in die Magengrube, denn für mich bedeutete es das genaue Gegenteil. Ich wollte alles, hatte immer schon alles gewollt, das volle Programm. Ehemann, Haus, Hund, vielleicht sogar Kinder. Ich war mir bei der Sache mit der Vaterschaft nicht ganz sicher, da ich nicht wusste, was für eine Art Vater ich sein könnte, aber ich wollte verdammt noch mal wählen können, ob oder ob nicht.
Ian war zufrieden mit dem Status quo. Er war zufrieden damit, zusammen zu leben, zusammen zu arbeiten, zusammen zu lieben. Er hatte kein Verlangen, kein Bedürfnis danach, in neues Terrain vorzudringen und hatte sich dort eingebunkert, wo er war.
„Warum kann ich nicht genug für dich sein?“, fragte er heiser, offensichtlich verletzt.
„Red keinen Quatsch“, schoss ich zurück. „Es hat nichts mit genug sein zu tun, sondern damit, dass ich will, dass alle wissen, dass du zu mir gehörst.“
„Aber warum spielt das eine Rolle?“
„Weil ich will, dass die Armee mich anruft, wenn dir – Gott bewahre – etwas zustößt. Ich will die Person sein, die der Arzt um Erlaubnis fragen muss, wenn er dich behandelt. Ich will, dass du einen Ring trägst. Ich will dein Ehemann sein.“
„Und was ich will, spielt keine Rolle?“
„Natürlich spielt das eine Rolle. Du musst mir einfach nur begreiflich machen, warum du das alles nicht willst.“
„Ich hab es dir bereits gesagt. Weil es für mich nicht passt.“
„Und warum nicht?“
„Wegen meines Jobs!“, schrie er.
Seit Wochen schon drehten wir uns im Kreis und redeten uns den Mund fusselig. Er hatte die Nase von dem Thema gestrichen voll. Im Unterschied dazu hoffte ich immer noch, dass er eines Tages aufwachen und seine Meinung komplett geändert haben würde. Ich wartete auf ein Wunder.
„Ian –“
„Du willst alles, was ich tue – alles, was ich bin – beeinträchtigen, nur damit du Vater-Mutter-Kind spielen kannst!“
„Wie bitte, was hast du da gerade gesagt?“, fragte ich eisig.
Sofort hob er die Hände. „Okay. Das war nicht fair, aber jetzt komm schon, M.“
„Komm schon was“, wollte ich wissen.
„Warum muss ich mich dir gegenüber rechtfertigen? Warum liegst du mir auf einmal ständig damit in den Ohren?“
„Ich –“
„Warum ist es so wichtig, dass wir heiraten?“
„Weil ich dich liebe.“
Er bewegte sich schnell, stand plötzlich vor mir, legte seine Hände an mein Gesicht und sah mir tief in die Augen. Wie immer verschmolzen Liebe und Verlangen und Lust in meinem Innern und ließen mir nahezu das Herz stillstehen. Ich wollte ihn so sehr.
„Ich liebe dich auch, M, aber Ehe – das ist nicht mein Ding.“
„Sie wäre es, wenn ich eine Frau wäre.“
Er ließ abrupt die Hände fallen und stampfte durch die Küche. Vor der Tür drehte er sich noch einmal herum. „Warum sagst du so einen Mist?“
„Weil es stimmt. Wenn ich eine Frau wäre, würdest du mich heiraten. Dann gäbe es kein Problem.“
„Aber du bist keine.“
„Nein.“
„Also ist die Frage überflüssig.“
Ich schwieg für einen langen Moment, und er ebenfalls, dann sagte ich: „Wir sollten die ganze Sache einfach vergessen. Ich bin es leid, mich mit dir darüber zu streiten. Und es tut mir leid, dass ich es überhaupt erst angesprochen habe.“
Er zuckte die Schultern. „Aber du kannst deine Gefühle nicht ändern, ebenso wenig wie ich.“
„Also was dann?“, fragte ich und hielt den Atem an. Das tat ich seit einiger Zeit in seiner Nähe des Öfteren. Dank Ian Doyle verkrampfte mein Magen sich neuerdings mit schöner Regelmäßigkeit schmerzhaft. Aber es war besser, die Frage endlich zu stellen und seine Antwort zu hören, sodass wir beide wussten, wo wir standen. Nachzugrübeln, den Teufel an die Wand zu malen, das war wenig hilfreich. Außerdem war es feige und es half niemandem, das Offensichtliche zu ignorieren. „Du gehst?“
„Wie, ich gehe?“
Schnelles Luftholen. „Du haust ab, lässt mich sitzen, lässt dich für wer weiß wie lange Gott weiß wohin versetzen – vielleicht für immer. Was weiß ich.“
„Warum sollte ich das tun?“
„Um von mir wegzukommen.“
„Und warum sollte ich das wollen?“
Er schien aufrichtig verwirrt zu sein und das schien mir ein gutes Zeichen.
„Um uns beiden Zeit zu geben, die Dinge klarzubekommen.“
„Scheiß auf den Scheiß“, knurrte er. „Ich lauf nicht weg und gebe dir so die Chance, herauszufinden, wie du ohne mich leben kannst. Das ist –“
„Ich will niemals ohne dich leben, das ist ja der Punkt!“
„Na, ich geh jedenfalls nirgendwohin, also wirst du wohl einfach für den Rest deines Lebens unglücklich sein müssen.“
„Ich bin nicht unglücklich“, murmelte ich in mich hinein.
„Das glaubst du doch selber nicht.“
„Pass auf, ich werde auch nicht gehen. So verhält sich ein Partner nicht.“
„Woher willst du das wissen?“, schoss er zurück. „Du denkst doch die ganze Zeit nur an dich und an das, was du willst. Was du haben musst, um glücklich zu sein.“
„Ian –“
Er schüttelte den Kopf. „Du kannst nicht eine Sache einfach verändern wollen, ohne auch an die Konsequenzen zu denken. Ich weiß, was ich tun kann, was ich geben und dabei ich selbst bleiben kann. Ich dachte, du würdest fragen, bevor du hingehst und ein Ultimatum stellst.“
„Ich habe dir kein Ultimatum gestellt“, beharrte ich.
„Ach nein?“
„Verdammt noch mal, nein! Ich habe dir gesagt, was ich will, aber das war auch schon alles.“
„Das war nicht auch schon alles. Wie könnte es auch?“ Er verschränkte die Arme vor der Brust, seine Kampfhaltung. Er war bereit für die Schlacht. „Du hast mich gebeten, dich zu heiraten. Du hattest einen Ring und alles.“
„Und du hast Nein gesagt“, brachte ich heiser heraus und der Schmerz durchströmte mich erneut.
Ich hatte sein Lieblingsessen gekocht, Bœuf Stroganoff, und dann war ich in der Küche – etwa dort, wo ich jetzt gerade stand – auf die Knie gegangen und hatte ihn mit einem schlichten Platinring gebeten, den Rest seines Lebens mit mir zu verbringen. Sein Gesichtsausdruck in dem Moment hatte mir das Blut in den Adern gefrieren lassen. Ich hatte Angst dort gesehen und Schmerz, aber nicht einen Funken Freude oder Glück.
„Weil ich den Rest meines Lebens mit dir verbringen will, ja. Aber wieso muss ich dazu einen Ring tragen? Warum ist der Quatsch so wichtig?“
„Wenn ich eine Frau wäre, wäre es dann auch noch Quatsch?“
Keine Antwort.
„Siehst du“, seufzte ich. „Heiraten ist etwas, das Heteros tun, richtig?“
Immer noch Schweigen.
„Verdiene ich es nicht, geheiratet zu werden?“
„Ich versteh nur einfach nicht, warum du es willst.“
„Weil ich dich liebe.“
„Liebe mich, M, und nicht ein Stück Papier, auf dem steht, dass du es musst.“
„Schön“, seufzte ich und gab auf. Ich hatte es gründlich satt, dass mein Wunsch ein Problem war. „Es tut mir leid, dass ich etwas gesagt habe.“
„Ja, aber du hast es.“
„Na und“, murmelte ich und wandte mich zur Spüle, um das Geschirr abzuwaschen. „Wie ich schon sagte, lass uns einfach vergessen, dass da etwas war.“
„Und ich hab dir schon gesagt, dass wir das nicht so einfach tun können. Du kannst die Sache nicht auf sich beruhen lassen und ich auch nicht. Ich würde sagen, wir haben beide ein Problem.“
„Wir hätten keins, wenn du mich einfach heiratest.“
„Sicher“, erwiderte er stoisch. „Und wir hätten auch keins, wenn dir das, was wir jetzt haben, reichen würde.“
„Du –“
„Wir sollten zu Bett gehen. Wir müssen morgen beide wieder früh raus und es ist schon fast Mitternacht.“
„Du gehst jetzt ins Bett?“ Ich konnte es nicht glauben. „Während wir uns noch streiten?“
„Wir streiten uns jetzt schon seit drei Wochen, was macht eine Nacht mehr oder weniger da schon aus?“
„Wie kannst du bei so was einfach einschlafen?“
„Übung“, sagte er ausdruckslos.
„Na, ganz offenbar ist dir die Sache völlig unwichtig.“
„Falsch“, erwiderte er. „Aber ich bin der Meinung, dass wir beide Zeit brauchen, um darüber nachzudenken, was genau wir eigentlich wollen und was wir tun können.“
„Was genau wir eigentlich wollen? Wovon redest du da?“
„Du willst einen Ehemann, richtig?“
„Ian –“
„Und wenn ich das nicht bin, was dann?“
„Dann schön, in Ordnung, ich finde mich damit ab.“
„Aber warum solltest du das müssen? Warum solltest du dir nicht einfach einen Typen suchen dürfen, der dieselben Dinge will, wie du auch, und der nachgibt?“
„Ich will nicht, dass einer von uns nachgeben muss. Es geht hier nicht ums Gewinnen.“
„Nicht?“
„Nein, du Idiot, es geht darum, dass ich den Rest meines Lebens mit dir verbringen will.“
„Das ist genau das, was ich auch will, nur eben ohne den Scheißring und so ein verfluchtes Stück Papier!“
„Warum nennst du die Heiratserlaubnis immer ein Stück Papier? Sie ist mehr als nur das.“
„Für dich“, wiederholte er.
„Für viele Leute!“
„Es geht hier aber nicht um viele Leute, es geht hier um dich und mich, Punkt.“
„Na schön.“
„Was na schön?“
Ich seufzte. „Finde du heraus, was du willst, und wenn du das getan hast, dann lass es mich wissen.“
„Ich weiß es schon. Mir gefallen die Dinge, wie sie jetzt sind.“
„Okay“, seufzte ich, zu müde und erschöpft, um mich weiter mit ihm zu streiten.
Er murmelte etwas, das ich nicht verstand, und polterte die Treppe hinauf. In seiner Abwesenheit räumte ich die Küche auf, stellte die Spülmaschine an und machte mich bereit, mit unserem Hund, unserem Werwolf, Chickie, eine Runde zu laufen.
„Was machst du da?“, brüllte er von oben herunter.
Normalerweise trat ich raus ins Wohnzimmer, sodass ich ihn sehen konnte, wenn ich zur Empore hochrief. „Ich geh mit Chickie raus.“
„Lass ihn einfach raus in den Hof. Ich mach da morgen sauber, wenn wir nach Hause kommen.“
„Nein“, rief ich zu ihm hoch. „Wir können beide ein bisschen frische Luft vertragen.“
„Wie du meinst“, grollte er. „Ich geh duschen.“
Ich wartete nicht, bis ich das Wasser rauschen hörte, sondern ging zur Haustür, atmete tief die frische Herbstluft ein und trat hinaus in die Nacht. Es wurde bereits kühler, war aber noch nicht so kalt, dass ich eine dicke Jacke gebraucht hätte. Das Kapuzenshirt, das ich trug, würde reichen.
Ich schloss die Tür hinter mir, eilte die Stufen hinunter und hatte beinahe das Ende unserer Straße in Lincoln Park erreicht, als ich hörte, wie jemand meinen Namen rief.
Ich drehte mich just in dem Moment um, in dem Ian mich erreichte. Er rannte mich beinahe über den Haufen. Er packte mich, zerdrückte mich fast in seinen Armen und presste seinen Kopf in meine Schulter.
„Nicht“, flüsterte er.
Ich registrierte, dass ich irgendwann in den letzten Sekunden aufgehört haben musste, zu atmen. Niemand außer Ian hatte diese Wirkung auf mich. Nur er konnte mich in diesen Zustand absoluter Regungslosigkeit und Stille – körperlich, mental und emotional – versetzen und in denjenigen verwandeln, der wartete.
Mit einem tiefen Luftholen klammerte ich mich an ihn, meine Lippen an seinen Hals gedrückt und genoss das Gefühl von ihm in meinen Armen. Ich wollte nicht loslassen. Ich hatte panische Angst, dass das, was wir hatten, uns zwischen den Fingern zerrann, während wir beide krampfhaft versuchten, es festzuhalten.
„Wir finden eine Lösung“, sagte er mit bebender Stimme. „Bitte streich nicht meinen Namen aus dem Grundbucheintrag fürs Haus oder so.“
„Das kann ich nicht“, sagte ich um den Kloß in meiner Kehle herum. „Und ich würde es auch nicht, selbst wenn ich es könnte.“
Er nickte an meiner Schulter.
„Es gibt einen Mittelweg“, seufzte ich und hielt ihn fester. „Wir werden ihn finden. Versprochen.“
„Ich hatte das Gefühl, als müsste ich mich übergeben, als du das Haus verlassen hast.“
„Wir finden eine Lösung. Das ist nicht das Ende der Welt.“
„Nein“, stimmte er schnell zu.
„Es kommt schon in Ordnung“, sagte ich und schob ihn sanft so weit von mir, dass ich ihn ansehen konnte.
Verdammter Ian. Nur er brachte es fertig, den Spieß so umzudrehen, dass ich derjenige war, der ihm versicherte, dass alles in Ordnung kommen würde, während ich es doch selbst nicht so ganz glaubte. Verflucht noch mal, schließlich war ich doch hier derjenige, den die Sache mehr mitnahm; ich war derjenige, dessen Gefühle verletzt und dessen Stolz getreten worden war. Ich war es, der das Gefühl hatte, als würde mein Herz von Dolchen durchbohrt, weil er mich nicht heiraten wollte. Ich hätte ihm eine runterhauen sollen, aber er war so voller Angst und Sorge. Ich konnte es deutlich sehen in seinen zusammengezogenen Augenbrauen, der Dunkelheit in seinen Augen, den fest zusammengepressten Lippen und der Anspannung in seinem Kiefer. Er hatte es so richtig mit der Angst zu tun bekommen und weil ich auch derjenige war, der sich in solchen Fällen immer der Sache annahm, der ihn beruhigte und die Dinge wieder in Ordnung brachte, konnte ich jetzt nicht einfach nichts tun, nur weil die Angelegenheit auch mich betraf.
„Okay.“
„Wir müssen zusammenbleiben“, sagte ich, und er war nicht der Einzige, der das hören musste.
„Ich weiß.“
Ich trat einen Schritt zurück. In seinen Augen lag noch immer ein gehetzter, gequälter Ausdruck, als hätte ich ihn tatsächlich endgültig verlassen. Er hatte sich wirklich zu Tode erschreckt. In Anbetracht der Tatsache, dass meine Knie zitterten wie Espenlaub, konnte ich guten Gewissens sagen, dass er nicht der Einzige war, dem es so erging.
Wir drehten gemeinsam die Runde mit Chickie und als wir wieder nach Hause kamen, hörten wir sein Handy klingeln. Einen Moment lang hatte ich Angst, dass er in den Einsatz berufen wurde. Ian gehörte den Sondereinsatzkräften an, von daher unterlag seine Entsendung dem Gutdünken des Präsidenten, und so bestieg er, wenn der Einsatzbefehl kam, umgehend den nächsten Flieger. Da er aber nicht Haltung annahm, während er zuhörte, sondern leise fluchte, wusste ich, dass es nicht die Armee war, sondern dass wir in den Dienst zurückgerufen wurden.
„Was ist passiert?“, fragte ich, als er auflegte.
„Dein Chef hat dich, mich, White und Sharpe für heute Nacht ans FBI ausgeliehen.“
„Warum ist er immer mein Chef, wenn er uns einen beschissenen Befehl gibt?“
„Lass mich kurz nachdenken“, sagte Ian und grinste mich fies an.
Es war schön, wenigstens ein kleines Stück weit die Normalität wiederhergestellt zu haben. Wir brauchten den Waffenstillstand zwischen uns, auch wenn keiner von uns sagen konnte, wie lange der anhalten mochte.
3
„AUF WAS hast du überhaupt geschossen?“, fragte Chandler White, der mir am folgenden Abend am Tisch gegenübersaß.
„Auf den Typen, der versucht hat, dich mit seinem Auto zu überfahren“, erklärte ich ein weiteres Mal, da er das erste Mal verpasst hatte. Ich hätte der Empfänger tiefer Dankbarkeit sein sollen, aber was ich bekam, waren Ärger und Gemecker.
„Ja, aber du hast nicht getroffen“, erinnerte Ethan Sharpe, Whites Partner, mich.
„Ich habe nicht nicht getroffen“, argumentierte ich. „Du hast nicht getroffen.“
Er schnaubte verächtlich. „In deinen Träumen, Jones. Ich habe auf das Auto geschossen. Er hat versucht, mir auszuweichen und ist so in sein eigenes Haus reingerauscht!“
„Das schon wieder?“ Ian klang gelangweilt, als er sich, von seinem Ausflug auf die Toilette zurückgekehrt, neben mich setzte. „Wartet doch einfach, bis wir den Bericht aus der Ballistik haben. Warum Zeit damit verschwenden, euch darüber zu streiten?“
Nach Dienstschluss am Mittwochabend hatten White und Sharpe uns eingeladen, mit ihnen im Haymarket Pub & Brewery unten auf der Randolph essen zu gehen. Da es direkt im West Loop und damit nicht weit von unserer Dienststelle entfernt lag, und wir beide den toten Punkt weit hinter uns gelassen hatten – mehr als vierundzwanzig Stunden lang nicht zu schlafen konnte diesen Effekt haben –, hatten wir zugestimmt. Normalerweise ging White nach Dienstschluss geradewegs nach Hause zu seiner Frau, aber sie war aus und traf sich mit Freundinnen. Also hatte er beschlossen, mit seinem Partner und seinen Arbeitskollegen abzuhängen. Da allerdings White fest entschlossen schien, eher seinem Partner zu glauben statt mir, fing ich langsam an, mir zu wünschen, Ian und ich hätten abgesagt. Ja, okay, ich verstand schon, Loyalität und der eigene Partner und all das. Aber doch nicht angesichts überwältigender empirischer Beweise für das Gegenteil.
„Ich habe das Auto erwischt“, wiederholte ich für Ian und spürte dabei, wie ich von Sekunde zu Sekunde ärgerlicher wurde.
„Okay.“
„Nein, nicht okay, du musst mir glauben.“
Er zuckte mit den Schultern und nahm einen Schluck von seinem Bier, einem Angry Birds Belgian Rye IPA, das er gern mochte, auch wenn er normalerweise Mathias Imperial IPA bevorzugte. Allerdings hatten sie das nicht immer vom Fass. Ich war nicht so der Biertrinker, aber mir schmeckte das The Defender American Stout, an dem ich im Moment nippte. Inzwischen schon am zweiten Glas, und mir ging es auch schon sehr viel besser, als ich mich beim Hereinkommen gefühlt hatte.