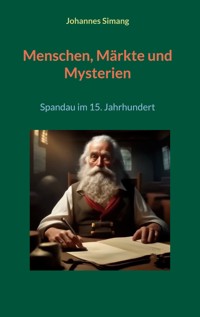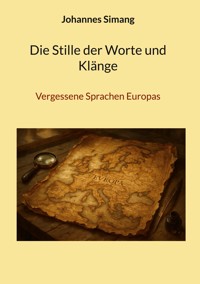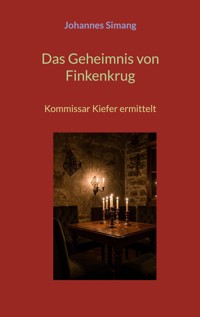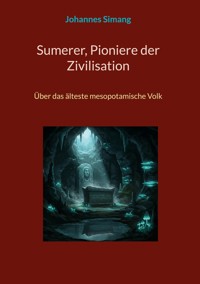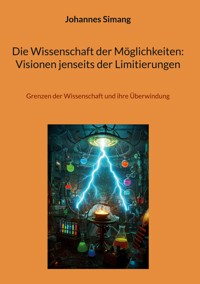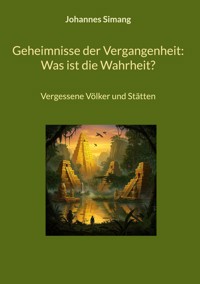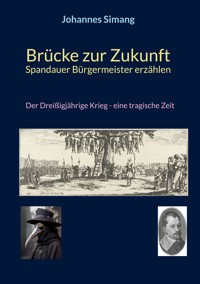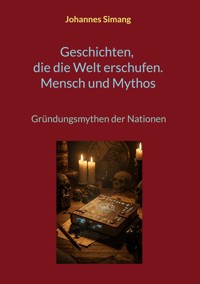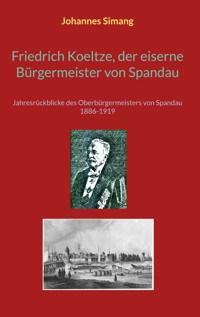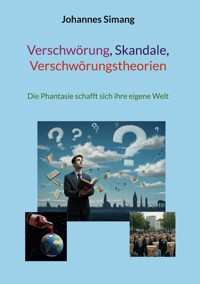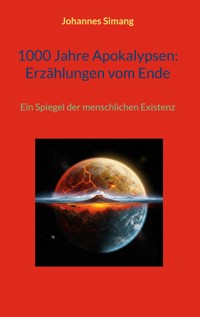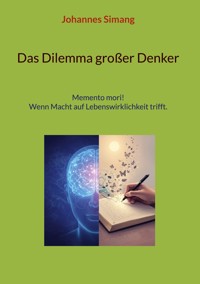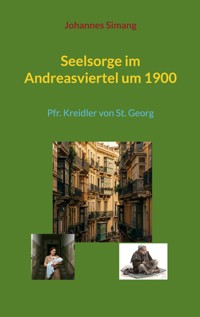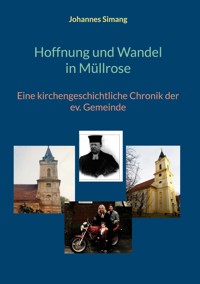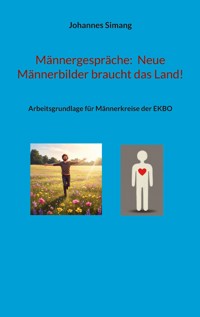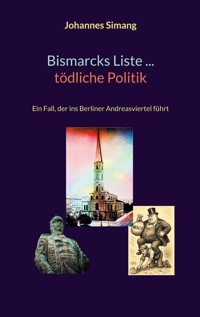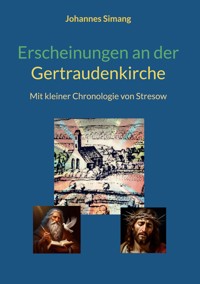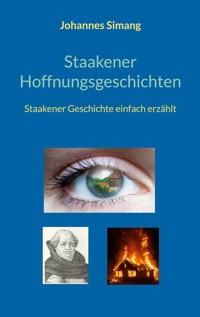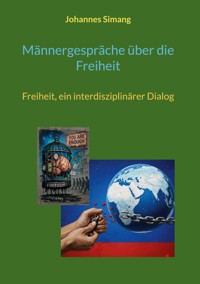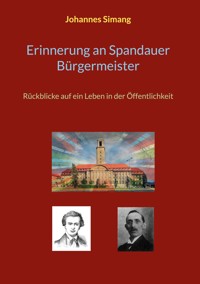
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Buch beschreibt die Geschichte der Stadt Spandau durch die Erzählungen von 80 Bürgermeistern, die das Schicksal der Stadt von ihrer Gründung im 12. Jahrhundert bis zur Eingliederung in Groß-Berlin im Jahr 1920 geprägt haben. Die Bürgermeister kamen aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten, darunter Handwerksmeister, Schulgesellen und in der letzten Zeit Juristen, und brachten unterschiedliche Erfahrungen und Überzeugungen mit. Sie agierten in einer Zeit des Wandels, geprägt von sozialen Spannungen, Kriegen und der Suche nach Identität. Ihre Entscheidungen reflektierten die Sorgen und Hoffnungen der Bürger. Die Erzählungen bieten Einblicke in die kommunalpolitische Landschaft und die sozialen Rahmenbedingungen und zeigen, wie Spandau sich von einer unabhängigen Stadt im 20. Jahrhundert zu einem Teil Berlins entwickelte. Das Buch würdigt die Anstrengungen der Bürgermeister und betont die Bedeutung von Engagement und Verantwortung in der Kommunalpolitik. Es ermutigt die Leser, die Geschichte ihrer Stadt zu schätzen und zu verstehen. Vor allem ist es aber ein Aufruf, die facettenreiche Geschichte Spandaus und die Menschen, die sie geprägt haben, zu erkunden und wertzuschätzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gewidmet:Den Bezirksbürgermeistern von Spandauund der einzigen Frau in diesem Amt: Frau Dr. Carola Brückner
Inhalt
Die Anfänge Spandaus
Heinrich von Stendel
Die Bürgermeister von Spandow / Spandau
Teil I – Bürgermeister des 15. Jh.
Hans Velkener (1410)
Clawes Stenze (1424-27)
Peter Hellembrecht (1427-34)
Jacob Seger (1429-36)
Vincentius Zabel (1410-32)
Petrus Michels (1432-34)
Jacob Voß (1442)
Martinus Wartenberg (1442-45)
Johann Muzeltyn (1442-74)
Matthias Hoenow (1467-71)
Jacob Farneholt (1468-71)
Severinus Kyen (1468-76)
Clawes Hoenow (1473-77)
Joachim Kra(e)mer (1473-87)
Sebastian Rücker (1491-1521)
Thomas Mewes (1492)
Matthias Wartenberg (1492-98)
Teil II - Bürgermeister des 16. Jh.
Peter Rudeniz (1506-10)
Jacob Daniel (1506-11)
Borchard Markert (1506-18)
Peter Schroeder (1512-22)
Jürgen Wartenberg (1513-41)
Michael Walter (1519-26
Hans Watze (1523-29)
Andreas Koch (1523-45)
Jürgen Gütten (1527-41)
Urban Ritter (1529-47)
Matthias Wilcke (1542-53)
Theoricus Drescher (1543-46)
Peter Lonies (1546-64)
Joachim Kramer (1546-75)
Bartholomäus Wittstock (1548-66)
Thomas Tempelhoff (1554-73)
Bartholomäus Bier (1564-78)
Andreas Forbiger (1568)
Andreas Marzahn (1569-93)
Johann Engel (1570-87)
George Schüler (1575-81
Bartholomäus Wendeler (1579-97)
Matthias Rostock (1588)
Balthasar Westphal (1583-1624)
Joachim Moyz (1591-1611)
Martin Koehler (1594-95)
Benedictus Dusicke (1594-98)
Teil III - Bürgermeister des 17. Jh.
Johann Müller (1596-1613)
Joachim Bier (1612)
Günter Eltiste (1613-18)
Johann Schmidt (1614-15)
Johann Blume (1616-29)
Joachim Frize (1618-39)
Johann Walter (1625-36)
Petrus Barthold (1630-53)
Christian Ungnad (1637-57)
Dietrich Albrecht (1640-57)
David Dilschmann (1658-83)
Emanuel Vulpinus (1658-64)
Andreas Fromm (1658-76)
George Erasmi (1677-91)
Andreas Leporinus (1678-93)
George Neumeister d. Jü. (1685-1703)
Johann Sebastian Züzel (1693-1714)
Teil IV - Bürgermeister des 18. Jh.
Ernst Gottlieb Cautius (1703-05)
Georg Adam Neumeister (1705-21)
Franz Ernst Cautius (1714-32)
Christian Lindner (1733-55)
Gottlieb B. Lemcke (1755-1808)
Teil V - Bürgermeister des 19. Jh.
Johann Chr. Kattfuß (1809-15)
Christian Daberkow (1815-21)
Johann Ferdinand Froehner (1821.38)
Eduard Zimmermann (1839-50)
Gustav Sprengel (1848-51)
Adalbert Roedelius (1851-69)
OB Carl Bollmann ((1869-72)
Richard Gardemin (1873-82)
Adam Betcke (1883-85)
Friedrich Koeltze (1886-1919 – ab 1895 OB)
Paul Wolf 2. Bürgermeister (1895-1919)
OB Dr. Kurt Woelck (1919-21)
2. Bürgermeister Emil Stahl (1919)
Vorwort
Die Geschichte einer Stadt ist nicht nur die Summe ihrer Gebäude und Straßen, sondern vor allem das Echo der Menschen, die sie geprägt haben. In diesem Buch präsentieren wir Ihnen die Geschichten von 80 Bürgermeistern, die über die Jahre hinweg das Schicksal der Stadt Spandau mitgestaltet haben. Von ihrer Gründung im 12. Jahrhundert bis zur Eingliederung in Groß-Berlin im Jahr 1920 war Spandau (bis 1878 Spandow) ein Ort des Wandels, der Herausforderungen und der Hoffnungen.
Jeder Bürgermeister, ob Handwerksmeister, Schulgeselle oder Jurist, brachte seine eigenen Erfahrungen, Überzeugungen und Herausforderungen mit. Sie waren Zeugen bedeutender gesellschaftlicher Umwälzungen, politischer Kämpfe und wirtschaftlicher Veränderungen. In dieser Zeit, die von sozialen Spannungen, Kriegen, Seuchen und der Suche nach Identität geprägt war, waren die Bürgermeister oft die ersten Ansprechpartner für die Bürger – ihre Sorgen, Ängste und Hoffnungen spiegelten sich in den Entscheidungen und Maßnahmen wider, die sie trafen.
Die vorliegenden Berichte und Erzählungen sind nicht nur biografische Skizzen, sondern auch wertvolle Dokumente, die Einblicke in die kommunalpolitische Landschaft und die sozialen Rahmenbedingungen der damaligen Zeit gewähren. Sie zeigen, wie Spandau sich von einer unabhängigen Stadt zu einem Teil der wachsenden Metropole Berlin entwickelte und welche Herausforderungen diese Transformation mit sich brachte.
Mit diesem Buch möchte ich die Leistungen und Mühen der Bürgermeister würdigen, die sich unermüdlich für das Wohl ihrer Stadt eingesetzt haben. Ihre Geschichten sind nicht nur Teil der Geschichte Spandaus, sondern auch Teil der deutschen Geschichte insgesamt. Mögen die Leser und Leserinnen durch diese Erzählungen inspiriert werden, die Bedeutung von Engagement und Verantwortung in der Kommunalpolitik zu schätzen und zu erkennen, wie wichtig es ist, die Geschichte der eigenen Stadt zu bewahren und zu verstehen.
Lassen Sie uns gemeinsam eintauchen in die facettenreiche Geschichte Spandaus und die Menschen, die sie geprägt haben.
Johannes Simang
Die Anfänge Spandaus: Ein historischer Überblick
Die Geschichte Spandaus ist tief in der slawischen und deutschen Vergangenheit verwurzelt, beginnend mit der Ansiedlung von Slawen an den Ufern der Havel. Diese ersten Siedler ließen sich wahrscheinlich um das 6. Jahrhundert n. Chr. nieder, und archäologische Funde zeugen von einer menschlichen Präsenz bis zu 55.000 Jahre zuvor. Während der slawischen Besiedlung entstand eine Gemeinschaft, die von Fischfang, Landwirtschaft und Bienenhaltung lebte und auch kriegerisch gegenüber Eindringlingen war.
Spandau entwickelte sich im Schatten bedeutender politischer Umwälzungen. Als der lokale Fürst Pribislav zum Christentum konvertierte, kam es zu einer Wendung in der Herrschaftsstruktur, die die Grundlage für spätere Machtverhältnisse schuf. Die Schenkung von Land an Albrecht den Bären markierte einen wichtigen Schritt in Richtung einer stärkeren Integration Spandaus in das Markgraftum Brandenburg. Der Name „Spandow“, vermutlich aus dem Slawischen stammend und damit eng mit der slawischen Vorherrschaft verbunden, fand im Verlauf der Jahrhunderte verschiedene Deutungen.
Mit der Etablierung der Askanierdynastie unter Albrecht der Bär ab 1137 begann eine Phase der Stabilität und des Wachstums. Der Markgraf ließ das Gebiet zwischen Elbe und Oder besiedeln, um das Land gegen die ständige Bedrohung durch wendische Überfälle zu schützen. Historische Dokumente aus dieser Zeit belegen, dass Spandau sowohl als militärischer Stützpunkt als auch als Handelsplatz an Bedeutung gewann. Die Errichtung von Burgen zur Verteidigung der Ostgrenze und die Integration jüdischer Kaufleute in das Handelsnetz zeigen die zunehmende Komplexität der sozialen und wirtschaftlichen Strukturen.
Markgraf Otto I. (1170-1184), der die Region nach Albrecht dem Bären regierte, setzte den Expansionskurs fort. Dieser wurde von seinem Sohn Otto II. (1184-1205) und dessen Nachfolgern weitergeführt. Der Konflikt mit den wendischen Bewohnern, dokumentiert in einem bemerkenswerten päpstlichen Schriftstück aus dem Jahr 1197, spricht von den Spannungen, die diese verschiedenen Kulturen und ihre Ansprüche miteinander verbinden. Währenddessen war Spandau auch als Sitz eines markgräflichen Vogtes von zentraler Bedeutung, was die politische Relevanz des Ortes untermauert.
Die Zeit bis zum 13. Jh. war geprägt von Kämpfen um Einfluss, territorialen Auseinandersetzungen und gesellschaftlichen Umwälzungen, die Spandau endgültig als bedeutende Siedlung in der brandenburgischen Markgrafschaft etablierten. Die Stadt, die sich aus einer strategisch gelegenen Fischerhütte entwickelte, ist heute ein symbolisches Zeugnis für die verwobene Geschichte zwischen slawischen Wurzeln und deutscher Territorialpolitik.
Insgesamt spiegeln die Anfänge Spandaus eine komplexe Wechselbeziehung zwischen verschiedenen Kulturen wider, die durch Kriege, Handelsbeziehungen und politische Strategien geprägt war. Diese fundamentalen Entwicklungen legten den Grundstein für die spätere Bedeutung der Stadt in der Region und ihre Rolle in der Geschichte Deutschlands.
Hier geht es nun um die Dorfschulzen und ab 1233 um die Bürgermeister (mitunter auch als ‚Burgemeister‘ bezeichnet) der Stadt Spandow. Da es anfangs ein Ehrenamt war, wählte man in der Regel – wie damals in Brandenburg üblich – 3-4 erfahrene Männer in das Amt der Bürgermeister (später proconsules), die anderen Ratsmänner erhielten den Titel ‚consules‘. Aus diesen vieren wurde dann jedes Jahr der Bürgermeister und sein Vertreter benannt. Starb jemand, wählte man einen Nachrücker. Diese Form der politischen Führung bewahrte man bis ins 19. Jh. Auf diese Weise erklären sich lange Bürgermeisterzeiten von mitunter 30 Jahren, in denen derjenige aber nur 7-10 Mal tatsächlich 1. Bürgermeister war.
In der Stadtgründungsurkunde wird als Schulze zu Spandow Heinrich von Stendel genannt.
Heinrich von Stendel, Schulze von Spandow Spandow, das Erbe der Flucht
Heinrich von Stendel, der Schulze von Spandow, saß in seinem kleinen, schlicht eingerichteten Arbeitszimmer, das sich im Schatten des mächtigen Schlosses erhob. Über den dicken Holztisch breiteten sich einige Dokumente, die das neueste Wachstum seiner geliebten Stadt dokumentierten. Er blätterte durch eine alte Urkunde, die auf den 7. März 1232 datiert war – ein bedeutsames Datum, das den Anfang einer neuen Ära für Spandow markierte.
In Gedanken versunken, blickte Heinrich aus dem Fenster auf die geschäftigen Straßen des Ortes, wo Händler mit bunten Waren um die Wette schrien und die Bürger geschäftig ihren täglichen Aufgaben nachgingen. Vor mehr als einem Jahrzehnt hatten die Markgrafen Johann I. und Otto III. vor dem Erzbischof von Magdeburg geflohen, verfolgt und geschlagen. Diese Flucht hatte nicht nur ihr Leben bewahrt, sondern auch das Schicksal von Spandow geprägt.
Heinrich erinnerte sich gut an den Tag, als die Markgrafen, die wie gefallene Sterne vor dem Grauen der Schlacht geflohen waren, in diesem kleinen, ruhigen Ort Zuflucht suchten. Man hatte sich besorgt umgesehen, als die Reiter mit schmutzigen Gesichtern und müden Augen im Ort eintrafen. Es war das erste Mal gewesen, dass die Schatten eines Krieges die Mauern Spandows berührt hatten. Der Ort war bekannt für seine Sicherheit, sein Schloss war nie erobert worden, und die Bürger hatten stets friedlich und zufrieden in ihrer Abgeschiedenheit gelebt.
Wenn Heinrich heute an jenen Tag dachte, konnte er die Atmosphäre noch deutlich spüren – die Angst, aber auch die Hoffnung. Die Stadt war sogleich in Aufruhr geraten. Es war klar, dass die Anwesenheit der Markgrafen, ihrer Gunst und Macht, eine neue Wendung bringen könnte. Heinrich, als Schulze, wusste, dass dies eine Gelegenheit war, die man nicht leichtfertig vergeben durfte. Mit einem Vorschlag, der an die Markgrafen gerichtet war, erbat er das Stadtrecht und die Erlaubnis, eine Flutrinne zu bauen, auf, dass Spandow nicht nur ein sicherer Ort, sondern auch ein blühender Handelsplatz werde.
Im Klartext: „Es ist das Recht unserer Stadt, die unsunglichen Gaben Gottes zu nutzen“, hatte er gesagt und sein Herz hatte dabei heftig geschlagen. „Schenkt uns die Freiheit vom Zoll, bringt Wohlstand in unsere Straßen und die Möglichkeit, unser Land zu mehren.“
Die Markgrafen, ergriffen von seiner Entschlossenheit und dem unerschütterlichen Glauben an die Stadt, hatten schließlich zugestimmt und die Urkunde unterzeichnet, die Spandow Vorteile bringen sollte, und den Menschen die Möglichkeit zu gedeihen. Heinrich hatte das Gefühl, dass dieser Tag nicht nur ein Erfolg für den Ort war, sondern für die Seelen aller, die unter dem Schild des Schlosses lebten.
Mit der Zeit hatte sich Spandow tatsächlich gewandelt. Die Handelstreibenden waren gekommen, die Plätze füllten sich mit Leben, und die einstigen Ängste der Menschen waren weichen den Geläuten der Märkte und dem Lärm des Lebens. Doch das war nicht nur ein materieller Gewinn – die Juden, die versiert im Umgang mit Geld und Krediten waren, sorgten dafür, dass der Reichtum nicht nur sich selbst, sondern dem gesamten Ort zugutekam. Sie hatten die Ströme des Geldes gelenkt, als die Kirche ihre Zugänge versperrte; ihre Geschäfte waren ein Segen für die städtische Wirtschaft und gaben Spandow eine neue Dynamik.
Heinrich, als Schulze, hatte dazu beigetragen, dass die noch junge Stadt florierte, und auch die Vielfalt und das Miteinander der Kulturen, die durch den Kommerz hierher gelangten, waren gewachsen. Er hatte die Verantwortung, die verschiedenen Strömungen zusammenzuführen und für ein harmonisches Miteinander zu sorgen. Er dachte an die Abende, in denen er mit den Bürgern zusammengekommen war, um über die Herausforderungen zu diskutieren, und daran, wie oft die Stadt ihr Gesicht gewandelt hatte.
Plötzlich riss ihn ein lautes Klopfen an der Tür aus seinen Erinnerungen. „Herein!“, rief er und der Stadtschreiber trat ein, sein Gesicht strahlend vor Begeisterung. „Heinrich, große Neuigkeiten! Der Handel blüht, und die ersten Zölle, die wir erheben, beginnen uns zu bereichern!“
Ein Lächeln breitete sich auf Heinrichs Gesicht aus. All die Mühe und Sorge, all die Erinnerungen an die Flucht der Markgrafen und die Entstehung der Stadt schienen in diesem Moment auf einen Punkt zuzulaufen. Spandow hatte sich endlich zu dem Ort entwickelt, den er sich immer gewünscht hatte – einen Zufluchtsort und ein Zentrum des Wohlstands.
Heinrich wandte seinen Blick wieder auf die Straßen vor dem Fenster. Ja, die Schatten der Vergangenheit würden immer bestehen bleiben, aber aus ihnen war ein unschätzbares Erbe erwachsen. Der Kampf hatte der Stadt Leben geschenkt, und während er an den Markgrafen und den Wortlaut der Urkunde dachte, wusste er: Spandow war bereit, sein eigener Weg zu gehen – und er würde immer daran glauben, dass aus Flucht altbewährte Antworten und neue Möglichkeiten geboren werden konnten.
Heinrich von Stendel oder Stendal, denn die Stadt Stendal wurde auch häufiger mit dem Namen ‚Stendel‘ belegt, war wahrscheinlich vom Markgrafen auf Lebenszeit zum Schulzen bestimmt. Das ging offenbar noch einige Jahrzehnte so weiter, auch wenn uns die dann bestimmten Namen nicht bekannt sind. Urkundenabschriften anderer Orte können hier vielleicht noch helfen.
Markgraf Johann starb 1317 vor dem Schloss, wahrscheinlich infolge einer Vergiftung. Er war der letzte Spross der ottonischen Linie und wurde im Kloster Lehnin beigesetzt.
Markgraf Waldemar sicherte den Bürgern Spandows den Gerichtsstand vor dem Stadtschulzen zu, sie mussten damit nicht mehr vor auswärtige Gerichte ziehen.
Am 30.11. (Andreastag) wurde die Bäckergilde neu begründet, die sich wegen einer Teuerung aufgelöst hatte. In einem ‚Beckerbrief‘ wurde vom Rat geboten, nur noch die Hälfte der Semmelware zu backen. Im Kloster wurde Johannes von Meersfeld erwähnt, ebenso 1322 und 1330.
Die Stadtordnung brachte später das System der ‚proconsules‘. Von der Zeit an werden die Bürgermeister von Spandow offenbar gezählt, denn der nächste Bürgermeister wird als der erste aufgeführt – ein im Stadtrat gewählter Vertreter der Stadt.
Die Bürgermeister von Spandow / Spandau
1410
Hans Velkener
1410
Vincentius Zabels
1424-27
Clawes Stenze
1427-34
Peter Hellembrecht
1429-36
Jacob Seger
1432
Vincentius Zabels
1432-34
Petrus Michels
1442
Jacob Voß
1442-45
Martinus Wartenberg
1442-74
Johann Muzeltyn
1467-71
Matthias Hoenow
1468-71
Jacob Farneholt
1468-76
Severinus Kyen
1473-77
Clawes Hoenow
1473-87
Joachim Kremer
1491-1521
Sebastian Rücker
1492
Thomas Mewes
1492-98
Matthias Wartenberg
1506-10
Peter Rudeniz
1506-11
Jacob Daniel
1506-18
Borchard Markert
1512-22
Peter Schroeder
1513-41
Jürgen Wartenberg
1519-26
Michael Walter
1523-29
Hans Wahsze
1523-45
Andreas Koch
1527-41
Jürgen Gütten
1529-47
Urban Ritter
1442-53
Matthias Wilcke
1543-46
Theodoricus Drescher
1546-64
Peter Lonies
1546-75
Joachim Kramer
1548-66
Barthol. Wittstock
1554-73
Thomas Tempelhoff
1564-78
Bartholomäus Bier
1568
Andreas Forbiger
1569-93
Andreas Marzahn
1570-87
Johann Engel
1575-81
George Schüler
1579-97
Barthol. Wendeler
1588
Matthias Rostock
1583-1624
Balthasar Westphal
1591-1611
Joachim Moys
1594-95
Martin Koehler
1594-98
Benedictus Dusicke
1596-1613
Johann Müller
1612
Joachim Bier
1613-18
Günter Eltiste
1614-15
Johann Schmidt
1616-29
Johann Blume
1618-39
Joachim Frize
1625-36
Johann Walter
1630-53
Petrus Barthold
1637-57
Christian Ungnad
1640-57
Dietrich Albrecht
1654-83
David Dilschmann
1658-64
Emanuel Vulpinus
1658-76
Andreas Fromm(e)
1675-76
George Neumeister d.Ä.
1677-91
George Erasmi
1678-93
Andreas Leporinus
1685-1703
George Neumeister d.J.
1692-93
Johann Seb. Zü(t)zel
1703-05
Ernst G. Cautius
1705-21
George A. Neumeister
1714-32
Franz. E. Cautius
1733-55
Christian Lindner
1755-1808
Gottlieb B. Lemcke
1809-15
Johann Chr. Kattfuß
1815-21
Christian Daberkow
1821-38
Johann Ferd. Froehner
1839-50
Eduard Zimmermann
1848-51
Gustav Sprengel
1851-69
Adalbert Roedelius
1869-72
Carl Bollmann (OB)
1873-82
Richard Gardemin
1833-85
Adam Betcke
1886-1919
Friedrich Koeltze (OB)
1895-1919 Paul Wolf (2.Bm)
1919-21
Dr. Kurt Woelck (OB)
1919 Ernst Stahl (2.Bm)
Hans Velkener und sein Stellvertreter
Die Bürgermeister von Spandow (1410)
Es war ein lauer Abend im Jahr 1415, als sich die beiden ersten Bürgermeister von Spandow, Hans Velkener und sein Stellvertreter Vincentius Zabels, in der kleinen, behaglichen Stube des Rathauses trafen. Der Lichtschein einer in der Ecke brennenden Lampe warf tanzende Schatten an die Wände, und der Duft von frisch gebackenem Brot drang durch das Fenster herein, das zum Karpfenteich hin geöffnet war. Es war ein entspannter Abend, der den beiden Männern die Gelegenheit gab, innezuhalten und über die schweren und wichtigen Monate nachzudenken, die hinter ihnen lagen.
Hans Velkener, ein stämmiger Mann mit einem dichten Bart und einer tiefen Stimme, war als starker Führer bekannt. Sein Gesicht war von tiefen Furchen durchzogen, die von Sorgen und Kämpfen zeugten. Vinzentius Zabels hingegen, der zierlichere der beiden, hatte den schüchternen Blick eines jungen Gelehrten. Eher in den Hintergrund gedrängt, war er oftmals der ruhende Pol, der Ausbalancierende zwischen Hans' Leidenschaft und dem Pragmatismus der Stadt.
„Wir haben viel durchgemacht, mein Freund“, begann Hans und ließ seinen Blick durch die kleinen Holzbalken der Decke schweifen. „Die letzten Monate waren stürmisch. Der Konflikt mit den Quitzows hat Spandow in den Abgrund blicken lassen. Wenn ich nur daran denke, wie wir Anfang des Jahres für den Kurfürsten und die Verteidigung der Stadt eintraten …“
Vincentius nickte, seine Augen glänzten im Licht der Lampe. „Ja, die Belagerungen, die Raubzüge … sie wollten unsere Stadt erdrücken, aber die Unterstützung des Kurfürsten gab uns die Kraft, standhaft zu bleiben. Ich erinnere mich noch an die Ständeversammlung, als Friedrich I. über die Untaten von Dietrich von Quitzow sprach. Sein Zorn war greifbar, und wir alle fühlten, dass der Geist der Gemeinschaft uns tragen würde.“
„Es war ein aufrüttelnder Moment“, stimmte Hans zu. „Aber es ist eine Schande, dass die Herrschaft von Dietrich sich immer noch auf unser Land erstreckt. Sein Einfluss in Pommern könnte Spandow und die Neumark stark gefährden, insbesondere jetzt, da er Unterstützung gefunden hat. Aber wir dürfen nicht aufgeben. Wir müssen dafür sorgen, dass der Geist des Widerstands in unseren Bürgern weiterlebt.“
„Wir haben den Menschen gezeigt, dass sie nicht allein sind“, sagte Vincentius leise. „Unsere Stadt mag klein sein, aber unsere Bündnisse sind stark. Ich denke an das Heilig-Geist-Hospital und die Unterstützung, die wir mit ihnen erreicht haben. Der Tausch von Brot und Wein sicherte nicht nur unsere Bedürfnisse, sondern auch einen gemeinsamen Glauben, der uns in schwierigen Zeiten stärkt.“
Hans schüttelte den Kopf, seine Augen leuchteten. „Ja, die Abmachung war weitsichtig. Es ist wichtig, dass wir in uns dieser unruhigen Zeit Nahrungsmittel sichern können. Aber ich habe auch gelernt, dass wir den Juden in der Neumark danken sollten, für ihren Mut im Handel und ihre Unterstützung. Das Schutzprivileg, das Kurfürst Friedrich I. für sie erneuert hat, ist von unschätzbarem Wert für die Wirtschaft unserer Stadt. Sie sind Teil unserer Gemeinschaft.“
„Eine Gemeinschaft, die von Vielfalt lebt“, fügte Vincentius hinzu. „Wir alle, unabhängig von Herkunft oder Glauben, kämpfen für Spandow und seine Zukunft. Es sind nicht nur die feierlichen Reden, die uns vereinen, sondern der tägliche Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung unserer Nachbarn.“
Die beiden Männer schwiegen einen Moment, während sie nachdachten. Im hellen Schein der Lampe konnte man die Wärme der Gemeinschaft fast spüren, die durch die Mauern der Stadt strömte. Plötzlich durchbrach ein ferner Klang das stille Beisammensein – das Lachen von Kindern und das Geschrei der Händler, gefolgt von den ehrfurchtsvollen Klängen der Glocken.
„Wir haben etwas Großartiges erreicht, Vincentius“, murmelte Hans. „Was wir in diesen Jahren für Spandow getan haben, wird in den Annalen der Stadt verzeichnet bleiben. Wir haben mehr getan als nur die Ämter verwalten – wir haben das Herz und die Seele unserer Stadt gefestigt.“
Vincentius lächelte, ein Gefühl der Zufriedenheit erfüllte ihn. „Und dafür werden unsere Nachkommen uns danken. Lass uns dafür sorgen, dass wir auch in Zukunft das Licht der Gerechtigkeit und des Friedens wahren, egal wie stürmisch die Zeiten auch werden mögen.“
Mit diesen Worten erhoben sich die beiden Männer und blickten zum Fenster hinaus, wo die letzten Strahlen der untergehenden Sonne das Wasser des Teiches in einem goldenen Glanz erstrahlen ließen. In diesen Augenblicken fühlten sie sich verbunden, nicht nur als Bürgermeister, sondern als die bewahrenden Wächter einer Stadt, die dennoch weiter blühen sollte, ganz gleich, wie stürmisch die Zeiten sein mochten.
Clawes Stenze (1424-27)
Die Abendsonne schickte ihre Strahlen über die Dächer von Spandow. Clawes Stenze, der Bürgermeister der Stadt, saß auf der Veranda seines schlichten, aber einladenden Hauses und blickte nachdenklich in die ferne Landschaft. Seinen Blick streifte die Silhouette der alten Burg, die im Abendlicht schimmerte und ihm Erinnerungen an seine Amtszeit weckte. Es waren turbulente Jahre gewesen, aber auch Jahre des Wandels und der Hoffnung.
Wenn er an die ersten Tage seiner Amtszeit zurückdachte, fühlte er das kribbelnde Gefühl des Neuanfangs. Als er 1424 gewählt wurde, war die Stadt voller Herausforderungen. Armut und Unruhen prägten das Leben der Bewohner, und es galt, das Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen. Clawes wusste, dass er einen klaren Kurs setzen musste, um die Geschicke Spandows zu lenken. Seine ersten Handlungen waren geprägt von Entschlossenheit. Der Handel musste gefördert werden, und dafür waren neue Ideen gefragt.
Besonders hallte in seinen Ohren das Gespräch mit den Priestern Hynrich Schulte und Everhard Everlynn wieder, die den Altar Mariä und Johannes Baptistae verkauft hatten. Der Gedanke, dass die heiligen Reliquien der Stadt und ihrer Gläubigen nicht länger die erhofften Zinsen und Erträge erwirtschafteten, beschäftigte ihn. Er hatte den Verkauf genehmigt und war stolz darauf, die Weitsicht besessen zu haben, die Altaranlage in die Hände von Hans Bevern zu legen. „Manchmal“, dachte Clawes, „muss man für das Wohl der Gemeinschaft unorthodoxe Entscheidungen treffen.“
In seinen Gedanken fiel sein Blick auf den Marktplatz, wo er viele lange Nächte verbracht hatte, um mit den Bürgern zu reden, ihre Sorgen zu hören und an einer Verbesserung ihrer Lebensumstände zu arbeiten. Er dachte an die Bösen, die oft in den Schatten der Stadt lauerten, aber auch an die Menschen, die sich mit Fleiß und Hingabe um die Geschäfte kümmerten. „Die Stärke einer Stadt liegt in ihrer Gemeinschaft“, hatte er oft gesagt. „Gemeinsam überstehen wir selbst die stürmischsten Zeiten.“
Die Zustimmung des Bischofs, des Rates der Stadt und des Propstes Johann Ravenstein zu den getroffenen Entscheidungen brachte ihm Gewissheit. Er wusste, dass man in der Politik manchmal Alliierte brauchte, um das Allgemeinwohl voranzutreiben. Spandow war kein Ort für Einzelgänger; die Geschichte lehrte ihn das jeden Tag aufs Neue.
Tag für Tag wurde ihm klarer, welches Erbe er hinterlassen wollte – eine Stadt, die nicht nur überlebte, sondern auch gedieh. Als er in die Gesichter der Menschen blickte, die er als Bürgermeister durch die Höhen und Tiefen geführt hatte, fühlte er den Stolz und die Dankbarkeit, die ihn überströmten.
„Wenn ich eines gelernt habe, dann das: Gemeinde ist mehr als nur ein Wort. Es ist eine Verpflichtung“, murmelte Clawes und verlor sich in seinen Gedanken. Die Freude, das Lachen und die kleinen Siege der Bürger schenkten ihm die Kraft, oft auch gegen die Widerstände der Zeit anzukämpfen.
Als die Sonne am Horizont versank, füllte sich der Himmel mit satten Rottönen, die die Stadt in ein warmes Licht tauchten. Clawes wusste, dass es an der Zeit war, den Stab der Führung weiterzugeben. Die zukünftigen Bürgermeister würden sicher mit anderen Herausforderungen konfrontiert sein, doch er haderte nicht – er war gewappnet für alles, was kommen mochte. Denn das Herz Spandows schlägt weiter, und er hatte einen Teil dazu beigetragen, dass es lebendig blieb.
Mit einem letzten Blick auf die Stadt, die ihm ans Herz gewachsen war, stellte er sich vor, wie er in vielen Jahren über diese schweren und schönen Zeiten erzählen würde – als ein Bürgermeister, der aus dem Schatten trat und auf das Licht der Gemeinschaft zurückblickte, das nie erlöschen sollte.
Peter Hellembrecht (1427-34)
Der Abendhimmel über Spandow war in ein warmes Orange getaucht, während Peter Hellembrecht, der ehemalige Bürgermeister von Spandow, auf der Terrasse seines bescheidenen Hauses saß. Es war nun das Jahr 1434, und die Erinnerungen an seine Amtszeit von 1427 bis 1434 strömten wie ein sanfter Fluss durch seinen Geist. 1427 war er zum ersten Mal als 1. Bürgermeister gewählt worden. Peter war immer noch erfüllt von den Herausforderungen und den Entscheidungen, die er treffen musste, sowie den Veränderungen, die er in seiner Stadt bewirkt hatte.
Er dachte an die ersten Monate seiner Amtszeit, als er eine Stadt vorfand, die sowohl voller Möglichkeiten als auch voller Widrigkeiten war. Die Kämmerei-Rechnungen erinnerten an die Einnahmen aus dem Hurenhaus, das in den Quartalen von Michaelis bis Weihnachten florierte. „Man muss die Realität akzeptieren, wie sie ist“, dachte er, „und das Beste daraus machen.“
Die Kasse musste gefüllt werden, und so notierte sich Peter gewissenhaft die Einnahmen aus den Jahrmärkten, auch an Heiligabend, lachte über die harten Zeiten, als der Umgang mit den Zinszahlungen zur täglichen Routine wurde. „Die Gewerbetreibenden müssen ihren Beitrag leisten, damit die Stadt prosperiert“, murmelte er und erinnerte sich an die zahlreichen Gespräche mit den Schneidermeistern und Barbieren, die ihm stets zur Seite gestanden hatten. Erfreulich war auch der Bau des ‚Kop-Hus‘ am Rande des Marktes. Viele Städte hatten ein Kaufhaus, jetzt auch Spandow
Ein kurzes Zucken seiner Mundwinkel erinnerte ihn an das Unglück des Brands in der Heide, das Spandow heimgesucht hatte. Der Gedanke an die Löschkosten ließ ihn innerlich zusammenzucken. „Feuer kann Freund und Feind zugleich sein“, dachte Peter und schloss die Augen. Es waren unruhige Nächte gewesen, in denen er zwischen Betroffenen und Feuerwehrleuten vermitteln musste.
Sein Geist streifte die Heerfahrten gegen die Hussiten, die er organisiert hatte. Matern Wartenberg, der Hauptmann, hatte unermüdlich und mutig gekämpft, aber die Schlachten waren oft hart und ohne Gewissheit. „Was ist das für ein Leben, in dem wir gegen Brüder in einer anderen Überzeugung kämpfen?“ fragte sich Peter frustriert, auch wenn seine Augen für die Zukunft ihrer Stadt leuchteten. „Müssten wir nicht miteinander für ein besseres Spandow statt gegeneinander kämpfen?“
Im Jahr 1431 war der Besuch des Kurfürsten Teil seiner Amtszeit gewesen, wenn er auch nur im Kreis der Erwählten und nicht 1. Bürgermeister war. Dann folgte die Kirchhofweihe durch den Bischof. Diese Tage waren festlich, aber auch anstrengend gewesen – die Kosten für das Festmahl hatten die Stadtkasse stark belastet. Erinnerungen an das gewaltige Festmahl mit Heringen und Bier waren in seinen Gedanken noch lebendig. „Essen und Trinken vereinen die Seelen“, dachte Peter nachdenklich, auch wenn sein Herz oft schwer war unter der Last der Verantwortung.
Bald würde die Stadt eine neue Ära beginnen mit einem neuen Bürgermeister – Vincentius - und Peter konnte sich nur wünschen, dass er mit der gleichen Leidenschaft und Hingabe regieren würde, wie er es versucht hatte. Die Brücke nach Stresow war ein markantes Bauwerk, das unter seiner Aufsicht entstanden war, ebenso wie das neue Rathaus am Markt, das mehr als nur ein Gebäude sein sollte – es war ein Symbol für Fortschritt und Zusammenhalt.
Er dachte an die ständigen Schwierigkeiten mit den Juden, die ihre Verstorbenen nach Spandow überführten, und an die Gebühren, die die Stadt dafür erhob. „Sind wir nicht alle Menschen, gleich, wen wir verehren?“ fragte er sich, während sein Blick in die Ferne schweifte. In diesen Zeiten wurden Gesetze und Regeln oft als Fesseln empfunden, die die Vielfalt der Menschen in der Stadt unterdrückten.
Er sah die Kinder, die einst lebhaft zur Schule liefen, deren Zuwachs durch den Bau des Schulhauses sichergestellt war. Diese Generation war die Hoffnung für die Zukunft Spandows. Ein Lächeln umspielte seine Lippen – „Die Weichen sind gelegt, wenn wir gute Bildung fördern.“ Peter war stolz darauf, dass er zur Schaffung eines besseren Schulsystems beigetragen hatte.
Sein Blick fiel auf die späten Sonnenstrahlen, die durch die Bäume schienen. „Möge das Licht stets die Dunkelheit des Unwissens vertreiben“, flüsterte er und erinnerte sich an seine Zeit, in der er stets nach Wegen gesucht hatte, das Licht in den Herzen der Menschen in Spandow zu entflammen.
Im Jahr 1434 schied Peter aus dem Kreis der Erlauchten aus und übergab die Verantwortung. „Es war nicht immer leicht, aber jedes Fest war eine Freude und jede Dunkelheit eine Lektion“, dachte er. Er hatte das Beste für seine Stadt getan, und nun war es an der Zeit, dass andere den Weg fortsetzten.
Während die Welt um ihn herum immer weiterdrehte, war Peter Hellembrecht stolz auf seine Zeit als Bürgermeister und wusste, dass das Erbe, das er hinterließ, fest in den Grundmauern der Stadt verankert war. In der Stille der Nacht war er glücklich, im Herzen Spandows, der Stadt, die ihm so viel bedeutete.
Jacob Seger (1429-36)
Jacob Seger, langjährig im Team der Bürgermeister von Spandow, saß an einem sonnigen Nachmittag in seinem kleinen Garten, umgeben von den vertrauten Klängen der Stadt. Der Duft von frischem Heu und fernem Braten erfüllte die Luft, während die Stimmen spielender Kinder im Hintergrund sanft ausklangen. Es war das Jahr 1436, und Jacob war nun im Nachhinein längst im Ruhestand, doch die Erinnerungen an seine Amtszeit von 1429 bis 1436 waren noch lebhaft in seinem Geist. 1429 war er das erste Mal 1. Bürgermeister.
Mit einem nachdenklichen Blick auf die alte Stresow-Brücke, die er während seiner Amtszeit hat fertigstellen lassen, begann er zu reflektieren. „Wie viele Geschichten könnten diese Steine erzählen?“, fragte er sich leise. Der Bau dieser Brücke war nicht einfach gewesen. Unzählige Gespräche mit den Handwerkern, die diese Steine schichtweise übereinandersetzen mussten, hatten ihn zu der Überzeugung geführt, dass eine gute Brücke in Zeiten des Krieges nicht nur Verbindungen schafft, sondern auch Sicherheit bietet.
Die Zeit, in der die Hussiten über das Land zogen, raubte es ihm oft den Schlaf. Heftige Konflikte waren angesagt, und unter der Führung von Hauptmann Matern Wartenberg hatte er eine Heerfahrt orchestriert, um das Stadtgebiet zu schützen. „Ein Bürgermeister mit Verantwortung muss auch Truppen führen“, dachte Jacob mit einem Schaudern. Er erinnerte sich an die Versammlungen, die von Sorgen, aber auch von Hoffnungen erfüllt waren. Das Gefühl, in solch schwierigen Zeiten Verantwortung zu tragen, hatte ihm oft das Herz schwergemacht. Er war damals froh, dass Peter Hellembrecht ihm zur Seite gestanden hat.
Eine Welle der Erleichterung erfüllte ihn, als er an die zwei Jahrmärkte und das Fest zu Heiligabend dachte, die dem städtischen Haushalt einige wohlverdiente Einnahmen beschert hatten. Die Aufregung des Marktgeschehens, der Geruch von frisch gebackenem Brot und die freudigen Gesichter der Menschen waren ein Lichtblick in dunklen Zeiten. „Wenn die Menschen zusammenkommen, geschieht etwas Magisches“, reflektierte er, während er sich an die großen Festessen für die Ratsherren erinnerte, die stets voller Fröhlichkeit und Scherz gewesen waren, auch wenn die Ausgaben für Matjes und Stockfisch manchmal eine Herausforderung darstellten.
Besonders in Erinnerung blieb ihm der Besuch des Kurfürsten Friedrich I. und seines Sohnes in Spandow. „Nein, ich sollte sie nicht fürchten, sondern als Chance sehen“, hatte er sich damals gesagt und die Stadt darauf vorbereitet, den hohen Herrschaften ein Fest zu bereiten, das sie nicht so schnell vergessen würden. Der Anblick des Kurfürsten, der mit seinen Gefolgen durch die Straßen schreitet, war ein Moment des Stolzes. Spandow hatte Geschichte geschrieben.
Doch musste auch gestraft werden, was gestraft gehörte. Der Vorfall mit Peter Otten, der seine Frau verwundet hatte, hatte ihn tief berührt. Die Ordnung aufrechtzuerhalten war kein leichtes Unterfangen. „Gerechtigkeit ist das Fundament einer jeden Gesellschaft“, murmelte er, während er darüber nachdachte, dass oft Dutzende von Schock Groschen für Blutgeld und Strafen gezahlt wurden – die ständige Erinnerung daran, dass das menschliche Wesen fragil war und sich auf das Wesentliche konzentrieren musste.
Seine Gedanken wanderten weiter zur Kämmerei, in der die Zinsregister geführt wurden. Die Juden aus Berlin, die ihre Verstorbenen nach Spandow überführten, trugen zur Vielfalt der Stadt bei, aber die Verwaltung war oft eine Herausforderung. „Manchmal war es wie ein Drahtseilakt“, gestand Jacob sich ein, „aber ich wusste, dass unser gemeinsames Ziel das Wohl aller war.“
Schließlich kam der Moment, als er die Wände des neuen Rathauses betrachtete, das gerade in der Nähe des Marktes errichtet wurde. „Ein neues Kapitel für Spandow“, dachte er stolz. Er hatte gute Entscheidungen getroffen oder daran mitgewirkt und war froh, dass diese Entscheidungen auch von den Ratsherren unterstützt wurden. Der Einsatz der „consules“ und ihrer Spenden an die Kirche zeigte ihm, dass Vertrauen in die Führung nicht unbegründet, sondern gut gefüllt war.
Während die Sonne hinter den Bäumen verschwand und die Farben des Himmels in sanften Rosa- und Lilatönen leuchteten, fühlte Jacob die Zufriedenheit in seinem Herzen. Er wusste, dass seine Zeit als Bürgermeister nicht immer einfach gewesen war, aber die geleistete Arbeit und die gesammelten Erfahrungen lehrten ihn vor allem eines: „Die Stärke einer Stadt liegt in ihrer Gemeinschaft.“ Spandow hatte sich gewandelt und würde weiterwachsen, und auch wenn er nicht mehr der aktive Bürgermeister war, so erschuf die Liebe zu seiner Stadt einen bleibenden Raum in seinem Herzen.
„Möge der Geist von Spandow immer in einem Licht erstrahlen“, flüsterte er, bevor die Dunkelheit des Abends ihn umhüllte. Die Erinnerungen an seine Zeit als Bürgermeister waren lebendig, und er war stolz auf das, was sie gemeinsam erreicht hatten.
Vincentius Zabels (1410-32)
Die Narben der Erinnerung
Vincentius Zabels saß allein in seinem spärlich beleuchteten Büro, während der Lichtschein der sinkenden Sonne die Wände in sanftes Gold tauchte. Er blickte aus dem Fenster auf die geschäftigen Straßen Spandows. Die Geräusche des Marktes drangen zu ihm durch die offenstehenden Fenster, das Lachen der Kinder und das Rufen der Händler, die ihre Waren anpriesen, hallten in seinen Ohren wider. Er war jetzt ein älterer Mann und der Bürgermeister dieser Stadt, doch in seinen Gedanken war er oft ein Jüngling im Dienst der proconsules, der Ratsherren, denen er in seinen frühen Jahren diente.
Er erinnerte sich gut an die Anfänge seiner Karriere. Die Jahre, die er mit den anderen proconsules verbracht hatte, waren von Herausforderungen und Triumphen geprägt. Es war eine Zeit des Wandels, geprägt von der ständigen Bedrohung durch die Raubritter und den politischen Spannungen innerhalb des Landes. Der alte Kurfürst Friedrich war ein strenger Herrscher, und seine Forderungen waren oft drakonisch. Vincentius hatte beobachtet, wie die Ständeversammlung in Berlin auf die Bedrohungen reagierte und mit fester Stimme entschied.
„Euch allen ist bekannt, dass Dietrich von Quitzow mein und meines Landes der Märker Feind war und ist…“ Die Worte Friedrichs hallten noch immer in Vincents Ohr, als wäre es gestern gewesen. Der Prozesstag auf dem Platz der Spandower Burg war ein Wendepunkt gewesen, und Vincentius hatte sich mit einem Schaudern an die Verhandlung erinnert, als Werner von Holzendorf vor den versammelten Herren zu Kreuze kriechen musste.
Die Verantwortung auf seinen Schultern war anfangs überwältigend gewesen. Er hatte seine Stimme oft gegen die Ungerechtigkeiten erhoben, auch wenn das bedeutete, sich gegen mächtige Männer zu stellen. Es war ein gefährlicher Tanz zwischen Loyalität und dem Streben nach Gerechtigkeit. Jede Entscheidung hatte Auswirkungen auf die Stadt und ihre Bürger, und oft hatte er in schlaflosen Nächten über den richtigen Weg nachgedacht. Gut, dass er damals den starken Charakter Bürgermeister Hans Velkener an der Seite hatte
Wie oft hatte er sich im Rathaus mit den anderen Ratsherren versammelt, um die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten, die Lebensmittelvorräte zu verwalten und die Sicherheit der Straßen zu gewährleisten! Erinnerungen kamen zurück an die Kämmerei-Rechnungen, die er akribisch überprüfte, an die Ausgaben für die Bürger und die Sorge um die Menschen, die im Hurenhaus lebten. Ihm war stets bewusst, dass das Wohl der Stadt von unterschiedlichen Interessen abhing.
Vincentius dachte an die Jahrmärkte, die er organisiert hatte, und die fröhlichen Gesichter der Menschen, als sie zusammenkamen, um zu feiern. Aber er konnte die Schatten nicht ignorieren, die die Stadt immer wieder heimsuchten. Der Aufstand der Hussiten war ein düsterer Zeitpunkt gewesen, und er erinnerte sich an die „Heerfahrten“, die organisiert worden waren, um sie zu bekämpfen. Er hatte den Hauptmann Matern Wartenberg gebeten, die Bürger in den Kampf zu führen, und das Bild der tapferen Männer – und auch der Feigheit mancher – blieb ihm unvergesslich.
Eines nachts, als er von einem dieser Aufträge zurückkehrte, hatte er die Gefühle des Zweifels geschmeckt. Die Dunkelheit mancher Menschen schien die Straßen Spandows mehr zu ergreifen, als die Dunkelheit der Nacht. Der Hauptmann hatte ihm berichtet, wie deren Rüstungen in der Schlacht glänzten, doch das Bild vom Verlust und von Gefallenen trübte seine Gedanken.
„Haben wir die richtige Entscheidung getroffen?“ murmelte er oft leise für sich allein, wenn die Kühle der Abendluft durch die Stadt strich. Doch er wusste, dass der Dienst an der Gemeinschaft auch ein Dienst an der Wahrheit war, und es war sein Weg.
Vincentius seufzte tief und winkte den Gedanken der Vergangenheit. Über die Jahre war er gewachsen – nicht nur als Politiker, sondern auch als Mensch. Die Verantwortung hatte ihm Narben und Weisheit verliehen, und es gab Momente, in denen er in der Stille des Abends den Bürgern zusah und dankbar war für die Stärke, die sie ihm gegeben hatten. Er wusste um die Bedeutung seiner Entscheidungen und Licht und Schatten, die sie über die Stadt brachten.
In diesem Moment entschloss sich Vincentius, die Erinnerung an seine Zeit im Dienst der proconsules mit den folgenden Generationen zu teilen. Er würde seine Erfahrungen aufschreiben, um zu zeigen, dass jede Entscheidung, die aus Gutem und Bösem resultierte, ein Teil des ständigen Wandels war. Die Geschichte sollte nicht vergessen werden, sie sollte als Lektion dienen – sowohl für die gegenwärtigen als auch für die zukünftigen Führer Spandows.
Als die Sonne schließlich hinter dem Horizont verschwand und das Zwielicht den Raum umhüllte, schloss er das Fenster. Mit neuem Mut griff er nach der Feder, um die Erlebnisse und Lehren eines Lebens in den Dienst seiner Stadt zu verewigen. So mochte die Geschichte von Vincentius Zabels und der proconsules für die kommenden Generationen einen Lichtstrahl der Weisheit und des Mutes bieten.
Petrus Michels (1432-34)
Der Erinnerungsfaden
Petrus Michels kniete auf dem kalten Steinfußboden seines Büros in Spandow, während das Licht der untergehenden Sonne durch das einzige Fenster des Raumes fiel. Es gab Tage, an denen er den Lärm der Stadt vermisste – das fröhliche Lachen der Kinder auf den Straßen, das Rufen der Händler, die ihre Waren anpriesen, und die tiefen Gespräche mit den Mitgliedern des Rates. Doch heute war es still, und seine Gedanken wanderten zurück zu den Tagen, als er als Bürgermeister das Schicksal seiner Stadt prägte.
Es war das Jahr 1432, als er zum 2. Bürgermeister gewählt worden war. Ein ehrwürdiges Amt, das Respekt und Verantwortung mit sich brachte. Er erinnerte sich an die feierliche Zeremonie, die in der Nikolaikirche abgehalten wurde. Die Ältesten hatten ihm feierlich das Zepter überreicht, und während der Zeremonie roch es nach frischem Brot und Wachs von den Kerzen, die in den Händen der Gläubigen glühten. „Du wirst die Stimme des Volkes sein“, hatten sie gesagt, „dein Handeln wird die Grundlagen dieser Stadt bestimmen.“
Petrus hatte sich oft gefragt, ob er dieser Bürde gewachsen war. Es war eine Zeit des Wandels, in der er bis 1434 im Amt war, noch spürbar. Mit den anderen Ratsherren hatte er gemeinsam am Tisch gesessen, beratschlagt und nach Lösungen für die Probleme gesucht, die die Stadt bedrängten.
Sein Erinnerungsfaden führte ihn zu den Kämmereirechnungen, die er durchforstet hatte. Es war bemerkenswert, dass die jüdischen Bürger aus Berlin ihre verstorbenen Angehörigen traditionell nach Spandow überführten. Die Gebühren, die am Tor bezahlt wurden, waren ein Spiegelbild der Stadtordnung und des Lebens. Petrus wusste, dass das Heidetor eine Verbindung zur jüdischen Gemeinschaft und eine Erinnerung an die Vielfalt war, die Spandow prägte.
Doch es gab auch Schwierigkeiten. Der Brand des Dorfes Staaken im Jahr 1433 war eine weitere schmerzhafte Erinnerung. Als er von den Flammen hörte, die das Dorf verzehrten, fühlte er eine Welle von Empathie für die, die ihre Heimat verloren hatten. Werner Broyle, der als Urheber des Brandes galt, wurde zur Rechenschaft gezogen. Sechs Schock Geld wurden ihm auferlegt – ein schrecklicher Preis für das, was er angerichtet hatte.
Die Menschen litten, und er erinnerte sich gut daran, wie er versucht hatte, Trost zu spenden. „Wir müssen die Gemeinde unterstützen, die Bedürfnisse der Menschen müssen an erster Stelle stehen“, hatte er gesagt, während sich die Familie um ihn versammelte, um über die Wiederaufbaupläne zu diskutieren. Er wusste, dass die nicht nur materiell, sondern auch emotional zu heilen waren.
Vincentius ertappte sich dabei, wie er über die Walk-Mühle an das Tor dachte, was er hatte bauen lassen. Infrastruktur war wichtig, um den Lebensunterhalt der Bürger zu sichern. Die Schule, die er hatte decken lassen, war ein Zeichen der Hoffnung und des Fortschritts – ein Ort, an dem die nächste Generation lernen und wachsen konnte. Aber die Schatten blieben.
Er dachte an den Abbruch des alten Kophus, des Kaufhauses, und den Bau eines neuen Rathauses am Markt. Es war ein symbolischer Akt, der den Glauben an die Entwicklung der Stadt verkörperte. Ein neues Rathaus, das die Menschen zusammenbringen und ein Ort der Begegnung sein würde. Doch die Missgunst gegenüber den jüdischen Kreditgebern blieb, und er spürte das Unbehagen, das damit verbunden war. Die Stadt war gespalten durch Vorurteile und Misstrauen, und er hatte oft zwischen den Fraktionen vermittelt.
„Die Geldleihe ist ein schmaler Grat“, murmelte Petrus leise zu sich selbst. „Wie kann ich das Vertrauen der Menschen gewinnen und zugleich die wirtschaftlichen Interessen unserer Stadt wahren?“ Er dachte an die christlichen Kreditgeber, die in den letzten Jahren die großen Summen vergaben und wie die jüdischen Gläubiger nur noch für kleine Kredite wahrgenommen wurden – ein Umstand, der ihm nie in den Sinn gekommen war, dass solche Vorurteile das Grundgerüst einer Gemeinschaft gefährden könnten.
Die Gedanken an seine Zeit als Bürgermeister riefen in ihm ein Gefühl von Nostalgie und Bedauern hervor. Es war eine turbulente Zeit, die ihn geformt und geprägt hatte. Er hatte die Menschen gekannt, ihre Träume und Sorgen. Oft waren sie an ihn herangetreten, in Zeiten der Not und des Zweifels, und er hatte sein Bestes gegeben, um ihnen zu helfen.
Als die Dunkelheit langsam hereinbrach, wischte Petrus sich eine Träne aus dem Gesicht. „Die Stadt ist mehr als nur Stein und Holz“, flüsterte er. „Sie lebt durch die Menschen, die in ihr wohnen.“ Er nahm einen tiefen Atemzug und stand entschlossen auf.
Er wusste, dass die Erinnerungen und Lektionen aus seiner Zeit als Bürgermeister nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für die Zukunft von Bedeutung waren. Mehr denn je verspürte er den Drang, seine Erfahrungen und Geschichten aufzuschreiben. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für die kommenden Generationen, die in Spandow leben würden.
So setzte er sich erneut an seinen Tisch und öffnete ein leeres Buch. Die Feder glitt über das Papier, während er die Geschichten von Mut, Herausforderungen und Hoffnung niederschrieb. In den Schatten der Erinnerung fand er das Licht, um die Vergangenheit mit der Zukunft zu verbinden.
Jacob Voß (1442)
Grabrede für Jacob Voß
Es war ein regnerischer Morgen im Spätherbst des Jahres 1442, als sich die Bürger von Spandow im kleinen Kirchensaal versammelten. Der Raum war schlicht, doch eine seltsame Lichtstimmung erfüllte ihn. Die bunten Fenster des Gotteshauses warfen sanfte Farben auf die Holzbankreihen, wo die Trauergemeinde Platz genommen hatte. In der Mitte des Raumes stand ein einfacher, hölzerner Sarg, bedeckt mit einem weißen Tuch, das in der schweren Luft wie ein leises Versprechen auflag.
Martinus Wartenberg, der erste Bürgermeister der Stadt, stieg auf die kleine Plattform und richtete seinen Blick auf die versammelten Männer und Frauen, die in ehrfürchtig gesenkten Häuptern jegliche Aufregung vermieden. Es war nicht die Zeit für Trauerbekundungen oder zur Diskussion. Es war die Zeit, anderen zu gedenken.
„Eure Ehren, liebe Bürger von Spandow,“ begann er, seine Stimme fest, jedoch von einer sanften Melancholie durchzogen. „Wir stehen hier versammelt, um einem der unseren die letzte Ehre zu erweisen: unserem geliebten zweiten Bürgermeister, Jacob Voß. Der Tod hat uns schmerzhaft überrascht und uns einen Mann genommen, der nicht nur ein einfacher Verwalter war, sondern ein Freund, ein Berater und ein unermüdlicher Kämpfer für das Wohl unserer Gemeinde.“
Er machte eine kurze Pause, während die Anwesenden flüsterten und den Schmerz in ihren Augen trotz ihrer Anstrengungen verbargen.
„Jacob, der vor wenigen Monaten erst in dieses Amt trat, hat unser Vertrauen gewonnen, nicht nur durch seine geschickten Verdienste, sondern auch durch sein großes Herz, das stets für die Belange der Bürger schlug. In seinen kurzen Monaten an der Spitze war sein Geist unermüdlich – er kämpfte für gerechte Steuern, sorgte für das Wohl der Armen und spendete den Bedürftigen Trost. Er war kein Mann der lauten Worte, sondern der leisen Taten. Jacob wusste, dass wahre Stärke in der Gemeinschaft liegt, und er führte uns mit sanftem, jedoch festem Willen.“
Martinus senkte den Kopf, und trieb seine Gedanken tiefer. „Wir, die wir hier stehen, sollen uns daran erinnern, dass er stets das Gemeinwohl über seine eigenen Bedürfnisse stellte. Manchmal wird gesagt, die Welt sei arm an wahren Helden, doch ich sage euch, verwahrt euch nicht vor den kleinen Taten der Helden, denn Jacob zog keine große Bühne für sich. Es sind die unermüdlichen Schritte im Hintergrund, die unsere Stadt voranbringen. Es war Jacob, der unzählige Male zu den Treffen des Landtags reiste, um uns zu vertreten. Er kämpfte für unsere Rechte und erwies sich als wahrer Wächter der Stadt Spandow.“
Seine Stimme wurde weicher, und ein Hauch von Traurigkeit schlich sich in der Stille um sie herum. „Heute stehen wir hier, nicht nur um zu trauern, sondern um Jacob zu danken. Möge der Herr ihm eine ehrende Ruhe schenken, denn sein Geist wird unter uns bleiben, solange wir solche bleiben, die die Prinzipien der Gerechtigkeit und des Miteinanders hochhalten.“
Die Menge, aus ihren Gedanken aufgeschreckt, neigte die Köpfe noch tiefer, die Emotionen lodernd in ihren Herzen wie ein schwindendes Feuer.
„Wir werden ihn in Ehren halten, indem wir die guten Taten fortsetzen, die er begonnen hat. Lasst uns nicht vergessen, dass jeder von uns, so klein oder groß er sein mag, einen Einfluss auf unsere Gemeinschaft hat. Lasst uns Jacobs Erbe bewahren und alle zu einem Teil dieser beständigen Reise ermutigen.“
Als Martinus die Worte sprach, ließ sich ein sanfter Wind durch die Kirchentür spüren, es war, als ob Jacob selbst durch diese Räume schritt und ihnen seinen Segen gab. Die Gesichter der Versammelten wurden heller, die Trauer wich dem beständigen Licht der Hoffnung.
„Leb wohl, Jacob Voß, dein Dienst für unsern Ort war nicht umsonst. Dein Geist wird uns leiten, solange wir in der Einheit zusammenstehen. Möge Gott dich annehmen und in den ewigen Frieden führen!“
Die Menge nahm sich dessen an, und während die letzten Klänge der Rede über die versammelten Köpfe schwebten, spürten sie alle das Gewissen, das sie an Jacobs Vermächtnis band und sich in jedem ihrer Herzen verankerte.
Martinus Wartenberg (1442-45)
Die Last des Amtes
Die Morgensonne schickte ihre sanften Strahlen über die schmalen Gassen von Spandow. Bürgermeister Martinus Wartenberg, ein Mann von mittlerer Statur, der die Weisheit und die Last seiner Amtszeit widerspiegelte, saß an einem hölzernen Tisch in seinem bescheidenen Amtszimmer. Über ihm hingen mehrere prachtvoll gestaltete Wappen, Erinnerungen an vergangene Stadtsitze und eine Zeit, in der der Einfluss der Stadt auf die Region noch nicht so wesentlich war.
Es war das Jahr 1445, und die Stadt hatte sich auf viele Prüfungen eingestellt. Blicke verloren sich in den eingemeißelten Holzvertäfelungen, während Martinus nachdachte. Wie oft hatte er an den Versammlungen mit Johann Muzeltyn, seinem treuen und klugen Berater, teilgenommen? Gemeinsam hatten sie Kriegszüge über das Land organisieren müssen, um die Ehre und die Sicherheit Spandows zu wahren. Zwei Heerfahrten waren im vergangenen Jahr nach Prenzlow und Lychen unternommen worden, und die Erinnerungen an die plätschernden Wellen und die aufgebrachten Bürger, die ihre Schilde erhoben, schlichen sich in seine Gedanken.
Martinus seufzte und ließ den Blick über ein offenbartes Manuskript wandern – die Rechnungen der Ausgaben für die Stadt. Ein berauschendes Fest an Reminiscere war geplant gewesen. Ein Fest, das die Bürger zusammenbringen sollte und auf dessen Kosten der Stadtrat ein opulentes Mahl organisiert hatte. Für ihn war es nicht nur ein Grund zum Feiern, sondern auch eine Pflicht, die Herzen seiner Bürger zu gewinnen und ihre Loyalität zu bestätigen.
„Wie sehr vermisse ich die klugen Ratschläge von Johann“, dachte er und erinnerte sich an die Treffen im Kloster Tilemann, wo sie oft in den Schatten der alten Bäume nach Lösungen für die drängenden Fragen suchten. Johann, ein Mann von überragendem Scharfsinn, hatte immer einen kühlen Kopf bewahrt, selbst als das Feuer der Heide sich unbarmherzig ausbreitete und der Rat den Bürgern auch noch eine Tonne Bier zahlte für ihre Tapferkeit beim Löschen. Es war eine neue Zeit angebrochen und die Herausforderungen wuchsen.
Es klopfte sanft an der Tür, und ein junger Bote trat ein. „Mein Herr, die Abrechnung für die Kolkstube ist bereit. Auch die Frauen haben nun ihren Platz gefunden – die Stadt verändert sich.“
Martinus nickte. „Ja, die Stadt verändert sich, mein Junge. Und wir müssen sicherstellen, dass diese Veränderungen zum Wohl aller Bürger geschehen.“ Er dachte an die Frauen, die nun auch die Bäder benutzen durften, und wie die Stadt in den letzten Jahren floriert hatte: Neue Wiesen wurden gekauft, die Zollstreitigkeiten mehrfach verhandelt und auch der Zuzug der Juden war ein Zeichen für das pulsierende Leben in Spandow geworden.
Doch es waren nicht nur Fortschritte, die ihn beschäftigten. Er kannte die Gesichter der Bürger, ihre Sorgen und Ängste – vom armen Fischer, der um sein Überleben kämpfte, bis hin zu den wohlhabenden Kaufleuten, die stets nach Einfluss strebten. „Wie können wir die Balance halten?“ fragte sich Martinus, während er das Manuskript zusammenfaltete und den Boten entließ.
Er nahm seine Feder und begann, eine Botschaft an die Bürgerschaft zu formulieren, in der er seine Gedanken über Gerechtigkeit und Gemeinschaft zusammenfasste. Es war an der Zeit, zusammenzuwachsen, den neuen Wandel als Chance zu begreifen. Und während er die letzten Zeilen schrieb, erinnerte er sich an Johann, der in seinen Reden oft die Worte „Einheit in Vielfalt“ prägte.
Martinus Wartenberg wusste, dass die Schatten der Vergangenheit stets eine Rolle in der Gestaltung der Zukunft spielen würden. Aber mit Einigkeit und dem Streben nach einem gerechten, respektvollen Miteinander würde Spandow überstehen, genauso wie es immer getan hatte – und er war fest entschlossen, weiter in diese Zukunft zu investieren.
Johann Muzeltyn (1442-74)
Die Chroniken des Bürgermeisters
Die Dämmerung senkte sich sanft über die Stadt Spandow, als Bürgermeister Johann Muzeltyn in seinem Amtszimmer saß, umgeben von den Schriften und Aufzeichnungen seines langen Lebens. Der Holzstuhl quietschte leise, als er sich zurücklehnte und die letzten Sonnenstrahlen durch das Fenster auf sich scheinen ließ. Gedanken an die vergangenen 32 Jahre glitten in seinen Sinn wie die Wellen des nahen Flusses, den er oft in den frühen Morgenstunden beobachtet hatte.
Über dreißig Jahre war er nun im Amt, und seine Hände waren von den Pflichten, die er so gewissenhaft erfüllt hatte, gezeichnet. Er erinnerte sich an die ersten Tage seiner Amtszeit, an den jungen und unerfahrenen Mann, der von den Bürgern nach dem plötzlichen Tod des Vorgängers gewählt worden war, um ihre Interessen zu vertreten. Damals war die Stadt noch von Spannungen geprägt – Konflikte, die sich zwischen den Fischen, den Zöllen und den angrenzenden Städten immer wieder entzündeten.
Im Jahr 1474, als der Frühling die Stadt Spandow mit seinen zarten Blüten und frischem Grün erweckte, fand sich Bürgermeister Johann Muzeltyn an einem ruhigen Nachmittag an seinem Schreibtisch wieder. Die Feder in seiner Hand zitterte leicht, als die Gedanken über die Jahre seiner Amtszeit durch seinen Kopf strömten wie der Fluss, der neben der Stadt floss.
Sein Blick wanderte hinaus zum Markt, wo die Menschen in geschäftigem Treiben mit ihren Waren handelten. Es war ein vertrauter Anblick, doch heute schien alles anders zu sein. Die Schatten der Vergangenheit hingen über ihm, die Freude und der Schmerz, die in seinen Erinnerungen verwoben waren.
Er dachte an die ersten Heerfahrten, die sie organisiert hatten, nach Prenzlau und Pasewalk. Die Berichte über die Kosten – 114 Schock und 6 Groschen, die für Pulver und Armbrüste ausgegeben worden waren – schienen ihn heute wie ein ferner Traum zu erreichen. Er erinnerte sich an die Pauken und Trompeten, die im Hintergrund ihrer Aufmärsche ertönten, und an die bedrückten Mienen der Bürger, die trotz des Kampfes hinter ihm standen.
„Ich betrachte den Markt und sehe die Gesichter, die mit mir alt geworden sind, die diesen Kämpfen gewachsen sind“, dachte er.
Ein tiefer Atemzug durchdrang seine Brust, als er sich an die Vertreibung der Juden in den vergangenen Jahren erinnerte. Die Schrecken, die sie erlitten hatten – die brutalen Schläge, der Verlust von Eigentum, die Armut, die sie gezwungen hatte, Spandow zu verlassen. Johann hatte immer für Gerechtigkeit gekämpft, doch die Umstände der Zeit waren unbarmherzig. Unsicher legte er seine Hand auf das antike Holz des Schreibtisches.
„Die Freiheit und die Gerechtigkeit sollten jedem zustehen“, murmelte er, „aber wie oft versagte ich in meinem Bestreben, diesen Grundsatz zu bewahren?“
Schlaglichtartig dachte er an die Ereignisse von 1448, als der Schiedsrichter Peter von der Groeben das Urteil über die Städte Berlin und Cölln fällte und die Bürger ihre Schulden begleichen mussten. Die 37.300 Gulden, die sie zahlen mussten, um den Frieden wiederherzustellen, waren gewaltig und bedeuteten einen großen Druck für die Bürger. Doch er hatte getan, was er musste – für das Wohl der Gemeinschaft. Diese Entscheidung nagte dennoch an ihm; die Verantwortung der Führung war ihm nicht leichtgefallen.
Die Zeit verging, während Johann in Erinnerungen schwelgte. Er dachte an die großen Feste wie Reminiscere und die Verbindung, die sie mit den Bürgern stärkte. Sie hatten Bier für all jene ausgegeben, die hundert Fässer für einen einzigen Festtag ausgegeben hatten. Es war ein Ausgelassensein, ein Tag, an dem sich die Sorgen des Alltags auflösten – doch im Hintergrund drängte sich stets die dunkle Wolke der Vermögensverteilung.
Das Licht des Nachmittagssonnens fiel auf seine alte Feder, und mit einem Seufzen stellte er fest, dass auch seinerseits Zeiten des Fortschritts und des Wohlstands in Spandow überwiegten. Sein Herz pochte vor Stolz, als er daran dachte, dass die zweite Schule 1439 eröffnet worden war, und wie er die Entwicklung des Wissens in der Stadt gefördert hatte. Für ihn war das wie ein Lichtstrahl in einer dunklen Nacht, wenn die Kinder das Erlernte ins Leben trugen und ein neues Spandow mit ihren Ideen und Träumen formten.
„Die Bildung“, murmelte er, „das ist das Erbe, das bleibt.“
Die Erinnerungen flossen weiter: Der Moment, als er am Klostertor die neue Mauer hatte reparieren lassen, und der Stolz auf die Moritzkirche, deren Altar auf seine Initiative hin gestiftet worden war und die durch die Sammlung der vielen Gläubigen lebendig wurde. Es waren diese kleinen Schritte, die ihn zu dem Mann gemacht hatten, der er heute war: ein Mann, der in der schweren Rolle des Stadtoberhauptes immer das Beste für sein Volk angestrebt hatte.
Schließlich schloss er die Augen und erinnerte sich an den Schwur, den er damals geleistet hatte – den Schwur, die Stadt zu schützen, für die Ordnung zu sorgen und immer die Stimmen der Bürger zu hören. Ein Schmunzeln erschien auf seinen Lippen. „Der Weg war lang“, dachte er, „aber ich bin dankbar.“