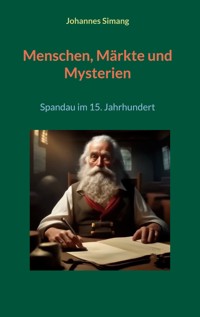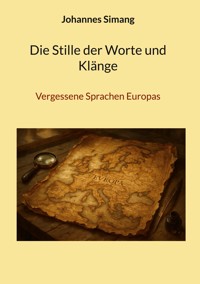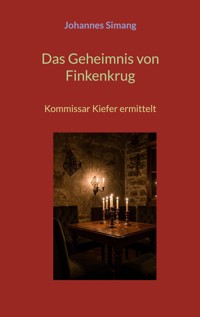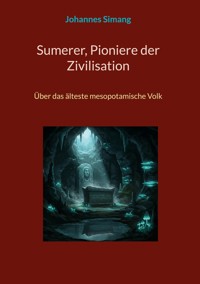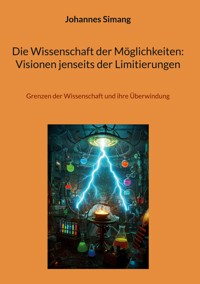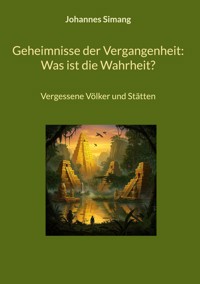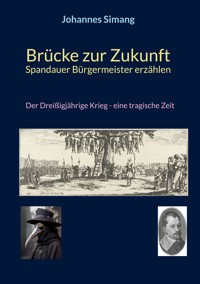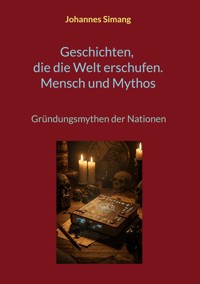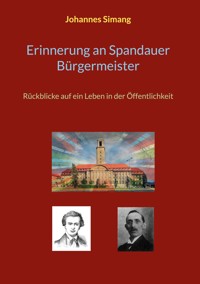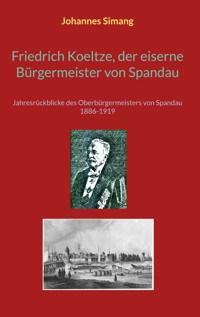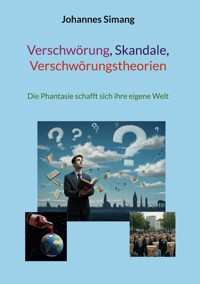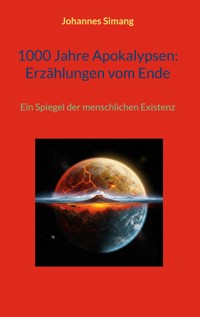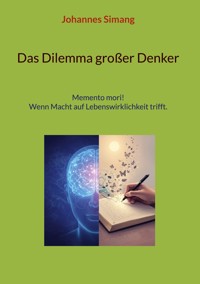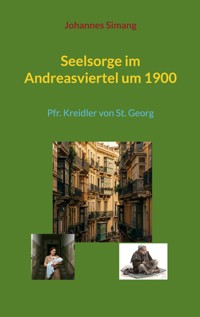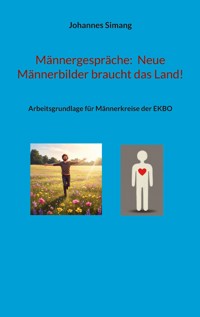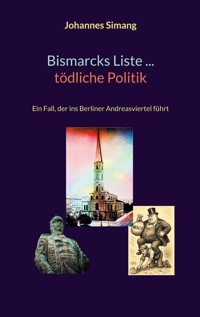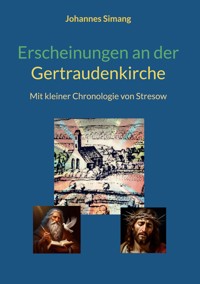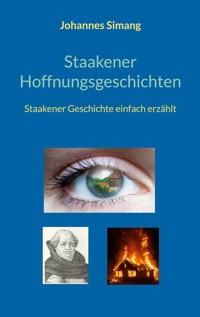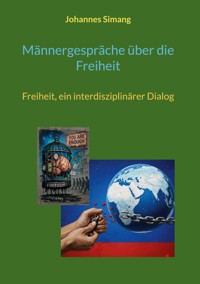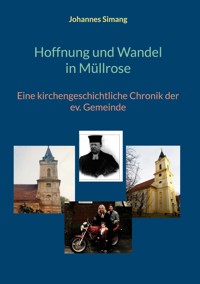
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Chronik der ev. Kirchengemeinde Müllrose bietet einen tiefen Einblick in die Sozialgeschichte der Gemeinde und dokumentiert das Leben ihrer Bewohner durch die Jahrhunderte. Sie vereint Einträge aus Kirchbüchern sowie Aufzeichnungen von Pfarrern und beleuchtet sowohl die Freuden als auch die Herausforderungen, die das Lebensumfeld prägten. Hermann Trebbin und seine Nachfolger haben mit akribischer Arbeit historische Ereignisse und Entwicklungen festgehalten, dennoch bleibt die Erzählung oft unvollständig, da sie nur einen Teil der Komplexität der Gemeindegeschichte widerspiegelt. Die vorliegende kirchliche Geschichte vermittelt die "Geschichte von unten", indem sie die zwischenmenschlichen Beziehungen, Ängste und Träume der Menschen in den Vordergrund stellt. Die kleinen Anekdoten und alltäglichen Ereignisse tragen zur einzigartigen Identität Müllroses bei, wie auch der Blick in die großpolitische Wetterlage, und machen die Chronik zu einem lebendigen Zeugnis der Menschlichkeit und des Glaubens, das Kraft und Mut aus den Lebensgeschichten der Zeitzeugen schöpft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 753
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Müllroser Kirchengeschichte
Gewidmet:
Meinem Freund und Kollegen
Pfr. Andreas Althausen
Pfarrer in Wellmitz und ab 1999 Biegen/Jacobsdorf
Pfr. i.R. Hans Lehmann
Ein treuer Berater
und den Kirchenräten von Müllrose,
die sich in allen Belangen für die Gemeinde einsetzten:
Ulrich Richling
Herbert und Ralf-Gunnar Jänisch
Helmut Philipp und Peter Schawaller
Iris Weiß und Margitta Strübing
Brigitte Kubica, Dr. Eckhard Fehse und Marion Werner
den Bläsern Carsten und Roberto Haase,
sowie den Organistinnen Dietlind Philipp, Christina Wiese, Ingeborg Weißhaupt
und besondere Frauen des Frauenkreises
Elfriede Hecke, Anneliese Scholz, Christel Richter,
Beate Schargott, Rotraud Zimmer und Susanne Thom
Inhalt
Die Pfarrer von Müllrose (Überblick)
Die Geschichte des Christentums
Katholische Anfänge
Einführung der Reformation in der Mark
Pfarreinkünfte
Einkünfte der Kirche
Die Pfarrer von Müllrose
Pfr. Fabianus Brull
Pfr. Winfred Dannewaldt
Pfr. Thomas Richter
Pfr. Florian Kienast
Pfr. Martin Gudemeyer
Pfr. Winfred Janus (Michael Genisch)
Pfr. Martin Schumann
Pfr. Abraham Senseke
Pfr. Jonas Kolheim
Pfr. Petrus Kolheim
Pfr. Johann Valentin Schmid
Pfr. Gottfried Christian Bencker
Pfr. Christian Rau
Pfr. Christian Ehrenfried Hermann
Pfr. Johann Heinrich Müller
Pfr. Johann Gottlob Tetz
Pfr. Johann Gottlieb Brenske
Pfr. Johann Wilhelm Andreas Burkhardt
Pfr. Arnold Hugo Augustin
Pfr. Johannes Klein
Pfr. Fritz Heinisch
Pfr. Hans-Joachim Heinisch
Pfr. Bruno Hemmerling
Pfr. Hanns-Joachim Hasse
Pfr. Bernd-J. J. Roggl / Johannes Simang
Handwerk und Kirche
Liste der Bürgermeister von Müllrose
Chronik der Müllroser Mühle
Chronik von Mixdorf (Auszüge)
Chronik der Ragower Mühle – Das Schlaubetal
Der Kupferhammer
Das Schlaubetal
Liste der Pfarrer von Jacobsdorf
Nachwort
Vorwort
Als Pfarrer ist man immer auch Chronist einer Gemeinde oder Kleinstadt. Der Blick eines Schuldirektors, wie es einst Hermann Trebbin war, ist ein anderer als der eines Pfarrers. Seine Arbeit ist wichtig gewesen, um Ereignisse, die die Kirche und Gemeinde bewegt haben, einzuordnen, aber für kirchengeschichtliche Studien gibt es doch eine Vielzahl von Quellen, die ihm nicht zur Verfügung standen, wie das Evangelische Pfarrerbuch für die Mark Brandenburg und all das, was kirchliche Archive gesammelt haben. Immerhin hat Hermann Trebbin fleißig in den Kirchbüchern gelesen. Ein Kirchbuch ist ja nicht nur eine Sammlung von Eintragungen über Kasualien, sondern im Grunde ist es eine Sozialgeschichte der Gemeinde. Unsere Geschichtsbücher sind oft ‚Geschichte von oben‘, wie ich es immer nenne. Wir lesen von Personen, die sich und das, was sie erlebt haben für ‚historisch‘ halten. Das Kirchbuch oder Geschichtssammlungen der Vergangenheit sind aber eine Art ‚Geschichte von unten‘, berichten also von denen, deren Schicksal durch historische Ereignisse nicht nur berührt, sondern oft deformiert wurde. Jeder Historiker beschreibt den Verlauf von Kriegen, die ja als Ursache auch nur Gier nach Macht, Reichtum und Immobilien haben, dass aber nach den Kriegen das Bild der Orte von Invaliden bestimmt wird, davon schreiben die wenigsten. Die ‚Chronik der Sperlingsgasse‘ sagt mir mehr über das Leben als Datensammlungen.
Dies ist also ein Lesebuch. Die chronistischen Daten der Pfarrer dienen einzig dazu, anzudeuten, wie die Menschen in der Gemeinde gelebt haben. Gerade sie haben ja auch als Chronisten ihrer Gemeinde beschrieben, wie es in der Gemeinde zuging, so wurde auch ins Kirchbuch eingetragen: ‚Fremde Handelsleute haben am Markt ihr Geschäft gemacht, dies in der Gaststätte gefeiert, was wegen eines Streites um den Gewinn in eine Schlägerei mündete, während der der Vater den Sohn erschlug.‘
Müllrose ist eine Oase,
so hieß es nach dem 2.Weltkrieg, denn Gebäude waren kaum zerstört. So empfand ich Müllrose auch, als ich 1998 vom Kirchenrat in Müllrose zum Pfarrer gewählt wurde. Die Menschen waren nett, die Arbeit war viel und meine Frau fühlte sich hier wohl. Was will der Mensch mehr. Sicher, es gab auch das andere: Die Kirche war in einem ruinösen Zustand, der Pfarrgarten und das Küstergrundstück verwildert und alles war sehr traditionell. Ersteres ließ sich ja ändern, auf das Letztere aber wollte ich mich einlassen, schon um die Traditionen kennenzulernen. Der Erfolg: die Gemeinde hat sich auch auf mich eingelassen. Das hat mir gutgetan und Mut gemacht, manches neu einzuführen.
Die Kirchrenovierung brachte mich dazu, da immer wieder Touristen vor der Kirchentür standen, geschichtliche Studien in kleinen Heften gegen einen Obolus an diese zu verkaufen. Auch haben viele ehemaligen Müllroser Ahnenforschung betrieben. Aus dem Grunde habe ich die Kirchbücher digitalisiert, das heißt komplett abgeschrieben. So konnte ich leicht Müller, Meier, Schulze … aus allen Jahrhunderten mit einem Suchbefehl darstellen. Die Kirchenrenovierung von Müllrose und Reparaturen an einigen Kirchen rundum kosteten rund eine Million Euro – erst der Turm, dann das Dach des Kirchenschiffes, dann das Kirchenschiff innen und außen; in Biegen das Dach und in Mixdorf kleinere Reparaturen. Der Ein- und Ausbau der Orgel während der Dachsanierung ist eingeschlossen. 60% der Kosten hat Land und Bund bezahlt, gut 10% die Stadt Müllrose und der Kirchenkreis, den Rest die Gemeinde. Diese rund 150.000,- Euro haben wir in den fünf Jahren nach Beginn der Baumaßnahmen aufgebracht. Die Kirchenmusik (Frau Weißhaupt, Frau Philipp und Herr Haase als Posaunenchorleiter) haben dazu beigetragen. Aus den Schieferschindeln des Turmdaches hat Herr C. Haase, der Steinmetzmeister) Uhren gemacht, die wir auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Markt verkaufen konnten und viele andere Aktionen haben dies ermöglich und vor allem ein großes Spendenaufkommen. Ein guter Ratgeber war mir auch immer der Gemeindekirchenrat unter dem Vorsitz von Herrn Richling. Wenn wir nach siebeneinhalb Jahren auch wieder Sehnsucht nach unserer Heimatstadt Berlin hatten, war Müllrose ein Stück wunderbare Lebenszeit. Viele Kontakte und hin und wieder der Blick auf die Müllroser Kirche erinnern uns immer wieder an diese Zeit.
Johannes und Heidi Simang
Eine kleine Kirchengeschichte von Müllrose
Chronologie der ev. Pfarrer
Nr.
Pfarrer
Dienstbeginn
1.
Fabianus Brull
1540
2.
Winfred Dannewaldt
1560
3.
Thomas Richter
1580
4.
Florian Kienast
1590
5.
Martin Gudemeyer
1610
6.
Winfred Janus / Michael Genicke
1620
7.
Martin Schumann
1624
8.
Abraham Senseke
1641
9.
Jonas Kolheim
1643
10.
Petrus Kolheim
1661
11.
Johann Valentin Schmid
1688
12.
Gottfried Christian Bencker
1716
13.
Christian Rau
1731
14.
Christian Ehrenfried Hermann
1771
15.
Johann Heinrich Müller
1806
16.
Johann Gottlob Tetz
1818
17.
Johann Gottlieb Brenske
1837
18.
Johann Wilhelm Andreas Burkhardt
1856
19.
Arnold Hugo Augustin
1884
20.
Johannes Klein
1916
21.
Fritz Heinisch
1928
22.
Hans-Joachim Heinisch
1952
23.
Bruno Hemmerling
1957
24.
Hanns-Joachim Hasse
1979
25.
Bernd-Jürgen Johannes Roggl Johannes Simang
1998 2000
26.
Oliver Fischer, Pfr. i. E.
2005
27.
Susanne Fischer, Pfn. i. E.
2008
28.
Matthias Hirsch
Die Geschichte des Christentums
Die Geschichte des Christentums beginnt mit der Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi - der Überwindung all dessen, was Angst macht: Macht - Gewalt - Tod
Die erste Gemeinde entstand in Jerusalem, oft missverstanden als jüdische Sekte: Jünger wie Thomas begründeten die ersten Gemeinden in Indien. Paulus begründete die ersten Gemeinden außerhalb Israels im Mittelmeerraum. Wir feiern den Anfang der christlichen Gemeinde als Pfingstereignis durch die Gabe des Hl. Geistes.
In der Apostelgeschichte (Acta 15 – erstes Apostelkonzil) erfahren wir von der Abwendung von jüdischen Bräuchen (Beschneidung).
325 Konzil von Nicäa - alle Bischöfe (erste Stadtpfarrer) trafen sich in der heutigen Türkei.
Kaiser Konstantin hatte die christliche Kirche zur Staatskirche gemacht, zweifellos ein politischer Akt, denn die Priester in Rom wurden entmachtet, zuvor hatte Konstantin 3 Cäsaren und den oströmischen Augustus getötet – alles seine Verwandten.
‚Staatskirche‘ bedeutete für die Christen die Einigung der Kirche, zuvor gab es viele verschiedene Richtungen.
Im Jahre 371 kam es zum Konzil zu Konstantinopel: die Trinitätslehre wurde zum Dogma. Vorkämpfer war der Bischof Athanasius, der fünfmal bis nach Trier ins Exil musste.
Die Zentren waren damals: Konstantinopel - Rom – Alexandria. Alexandria fiel im 7.Jhrdt. durch Ausdehnung des muslimischen Reiches.
Mit der Krönung Karls des Großen wurde das Frankenreich geeint und das Hl. Römische Reiches deutscher Nation begründet. Damals um 800 gab es mehrere Zeitrechnungen – eine Einigung des Kalenders gab es erst im 11.Jahrhundert nach Christi Geburt.
In der Mark Brandenburg belegen archäologische Funde menschliches Leben bis 9000 vor Christi Geburt (Ausgrabungen des größten europäischen Friedhofes im Norden von Müllrose aus der Zeit danach zeugen davon – beim Landstraßenausbau gefunden und konserviert.) Slawen zogen ein im 6.Jahrhundert nach Christi Geburt.
Im Erzbistum Magdeburg existiert eine Urkunde (1110), dass das Land zwischen der Niederlausitz und Pommern ein Geschenk Heinrich V. an den Bischof wäre. Dieser Anspruch wurde von den Landesherren aber nicht anerkannt, sodass das Erzbistum 1150 noch einmal eine Kaufsumme für diese Region zahlen musste. Die Errichtung sollte vor allem den Expansionsdrang der polnischen Herrscher eindämmen und der Mission der in diesem Gebiet noch lebenden Wenden dienen.
Neben Frankfurt an der Oder war als wichtiger strategischer Punkt jenes kleine wendische Dorf am Möllensee interessant als Missionsstation, weil sich hier die Wege nach Polen, nach Schlesien und nach Böhmen und Leipzig kreuzten.
Durch die Besiedlung von Mönchen kam es zur Besiedlung des ‚brandgerodeten Grenzlandes‘, so ist wohl Mark Brandenburg zu übersetzen. Die ersten deutschen Zuwanderer werden schon mit den Feldzügen gegen die Slawen im 10. Jahrhundert in die Region gekommen sein. Weitere mit den Mönchen (Zisterzienser und Kartäuser in unserer Gegend).
Die politisch relevante Einsetzung von drei Bischöfen hatte vor allem mit der Befriedung des Landes zu tun, das immer wieder von polnischen Fürsten und Königen überfallen wurde.
In dieser unruhigen Zeit beginnt die Siedlungszeit, die sich mit der Begründung der Kirchengemeinde Müllrose verbindet. Man glaubt, dass die erste Steinkirche 1275 auf dem Fundament einer bis dahin bestehenden Holzkirche gebaut wurde, die wohl zur Zeit der Begründung des Bistums Lebus (1124) entstanden war.
Aus der Gründungsurkunde
„Es liegen aber bei dieser Stadt 114 Hufen; davon sind endgültig 64 Hufen für Äcker und Holzungen bestimmt, die übrigen 50 aber für Weideland berechnet. Von den 64 Hufen, die auf Acker und Holzung entfallen, gehören 4 Hufen der Kirche und 24 Hufen den Schulzen der Stadt, Wilhelm Hase, als ‚Gründungs- oder Besetzungshufen‘.“
Abgaben der Kirche bei Ausgründung der Stadt
Unsere Kirche hatte jährlich 5 Talente als „Cathedratikum“ (Lehrbefugnis bezogen auf den katechetischen Unterricht) an den Bischof abzuführen, dasselbe, was auch Lossow, Merz, Biegen, Jakobsdorf zu entrichten hatten. Unsere Stadt wird also damals wohl kaum größer gewesen sein als eins von diesen Dörfern. Hohenwalde, Lichtenberg, Pillgram, Booßen pflichteten 4 Talente, desgleichen Seelow, Müncheberg aber 12, Frankfurt sogar 50.
Im Lebuser Schlossregister heißt es über unsere Stadt:
„Melrase hot 64 Hufen, der Pfarrer 4, die Brocherftorsser 8 frei zu dynste. So czinsen 52 Hufen, yßliche (jegliche) 4 Groschen und dortzu 6 Schogk Orbethe, unde dye Brocherftorsser wollen dye Fischer unde Ezideler nicht lassen schossen. Vorhen synt 4 Hufen wüste wurde (beim Durchzug der Hussiten), dy czinseten 16 Groschen, do von geyn am Schosse abe 2 Groschen.“
Katholische Anfänge
Das Bistum Lebus existierte somit von 1124-1598 (ab ca.1560 nur dem Namen nach).
Das Bistum wurde eingerichtet zur Missionierung des wendischen Landes, aber auch, um das Land politisch zu beruhigen, da slawische / polnische Stämme in ständigen Fehden lagen.
Seine politische Bedeutung hatte es durch die Verbindung mit polnischen Städten und Regionen. Der Kurfürst beließ das Bistum dem Namen nach bis 1598, aber schon nach der Reformation war es funktionslos und nach dem Tod des störrischen Bischofs, der die Reformation ablehnte wurde alles dem Konsistorium untergeordnet.
Besoldung der Geistlichen in jener Zeit
Die genannten 4 Pfarrhufe bildeten den Grundstock für die Besoldung des oder der hiesigen Geistlichen. Diese Hufen machten noch 1851 296 Morgen aus. Da aber in diesem Jahre 182 verkauft wurden, sind jetzt nur noch 114 Morgen bei der Kirche vorhanden. Übrigens kehrt die Zahl 4 bei fast allen askanischen Stadtgründungen wieder, darum die Gesamthufenzahl: 104, 114, 124, 254 usw. Ähnlich war es bei den Dörfern, z.B. mit 64 Hufen. In dem Lehnsbrief vom Jahre 1444 erscheinen unsere Pfarräcker als adeliges Kirchenlehen.
Pfarrstellenbesetzung nach Patronatsrecht
Dem ersten Pfarrer stand beim Zuzug mit Gewissheit eine Gruppe von deutschen Handwerkern zur Seite. Mit jeder neuen Gruppe kamen nun neue Rechte nach Müllrose, die den willigen Zuwanderern teils als Lockmittel versprochen wurden, teils auf Grund ihrer Berufe und Zunftzugehörigkeit zustanden - so kam die Müllrose möglicherweise zum Stadtrecht, ohne eine Stadtgründungsurkunde zu besitzen (?). Unter der Herrschaft Otto III. aus dem Geschlecht der Askanier kam es zu neuen Stadtgründungen. In solchen Städten wie Müllrose wurde ein Lokator ernannt, der eine offizielle Stadtneugründung vornahm, die mit entsprechenden Regelungen und Rechten beurkundet wurde. 1260 erhielt Wilhelm Hase den Auftrag als Lokator von Müllrose zu fungieren. Er bewohnte die alte slawische Burg am Möllensee, war kraft seines Amtes der erste Burgemeister, organisierte einen Stadtrat, ordnete nach Weisung des Landesherrn Rechte und Pflichten der Bürger, der verschiedenen Zünfte und der Landpächter an und teilte 114 Hufen Land auf, die der Bürgerschaft zu Müllrose vom Landesherrn zugesprochen wurden. Dies alles ist festgehalten in der Urkunde zur Verleihung der Berliner Rechte von 1275, die diese ‚Neu-Gründung' dokumentiert. Diese Urkunde und die durch den Bischof erlassenen Abgaben an die Kirche (Müllrose: 5 Taler pro Jahr, Frankfurt: 50 Taler) regelten auch die Einkünfte am Ort und machten es möglich, die erste Steinkirche 1275 zu erbauen.
Die ersten hundert Jahre waren Jahre des Aufbaus. Land musste gerodet und urbar gemacht werden - wie es der Name Mark Brandenburg besagt: „durch Brandrodung erschlossenes Grenzgebiet“. Es kam nach wie vor zu polnischen kriegerischen Einfällen. Es gab immer wieder Auseinandersetzungen zwischen Bürgern, die auf Sonderrechte pochten. Zwischen der Kirche und zuwandernden Armutsorden (Waldenser) gab es Streit: in Angermünde wurden Waldenser als Ketzer öffentlich verbrannt. Auch zwischen Christen und Wenden gab es Probleme wegen der immer wieder durchgeführten heidnischen Kulthandlungen: in Brandenburg gab es einen Steingötzen mit drei Gesichtern, vor dem man angeblich Kinder opferte. Eine ähnliche Gestalt sollen die Templer verehrt haben (Baphomet, der dreigesichtige), wahrscheinlich das, was man heute Verschwörungstheorie nennt.
Schon um 1375 - wissen die Historiker - gab es im Umkreis kaum noch wendische Bauern oder Fischer.
Zudem bestimmten mit der Übernahme des bayrischen Königshauses als Landesherr der Mark, den Wittelsbachern, politische Wirren das Geschehen. Unter anderem gaben die Bischöfe ihren Ortsgeistlichen immer wieder die Weisung auf die Ausbeutung der Mark durch die Wittelsbacher zu weisen - in der Tat ein großes Problem für alle Menschen in der Mark. Der damalige König Ludwig setzte als Gegenmaßnahme seinerseits Gerüchte in Umlauf, dass die Bischöfe für den Einfall der Polen in die Mark verantwortlich seien, was z.B. dem Propst von Bernau das Leben kostete, der vom Volk gelyncht wurde.
Erst mit dem böhmischen Herrscher Karl IV. kam es schließlich zum wirtschaftlichen Aufschwung. Einen Erbstreit unter den Wittelsbachern ausnutzend, eignete er sich durch Heirat erst die Lausitz an und zwang schließlich Otto „den Faulen" den Rest der Mark abzutreten - was im übrigen Mixdorf (wohl ‚Meischdorf: kleines Dorf) zum zeitweisen Zusammenschluss mit der Kirchengemeinde von Müllrose brachte.
In Müllrose blühte nicht nur die Stadt auf, sondern auch das kirchliche Leben und eine kirchliche Laienbewegung, wie sie ihresgleichen in Müllrose einzigartig war. Zuwandernde und Handelsreisende brachten immer neue Impulse.
Um 1400 wurde Müllrose – wie auch Lebus – Immediatsstadt, d.h. Adlige wurden Lehnsherren und Patrone. In Müllrose war es die Familie von Kuntz von Hohendorf und ab 1440 die Familie von Burgsdorff, also Zabel (Sebald) von Burgsdorff (Borscherstorffer 1460 im Schoßregietser).
Infolgedessen war auf den Ritter, wie uns bereits bekannt, auch das ehedem landesherrliche Recht übergegangen, bei eintretenden Neubesetzungen einer der hiesigen Pfarrstellen einen ihm genehmen Bewerber zu präsentieren, der dann, falls es der geistlichen Behörde recht war, von dem zuständigen Dompropst oder dem Archidiakonus im Namen des Bischofs erwählt wurde. Danach erfolgte die förmliche Proklamation vor der Gemeinde, und erhob diese keinen Einspruch, so geschah die Einführung des neuen Seelenhirten in der Art, dass die Betrauung mit dem geistlichen Amt durch den Vertreter des Bischofs, die Begabung mit den Pfründen aber durch den adligen Grundherrn als den Patron der Kirche erfolgte. Da nun aber später sämtliche Burgsdorffschen Teilgüter von dem Landesherrn erworben wurden, so ging auf diesen auch das mit dem adligen Grundbesitz verknüpfte Patronat über.
Die Zeit des Aufschwungs in der Mark - und somit auch in Müllrose - ging etwa 50 Jahre vor der Reformation ihrem Ende entgegen. Politische Intrigen, Machtansprüche der Kirchenfürsten und Ausbeutungsstrategien der Landesherren führten schließlich zur Reformation. Es ging nicht nur um das Wort Gottes - der Ablass-Streit und die in der Mark zunehmenden lnquisitionsprozesse lassen dies erahnen - es ging auch vor allem um Besitz- und Machtgier. In Müllrose sind solche Ereignisse nicht bekannt, Veränderungen waren daher nicht erwünscht, auch den neuen Vorstellungen aus dem Sachsenland konnte man nichts abgewinnen. Und doch kam sie unaufhaltsam, die Reformation.
1539 Einführung der Reformation in der Mark
Die strikte Weigerung des Bischofs von Lebus ließ Kurfürst Joachim II. behutsames Vorgehen für sinnvoll erscheinen, da jener Bischof einst Lehrer und Erzieher seines Vaters war.
Der Lebuser Bereich erstreckte sich von der Kontopper Mühle bis Treppeln und Chossewitz, von Karausch (bei Ragow) die Ölse entlang bis Prelauki, von Seelow bis Fürstenwalde.
Kirchspiel Müllrose gehörte zum Sprengel Frankfurt (sedes). Acht sedes (Sprengel) gehörten zum Bistum Lebus.
Die Größe Müllroses lässt sich aus den Abgaben an das Bistum ersehen.
Abgaben an den Bischof:
Frankfurt
50 Talente
Seelow + Müncheberg
12 Talente,
Müllrose, Lossow, Merz, Biegen, Jacobsdorf
5 Talente,
Hohenwalde, Lichtenberg, Pillgram, Booßen
4 Talente.
Vor der Reformation sind die Namen von 27 kath. Hauptgeistlichen aufgeführt (Classis Prima Superioris Ordinis)
z.B.: Kluge, Raffeisen, Martin, Schönhausen, Scherer, Rücker, Bekmann, Scholze, Schulze, Schönemark, Thiessen, Livius, Delius, Derschau, Charteau, Bugrette, Geras.
Daneben gab es sicher viele Nebengeistliche (Classis Minerioris Ordinis), Messpriester und Altaristen, denn der Grundriss der alten Müllroser Kirche (niedergerissen 1746) zeigte viele Nischen und Anbauten, offenbar für Nebenaltäre, Kapellen und Heiligen-Altarräume. Nach der Matrikel von 1600 lag der ‚Altaristengarte‘ neben der Pfarre.
Ein Hauptgeistlicher, ein Messpriester und ein Altarist sind in Müllrose wohl stets dagewesen (handschriftlicher Nachlass Beckmann – Staatsarchiv Berlin).
Zum Vergleich: Die Frankfurter Kirche (eine kurfürstliche Liegenschaft, darum nicht der Bischofssitz) hatte 36 Altäre und ebenso viel Messpriester, wohl ebenso viel Altaristen und mehrere Hauptgeistliche.
Am 1. Nov.1539 nahm der Bischof von Brandenburg das Abendmahl in beiderlei Gestalt (bei den Evangelischen erhält die Gemeinde Brot und Wein, bei Katholiken nur Brot, Wein trinkt allein der Priester). Acht Tage später wurde der letzte katholische Gottesdienst in Frankfurt gehalten. Am 11.Dez.1539 erfolgte die Einführung des evangelischen Bekenntnisses in der Marienkirche - es predigte Pfarrer Johann Ludecus (Lüdecke). Der Frankfurter Bürgermeister Peter Petersdorf nahm hier erstmals das Abendmahl nach evangelischer Art.
1540 wurde der erste lutherische Prediger nach Müllrose nach Müllrose entsandt. Das bedeutet, dass der Müllroser katholische Pfarrer, Pfarrer Schönemark, den Übertritt zum evangelischen Glauben verweigerte und mit einer Abfindung zum Unterhalt aus dem Dienst entfernt wurde. Dieses Schicksal erlitt auch der Pfarrer von Podelzig, vom Stammsitz der Familie von Burgsdorff, die treue Anhänger des Bischoffs von Lebus waren. Jener Bischof verweigerte den Übertritt und erreichte, das man ihm die Diözese beließ, obwohl er keine Gemeinden mehr hatte. Dr Johann von Horneburg, jener letzte Bischof von Lebus, starb 1555 in Storkow.
Müllrose folgte entsprechend dem Beispiel Frankfurts im Jahre 1540. Eine Notiz in unserem alten Kirchenbuch, allerdings erst aus späterer Zeit, sagt: „1539 ist zu Frankfurt a. O. das Papsttum abgeschafft worden. 1540 kommt der erste lutherische Prediger nach Müllrose: Fabianus Brull.“
Viele Geistliche wurden damit zum Übertritt bewegt, dass der Kurfürst allen, die nicht übertreten wollten, androhte, sie dem Lebuser Bischof zu unterstellen. Das half - eine Antwort ist überliefert: „O gnediger Herr! Behüt uns Gott für den Papst und den Bischof von Lebus, es ist ein Teuffel wie der ander, bitten nur um 14 Tage Diktion oder Frist, uns zu bedenken."
Pfarreinkünfte:
Die Einkünfte des katholischen Pfarrers gingen wohl ohne weiteres auf seinen evangelischen Nachfolger über. Über den Prediger (damals Thomas Richter) heißt es in der Matrikel vom Jahre 1600:
„Hat ein Pfarr Hauß und ein Baumgarten dabey.
Item 4 Pfarr-Hufen, gebraucht die vermöge der Ordnung.
Sechzig Scheffel Messkorn von 50 Hufen.
Eine Wiese auf dem Kietz von 5 Fuder Heu.
Eine Wiese im Wolfs-Winkel, gibt 7 Scheffel Korn zur Pacht.
Hatt freye Höltzung, und jeder, der Anspannung hat, hohlet ihme alle Jahr drey Fuder, die Gärtner aber, so keine Pferde haben, hauen das Holz, gibt der Pfarrer jedes Mal eine Tonne Bier.
Den Bierzeitenpfennig, ungefehrlich 1 R.
Ein Altaristengarte neben der Pfarre.
Eine Johannisgabe jährlich von jeder Hufe.
Aus jedem Haus auf Michael 12 Pfg.
Von den Haußleuten und einzelnen Persohnen aber 6 Pfg.
Zwey Scheffel Mehl aus der Mühlen im Städtlein.
1 Scheffel Mehl aus der Kaysermühlen.
1 Rt. Zins von 100 Rt. Haubt Summa steht bey Georg und Heinrich von Burgsdorff, Inhalts ihrer Briefe und Siegel.
3 Thaler minus 5 Sgr.von 40 Thaler Haubtsumme bey Georg Rehfelden zu Loßau. Hat die alte Bomstorffin zum Predigt-Stuhl verehrt.
7 ½ Rt. Zins von 114 Rt. 4 Sgr. Haubt Summa hat Friedrich von Burgsdorff vermöge seiner Handschrift.
5 Gr. Von Funere Generali (d.h. von einem großen Leichenbegängnis). 2 Gr. Von einem Kind, wann man nicht mit allen Glocken läutet, von denen, so in und außerhalb denen Städtlein begraben werden.
3 Sgr. (Silbergrosschen) Vom Aufbieten und dem Opfer.
1 Rt. Jährlich die Kirchenregister zu halten.“
Dies waren die Einnahmen der Pfarre.
Weitere Einkünfte der Kirche
Schulmeister und Kirche hatten ihre besonderen Einkünfte. So erhielt letztere außer der Pacht von 8 Acker- und Wiesenstücken 6 Pfund Wachs oder 1 Taler 3 Sgr. Für die Fischerei auf dem Katharinensee, die zu jener Zeit Joachim, George und Heinrich von Burgsdorff ausübten, ein Wachslicht für den Altar von den Zeidlern (Bienenwirten), anderthalb Silbergroschen von jedem Brauvorgang, zu welchem die Kirche in jedem Falle die Braupfanne zur Verfügung stellte. Endlich heißt es: „Weil auch nothwendig ein Begräbnüß außerhalb denen Städtlein (am See) zugerichtet werden müßen, so haben die Herren Visitatoren sich solches nicht allein mit gefallen laßen, sonderm Verornen auch hieben, welcher hinfüro in dem Städtlein will begraben werden, dass eine alte Person 6 Sgr., ein Junger aber 3 Sgr. der Kirchen entrichten soll. Die aber, so außerhalb denen Städtlein begraben werden, dürffen nicht mehr als den Pfarrern und Schulmeister seine Gebühr geben“.
Besondere Traditionen – das Mettenläuten
Ein in vielen Jahren mitgeschleppter Rest aus bischöflicher Zeit war das sog. Mettenläuten, das in der Zeit zwischen Martini und Lichtmess oder Reminiszere täglich morgens um 4 Uhr erklang, obwohl seit Einführung der Reformation eine Frühmesse hier wohl kaum noch gehalten wurde. Erst 1835 schaffte Pfarrer Tetz diesen katholischen Brauch als „unnütz, überflüssig, ja sogar feuergefährlich“ – denn Müllrose hatte bis ca.1880 einen im oberen Teile hölzernen Turm – kurzerhand ab.
Besondere Traditionen – die Betglocke
Gleichfalls aus katholischer Zeit stammte das Ziehen der sog. Betglocke. Am 22. März 1369 gab Bischof Peter I. von Seelow aus einen Ablassbrief für Gebete, die bei dem täglich mehrmaligen Anschlagen der großen Glocke verrichtet wurden. Dieser Brauch bestand seit dem Jahre 1316, in welchem der Papst Johann XXII. Befohlen hatte, dass täglich dreimal, nämlich morgens 6 Uhr, mittags 12 Uhr und zur Vesperzeit um 5 Uhr, mit der Glocke ein Zeichen zum Gebete gegeben werden sollte, auf welches jeder niederfallen und Gott bitten möchte, dass er die Gefahr wegen des drohenden Einbruchs der Türken in das deutsche Land gnädigst abwenden möchte. Beim ersten Schlage sollte gebetet werden: 1. Mose 32, 10 „Herr, ich bin viel zu gering . . .“, beim zweiten: Lukas 18, 13 „Gott sei mir Sünder gnädig“, und beim dritten: Psalm 143, 10 „Herr, lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen . . .“ Noch im Jahre 1456 wurde diese Forderung vom Papste wiederholt.
Besondere Traditionen – der Bischofzehend
Auch der „Bischofzehend“, der 1811 noch von den hiesigen Einhüfern für das Amt Biegen gefordert wurde, verschwand allmählich aus den Akten. Man sah diese und ähnliche Steuern als unzeitgemäß an, und der Magistrat sprach 1849 von dem „allgemeinen Unwillen über die alten geistlichen Abgaben, wie Bierzeitengeld, Ostereier, Christpfennig, Michaelisopfer etc., über deren Grund kein Mensch eine Ansicht hat, weshalb sie gezahlt werden müssen . . .“
Erst nachdem ein entsprechendes Ablösungsgesetz vom 11. Juni 1873 herausgekommen war, gingen die ersten Müllroser Ablösungsgesuche bei der Kgl. Generalkommission in Frankfurt ein.
Die Geschichte der christl. Gemeinde Müllrose
Lange Jahre ist es her –
am Möllensee, da wohnten Wenden,
Der Erzbischof erwarb das Land,
um Kriege gegen Polen zu beenden.
Ein Bischof kam dann nach Lebus
als des Friedens Unterpfand,
er baute Kirchen überall,
warb Christen für das ganze Land.
An Handelswegen wuchsen Orte,
an Oder , Schlaube und der Spree,
nach Böhmen, Breslau, Krakau, Görlitz
kam man vorbei am Möllensee.
So wuchs der Ort im Jahr Zwölfhundert,
Familien kamen gern hierher,
Wenden, Deutsche, bunt gemischt,
kannten keine Fremden mehr.
Die Kirche war der Mittelpunkt,
die Wenden wohnten noch am Kiez,
die Gottesdienste hielten Priester,
sprich: classis prima ordinis.
Drei Altaristen war'n im Amt
für all die gläub'gen Menschen hier,
priesen St. Jakobus, Andreas und Maria
für eine tüchtige Gebühr.
Mit allen, die nun hierherkamen,
gab es neue Rechte,
für Jagd und Zoll, die Fischerei;
für Forst und zünft'ge Mächte.
Otto der Dritte, einst Landesherr,
ernannte Lokatoren,
Wilhelm Hase tat den Dienst –
die Stadt Müllrose ward geboren.
Zwölfhundertsechzig geschah dann dies,
das Land war nun gerecht geteilt,
an Rat und Kirche und die Burg,
wo der Lokator einst verweilt.
Der Herrscher gab es viele:
Wittelsbacher, Sachsen und die Böhmen,
doch erst an Karl den Vierten
konnten die Müllroser sich gewöhnen.
Zünfte, Kalanden, Armengilden,
das Handwerk ließ Müllrose blühen,
die Wallfahrt am Jakobusweg
und alles Schuften und auch Mühen.
Doch Misswirtschaft und Ablassstreit
und landesherrliche Intrigen,
machten arm, was lange reich,
der Gier kann nichts genügen.
So ist's im Frieden und erst recht im Kriege,
überall nur Mord und Gier,
als die Hussiten gen Frankfurt zogen,
brannten alle Häuser hier.
Die Müllroser waren außer sich,
zogen voll Wut dem Feinde nach,
mit Knüppeln, Schippen und auch Gabeln
legten sie die Hälfte flach.
Zabel von Burgsdorff, Patron der Stadt,
des Kaisers wilder Streiter,
sah das Elend seiner Bürger
und half so manchem weiter;
die Häuser waren dann bald heil,
der Ritter erhielt nun auch das Lehen
seither sieht man die Burgdorffs
Jahrhunderte im Kirchbuch stehen.
Bis fünfzehnhundertneununddreißig
war'n 27 Priester hier im Amt,
Pfarrer Schönmark musste gehen,
weil evangelisch wurd' das Land.
Auf Fabianus Brull fiel nun die Wahl
nach einem hirtenlosen Jahr,
der als der Pfarrer auch der Lehrer
für die Müllroser Kinder war.
So blieb allein das Evangelium –
Brull hat es brav verkündet,
In langen zwanzig Jahren,
hat er so manche Not gelindert.
Die ewige Verdammnis
war der Menschen größte Pein,
dass Glaube aber freimacht,
sollt' seine Predigt sein.
1. Pfr. Fabianus Brull (1540-1560)
Bischof in Lebus zur Zeit der Reformation und erbittertster Gegner derselben war Dietrich von Bülow - zugleich der Erzieher des Kurfürsten Joachim I. Der Bischof war nicht nur Herr über geistliche Güter, sondern 1518-55 war Beeskow in seinem Besitz, zeitweise auch Müllrose. Die Burgsdorffs (Lehnsadel in Müllrose - Stammgut Podelzig) verkauften und verpfändeten Müllrose teilweise an den Fürstenwalder Domherrn, teilweise an die Frankfurter Kartäusermönche.
Der Stiftsforst (Neuzelle) ging bis zur Südseite des Müllroser Sees - ein Hügel an der Südseite heißt ja noch heute ‚Abtsberg‘. Der Markgraft Johann von Küstrin kaufte 1555 Beeskow und Storkow frei von den geistlichen Besitzern. Per Landkauf oder Heirat konnte man zu jener Zeit seinen Machtbereich vergrößern: Joachim I. heiratete Elisabeth von Schleswig-Holstein, was seinen Nachfolgern die Belehnung einbringen sollte – Neuruppin hingegen kaufte er 1525.
Während dies noch ein regulärer Kauf war, eignete sich der Landadel schon lange kirchliche Güter auf unrechte Weise an. Ein Beispiel ist Neuruppin. Der Kurfürst hatte den Ort und die Umgebung kaum gekauft, da bemächtigten sich der Landadel schon der Kirchengüter und drängte - wissend um die landesherrliche Führung der lutherischen Kirche - am stärksten auf die Reformation.
Achim von Bredow gehörte auch zu den Kämpfern für die Reformation - er hatte guten Grund, denn er hatte 1526 schon einige Dörfer des Klosters Lindow in seinen Besitz gebracht. Der Prenzlauer Rat setzte angesichts dessen, was da kommen sollte, kurzerhand die Zinsen für geistliche Güter herab. Klöster kamen durch solche willkürlichen Aktionen derart in Not, dass z.B. die Franziskaner in Stendal aus Geldmangel ihr abgebranntes Kloster nicht mehr aufbauen konnten.
Dem Kurfürsten waren reformatorische Bestrebungen ein Dorn im Fleisch, zumal sie sich gegen den Ablass richteten, an denen sein Bruder, der Erzbischof von Magdeburg maßgeblich verdiente. Er, Joachim I. mit Beinamen „Nestor" - er war Nestor des Reichstages (= der lateinische Sprecher der Kurfürsten), riet auf dem Reichstag zu Worms noch dem Kaiser zu, Luther gar nicht erst anzuhören - mit Not konnte man Tätlichkeiten mit dem dagegen sich verwehrenden Kurfürsten von Sachsen, Friedrich den Weisen, verhindern.
Als er darauf die brillante Darstellung Luthers erleiden musste, schwor Joachim I., das Wormser Edikt bis auf's Yota durchzuführen. Sachsen war schon protestantisch, da hatte der Nachfolger Dietrich von Bülows als Bischof von Lebus, Georg von Blumenthal, noch das Recht, evangelische Prädikanten, die in seinem Bereich predigten, gefangen zu nehmen - besonders in den Städten um Brandenburg und Guben wurden solche evangelischen Gottesdienste heimlich, aber immer häufiger, durchgeführt. Der Kurfürst verbot sogar das Lesen des Neuen Testamentes - selbst wenn es nicht lutherisch war, weil die katholischen Übersetzer (z.B. Emser) mangels eigener Griechisch-Kenntnisse rigoros von Luther abschrieben ... und so seine evangelische Lehre verbreiten halfen.
Joachim I. schloss sich mit seinen katholischen Nachbarn zum Dessauer Bund zusammen und wurde Wortführer der katholischen Partei im Reichstag - und erlitt zugleich die größte Niederlage, als die von ihm schmählich vernachlässigte Kurfürstin Elisabeth zu Ostern 1527 in Sachsen den lutherischen Glauben annahm. Luther ermahnte den Kurfürsten zudem öffentlich für sein rüdes Benehmen gegenüber der Kurfürstin. Eine Frist bis Ostern 1528, um der „falschen Lehre" abzuschwören, beantwortete sie mit der Flucht bei Nacht zu ihrem Oheim nach Sachsen. Sie wagte sich zu seinen Lebzeiten nicht zurück. In seinem Testament verlangte er von seinen beiden Söhnen noch das Versprechen, dass sie katholisch blieben. Er starb 1535.
Die Wirren in der Mark hatten wohl auch damit zu tun, dass Joachim I. mit 15 Jahren Kurfürst geworden ... und so anfangs ein Spielball der Adligen, Bischöfe und Stände war. Seinem Kampf für den katholischen Glauben steht auch seine außerordentliche Vorliebe für die Astrologie entgegen. Und das Bild eines politisch desorientierten Herrschers rundet ab, dass er 1510 in Berlin 38 Juden hinrichten ließ und aus der Mark alle Juden verbannte - die übrigens sein Sohn Joachim II., der wegen seiner Verschwendungssucht unter chronischem Geldmangel litt, gegen eine Sonderzahlung wieder in die Mark holte.
Weitere Gegner der Reformation in der Mark Brandenburg:
Aber es blieben der Bischof von Lebus, Georg von Blumenthal - der Bischof von Havelberg, Basso von Alvensleben - der Domherr von Fürstenwalde, Wolfgang Redorffer, die eifrigsten Verfechter der alten Lehre.
Die Reformation setzt sich durch
Die märkischen Stände und der Landadel (von Bredow - von Rochow im Havelland) setzten schließlich die Reformation durch - zahlreiche lokale Reformversuche (1536 in Brandenburg-Neustadt - 1537 in der Petri-Kirche zu Cölln an der Spree - 1538 in Tangermünde) konnte der Kurfürst nur mit dem Versprechen verhindern, die Reformation schließlich einzuführen.
Joachim II. ließ eine neue Kirchenordnung ausarbeiten und nahm am 1.Nov. 1539 das Abendmahl nach evangelischer Art aus der Hand des Bischofs von Brandenburg, Matthias von Jagow.
Am 11.11.1539 war der erste evangelischen Gottesdienst in Frankfurt (Oder) als allgemeine Einführung des evangelischen Bekenntnisses in der Marienkirche. Pfr. Johann Ludecus (Lüdecke) predigte. Allen voran ließ sich der Frankfurter Bürgermeister Peter von Petersdorf das Abendmahl nach evangelischer Art reichen.
Die wirtschaftliche Situation Müllroses am Morgen der Reformation
Bischof in Lebus zur Zeit der Reformation und erbittertster Gegner derselben war Dietrich von Bülow - zugleich der Erzieher des Kurfürsten Joachim I.
Der Bischof war nicht nur Herr über geistliche Güter, sondern 1518-55 war Beeskow in seinem Besitz, zeitweise auch Müllrose. Die Burgdorffs verkauften und verpfändeten Müllrose teilweise an den Fürstenwalder Domherrn, teilweise an die Frankfurter Karthäusermönche.
Der Stiftsforst (Neuzelle) ging bis zur Südseite des Müllroser Sees - ein Hügel an der Südseite heißt ja noch heute "Abtsberg".
Der Markgraf Johann von Küstrin kaufte 1555 Beeskow und Storkow frei von den geistlichen Besitzern. Per Landkauf oder Heirat konnte man zu jener Zeit seinen Machtbereich vergrößern: Joachim I. heiratete Elisabeth von Schleswig-Holstein, was seinen Nachfolgern die Belehnung einbringen sollte - Neuruppin hingegen kaufte er 1525.
Die Reformation erreicht Müllrose
Eintragung im Kirchenbuch von Müllrose:
"1540 kommt der erste lutherische Prediger nach Müllrose: Fabianus Brull."
Der letzte katholische Geistliche von Müllrose, Pfr. Schönemark, hatte es abgelehnt, den evangelischen Glauben anzunehmen. Er wurde mit einer Abfindung entlassen, wahrscheinlich wurde er vom Bischof von Lebus in einer katholischen Gemeinde untergebracht, denn noch 1561 gab es eine katholische Minderheit in der Mark Brandenburg.
Auch der Bischof von Lebus lehnte die Reformation ab, behielt aber die Diözese auf Lebenszeit, die dem Namen nach bis 1598 bestand ... dank der Nachgiebigkeit Joachim II. Als der Bischof von Lebus starb (1555), setzte der Kurfürst übrigens seinen Sohn Joachim Friedrich als Bischof von Lebus ein - 1560 wurde derselbe auch der Bischof von Brandenburg, welcher Aufgabe er sich bis zur Übernahme der Kurfürstenkrone hingebungsvoll widmete. Bischof von Havelberg wurde übrigens schon 1548 der Sohn Friedrich. So hatte Joachim II. alle drei Brandenburger Diözesen in kurfürstlicher Kontrolle.
Die Reformation und ihre eigennützigen Helfer
Während dies noch ein regulärer Kauf war, eignete sich der Landadel schon lange kirchliche Güter an. Ein Beispiel ist Neuruppin. Der Kurfürst hatte den Ort und die Umgebung kaum gekauft, da bemächtigten sich der Landadel schon der Kirchengüter und drängte - wissend um die landesherrliche Führung der lutherischen Kirche - am stärksten auf die Reformation.
Achim von Bredow gehörte auch zu den Kämpfern für die Reformation - er hatte guten Grund, denn er hatte 1526 schon einige Dörfer des Klosters Lindow - wie bereits erwähnt - in seinen Besitz gebracht. Der Prenzlauer Rat setzte angesichts dessen, was da kommen sollte, kurzerhand die Zinsen für geistliche Güter herab. Klöster kamen durch solche willkürlichen Aktionen derart in Not, dass z.B. die Franziskaner in Stendal aus Geldmangel ihr abgebranntes Kloster nicht mehr aufbauen konnten.
Eine Visitationskommission realisiert die Reformation
Eine Visitationskommission regelte die Übergabe aller kirchlichen Güter, soweit ihnen die kurfürstliche Order nicht zuvorgekommen war. Zur Visitationskommission gehörten: ein Ritter, ein Jurist, ein Prälat. Die Visitationskommission besuchte jede Gemeinde im Lande. Die Herren verlangten den Übertritt des Pfarrers, regelten im anderen Falle dessen Entlassung, bzw. drohten mit der Zuordnung zu dem sehr gestrengen und gefürchteten Bischof von Lebus.
Die Visitationen dauerten bis 1544 in der Mark.
Lebuser Bischofssiegel seit 1370
Die Kirche wird neu geordnet:
In dieser Zeit wurde ein evangelisches Konsistorium, mit Theologen und Juristen besetzt, geschaffen (1542/3), die Rechte eines Pfarrers (Matrikel) wurden festgestellt, die des Patrons ebenso - blieben aber bei letzterem im Wesentlichen wie vorher.
Die Mark wurde in Superintendenturen eingeteilt und der ehemalige Propst von Berlin, Stratner, wurde erster Generalsuperintendent - als katholischer Propst war er der Berater Joachim II. in Sachen Reformation.
Die Reformation begründet das Schulwesen:
Das Schulwesen wurde auf evangelische Grundlage umgestellt, Volksschulen wurden gefördert, in Müllrose aber eher im Sinne einer Katechismus-Schule im Hause des Pfarrers Brull - wobei angemerkt sei, dass im lutherischen Kleinen Katechismus neben vielen nützlichen Dingen auch das Einmaleins enthalten ist. Die Müllroser Schule wurde als Volksschule bekanntlich erst 1571 begründet - in den umliegenden Dörfern entstanden Schulen in der Regel erst ca.100-150 Jahre später. Eine Notiz im Kirchbuch lässt erkennen, dass Pfarrer Brull eine Familie hatte, denn die Witwe von Fabianus Brull hat das dem Pfarrer gegebene Grundstück an die Kirchengemeinde verkauft - gegen geringen Zins blieb sie bis zum Tode 1573 dort wohnen (Zins wie im ‚Schöppenbuch‘ vorgeschrieben). Ihr Sohn verstarb vorher. 1573 fiel das Grundstück übrigens ganz an die Kirchgemeinde Müllrose (Urkunde ging nach Berlin – Unterschriften von den Kirchvätern Clemens Hase und Thomas Butzke)
Kirchlicher Besitz verschwand bei landesherrlichen Günstlingen:
Von Müllrose existiert kein Übergabeprotokoll des Besitzes der Kirchengemeinde. Die Visitationskommission hat entweder keinen Besitz vorgefunden, oder es ist verloren gegangen. Das lässt auf drei Möglichkeiten schließen:
a) Pfarrer Schönemark hat sich mit dem Kirchengut aus dem Staube gemacht (so etwas geschah andernorts leider gar nicht so selten, denn mancher Pfarrer war nach verweigertem Übertritt mittellos);
b) Die Burgsdorffs als erklärte Gegner der Reformation und Patron der Kirchengemeinde zu Müllrose haben den Besitz an sich gebracht. Denn neben dem Müllroser Pfarrer hat in unserer Region nur noch der Pfarrer in Podelzig den Übertritt verweigert - Podelzig ist der Stammort der Burgsdorffs.
c) wahrscheinlicher ist: Der Kurfürst hat die Order erteilt, alle Güter, die die Gemeinde nicht unbedingt zum evangelischen Gottesdienst benötigte, an seine geliebte, von seinem Vater gegründete Universität nach Frankfurt zu geben:
Gold- und Silberkelche und -kannen, Kreuze der Neben- und Heiligenaltäre, Monstranzen (Hostienschrein aus Silber), Rauchfässer, Bilder, Kleinodien und Reliquien verließen so Müllrose vor dem Besuch der Visitationskommission auf landesherrliches Geheiß – manches wanderte auch in die Silberkammer des Kurfürsten, wie z.B. die Silberrahmen der Bilder aus dem Dom von Brandenburg und auch das große Silberkreuz (ca. 2x1m).
Die Universität von Frankfurt (Oder) - schwieriger Beginn:
1540 wurde die bis zuletzt gegen die Reformation kämpfende Universität in Frankfurt - in der kaum noch 40 Studenten waren (1518-1521 zählte man in Wittenberg aber schon allein 89 märkische Studenten) - zur evangelischen Landesuniversität ernannt und mit Pfarreinkünften bedacht: Pachten und alle Einnahmen der Gemeinde Jacobsdorf - und eben der ‚katholischen‘ Wertgegenstände der Kirchengemeinden aus der Umgebung wechselten den Besitzer.
Schon 1538 hatte man, um Studenten nach Frankfurt zu ziehen, den Schwiegersohn Melanchthons, Sabinus, für eine Professorenstelle gewonnen. Seine Ausstrahlung war aber kaum vergleichbar mit der seines Schwiegervaters in Wittenberg - eher weiß man darum, dass jener Sabinus seine Frau schlecht behandelte, weshalb Melanchthon sie noch zu seinen Lebzeiten begraben musste - wohl der schwerste Gang für jeden Vater / jede Mutter.
Darüber hinaus erhielt die Universität Frankfurt unter Studenten den Nicknamen ‚Anti-Wittenberg‘. Es wundert nicht, dass sich die Universitätsleitung sich damals zum Handlanger des Kurfürsten machten und halfen, die Gemeinden von ihren Vermögen zu befreien.
Die kostenträchtigen Beziehungsprobleme des Landesherrn:
Der Kurfürstin Elisabeth blieb dieses Leid zwar erspart, denn sie verstarb 1555, ihre Söhne beide 1571 - wodurch die von Joachim I. getrennte Mark wieder zusammenkam. Aber als ihr Gatte verstarb, traute sie sich längst noch nicht nach Hause, denn ihr Sohn Joachim II. war mit der Tochter des polnischen Königs verheiratet, die auch, als Joachim sich in der Spandauer Nicolaikirche zum lutherischen Glauben bekannte, demonstrativ zu einer katholischen Messe in Berlin ging. Viel kann es Joachim II. aber nicht bedeutet haben, denn Unsummen gab er bekanntermaßen nicht nur für seine Frau aus, sondern für seine Freundin Anna Sydow, ‚die schöne Gießerin‘, die Frau eines Geschützgießers - unendlich viel Klatsch wurde auf dem Lande über diese Beziehung verbreitet. Durch seine ausschweifende Lebensweise war der Kurfürst verschuldet, wie sonst zuvor nur Markgraf Albrecht zu früheren Zeiten. Zu ihrer Ehrenrettung sei gesagt: Markgraf Albrecht hatte unendliche viele Kirchen mit Gemälden ausgestattet, Joachim II. baute immens viele Verteidigungsanlagen in Brandenburg, zum Beispiel die Spandauer Festung. Allein schon die Wahl zum Kurfürsten kostete viel, wie wir es heute von den Präsidentenwahlen in USA kennen, aber die Kriege waren ein teures Unterfangen und davon gab es viele in jeder Generation. Man muss aber auch erwähnen, dass jede Stadt und jeder Markt darauf gewiesen waren, sich von jedem neuen Herrscher der Mark Brandenburg die Rechte und Freiheiten bestätigen zu lassen. Das nutzte keiner mehr aus als Joachim II. Der mit seinem Hofstaat in die Städte zur Huldigung kam und Festmähler erwartete, die Städte wie Spandow die Hälfte ihrer Jahreseinnahmen kostete. Kurfürst Joachim II. war ein maßloser Herrscher.
Mangel an evangelischen Pfarrern durch staatl. Eingriffe:
Der spartanisch lebende Hans von Küstrin war zwar als streng bekannt, aber darum wohlgelitten, weil er die Landstraßen in dieser Region, die Brücken und die Festungen (z.B. in Küstrin und Peitz) ausbauen ließ - was zum Florieren des Handels beitrug und nicht nur Müllrose nach der langen Flaute erblühen ließ.
Wirtschaftlich ging es in der Tat trotz der Verschwendungssucht des Kurfürsten Joachim II. bergauf - seine allzu ‚katholische‘ Kirchenordnung verhinderte jedoch das Kommen aufrechter Protestanten, insbesondere protestantischer Prediger und Schullehrer. Trotzdem fanden in den ersten 15 Jahren fast 1000 junge Prediger – meist in Wittenberg ausgebildet -, was darauf zurückzuführen war, dass Bischöfe lieber Heere finanzierten, statt in Pfarrämter zu investieren. In den Städten protestierten die Bürger, in den Landgemeinden suchte man händeringend Pfarrer. Oft wählten Gemeinden die protestantischen Pfarrer, die dann jahrelang von den Adligen und Landeignern gemobbt wurden. So gab es in Städten häufiger Wechsel als in den Landgemeinden, wofür das ‚unchristliche‘ Betreiben einflussreicher Bürger verantwortlich war.
Bezüglich der Einkünfte hatte sich denn auch für den evangelischen Pfarrer gegenüber seinen katholischen Vorgängern zumindest in Müllrose nicht viel geändert. Er lebte von den gleichen Einkünften, die schon den katholischen Pfarrern als Existenzgrundlage zustanden.
Aber laut landesherrlicher Kirchenordnung sollten die Prozessionen beibehalten werden, die Gesänge im Gottesdienst weiterhin lateinisch sein - was angesichts vieler Prediger, deren Patron sie nach wenigen Semestern für ‚reif‘ befanden, die man in der Mark nehmen musste, da Theologen mit einem Studienabschluss (Magister) sich verweigerten, gar nicht mehr möglich war. Selbst die Messgewänder sollten den Domgottesdienst weiterhin verschönen, was den Prediger Ludecus in der kurfürstlichen Marienkirche von Frankfurt veranlasste, Luther vor dem ersten Reformationsgottesdienst eine Eildepesche zu schicken. Luthers Antwort kam denn auch prompt. Sie lautete: „Wenn der Kurfürst will, so möge er drei Messgewänder überziehen, Hauptsache es werde das rechte Evangelium gepredigt."
Mönchsklöster sollten aufgelöst werden, Nonnenklöster mussten in Jungfrauenstifte umgewandelt werden, was angesichts der maroden Finanzen vieler Klöster gar nicht mehr anders ging - Neuzelle und Chorin sind da rühmliche Ausnahmen.
Einnahmen der Pfarrer in Müllrose:
Die Einnahmen der Gemeinde Müllrose waren demgegenüber noch so, dass der regelmäßig durch Blitzschlag in Flammen stehende Turm tatsächlich immer wieder repariert werden konnte - Pfarrer Brull ließ sie aber gegenüber früheren Zeiten ‚festsetzen‘ gemäß den Gepflogenheiten der Region - denn zuvor waren die Preise ‚fließend‘ und verhalfen Pfr. Schönemark und seinen Vorgängern zu einem tüchtigen Zubrot:
Pacht von 8 Acker- und Wiesenstücken,
6 Pfund Wachs von den ansässigen Meistern mit eigenem Betrieb,
1 Taler und 3 Silbergroschen für die Fischerei auf dem Katharinensee,
1 Altarkerze von den Zeidlern (Bienenwirte),
1,5 Silbergroschen von den Brauern pro Brauvorgang, die Kirche stellte die Braupfanne gegen einen Mietzins,
pro Begräbnis: 6 Silbergroschen
Geld für das Mettenläuten;
zudem: Bierzeitengeld, Ostereierlieferungen an die Gemeinde von dem Kossäten und Gutsbesitzern, den Christpfennig, das Michaelisopfer letztere wurden erst nach 1873 abgeschafft.
Kurfürstliche Doppelstrategie wider Willen:
Fabianus Brull - der erste Müllroser Pfarrer - lebte in einer unsicheren Zeit. Erst kurz vor dem Ende seiner Amts- und auch Lebenszeit konnte er sicher sein, als evangelischer Pfarrer nicht doch noch vertrieben zu werden, denn niemand war unzuverlässiger als sein Landesherr. Eben hatte er noch die Reformation eingeführt - Joachim II. mit Beinamen Hektor, wegen seiner Verdienste im Kriege gegen die Türken - da schickte er auch schon seine märkischen Landeskinder in den Krieg mit dem Kaiser gegen die evangelischen Stände.
Der Kaiser Karl V. gewann diesen Krieg und wollte nun den militärischen Sieg in einen politischen verwandeln. Er ließ durch einen katholischen Reformtheologen und Johann Agricola, den Hofprediger des brandenburgischen Kurfürsten einen Vergleich ausarbeiten - eine theologische Kompromissformel. Joachim II. konnte durch seine Gläubiger, denen er Unsummen schuldete, gezwungen werden, dieses Interim dem Kaiser zu überreichen. Aus seiner Hand nahm dieser es auch an, das den Abendmahlskelch auch für die Gemeinde und die Ehe für den Priester zugestand. Da die Katholiken sich nach der Veröffentlichung weigerten, dies anzuerkennen, stellte der Kaiser fest, es gelte nur für die Evangelischen.
Für Fabianus Brull bedeutete es eine erste Sicherheit, die mit dem Augsburger Religionsfrieden 1555 Gewissheit wurde. Winfred Dannewaldt, der 1560 die Pfarrstelle von Müllrose durch Gemeindewahl erhielt, hatte aber dennoch mit vielen, wenn auch anderen Problemen zu kämpfen.
Ein Übergabeprotokoll - die ein Visitationskomitee, dass 1540/1 alle Gemeinden in Brandenburg besuchte - über die Wertsachen der Kirche machten, existiert von Müllrose leider nicht.
Chronik – Blick in die Welt
1540 Englands König Heinrich VIII. heiratet die deutsche Anna von Kleve – lässt die 4. Ehe aber bald annullieren.
In Ungarn wird der wenige Tage alte Sohn Ferdinand I. Johann Sigismund Zápolya von einer eilig einberufenen Adelsversammlung in Buda zum König von Ungarn gewählt. Der Bischof übernimmt die Vormundschaft.
Eine Flotte unter dem Kommando von Hernando de Alarcón wird losgeschickt, um die Expedition von Coronado zu unterstützen und nebenbei den Golf von Kalifornien und die vermeintliche Insel Baja California zu erkunden.
Von Quito aus bricht die Zimtlandexpedition unter der Führung von Gonzalo Pizarro ins Amazonastiefland auf.
28. Juni bis 28. Juli: Beim Hagenauer Religionsgespräch werden hauptsächlich Bedingungen und Verfahrensfragen für ein zukünftiges Religionsgespräch zwischen Katholiken und Protestanten besprochen. Die Fronten zwischen beiden Lagern sind verhärtet.
Philipp Melanchthon veröffentlicht anonym in Straßburg den ‚Tractatus de potestate et primatu Papae‘ als Nachtrag zur Confessio Augustana.
In Mitteleuropa zählte das Jahr mit der Dürre in Mitteleuropa 1540 zu den wärmsten und trockensten Jahren des Jahrtausends; es geht als Jahr der möglicherweise katastrophalsten Dürre des Jahrtausends in die Geschichte ein. Zwischen März und September regnete es kaum, Brunnen und Quellen fielen trocken, Vieh wurde notgeschlachtet, unzählige Menschen starben bei der Arbeit auf dem Feld. Der Rhein ist bei Basel und Köln zu Fuß überquerbar.
Allein in Deutschland kam es zu 33 Stadtbränden (z. B. Stadtbrand von Einbeck (Fürstentum Grubenhagen), Freudenberg (Siegerland), Wangen im Allgäu); etliche davon gelten als antiprotestantische Brandstiftungen.
1541 Die Osmanen eroberten Buda. - Transsilvanien wurde unabhängiges Fürstentum unter osmanischen Schutz.
Martin Luther verfasste seine Ekklesiologie ‚Wider Hansworst‘.
Der Wendentaler wurde in Lüneburg geprägt.
Brand auf der Prager Burg: Die ‚Böhmischen Landtafeln‘ wurden zerstört.
1542 In Schweden gab es einen Bauernaufstand (Nils Dacke), der am Ende zum Sturz des Königs Gustav Wasa führte.
Die sechs Tage alte Maria Stuart wurde Königin von Schottland.
Portugiesen eroberten Nord-Äthiopien.
Das Gedicht ‚Ihr lieben Christen freut euch nun‘ wurde von Erasmus Alberus veröffentlicht – heute Adventslied.
Der Dammweg von Berliner Schloss zum Jagdschloss Grundewald wurde als Reitweg für Joachim II. angelegt (heute Kurfürstendamm).
Die Kloster Chorin und Lehnin wurden säkularisiert.
1543 Türken und Franzosen belagerten Nizza, bis kaiserliche Truppen kamen und die Feinde verjagten.
Rixdorf ging in den Besitz der Stadt Cölln über.
Nikolaus Kopernikus veröffentlichte „De revolutionibus orbium coelestium“, mit der er beschrieben hat, dass die Planeten sich um die Sonne bewegen.
Andreas Vesalius veröffentlichte das medizinische Werk „Libri septem de humani corporis fabrica“ in Basel und begründete damit die neuzeitliche Anatomie.
In den Schriften „Von den Jüden und ihren Lügen“ und „Vom Schem Hamphora“s diffamierte Martin Luther die Juden und setzte sie mit dem Teufel gleich.
1544 Der letzte Inka-Herrscher Manco Cápac II. wurde von Anhängern des 1538 hingerichteten Konquistadors Diego de Almagro el Viejo ermordet, denen er Zuflucht gewährt hatte.
In Königsberg entstand die erste ‚Volluniversität‘ (nach Frankfurt (Oder). Gründungsrektor wurde Georg Sabinus, Professor für Poesie und Beredsamkeit.
Der ev. Glaube wurde Nationalreligion in Schweden.
Der sächsische Kurfürst Johann Friedrich I. ließ auf Schloss Hartenfels die Torgauer Schlosskapelle errichten. Es ist der erste evangelische Kirchenneubau der Welt.
1545 Das von Papst Paul III. einberufene Konzil von Trient wurde einberufen, um auf die Reformation zu reagieren (dauerte bis 1563).
In Mexiko brach ein Fieber aus, an dem 800.000 Menschen starben.
Der Reichstag zu Worms begann.
Der Reichstag zu Worms von 1545 war eine Versammlung des Heiligen Römischen Reiches, die im Kontext der Reformation stattfand. Er wurde einberufen, um die Spannungen zwischen den katholischen und protestantischen Fürsten zu diskutieren und um den Konflikt um die Lehren Martin Luthers zu behandeln, der bereits seit den 1520er Jahren im Gange war.
Ein zentrales Thema des Reichstags war die Frage der religiösen Einheit im Reich und die Bemühungen der katholischen Seite, die protestantischen Lehren zurückzudrängen. Der Reichstag führte zu einem weiteren Abkommen, dem sogenannten „Augsburger Interim", das 1547 erlassen wurde und eine vorläufige Regelung der religiösen Fragen im Reich darstellte.
Der Reichstag von 1545 war jedoch nicht in der Lage, zu einer dauerhaften Lösung zu führen, und die religiösen Spannungen blieben bestehen, was schließlich zur Entstehung des Dreißigjährigen Krieges im 17. Jahrhundert beitrug.
1546 Kaiser Karl V. berief die Regensburger Religionsgespräche ein, um von seinen Vorbereitungen eines Krieges gegen den Schmalkaldischen Bund abzulenken.
Der Schmalkaldische Krieg
Der Schmalkaldische Krieg (1546–1547) war ein Konflikt zwischen den protestantischen Fürsten des Schmalkaldischen Bundes und dem katholischen Kaiser Karl V. Er entbrannte aufgrund religiöser Spannungen und politischer Machtkämpfe im Heiligen Römischen Reich. Der Schmalkaldische Bund wurde 1531 gegründet, um die Interessen der lutherischen Fürsten zu vertreten und sich gegen die katholische Hegemonie zu wehren.
Der Krieg begann, als Karl V. versuchte, die protestantischen Fürsten zu unterwerfen und die Einheit des Reiches wiederherzustellen. Die entscheidende Schlacht fand 1547 bei Mühlberg statt, wo die protestantischen Truppen eine Niederlage erlitten.
Nach dem Krieg wurde der Augsburger Religionsfrieden von 1555 vorbereitet, der eine gewisse Religionsfreiheit für die Protestanten gewährte und die konfessionelle Spaltung des Reiches legitimierte. Der Schmalkaldische Krieg hatte somit langfristige Auswirkungen auf die religiöse und politische Landschaft in Deutschland.
1447 Am 28. Januar starb Heinrich VIII. im Palace of Whitehall in London. Ihm folgte Eduard VI., sein neunjähriger Sohn aus der Ehe mit Jane Seymour, auf den Thron Englands und Irlands.
Eduard VI.
16. Januar: Iwan IV. wurde erster gekrönter russischer Zar. Seine Zeremonie orientierte sich an den Kaiserkrönungen im Byzanz des 14. Jahrhunderts. Durch den Metropoliten wurde Iwan, der später als ‚der Schreckliche‘ bekannt war, mit der Mütze des Monomach (s. Bild: Krone des Alleinherrschers) gekrönt.
Der französische König Franz I. starb. Heinrich II. wurde Nachfolger.
1548 Die fünfjährige Maria Stuart wurde mit dem vierjährigen Dauphin Francois verlobt.
Piri Reis eroberte das jemenitische Aden für die Osmanen von den Portugiesen.
Bader erhielten Zunftrechte im ganzen Hl. Römischen Reich.
Papst Paul III. gründete die Schweizer Garde, die seit 1527 aus deutschen Legionären bestand.
1549 England stellte die Verfolgung Andersgläubiger ein.
In Südamerika begann der Missionskreuzzug der Jesuiten, welche die Indianer schützten, aber als Arbeitskräfte importierte afrikanische Sklaven gutheißen.
Der Jesuit Francisco de Xavier y Jassu traf in Japan ein, um es zu missionieren.
Papst Paul III. starb. Man konnte sich im Konklave nicht einigen.
Heinrich Bullinger und Johannes Calvin einigten sich im ‚Consensus Tigurinus‘ auf ein reformiertes Abendmahl.
Sternberger Landtag: Mecklenburg bekennt sich zur luth. Lehre. 1550 Kaiser Karl V. berief den Augsburger Reichstag ein (bis 1551). Asien: Mongolen belagerten Peking.
Der französische Apotheker Nostradamus begann mit den Veröffentlichungen seiner jährlichen Prophezeiungen.
Die Mode der Pluderhose in Europa modern, als Kniebundhose.
Julius III. wurde zum Papst gewählt und machte gleich seinen Adoptivneffen zum Kardinal (Nepotismus).
1551 Herzog Ferdinand I. erließ das Judenpatent. Es gilt in allen Habsburger Ländern, wo Männer, Frauen und Kinder einen gelben Ring an der Kleidung anbringen mussten.
Augsburger Reichstag: Eine neue Reichsmünzordnung erlassen.
Die erste Bibel mit detaillierte Einteilung in Verse erscheint in Genf.
Die Belagerung der Stadt Magdeburg, die das Augsburger Interim nicht unterschrieb, endete nach einem Bann mit Friedensvertrag.
Augsburger Interim
Das Augsburger Interim war ein religiös-politisches Dokument, das 1548 während des Deutschen Reichstags in Augsburg erlassen wurde. Es wurde von Kaiser Karl V. eingeführt, um den Konflikt zwischen den katholischen und protestantischen Fürsten im Heiligen Römischen Reich zu entschärfen, der durch die Reformation entstanden war.
Das Interim sollte eine vorläufige Regelung für die Religionsverhältnisse im Reich schaffen, bis eine endgültige Lösung gefunden werden konnte. Es legte eine Mischung aus katholischen und lutherischen Praktiken und Glaubenssätzen fest, was es für viele Seiten nicht zufriedenstellend war. Die katholischen Fürsten sahen es als zu nachgiebig gegenüber den Protestanten, während die Protestanten es als zu stark von der katholischen Lehre geprägt erachteten.
Das Augsburger Interim führte zu weiteren Spannungen und Konflikten im Reich und war letztlich nicht in der Lage, eine dauerhafte Lösung zu bieten. Es wurde 1555 durch den Augsburger Religionsfrieden abgelöst, der den Fürsten das Recht gab, die Religionszugehörigkeit ihrer Untertanen zu bestimmen.
1552 Fürstenaufstand wegen der Nachfolgeregelung Karls V. Der Kaiser floh aus Innsbruck nach Villach. Es gab viele Nachfolgekriege.
Iwan der Schreckliche eroberte Kasan und damit Sibirien.
Weißwasser (Oberlausitz) wurde erstmals erwähnt.
Die Detailansicht von Lübeck wurde gedruckt. >
An der Nordsee gab es eine Sturmflut.
1553 Maria Stuart wurde Königin von Elsas. Eine ev. Kandidatin setzt sie ab.
In Franken tobe der 2. Markgrafenkrieg. Hof wurde belagert und erobert, Kulmbach zerstört.
Hinrichtung des Michael Servetus. Er leugnete, das Gott Menschen verdammt, wofür ihn Calvin als Ketzer hinrichten ließ.
Papst Julius III. ließ Talmudim verbrennen und empfahl es den Inquisitionsrichtern. Ein Talmud besteht aus der Mischna (jüd. Gesetzestexte) und der Gemara (Erklärungen).
200 Mitglieder der Gemeinde des Reformators Johannes a Lasco flohen vor Maria Stuart über Kopenhagen (abgewiesen) nach Travemünde (Beginn der reformierten Gemeinde in Lübeck).
1554 Im Markgrafenkrieg wurde Schweinfurt zerstört.
Die Missionare Manuel da Nobrega und José de Anchieta gründeten in Brasilien anlässlich des Festes von Pauli Bekehrung ein Jesuitenkolleg, aus dem sich mit den Jahren die Stadt São Paulo entwickelte.
In Konstantinopel eröffnete – gegen den Widerstand des islamischen Klerus – das erste europäische Kaffeehaus.
1555 Der Augsburger Reichstag zur Neuordnung der politisch-kirchlichen Verhältnisse im Reich endete mit dem Augsburger Religionsfrieden.
Kaiser Karl V. entschied sich für seine Abdankung.
Papst Julius III. starb, es gab ein Drei-Päpste-Jahr, dass mit Paul VI. endete.
Papst Paul VI. erließ die Bulle ‚Cum nimis absurdum‘, ein antijudaistisches Dokument, weshalb in Rom das erste Ghetto entstand.
Nostradamus veröffentlichte seine Zenturien (Prophetien).
1556 Maria I. ließ den anglikan. Erzbischof von Canterbury Thomas Cranmer wegen Ketzerei im Zuge der Rekatholisierung verbrennen.
Karl V. trat zurück. Sein Sohn erbte habsburgisches Erbe, sein Bruder Ferdinand I. das Hl. Römische Reich.
Iwan der Schreckliche ließ Astrachan niederbrennen.
Schreckliches Erdbeben in China. In manchen Städten starben 60% der Bürger. 3-5 Jahre gab es Nachbeben.
1557 König Heinrich II. erließ Edikte gegen Hugenotten und deren Religionsausübung.
Zagreb wurde erstmals als kroatische Hauptstadt erwähnt.
Portugiesen errichteten in China Verwaltungszentrum (Macau) und Spanier in Amerika Kolonien.
1558 Kurfürstentag akzeptierte Kaiserkrone für Ferdinand I.
Dauphin Franz und die schottische Königin Maria Stuart heiraten.
Die katholische Königin Maria I. starb kinderlos. Die protestantische Halbschwester Elisabeth I. wurde ihre Nachfolgerin. Sie machte mit ihren Kapitänen (marodierende Piraten) die Weltmeere unsicher. England wurde zur Großmacht.
Zar Iwan IV. eroberte Narwa und damit den Ostseezugang. Im Baltikum führte er den Livländischen Krieg.
Die Börse in Hamburg wurde gegründet.
1559 Der französische König Heinrich II. starb bei einem Turnier, sein 15jähriger Sohn Franz II. wurde sein Nachfolger.
In Württemberg wurde mit einer ev. Kirchenordnung die Schulpflicht für Jungen eingeführt.
Paul VI. verfasste einen Index für verbotene Schriften. Bald darauf starb er, was in Rom Jubel auslöste. Der Palast der Inquisition wurde in Brand gesetzt. Inquisitionsgefangene kamen frei.
(Wir wissen natürlich nicht, was der Pfarrer von den Geschehnissen in der Welt wusste, aber der Bürgermeister vertrat die Stadt auf dem Ständetag, und tagte in der Stadt mit dem Lehrer, dem Pfarrer und
den Zunftmeistern, da werden sie einiges besprochen haben. Vf.)
Gespräch zwischen Philipp Melanchthon und Fabianus Brull
Der Ort war die Sakristei in der Kirche von Müllrose, umgeben von Büchern und Manuskripten. Melanchthon und Brull saßen an einem Tisch, auf dem der ‚Tractatus de potestate et primatu Papae‘ ausgebreitet lag.
Melanchthon: Guten Tag, Herr Brull. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, über meine Schrift zu sprechen. Der ‚Tractatus de potestate et primatu Papae‘ ist ein wichtiges Dokument, das wir als Nachtrag zur Confessio Augustana betrachten müssen.
Brull: Guten Tag, Herr Melanchthon. Es ist mir eine Ehre, mit Ihnen über dieses Thema zu diskutieren. Ich habe die Schrift durchgesehen, und ich verstehe, dass sie sich mit der Rolle des Papstes befasst. Warum halten Sie sie für so bedeutend?
Melanchthon: Sie sehen, die Confessio Augustana legt die Grundlagen unseres Glaubens und unserer Lehre fest. Doch die Frage nach der Autorität des Papstes bleibt ein zentrales Streitobjekt. Mit dem Tractatus wollte ich klarstellen, dass die Macht des Papstes nicht biblisch fundiert ist und dass viele seiner Ansprüche unbegründet sind.
Brull: Das ist ein starker Standpunkt. Aber warum ist es so wichtig, diese Thematik jetzt zu behandeln?
Melanchthon: In der gegenwärtigen Zeit, in der viele Menschen nach Klarheit und Wahrheit suchen, ist es entscheidend, die Missbräuche und die Hybris der päpstlichen Autorität zu benennen. Viele Gläubige sind verunsichert und glauben, dass der Papst eine göttliche Autorität besitzt. Es ist unsere Pflicht, sie darüber aufzuklären, dass Christus allein das Haupt der Kirche ist.
Brull: Das verstehe ich. Es könnte jedoch auch zu Spannungen führen, insbesondere mit denjenigen, die den Papst als unfehlbar ansehen. Gerade in meinem ersten Jahr gab es eine Dürreperiode, man nannte den Sommer einen Jahrtausendsommer. Und heute weiß man, dass fanatische Papsttreue ganze Städte angezündet haben – ihr eigenes Zuhause.
Melanchthon: Ja, das ist ein Risiko. Doch die Wahrheit muss gesagt werden. Das Traktat ist nicht einfach eine Ablehnung des Papsttums, sondern eine Einladung, die Schrift und die Lehre Christi über menschliche Traditionen zu stellen. Wir müssen die Gläubigen ermutigen, ihren Glauben auf die biblischen Grundlagen zu stützen.
Brull: Sie sprechen von einer Rückkehr zu den Wurzeln des Glaubens. Glauben Sie, dass dies die Menschen tatsächlich erreichen wird?
Melanchthon: Ich bin überzeugt davon. Die Menschen haben ein tiefes Bedürfnis nach echtem Glauben und einer authentischen Beziehung zu Gott. Wenn wir ihnen die Wahrheit über die Autorität des Papstes und die Freiheit des Glaubens vermitteln, können wir sie von den Fesseln falscher Lehren befreien.
Brull: Es ist also nicht nur eine theologische Auseinandersetzung, sondern auch eine Frage der seelsorgerischen Verantwortung?
Melanchthon: Genau! Wir müssen die Menschen nicht nur lehren, sondern sie auch begleiten auf ihrem Weg zu einer tieferen Beziehung zu Christus. Das Traktat soll dazu dienen, das Bewusstsein für die wahre Lehre zu schärfen und die Gläubigen zu ermutigen, ihren Glauben selbst zu prüfen.
Brull: Vielen Dank, Herr Melanchthon. Ihr Engagement für die Wahrheit ist inspirierend. Ich werde Ihre Argumente in meiner Gemeinde weitertragen und die Menschen ermutigen, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen.
Melanchthon: Es war mir eine Freude, mit Ihnen zu sprechen, Herr Brull. Möge Gott Ihnen in Ihrer Arbeit beistehen und Ihnen Weisheit schenken.
Der zweite Pfr. Winfred Dannewaldt (1560-80)
Das Pfarrbuch der Mark spricht von Michael Dannewaldt. Man muss wohl der Kirchenliste von Müllrose folgen, da der Pfarrer selbst für das Schreiben des Kirchbuchs verantwortlich ist – das wird der Pfarrer von 1628 gekannt haben.
Winfred Dannewaldt erhielt die Stelle durch Gemeindewahl. Wie diese Wahl aussah, ist schwer nachvollziehbar, denn der Patron hatte das Recht der Präsentation. Wahrscheinlich mussten sich die Kandidaten den von Burgsdorffs vorstellen - bei Gefallen durfte dann die Gemeinde wählen.
Jener junge Theologe, offenbar mit Familie, kam in eine Gemeinde, die die Vor- und Nachwehen der Reformation wohl ganz gut überstanden und einen Aufschwung zu verzeichnen hatte. Es ist nicht sicher, ob es schon einen Gemeindekirchenrat gab, aber die Unterlagen lassen darauf schließen, dass sich regelmäßig Vorsteher der zur Kirchengemeinde Müllrose gehörenden Ortschaften trafen: aus Ober-Lindow (Weißenspring ist nicht extra aufgeführt), aus Schlaubehammer und Hammerfort, aus Dubrow, Mixdorf und Werchenow (am Wergensee vor Neubrück, wie der Müllroser Ortschronist H. Trebbin vermutet) und schließlich Gore Keyser, der die Brettmühle zu Melrase besaß, eine Wassermühle zu Kaisermühl, die also ein Sägewerk mit Energie versorgte. Auch die Vertreter aus Schlaubehammer und Hammerfort waren Mühlenbesitzer, deren Mühlen die Schmieden mit Energie versorgten. Der Hammer in Hammerfort (eine Eisenschmiede) hörte 1750 auf zu pochen - seit Luthers Zeiten war er in Betrieb - vermerken die pfarramtlichen Chronisten.
Ober-Lindow war als letzter Ort zu Müllrose gekommen. Der Ort gehörte zuvor den in Frankfurt ansässigen Kartäusern, deren Besitz mit der Reformation vollständig an die Universität in Frankfurt ging. Zu Zeiten des Pfarrers Winfred Dannewaldt wurde Ober-Lindow dann Müllrose angegliedert.
All die Ortsvorsteher kamen, weil genau geregelt werden musste, was der Kirchengemeinde, dem Superintendent bzw. Konsistorium, dem Amte und den Burgsdorffs zustand - auch der Bischof von Lebus erhielt noch Abgaben bis 1598. Eifersüchtig wachten die von Burgsdorff über die Aufteilung, denn sie galten als verarmter Adel, auch wenn sie in ganz Europa für Kaiser und Könige ihr Blut ließen.
Bauliche Veränderungen in Müllrose:
1561 geschah der Bau des Pfarrhauses durch die Stadt Müllrose, inklusive einer Teilfinanzierung durch Thomas von Burgsdorff – Bauherr: Bürgermeister Thomas Butzke, der zugleich Kirchenvater war, wie früher die Ältesten hießen.
Bewohner waren Pfarrer Winfred Dannewaldt + Pfarrmagister (=Lehrer) Michel Stauch.
1571 wurde die Schule durch Bürgermeister Thomas Butzke