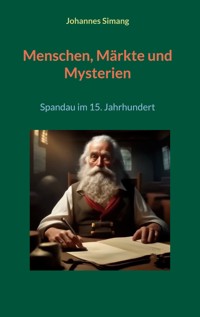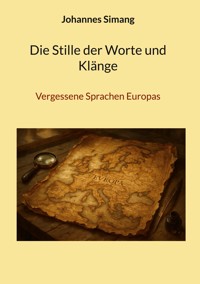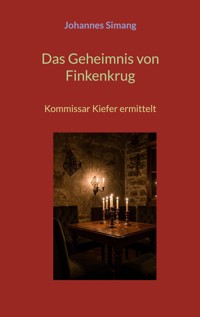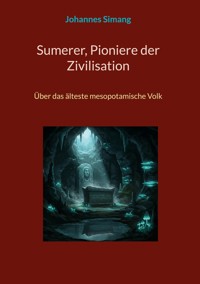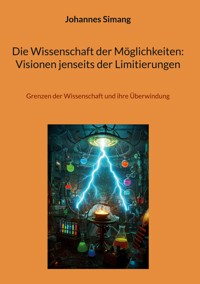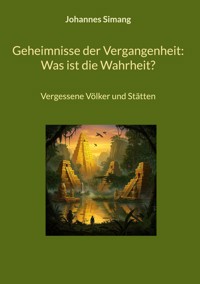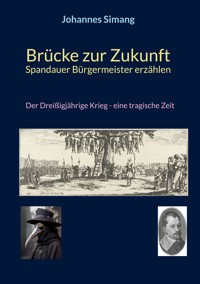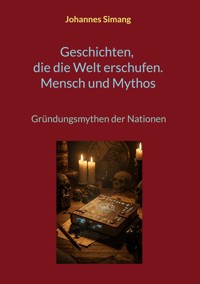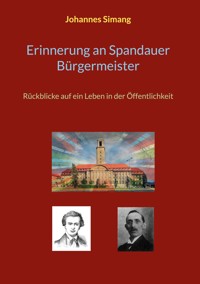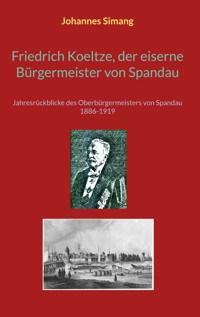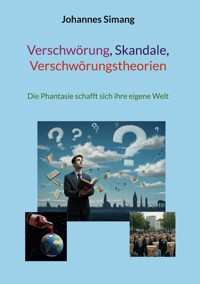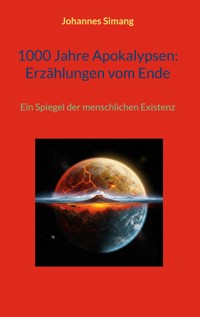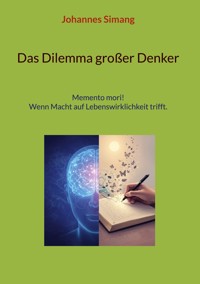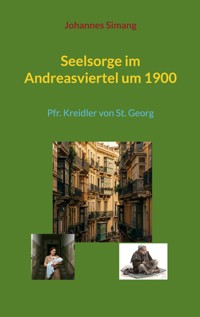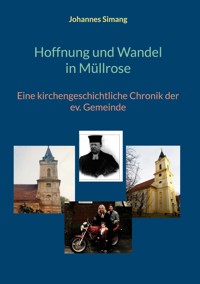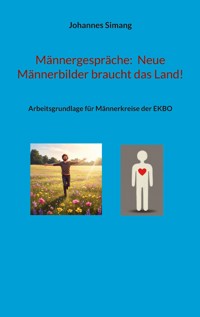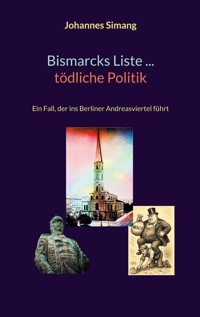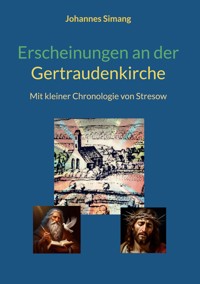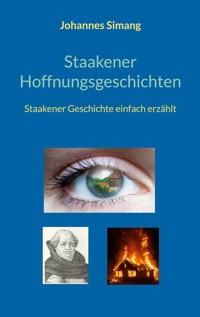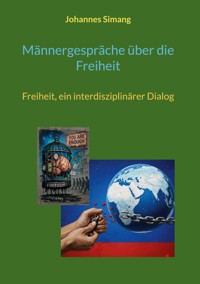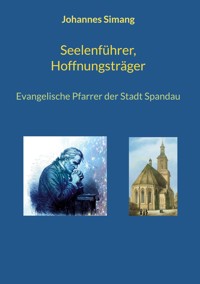
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Buch beschreibt die Rolle der Pfarrer von Spandau als weit mehr als bloße Amtsinhaber. Sie waren Hüter von Traditionen, Seelsorger und gesellschaftliche Wegbereiter, deren Geschichten eng mit den gesellschaftlichen Umbrüchen ihrer Zeit verbunden sind. Durch ihr Engagement und ihre Predigten prägten sie die religiöse Identität Spandaus und boten den Menschen in Krisenzeiten Trost und Orientierung. Das Buch, das die Biografien und das Wirken der Pfarrer beleuchtet, würdigt ihr Erbe und zeigt, dass es über die Grenzen der Kirche hinauswirkt. Zudem sollen literarische Gespräche am Ende jeder Biografie helfen, theologische Diskussionen verständlich zu machen. Es ist eine Hommage an die Pfarrer von Spandau und einen Aufruf, die Werte des Glaubens im eigenen Leben weiterzutragen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 659
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
1. Pfr. Heinrich Machelt (1538-39)
2. Pfr. Johann Herz (1540-41)
3. Pfr. Johann Schmol (1542-43)
4. Pfr. Johann Garz (1543-46)
5. Pfr. Mag. Christoph Lasius (1546-55)
6. Pfr. Johann Salmuth (1555-66)
7. Pfr. Johann Aquila (1567-78)
8. Pfr. Albert Colerus (1578-98)
9. Pfr. Christoph Gigas (1598-1603)
10. Pfr. Joachim Grunow (1603-18)
11. Pfr. Tobias Reinhardt (1618-26)
12. Pfr. Wolfgang Günther (1626-32)
13. Pfr. Joachim Mauritz (1632-59)
14. Pfr. Daniel von der Linde (1660-79)
15. Pfr. Zacharias Matthiae (1680-1702)
16. Pfr. Joachim Lamprecht (1702-28)
17. Pfr. Georg Lamprecht (1728-59)
18. Pfr. Johann G. Freyer (1759-78)
19. Pfr. Daniel F. Schulze (1778-1811)
20. Pfr. Otto. J. Fidler (1812-31)
21. Pfr. Karl J. Hornburg (1831-45)
22. Pfr. Johann F. Stechow (1845-48)
23. Pfr. Ludwig K.T. Guthcke (1849-81)
24. Pfr. Heinrich T. T. Pezold (1882-89)
25. Pfr. Otto K. L. Recke (1889-1915)
26. Pfr. Max K. F. Augustat (1915-31)
Katholische Pfarrer – Ev. Archidiakone, Diakone und Zuchthaus-, Garnisons- und Feldprediger u.a. in der Stadt Spandow / Spandau (biographische Skizzen)
Vorwort
In der pulsierenden Geschichte der Stadt Spandau, die von den Wellen der Zeit immer wieder neu geformt wurde, nehmen die Pfarrer eine herausragende Rolle ein. Von den ersten reformatorischen Anfängen im Jahr 1539 bis zum beginnenden 20. Jahrhundert im Jahr 1920 haben sie nicht nur die spirituelle Landschaft der Stadt geprägt, sondern auch als Hoffnungsträger und Seelenführer die Herzen der Menschen berührt. In diesem Buch, „Seelenführer, Hoffnungsträger“, werfen wir einen Blick auf die Lebenswelten und das Wirken dieser bedeutenden Persönlichkeiten, die in Zeiten des Wandels und der Herausforderung unermüdlich für ihre Gemeinden und die Werte des Glaubens eintraten.
Die Pfarrer von Spandau waren weit mehr als bloße Amtsinhaber; sie waren Hüter von Traditionen, Vermittler von Glaube und Hoffnung, Seelsorger und oft auch gesellschaftliche Wegbereiter. Ihre Geschichten sind untrennbar mit den großen gesellschaftlichen Umbrüchen, den Kriegen, den sozialen Bewegungen, den theologischen und sozialen Diskussionen und den kulturellen Entwicklungen ihrer Zeit verbunden. Durch ihre Predigten, ihr Engagement und ihre Seelsorge haben sie nicht nur die religiöse Identität der Stadt mitgestaltet, sondern auch den Menschen in Krisenzeiten Trost und Orientierung gespendet.
In den folgenden Kapiteln nehmen wir Sie mit auf eine Reise durch die Jahrhunderte, in denen wir die Biografien und das Wirken der Spandauer Pfarrer näher beleuchten. Wir werden die Herausforderungen, denen sie sich gegenübersahen, die Errungenschaften, die sie feierten, und die Spuren, die sie in der Gemeinschaft hinterließen, nachzeichnen. Dabei wird deutlich, dass ihr Erbe weit über die Grenzen der Kirche hinausreicht und bis in die heutige Zeit nachhallt.
Dieses Buch ist nicht nur eine Hommage an die Männer, die mit Hingabe und Leidenschaft ihren Dienst taten, sondern auch ein Zeugnis für die Kraft des Glaubens und die Bedeutung von Gemeinschaft. Möge es dazu beitragen, die Erinnerung an diese Seelenführer, ein Begriff, den Pfarrer Daniel Friedrich Schulze aus Spandau um 1750 prägte, und Hoffnungsträger lebendig zu halten und uns inspirieren, die Werte des Glaubens in unserem eigenen Leben weiterzutragen.
Die Gespräche jeweils am Schluss einer Biographie sind literarische Werke und sollen helfen, die berechtigten theologischen Auseinandersetzungen und ihre Ursachen auch für Laien verstehbar zu machen. Um sie ging es den Theologen vor Ort schließlich.
Für die katholischen Brüder im Herrn, die nach der Reformation in Spandau wirksam waren, bedarf es einer separaten Arbeit, die ich mangels Informationen nicht recherchieren kann. Sie haben es sicher ebenso verdient.
In Dankbarkeit und Respekt für all jene Geistlichen, die vor uns in Spandau lebten und wirkten, lade ich Sie ein, die Geschichten dieser bemerkenswerten Männer zu entdecken und ihre unvergänglichen Beiträge zur Geschichte Spandaus zu würdigen.
Johannes Simang, Spandau 2025
Ehemals Pastor in Staaken,
heute Landesmännerpfarrer der
EKBO.
1.Pfarrer in St. Nikolai (Oberpfarrer, Superintendent)
1. Pfr. Heinrich Machelt (1538-39)
Der erste evangelische Prediger war Herr Heinrich. Für ihn wurde das Hirten Haus für 1 Schock 3 Gr 6 Pf, (für 9 Tage Arbeit von zwei Männern) bereitet, welches zuvor das Huren Haus war.
1539
Feierliche Einführung in die Reformation am 1.November.
Der märkische Chronist Peter Hafftiz hat in seiner Chronik den ersten ev. Gottesdienst beschrieben: „In diesem Jahr ist Herr Georg Buchholtzer, von Arnswalde aus der Neumark berufen, angekommen und hat am 15. Sonntag nach Trinitatis die erste ev. Predigt im Domstift zu Cölln gehalten. Er ist darauf zum Propst von Berlin angenommen und hat 26 Jahre mit Predigten, Sakramente austeilen, Verrichtung und Pflege anderer christlicher Zeremonien der Kirche fleißig und getreulich vorgestanden. In diesem Jahr nach ausgefegten, papistischen Gräueln und Reformation der Kirche ist die reine, gesunde Lehre des heiligen Evangeliums lauter und klar in der Kurmark Brandenburg aufgegangen und vor allen anderen Städten zuerst in Spandow gepredigt worden, so dass auch die Leute aus Berlin häufig dahingelaufen und gefahren sind, die Predigt anzuhören. Am Tage Allerheiligen ist zu Spandow in Gegenwart aller Prediger, die aus den Städten der Kurmark dazu aufgefordert waren, das erste evangelische Amt von Herrn Matthias von Jagow, Bischof zu Brandenburg, gehalten, und wie man’s hinfort mit der Kommunion nach Ordnung und Einsetzung des Herrn Christi halten sollte, christlich verordnet worden. Und es hat der durchlauchtigste, hochgeborene Fürst und Herr Joachim II., Markgraf von Brandenburg, des Hl Röm. Reiches Erzkämmerer und Kurfürst das hochwürdige Sakrament des wahren, natürlichen und wesentlichen Leibes und Blutes des Herrn Christi in beiderlei Gestalt empfangen.“
Und anders als in anderen deutschen Ländern konnten die Gottesdienste und die Einführung der evangelischen Ordnung in Berlin-Cölln, in Spandow für all die Adligen des Umlandes, und später an all den anderen Orten der Mark ohne irgendwelche Gewalttaten oder harten Zwangsmaßnahmen durchgeführt werden.
Mit diesem Gottesdienst wurde in Spandow alles anders. Der neue ev. Prediger Heinrich Machelt war schon 1538 in diese Stadt gekommen, die ein unförmiger Wall umgab. Die Bürgermeister Jürgen Wartenberg und Andreas Koch machten ihm Mut, wenn er auch die Kirche in einem furchtbaren Zustand vorfand. Bei der letzten Kirchenversammlung vor dem Fest der Reformation hörte er einiges über den Zustand der Kirche. Man suchte sicher, die Schäden zu beschwichtigen, doch von den Kollegen erfuhr er, wie übel es um die Kirche bestellt war: Alle Laster und Ausschweifungen, besonders das ‚Volltrinken‘ waren im Schwunge und die Geistlichkeit ging mit dem bösen Beispiel voran. Sie war so entartet, dass sie nicht nur den Volksunterricht gänzlich vernachlässigte, sondern absichtlich jede Art von Aberglaube beförderte. Allgemein war der Glaube an die Wunderkraft der Reliquien, an Hexen und Hexenmeister, an Zauberer und Teufelsbeschwörer. Gott und sein Reich ward nicht gesucht und wo es gesucht wurde, fehlte beim Suchenden der klare Blick, es zu finden.
Die Nikolaikirche, die ihn als Oberpfarrer gewählt hatte, hatte, als er kam, noch keine Kirchturmspitze, aber noch vor dem Fest sollte sie aufgesetzt werden. Ihm richtete man auch schnell ein ‚Hirtenhaus‘ ein, wenn es ihm auch missfiel, dass dieses Haus zuvor das Hurenhaus gewesen war, so strebte er an, auf dem Kirchhof ein Pfarrhaus bauen zu lassen, was auch gleich nach Jubilate 1539 geschah. Mit dem Kaplan Johann Kaulitz hatte er auch eine Unterstützung, da auch im nahen Nonnenkloster zweimal täglich Gottesdienste zu halten waren.
Mit dem Pfarrsold hatte man nichts neu geregelt, es blieb, wie es zuvor bei den Katholischen war: 44 Gulden, 4 Ruthen Holz aus der Kloster Heyde (Klosterwald) und 1 Wispel Roggen; und den ‚Vier Zeiten Pfennig‘.
Hier wurde dann am besagtem Festtage erst eine öffentliche evangelische Predigt in der Mark gehalten, was die verwitwete Kurfürstin bisher nur in ihrem Zimmer hatte tun lassen. Es soll ein solcher Zulauf von hohen und niedrigen Adel dabei gewesen sein, dass nicht nur die Leute aus Berlin, sondern auch aus anderen benachbarten Städten häufig hierhergefahren und gelaufen kamen, solche öffentliche Predigt mit anzuhören und an der Kommunion des Kurfürsten teilzuhaben. - Weshalb Pfr. Heinrich Machelt Spandow verließ, ist unbekannt.
Ein Streitgespräch
(Streitgespräch zwischen Pfarrer Heinrich Machelt und Bürgermeister Jürgen Wartenberg. Der Ort ist die Kirche von Spandow St. Nikolai, mit neu erbauter Turmspitze.)
Heinrich Machelt: (mit ernster Miene) Bürgermeister Wartenberg, wie können Sie es zulassen, dass unsere Gemeinde in so einen Zustand verfällt? Die Menschen mögen äußerlich evangelisch geworden sein, aber wo bleibt der echte Glaube? Wo bleibt die Lehre?
Jürgen Wartenberg: (skeptisch) Herr Pfarrer, die Leute sind froh, nach Luther nun einen Weg gefunden zu haben, dem sie folgen können. Es ist nicht meine Aufgabe, sie mit Lehren und Schriften zu belämmern. Die Menschen brauchen Stabilität und nicht das Geplapper theologischer Debatten.
Machelt: (verärgert) Stabilität? Das ist nicht das Ziel der evangelischen Lehre! Wir sind nicht hier, um die Menschen mit Aberglauben und scheinheiligem Verhalten zu belügen. Die Freiheit in Christus bedeutet Verantwortung, nicht Anarchie! Die Menschen müssen die Grundsätze verstehen, die wir vertreten.
Wartenberg: (abwehrend) Ethische Lehren sind gut und schön, aber viele in unserer Gemeinde kümmern sich nicht um das, was Sie als „reinen Glauben" betrachten. Sie wollen einfach ihre Seelenruhe und ein gutes Leben. Das reicht doch!
Machelt: (leidenschaftlich) Und wenn sie dafür ihre Seelen opfern? Die Reliquien, der Aberglaube – all das ist nichts als ein Schatten des wahren Glaubens. Zu glauben, dass man durch solche Dinge Gutes tun kann, ist eine beleidigende Blasphemie gegen Gott! Wir müssen die Menschen erziehen, nicht nur ihre Wünsche befriedigen!
Wartenberg: (leise) Aber die Menschen fühlen sich mit den Traditionen verbunden – auch wenn diese nicht ganz den evangelischen Prinzipien entsprechen mögen. Was soll ich tun? Die Stadt ist aufgebracht! Ein Aufstand könnte bald folgen, wenn wir zu radikal vorgehen!
Machelt: (zornig) Radikal? Es ist unsere Pflicht, für die Wahrheit einzutreten! Luther wollte eine Reformation, keine Kompromisse! Wir können nicht einfach so tun, als ob alles in Ordnung wäre, während die Leute in Sünde leben. Die Gemeinde braucht einen Hirten, keinen Dienstleister!
Wartenberg: Aber nicht einmal den den gab es in Spandow. Der Bischof hat doch lieber sein Heer finanziert, als die Gemeinden zu finanzieren. Die kath. Kollegen lebten ja fast schon so ärmlich wie unsere Armen in der Stadt … darum ist doch alles verlottert. Unser Wechsel zum evangelischen Glauben hatte weniger mit den Kundgaben Luthers zu tun, sondern es ging uns Städten darum, wieder eine helfende Kirche im Ort zu haben. Unsere Kirchen waren immer die Träger all der sozialen Dienste … das haben wir vermisst.
Machelt: (etwas weniger zornig) Das ist auch Teil unseres Dienstes, uns geht es aber auch um die Seelen der Menschen. Dazu braucht es sicher das diakonische Handeln, vor allem aber die recht Ansprache, die Menschen zum Seelenheil helfen kann und auch Bildung aller steht auf unserem Programm.
Wartenberg: (versucht, ruhig zu bleiben) Ich verstehe Ihre Passion, Herr Pfarrer, doch ich bin hier, um das Wohl der Stadt zu schützen. Vielleicht sollten wir unsere Ansichten vereinen und einen Weg finden, diese schwierige Situation zu meistern, ohne die Menschen gegen uns aufzubringen.
Machelt: (nachdenklich) Vielleicht, aber nur, wenn wir die entscheidenden Themen nicht aus dem Blick verlieren. Wir müssen die Menschen auf den richtigen Weg führen, nicht nur ihre Ängste beruhigen! Es ist höchste Zeit für eine echte geistliche Erneuerung, hier und jetzt! Sehen Sie sich doch an, was mit dem Kurfürsten ist. Er hat der Reformation nur zugestimmt, weil er übermäßig verschuldet ist! Sein einziges Interesse war es, sich an den Kirchengütern zu bereichern, um seinen verschwenderischen Lebensstil mit der von ihm geheirateten Prinzessin aus Polen und seinen zahlreichen Mätressen zu finanzieren!
Jürgen Wartenberg: (verwirrt) Herr Pfarrer, das können Sie doch nicht behaupten! Die Stadträte sind Realisten. Wir alle wissen um die Schulden des Kurfürsten, aber seine Mutter, die Kurfürstinnenmutter, ist eine aufrechte Protestantin! Sie lebt auf dem Spandauer Schloss und setzt sich für unsere Sache ein!
Machelt: (verärgert) Aufrechte Protestantin? Das ändern doch nichts an den wahren Motiven des Kurfürsten! Seine Entscheidungen sind allein politisch motiviert. Glauben Sie wirklich, die Menschen in der Gemeinde profitieren von solch heuchlerischem Verhalten? Man kann nicht auf dem Rücken des Glaubens Karriere machen!
Wartenberg: (versucht zu vermitteln) Ich verstehe Ihren Frust, aber die Umstände sind komplizierter, als Sie es schildern. Der Kurfürst hat auch seine Verantwortung, und die Politik spielt eine große Rolle. Wir können nicht einfach alles über Bord werfen!
Machelt: (mit fester Überzeugung) Verantwortung oder nicht, die Menschen benötigen einen klaren Weg, keinen Kompromiss, der nur den Mächtigen nützt! Ich kann nicht mit einem guten Gewissen predigen, wenn die Grundlagen unseres Glaubens allein politisch motiviert sind!
Wartenberg: (mit Nachdruck) Aber eine radikale Abkehr von dieser Politik könnte unsere Gemeinde spalten! Wir brauchen ein gewisses Maß an Zusammenarbeit, um die Bevölkerung nicht gegen uns aufzubringen. Denken Sie an die Unruhen, die wir vermeiden müssen!
Machelt: (schnaubend) Unruhen? Wer den wahren Glauben aufgibt, der ist verloren! Ich kann nicht weiterhin in dieser Gemeinde sein, in der das Wohlstandsdenken über die Wahrheit siegt. Wenn es so weitergeht, sehe ich keinen Sinn mehr in meiner Berufung hier in Spandow!
Wartenberg: (verzweifelt) Herr Pfarrer, bitte! Lassen Sie uns einen Weg finden! Ihre Leidenschaft ist bewundernswert, aber ich bitte Sie, nicht aufzugeben. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, innerhalb dieses Systems zu arbeiten!
Machelt: (entschlossen) Ich habe diesen Weg bereits über viele Jahre eingeschlagen. Ich kann nicht vor dem Glauben kneifen, nur um mich an die bestehenden Verhältnisse anzupassen. Ich werde Spandow verlassen, da ich keine Aussicht auf eine echte Reform sehe, wie Sie mir gerade versichert haben!
Wartenberg: (traurig) Wenn das Ihre Entscheidung ist, kann ich Sie nicht aufhalten. Aber denken Sie daran, dass die Gemeinde Ihre Stimme dringend braucht. Manchmal ist es schwierig, zwischen Glauben und den Realitäten des Lebens zu navigieren. Es tut mir leid, dass es so enden muss.
Machelt: (seufzend) Es ist eine traurige Sache, Bürgermeister. Ein guter Hirte ist da, um den wahren Glauben zu verteidigen, und nicht dafür, seinen Posten zu verwalten, während die Menschen in der Unkenntnis bleiben. Möge Gott diese Gemeinde führen, auch ohne mich.
(Pfarrer Machelt dreht sich um und verlässt die Kirche, während Bürgermeister Wartenberg nachdenklich stehen bleibt, das Gewicht der Entscheidungen auf seinen Schultern spürend.)
2. Pfr. Johann Herz (1540-42)
Erst Pfarrer in Zerbst, Oberpfarrer in Spandow, ab 1542 Pfarrer in Tangermünde. Der Kaplan Johann Kaulitz verstarb, daher musste Johann Herz, der aus Zerbst berufen worden war, die Dienste im Kloster übernehmen.
In diesem Jahr 1540 konnte auch die Kirchturmspitze gemacht werden, die eigentlich schon bei der Jubelfeier ersetzt werden sollte.
Für die abgebrannte Kirchturmspitze erhielt Caspar Theißen, kurfürstlicher Obrist-Baumeister des begonnenen Schlosses 30 Gulden und 10.000 Steine mit einem Knopf von neuem Kupfer. Die Turmspitze wog 1½ Zentner, 59½ Pfund für insgesamt 42 Gulden und der Vergoldung desselben für 17 Gulden. Für ihn, die Arbeiten, dem Küfer und der Schieferdeckung gab der Rat 300 Gulden aus.
Die Nikolaikirche erhielt einen neuen Predigtstuhl für 12 Gulden 12 Gr., nebst Einbaukosten von 15 Gulden 9 Gr für Tischlermeister Thomas und den Schmied Klein. 28 Gr kosteten 4 neue Gesangbücher, sie gingen an den Schulmeister. Ebenso wurde ein neues Kruzifix gesetzt.
Der neue Stadtschreiber Andreas Forbiger (Ostern von Wittenberg gekommen) vermerkte: Pfr. Johann Herz hat aus Zerbst Weib und Kind hergeholt. Der Prädikant Johann Kaulitz hat in Spandow geheiratet und erhält 9 Schock 36 Gr.
Moritz Boediker und Wolff Darsikow waren hier Schulgesellen und Matthaeus Reinicke der Küster. Sie erhielten 20 Schock 32 Gr. aus siebenjähriger Schuld
Bürgermeister waren George Wartenberg, der in diesem Jahr starb, und Andreas Koch, neue Ratsmänner: Jacob Berg und Joachim Kramer.
1541 gab es die erste Kirchenvisitation in Spandow. Es erfolgte die vollständige Reformierung des Klosters.
Damit erlebte auch Staaken seine Kirchen- und Schulvisitation, bei der die Pfarrbesetzung dort endgültig geregelt wurde. Der Nachfolger Andreas Ebel wurde als zweiter Kaplan von Spandow aus den Einkünften der Pfarren in Staaken und Seeburg besoldet.
Der Kanzler Johann Weinleben, die Theologen Jacob Stratner und George Buchholzer hielten in Spandow die erste Schulvisitation. Dem Pfarrer sahen sie als Gehalt vor: 100 Gulden, freies Wohnen im Pfarrhaus, den Vier-Zeiten-Pfennig und Naturalien; dem Kaplan 50 Gulden, freie Wohnung und Naturalien. Für Staaken und Seeburg sollte ein weiterer Kaplan mit Pfarrrecht für die Orte kommen, aber auch in der Stadt helfen. Der Küster sollte freie Behausung, ½ Schock für das Zeigerstellen erhalten und 4 Schock für das Instandhalten der Kapellen auf dem Schloss und die Moritzkirche, 4 Pf. aus jedem Haus jährlich und 3 Schock aus dem Spendenkasten, wofür er das Läuten zu regeln hatte. Dem Schulmeister standen freie Wohnung in der Schule 45 Gulden und Naturalien zu, dem Schulgesellen 30 Gulden.
Die Georgen-Kapelle beim Hospital wurde geschlossen.
Das Kloster gehörte künftig mit allen geistlichen Lehen dem Landesherrn. Das Kloster hatte aber kein geistliches Lehen mehr, da sie sich des Dienstes der Pfarrer in der Pfarrkirche bedienten.
Das Jungfern Kapitel musste an den Rat das ‚ius patronatus‘ abtreten, der nun der Pfarrerwahl des kirchlichen Magistrats zustimmen musste.
Zum Erhalt von Kirche und Schule wurde dem Kloster Ersatz für die Zahlungen ins Pfarrhaus und an die Schule von den Visitatoren Abgaben auferlegt, für die Schule 1 Schock 45 Gr. und Naturalien. Das Kloster bekam einen Verweser.
Die Visitatoren erhielten: Johann Weinleb 10 Gold Gulden und Ehrwürden Jacob 8 Rheinische Gulden.
In der Kirche wurde ein Ratsstuhl gebaut und die ‚graue Zelle‘ (Küsterei) ausgebaut. Wegen des Knopfes auf dem Nikolai Kirchturm erhielt der Kupferschmied aus Berlin 8 Schock 51 Gr.
Ehrwürden Johann Herz erhielt eine Zusage für Sold auf vier Jahren 10 Schock 40 Gr.
Jubilate gab es eine böse Überraschung, denn in der Heide (Stadtforst) brannte es.
Angenehm konnte Pfr. Herz aber die neue Polizeiordnung sein:
Sie dringt wegen der nun mehrenden Erkenntnis auf ein anständiges Leben, empfiehlt die Furcht Gottes und die Liebe des Nächsten, verbietet die Lästerung Gottes, seines Wortes, der Mutter unseres Herren, setzt Strafen sogar für die, so solche Lästerungen hören und verschweigen. Ohne Erlaubnis des regierenden Bürgermeisters soll keiner vor der Messe hohen Predigt die Stadt verlassen, oder sich sonst aus der Stadt begeben, sondern jeder sich mit den Seinigen zur Predigt halten; auch niemand unter der Predigt oder Kommunion auf dem Markt oder sonst müßig stehen, oder aus Verachtung um den Kirchhof oder außerhalb des Tores spazieren gehen; noch in Wein- oder Bierschenken, viel weniger zum Branntwein mittlerer Zeit finden lassen, bei 4 Gr in den Gotteskasten und 4 Gr an den Rat als Strafe; wer aber solche Strafe nicht zu zahlen vermag, soll einen Tag und eine Nacht im Gefängnis dafür sitzen. Ebenso soll, wer in der Zeit dergleichen verkauft, bestraft werden; ausgenommen Kranke, denen nichts hiervon versagt werden soll.
Es soll niemand das Gesinde und Tagelöhner anders, als hier folgt, belohnen: Einen gemeinen Tagelöhner jedes Tages einen Groschen, einen Futterschneider Winters und Sommers des Tages zwei Groschen, einen Schnitter 10 Heller. Es soll niemand dem andern sein Gesinde abspenstig machen und wenn es sich vor der Zeit außer Dienst begibt, ohne Ersuchen des Herrn und wieder seinen Willen annehmen, bei Strafe eines Wispel Hafers. Wer viel Zanks und Widerwillen von wegen geringen Dinges erhebt und den anderen gröblich an Ehre und Glimpf antastet, was der Obrigkeit viel Mühe und Unlust verursacht, soll 2 Wispel Hafer, einen dem Rat und einen dem gemeinen Kasten geben; oder aber die Steine, wie vor alters geschehen, in der Stadt umtragen. Wer im Rathaus oder sonst vor dem Rat den anderen mit Worten angreift, Lügen straft und groß Geschrei hat, soll von Stund an vom Rathaus in Gehorsam gehen und Tage darinnen sein etc.
1542 wurde die Georgen-Kapelle abgerissen. Die Steine sollten für eine neue Pfarre gebraucht werden und die Reparatur der Grauen Zelle sollte damit finanziert werden. Die restlichen Einnahmen wurden der Nikolaikirche zugerechnet.
Kaspar von Klitzing wurde Verweser des reformierten Klosters. Der Rat holte Magister Wittstock, den Stadtschreiber von Wittenberg als neuen Kaplan – eine Gefälligkeit Melanchthons an den Rat anlässlich seines Besuchs bei der verwitweten Kurfürstin.
Die Kirche hatte inzwischen einen Kantor angestellt, der ein Ostergehalt von 2 Gulden erhielt, wie der Kirchenvorsteher Joachim Wartenberg vermerkte.
Dann heißt es: Als Prediger kam Mag. Johann Schmol – der erste mit akademischen Grad. Wie sein Vorgänger Heinrich Machelt blieb er nur zwei Jahren, kehrte aber mit dem Mag. Bochow zwölf Jahre später in der Zollstube ein.
Pfr. Herz war offenbar nur eine Interimslösung, denn es hieß ja: Mag. Johann Schmol … Vorgänger Heinrich Machelt. So ging Pfarrer Johann Herz (Cordus) als Pfarrer nach Tangermünde. Dass zu der Zeit noch eine ähnlich interessante Stadt wie Berlin und Stendal war, in der sich die Politik und die kirchliche Leitung des Landes Mark Brandenburg abspielte.
Ein Gespräch mit dem Reformator
(Der Ort des Gesprächs ist ein bescheiden eingerichtetes Zimmer im Schloss Spandow, umgeben von hohen Fenstern, durch die das Licht sanft auf die Holztische fällt. Pfarrer Johann Herz sitzt an einem Tisch, während Philipp Melanchthon ihm gegenüber Platz nimmt. Ein leichtes Aroma von Rotwein weht durch den Raum.)
Pfr. Herz: (mit einem freundlichen Lächeln) Hochgeschätzter Herr Melanchthon, es ist mir eine große Ehre, Sie hier in Spandow zu empfangen. Ihre Schriften und Lehren haben viele Herzen erleuchtet. Darf ich Sie fragen, was Sie für das Wesentliche des evangelischen Glaubens halten?
Melanchthon: (nickt dankbar) Es ist mir ebenfalls eine Freude, hier zu sein, lieber Pfarrer Herz. Der evangelische Glaube basiert auf der Gnade Gottes und der Rechtfertigung durch den Glauben allein. Es ist nicht unser Werk, das uns vor Gott rechtfertigt, sondern allein der Glaube an Christus.
Pfr. Herz: Die Rechtfertigung durch den Glauben? Können Sie das näher erläutern?
Melanchthon: Natürlich. Die Rechtfertigung durch den Glauben bedeutet, dass der Mensch allein durch den Glauben an Jesus Christus vor Gott gerechtfertigt wird, nicht durch die eigenen Werke oder Verdienste. Dieses ist das Herzstück unserer Lehre und der Schlüssel zu einem wahren Verständnis des Evangeliums.
Pfr. Herz: Aber warum ist das so entscheidend? Sind gute Werke nicht auch wichtig?
Melanchthon: Gute Werke sind in der Tat wichtig, aber sie sind das Ergebnis des Glaubens, nicht dessen Grundlage. Wenn wir glauben, dass unsere Werke uns vor Gott rechtfertigen, geraten wir in die Falle des Stolzes und der Selbstgerechtigkeit. Der Glaube hingegen demütigt uns und führt uns zu Christus, der allein unsere Sünden trägt.
Pfr. Herz: Das klingt einleuchtend. Aber wie können wir sicher sein, dass dieser Glaube uns wirklich rettet?
Melanchthon: Der Glaube ist nicht bloß ein Gefühl oder eine bloße Überzeugung. Er ist ein Vertrauen auf die Verheißungen Gottes, die uns in der Hl. Schrift gegeben sind. Wenn wir auf Christus vertrauen, sind wir gewiss, dass er uns annimmt und unsere Sünden vergibt. Die Gewissheit gibt uns Friede und Freude ins Herz.
Pfr. Herz: (mit Nachdruck) Und was ist mit denen, die von der Lehre abweichen? Müssen wir nicht auch für Wahrheit und Reinheit in der Lehre kämpfen?
Melanchthon: (ernst) Ja, das ist wahr. Wir müssen die Wahrheit verteidigen, aber auch mit Geduld und Liebe handeln. Wir sind nicht dazu berufen, zu verurteilen, sondern zu lehren und zu führen. Der Schlüssel liegt in der Balance zwischen Wahrhaftigkeit und Barmherzigkeit.
Pfr. Herz: (nachdenklich) Ihre Worte sind weise, Herr Melanchthon. Ich hoffe, dass wir in unseren Gemeinden diese Balance finden können. Es ist eine herausfordernde Zeit für uns alle.
Melanchthon: (nickt zustimmend) Ja, die Zeiten sind turbulent, aber die Botschaft des Evangeliums bleibt unverändert. Lassen Sie uns weiterhin für Einheit im Glauben beten und die Liebe Christi in unseren Herzen tragen.
(Das Gespräch geht weiter, während die beiden Männer über die Herausforderungen und Hoffnungen der reformatorischen Bewegung diskutieren, jeder in dem Wissen, dass ihr gemeinsames Streben um die Wahrheit und die Gnade Gottes sie verbindet.)
3. Pfr. Johann Schmo(o)l (1542-43)
Geb. in Frankfurt an der Oder, dort auch Prediger, von 1542-43 Oberpfarrer in Spandow. Johann Schmol kam mit der neuen Polizeiordnung und dem Abbruch der Georgenkirche.
Der Kurfürst, der sich jetzt auch ‚Des Heiligen Römischen Reichs Ober Feld Haupt Mann‘ nannte, erlaubte dem Rat ein zweites Hospital zu bauen. Dazu sollte die Mauer an der Kirche niedergebrochen werden, wo das neue Hospital erstehen sollte, so, dass die Kranken die Predigt hören können und an der Sakramentsverreichung teilhaben sollten.
Die Moritzkirche wurde 1543 durch den Kurfürsten an St. Vitus (15. Juni – Schutzheiliger der Gastwirte, Winzer und Bierbrauer u.a.) als ‚ecclesia parochalis‘, Pfarrkirche aufgeführt.
In den Konventen mit den Kollegen traf er Urban Dreibrot aus Dallgow, Johann v. Stechow aus Fahrland, Jakob Kortenbeck, der zum ev. Glauben konvertiert war, er wurde in Falkenrehde dann durch Heinrich Döbbecke abgelöst wurde, Nikolaus Werner aus Bornim und Johann Buschel aus Marwitz, der erste ‚Sofa-Konvent‘ (was meint: alle Pfarrer passen auf ein Sofa). Sie werden sicher neben theologischen Themen auch über die Tagesthemen gesprochen haben, denn Spandow und die anderen Orte musste eine ‚Türken-Steuer‘ zahlen, die der Kaiser von den Kurfürsten verlangte nebst Männer, die kämpfen sollten. Auch die ‚Musterer‘ mussten die Orte anteilig bezahlen.
1542 entstand aber auch der Dammweg, ein Reitweg für den Kurfürsten Joachim II. zum Jagdschloss Grunewald, der später deshalb Kurfürstendamm hieß.
1542 war aber auch das Jahr, indem die Klöster säkularisiert wurden – im Horizont der hiesigen Pfarrer ging es um Spandow, Lehnin und Chorin.
Über Johann Schmol weiß man nicht, wann er gestorben ist, denn ein Weggang ist nicht bekannt, auch kein Ziel, sprich eine andere Pfarre.
Chronik – kleiner Blick in die Welt
Die Spanier wüteten im Maya-Land und kolonisierten Mittel- und Südamerika.
Es gab in Europa Fehden wegen der Eintreibung der Türkensteuer (ernestinisches Sachsen – Kollegiatsstift Wurzen). Nur Philipp von Hessen und Martin Luther verhinderten einen offenen Krieg.
In Schweden gab es den Dacke-Aufstand, Bauern die nahe daran waren, König Gustav Wasa zu stürzen.
Die sechs Tage alte Maria Stuart wurde Königin von Schottland.
Die Mission in Indien begann in Goa.
Paul III. bewilligte die Inquisition, um die katholische Kirche vor Häresien zu schützen. Sechs Kardinäle bekamen Sonderrechte als Generalinquisitoren. Papst Paul III. hatte dabei besonders die Protestanten im Blick.
Gespräch
Pfarrer Urban Dreibrot (Dallgow) und Pfarrer Johann Schmol (Spandow) im Jahr 1542
Der Ort ist ein kleiner, bescheidener Raum in der Kirche von Dallgow. Ein Tisch steht in der Mitte, auf dem eine Kerze flackert. Draußen ist es kühl, und der Wind pfeift durch die Ritzen der Fenster.
Dreibrot: (setzte sich und schaute besorgt aus dem Fenster) Johann, ich kann nicht anders, als mir Sorgen um die Entwicklungen in unserem Land zu machen. Die Aktivitäten der Kurfürsten und Grafen, die sich dem Schmalkaldischen Bund anschließen, scheinen uns nicht zu schützen, sondern eher in einen Sturm zu münden.
Schmol: (nickte nachdenklich) Ja, Urban. Die Nachricht von der katholischen Liga und den Truppen des Kaisers erreichte uns wie eine dunkle Gewitterwolke. Ich fürchte, sie planen, uns mit Gewalt zu unterdrücken. Wenn der Papst seine Inquisitoren auf uns loslässt, wird es kein Entkommen geben.
Dreibrot: (lehnte sich zurück und betrachtete Schmol) Du sprichst von berechtigter Furcht, mein Freund. Doch lass uns nicht vergessen, dass wir nicht allein sind. Der Schmalkaldische Bund vereint viele Fürsten und Städte. Sie sind entschlossen, für die evangelische Lehre zu kämpfen. Wir haben eine gemeinsame Stärke.
Schmol: (mit einem besorgten Blick) Stärke allein wird uns nicht vor den Waffen der Kaiserlichen schützen. Was, wenn sie uns mit ihrer Übermacht überrennen? Was, wenn der Papst uns mit seinen Kardinälen und Inquisitoren verfolgt? Ich kann die Schreie der Verfolgten schon jetzt hören. Luther hatte recht. Die Päpste dieser Zeit sind wahrhaftig Teufel.
Dreibrot: (mit fester Stimme) Aber Johann, wir dürfen nicht vergessen, dass Gott auf unserer Seite ist. Die Wahrheit, die wir verkünden, ist stark. Die Herzen der Menschen können nicht so leicht durch Gewalt gebrochen werden. Auch in der Dunkelheit kann das Licht der Lehre leuchten. Das erleben wir doch gerade. Wir sind die erste und zweite Generation evangelischer Prediger in der Mark Brandenburg. Fast 1000 Ort haben sich für unsere Verkündigung und unsere Lehre entschieden.
Schmol: (seufzt) Du hast recht, Urban. Doch die Realität ist gnadenlos. Wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten. Was, wenn wir gezwungen werden, unsere Überzeugungen zu verleugnen? Was, wenn wir unsere Gemeinden verlieren?
Dreibrot: (legt beruhigend die Hand auf Schmol) Wir dürfen uns nicht von der Angst leiten lassen. Wir müssen unsere Gemeinden stärken, im Glauben und in der Einheit. Vielleicht sollten wir eine Versammlung einberufen, um die Gläubigen zu ermutigen und sie auf das vorzubereiten, was kommen könnte.
Schmol: (nickt, etwas aufmunterter) Das ist eine gute Idee. Wenn wir zusammenstehen und die Menschen in ihrem Glauben bestärken, könnte dies die Kraft entfalten, die wir benötigen. Aber was ist mit den Fürsten? Werden sie uns im Stich lassen, wenn es ernst wird?
Dreibrot: (lächelt leicht) Wir müssen Vertrauen in die Gnade Gottes setzen. Die Fürsten sind auch Menschen, und sie haben ihre eigenen Ängste. Doch die Lehre, die wir vertreten, ist nicht nur eine politische Sache. Es geht um das Seelenheil. Wenn wir standhaft bleiben, werden wir die Unterstützung finden, die wir brauchen. Das hat doch schon Paulus gesagt und den Herrschern deshalb eine besondere Zuwendung Gottes zugesprochen.
Schmol: (atmet tief durch) Du hast mir Hoffnung gegeben, Urban. Wir müssen uns zusammentun und das Wort Gottes verbreiten. Lass uns nicht nur auf das Unheil blicken, sondern auch auf die Möglichkeiten, die vor uns liegen.
Dreibrot: (nickt zustimmend) Ja, Johann. Gemeinsam werden wir nicht nur die Dunkelheit bekämpfen, sondern auch das Licht der Hoffnung in die Herzen der Menschen tragen. Lass uns beten und unsere Gemeinden stärken.
(Die beiden Pfarrer schlossen die Augen und beteten gemeinsam für Kraft und Weisheit in den kommenden Kämpfen, während die Kerze auf dem Tisch weiter flackerte und das Licht in den Raum warf.)
4. Pfr. Johann Gar(t)cäus (Gartz) (1543-1546)
Geb. 1502 in Spandau, ab 1529 Konrektor am Johanneum in Hamburg, ab 1534 Pfarrer in St. Petri (Hamburg), ab 1543 Oberpfarrer in Spandow, ab 1546 Pfarrer an Jakobi in Greifswald, ab 1551 Prof. der Theologie in Greifswald, ab 1554 Superintendent in Neubrandenburg (Mecklenburg). Gest. am 24.8.1558 in Neubrandenburg
Der neue Oberpfarrer Mag. Johann Gar(t)z (Garcaeus) bekam seine Besitztümer aus Hamburg durch den Marktmeister gebracht, was dem Rat 1 Schock 4 Gr ab Havelberg wegen der Verzehrkosten der vier Pferde und des Fuhrmanns und 14 Schock 66 Gr kostete, dazu zwei Reisen des Pfarrers mit seinem Besitz von Hamburg nach Havelberg.
Prediger Stephan Meier kam für ein Jahr. Sein Kollege Sebastian Stieglitz kam immerhin für vier Jahre.
Das Haus bei der Schule, in dem Magister Sebastian wohnte, der auch Kaplan war, wurde neu gedeckt und innen ein steinerner Flur gelegt.
Der Glaser verglaste das neue Haus des Rats am Kirchhof bei der Schule für 3 Schock 44 Gr.
In der Mönchszelle wurde ein Kachelofen gesetzt.
Die Kirche hatte einen Garten von B. Koch und Wollburg für 30 Gr gekauft, den der Pfarrer erhielt, um den ein Zaun für 25 Gr. aufgestellt wurde.
Pfarrer Garz erhielt auch Gelder, um im Filialdorf ein Pfarrhaus bauen zu können, Was ihn und seine Kollegen sehr entlastete.
Ebenso gab es auch 1544 wurde eine Verordnung besonderer Art für die Spandower in drei Teilen erlassen.
Ordnung
, wie man es in Stätten des Kurfürstentums der Mark zu Brandenburg mit Verköstigungen und Wirtschaften, und auch mit
Kindelbieren
(Verköstigung bei Kindstaufen) hinfüro halten solle.
Der Römischen Kaiserlichen Majestät Ordnung und Reformation guter Polizei zur Beförderung des Gemeinnutzes auf dem Reichstag zu Augsburg, Anno Domini 1548 aufgerichtet.
Des Rates der Oldenstadt Magdeburg Ordnung über Ehebrock, Gelöffte (Verlöbnisse), Werthschop (Hochzeiten) und Kleidung.
In 1. wird gesagt:
„… dass wir die Ordnung der Hochzeiten und Kindelbiere, so weiland unser gnädiger und freundlicher lieber Herr und Vater, seliger Gedächtnis, aufgericht, wiederum revidiert, in Druck verfertigen, und aufs Neue publizeren lassen wollen.“
Es folgen einzelne Bestimmungen:
„Und folgt erstlichen, wie viel Personen zu jeder Hochzeit zu bitten sind, und wie man es im Anfang derselbigen halten solle.“
Einzelbestimmungen dazu folgen: z. B. Wer Verköstigung oder Wirtschaft machen will, soll nicht mehr die sechs Bittern haben.
Es folgt über die Spielleute, Pfeifer, Trummenschleger.
Es folgt, wieviel ein jeder von den Einwohnern, zu seiner oder seiner Kinder Verköstigungen bitten soll.
Es folgt die Anzahl der Gerichte p.p.
Wie es des Dienstags, oder sonst des dritten Tages in der Hochzeit gehalten werden soll.
Von dem Entgegenreiten und dem Annehmen fremder Gesten.
Es folgt, wie es mit dem Geschenk, so man der Braut, und die Braut hinwieder pflegt zu geben, gehalten werden soll.“
Von den Brauthanen (Gebratenes zum Hochzeitsschmaus), wie und von welchen derselbige gebracht werden soll p.p.“
Dazu etliche Artikel die Polizei und den gemeinen Nutz betreffend, wie dieselbigen hinfür in dem Kurfürstentum der Mark zu Brandenburg sollen gehalten werden.
Gedruckt zu Frankfurt an der Oder durch Johann Eichhorn, MDL
Mag. Johann Gar(t)z (Garcaeus) hatte leider ständig mit dem Superintendenten Aepinus Streit. Gegenstand des Streites war u.a. die ‚Höllenfahrt Christi‘. Garcäus ging nach seiner Absetzung nach Greifswald, wo er Professor und später Rektor der Universität wurde. 1561 wurde er nach St. Katarinen in Brandenburg berufen und tat Dienst als Superintendent bis zu seinem Tod.
August: Richardsdorf (später Rixdorf, heute Berlin-Neukölln) geht in den Besitz der Stadt Cölln über.
In den Jahren 1543 bis 1546 ereigneten sich in Deutschland mehrere bedeutende historische Ereignisse, insbesondere im Kontext der Reformation und der religiösen Auseinandersetzungen.
Wichtige Punkte sind:
Fortschritte der Reformation (1543): In dieser Zeit setzte sich die reformatorische Bewegung unter Martin Luther und anderen Reformatoren fort. Luther veröffentlichte 1543 mehrere Schriften, darunter „Von der Wiedergeburt“, in der er die Bedeutung der inneren Erneuerung durch den Glauben betonte.
1543 veröffentlichte Luther auch die Schrift „Von den Juden und ihren Lügen“, die in der späteren Geschichte sehr kontrovers und problematisch war. Diese Schrift zeigt Luthers wachsende Frustration und Antipathie gegenüber den Juden, was in späteren Jahrhunderten zu großer Tragik führte, wohl aber damit zu tun hatte, dass er nicht vermochte, die Juden zur Konversion zu bewegen. Mission ist der jüdischen Religion fremd, denn wirklich Jude ist man dann, wenn die Mutter eine Jüdin war.
Kurfürst Joachim II. nahm wieder Juden in der Mark auf, als er von der Unschuld der 1510 verbrannten Juden hörte. Es hatte mit seinem Gerechtigkeitssinn zu tun. Die meisten warfen ihm aber wirtschaftliche Interessen vor, da Juden mehr Steuern zahlen mussten.
Der Schmalkaldische Krieg (1546-1547): Die Spannungen zwischen den protestantischen und katholischen Fürsten nahmen zu, was letztendlich zum Schmalkaldischen Krieg führte. Der Krieg begann zwar erst 1546, die Vorbereitungen und politischen Spannungen dafür reichten jedoch in diese Jahre zurück. Die Schmalkaldische Liga, ein Bündnis protestantischer Fürsten, war eine direkte Antwort auf die katholischen Bestrebungen, die Reformation zurückzudrängen.
Luthers letzte Jahre: Martin Luther selbst erlebte in diesen Jahren gesundheitliche Probleme, die sich auf seine Arbeit und seine Schriften auswirkten. 1546 starb Luther schließlich in Eisleben, was als ein bedeutendes Ereignis in der Geschichte der Reformation gilt.
In dieser Zeit festigten sich auch die religiösen Spaltungen zwischen den lutherischen und reformierten Bewegungen, was zu weiteren Konflikten und Debatten über die theologischen Unterschiede führte.
Die Jahre 1543 bis 1546 waren somit eine Zeit intensiver religiöser Auseinandersetzungen und politischer Umwälzungen in Deutschland, die die Grundlage für die zukünftige Entwicklung der protestantischen Kirchen und die Auseinandersetzungen mit der katholischen Kirche legten.
Ereignisse in der Mark Brandenburg
Im Zeitraum von 1543 bis 1546 erlebte die Mark Brandenburg signifikante Entwicklungen, sowohl politisch als auch religiös, die weitreichende Konsequenzen für die Region und deren Bevölkerung hatten. Diese Jahre fielen in die Zeit der Reformation, die die religiöse und gesellschaftliche Landschaft Europas nachhaltig veränderte. In Brandenburg war diese Periode insbesondere von den Bemühungen geprägt, den Protestantismus in der Region zu etablieren und die politische Macht seiner Herrscher zu festigen.
Zunächst ist zu erwähnen, dass der Kurfürst Joachim II. von Brandenburg (regierte von 1535 bis 1571) in dieser Zeit eine wesentliche Rolle spielte. Er versuchte, die protestantischen Lehren zu konsolidieren und deren Einfluss im Land auszubauen. Im Jahr 1543 gab es bereits erste Schritte in Richtung einer lutherischen Kirchenordnung in Brandenburg, was den Weg für eine umfassende Reform des kirchlichen Lebens ebnete. Joachim II. strebte eine gewisse Autonomie von den katholischen Traditionen an und wollte die politische Macht der Kurfürsten durch die Unterstützung der lutherischen Bewegung stärken.
Ein weiterer entscheidender Schritt in dieser Zeit war die Ausgestaltung der lutherischen Lehre im kirchlichen Alltag. Die Einführung der neuen Konfession in den Kirchen und die damit verbundene Reformierung der Gottesdienste war ein zentraler Aspekt, der auch die soziale Struktur der Gemeinden beeinflusste. Geistliche, die nicht den neuen Glaubensüberzeugungen folgten, wurden teilweise abgesetzt, was zu Spannungen innerhalb der Bevölkerung führte, da viele Menschen noch an den traditionellen katholischen Bräuchen festhielten.
In der Mark Brandenburg sorgte die Einführung des Protestantismus nicht nur für Veränderungen in der Religionsausübung, sondern auch für tiefgreifende soziale Umwälzungen. Das Ende der katholischen Vorherrschaft führte zu einem neuen Selbstverständnis der Menschen. ‚Bildung‘, die mit der Aufklärung in Verbindung gebracht wird, bekam einen neuen Stellenwert, da die lutherische Lehre viel Wert auf individuelles Lesen und das persönliche Verständnis der Bibel legte. Die Frage nach dem eigenen Glauben wurde künftig nicht mehr nur von der Obrigkeit vorgegeben, sondern wurde zu einem individuellen Bestandteil des Lebens.
Allerdings war die Zeit nicht nur von Fortschritt geprägt. Auch innerhalb der lutherischen Bewegung gab es unterschiedliche Strömungen und Meinungsverschiedenheiten. Diese internen Konflikte führten zu einem gewissen Maß an Spaltung, was sich auch in der Mark Brandenburg bemerkbar machte. Die Konfessionalität wurde ein entscheidendes Merkmal, das die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse prägte. Dabei war die Fähigkeit der Kurfürsten, die unterschiedlichen Strömungen zu vereinen und die Macht zu zentralisieren, von großer Bedeutung.
Man kann konstatieren, dass die Jahre 1543 bis 1546 für die Mark Brandenburg eine Zeit des Wandels waren, in der der Protestantismus seinen festen Platz in der Gesellschaft fand und die politischen Strukturen der Region entscheidend beeinflusste. Diese Veränderungen waren nicht nur religiöser Natur, sondern hatten auch tiefgreifende Auswirkungen auf die soziale und kulturelle Identität der Menschen im Herzen Brandenburgs. Die Mark Brandenburg wurde in dieser Zeit zu einem Zentrum der reformatorischen Bewegung in Deutschland, dessen Auswirkungen bis in die Neuzeit nachwirkten.
Streitgespräch über die Höllenfahrt Christi
Johann Garz (Garcaeus) und Superintendent Aepinus
Ort ist ein schlichtes, aber gemütliches Zimmer in einem Spandauer Pfarrhaus. Der Raum ist mit theologischen Büchern und Manuskripten gefüllt. Ein Tisch steht in der Mitte, auf dem eine Kerze flackert und zwei Becher stehen.
Johann Garz (Garcaeus): (mit einem nachdenklichen Ausdruck) Aepinus, ich kann nicht umhin, die Lehre von der Höllenfahrt Christi zu hinterfragen. Ist es wirklich notwendig zu glauben, dass unser Herr in die Hölle hinabstieg? Das scheint mir mehr eine menschliche Spekulation zu sein als eine biblische Wahrheit.
Aepinus: (mit fester Stimme) Garz, das Apostolische Glaubensbekenntnis spricht eindeutig von der Höllenfahrt. Es ist nicht nur eine Tradition, sondern eine tief verwurzelte Überzeugung in unserer Kirche. Christus hat den Tod und die Hölle besiegt, um uns die Hoffnung auf Erlösung zu bringen, aber eben auch den Gerechten, die vor Jesus auf Erden wandelten. Diese Lehre ist von zentraler Bedeutung für unser Verständnis von Gnade.
Garz: (skeptisch) Doch, wo finden wir die eindeutigen biblischen Belege für diese Höllenfahrt? Es gibt viele Passagen, die die Auferstehung betonen, aber die Vorstellung, dass er in die Hölle hinabstieg, ist nicht klar belegt. Wir sollten uns nicht in spekulativen Theorien verlieren, sondern die klare Botschaft des Evangeliums verkünden.
Aepinus: (energisch) Die Höllenfahrt ist keine Spekulation, sondern ein notwendiger Teil der Heilsgeschichte. Sie zeigt, dass Christus alles durchlebt hat, auch die tiefste Verzweiflung. Indem er die Hölle betrat, hat er den Menschen gezeigt, dass selbst der Ort des größten Schmerzes nicht außerhalb seiner Reichweite ist. Wir sollten diese Botschaft der Hoffnung nicht schmälern.
Garz: (mit Nachdruck) Aber Aepinus, ich befürchte, dass wir durch die Betonung der Hölle den Menschen mehr Angst als Trost bringen. Die Botschaft sollte die Liebe und Gnade Gottes in den Vordergrund stellen, nicht die Furcht vor der Verdammnis. Wir müssen die Menschen ermutigen, sich auf die Liebe Christi zu konzentrieren.
Aepinus: (seufzend) Darum geht es doch letztlich. Er bringt den Menschen, die vor dem Erlösungswerk Gottes lebten, die gute Botschaft, dass auch ihnen das Handeln Gottes gilt. Gottes Ewigkeit umfasst eben die Zeiten der Vergangenheit, der Gegenwart und der der Zukunft.
Garz: Wenn wir annehmen, dass Christus in die Hölle hinabstieg, um die Seelen der Verlorenen zu befreien, könnte dies den Eindruck erwecken, dass es einen Ort gibt, an dem Gottes Liebe nicht wirksam ist und wo Menschen für immer verloren sein können.
Diese Vorstellung könnte die Beziehung zwischen Gott und den Menschen stark belasten und den Glauben an einen gütigen, liebenden Gott untergraben. Wenn die Höllenfahrt als notwendig erachtet wird, um die Seelen der Gerechten zu befreien, könnte dies implizieren, dass Gottes Gnade nicht von Anfang an für alle Menschen verfügbar war, oder dass es einen Zustand gibt, in dem die Menschen von Gott getrennt sind, ohne Hoffnung auf Erlösung.
Aepinus: (beruhigend) Das ist ein berechtigter Punkt, Garz. Aber ich behaupte, dass die Höllenfahrt nicht als Werkzeug der Angst verwendet werden sollte. Vielmehr ist sie ein Zeichen der Hoffnung, dass niemand zu verloren ist, um von der Gnade Gottes erreicht zu werden. Es ist eine Botschaft, die uns ermutigen sollte, nicht uns ängstigen.
Garz: (seufzt) Ich verstehe deine Sichtweise, aber ich kann nicht zustimmen. Es gibt zu viele Fragen, die diese Lehre aufwirft. Ich glaube, dass wir als Pfarrer auch Verantwortung dafür tragen, wie wir solche Themen den Menschen nahebringen. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich meine Gedanken in einer anderen Umgebung weiterverfolge.
Aepinus: (mit einem bedauernden Blick) Du bist entschlossen, Garz. Ich respektiere deine Entscheidung, auch wenn ich hoffe, dass du deine Position noch einmal überdenkst. Die Theologie ist ein ständiger Dialog, und ich hätte mir gewünscht, dass wir zu einer Einigung kommen könnten.
Garz: (nickt langsam) Es tut mir leid, Aepinus. Ich werde nach Greifswald gehen, um dort als Pfarrer und Professor der Theologie zu wirken. Vielleicht kann ich dort neue Perspektiven finden und mit anderen über diese Fragen diskutieren. Es ist ja nicht nur diese Frage, die mich bewegt …
Aepinus: (mit einem seufzenden Lächeln) Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg, Garz. Möge deine Suche nach Wahrheit und Erkenntnis fruchtbar sein. Und vielleicht werden unsere Wege sich einst wieder kreuzen.
(Garz erhebt sich, nimmt seine Bücher und bereitet sich darauf vor, zu gehen. Aepinus bleibt nachdenklich zurück, während die Kerze auf dem Tisch langsam niederbrennt.)
5. Pfr. Christoph Lasius (1546-55)
Geb. 6.7.1504 in Straßburg, Universität Wittenberg, 1537-40 Rektor in Görlitz, 1543 Diakon in Greußen, 1545 Hofprediger in Dresden, 1546-55 Oberpfarrer in Spandow, 1561 Archidiakon in Küstrin, 1568 Superintendent in Cottbus, 1570-72 Oberpfarrer in Senftenberg. Gest. 25.8.1572 in Senftenberg. Sein Sohn, Christoph Lasius war 1572 Oberpfarrer in Senftenberg und ab 1574 Feldprediger.
Mit Mag. Christoph Lasius aus Wittenberg kam ein neuer Pfarrer nach St. Nikolai. Lasius galt als brillanter Prediger, als er aber eine Predigt gegen den Kaiser hielt, wurde er nach Berlin eingeladen. Das verlief überraschend positiv, denn wenige Jahre später wurde er in eine theologische Kommission berufen, die die Kontroverse um die Rechtfertigungslehre Luthers untersuchen sollte. Da er aber nach dem Augsburger Religionsfrieden 1555 weiter gegen die kathol. Kirche schimpfte, verstieß ihn der Generalsuperintendent Agricola. Er wurde später Superintendent in Cottbus und dann Oberpfarrer in Senftenberg, wo er auch starb.
Die geistlichen Kalandsbrüder von Wustermark zahlten ihre Pächte dieses Jahr und künftig an die Nikolaikirche.
Der Rat schickt den Stadtschreiber nach Wittenberg, um einen neuen Schulmeister zu holen: Martinus Gerow.
Invokavit wurde der neue Pfarrer Christophel Lasius aus Wittenberg geholt und Palmarum präsentiert. Mit zwei Stadtverordneten und dem Stadtschreiber musste er sich dem Kurfürsten in Berlin stellen, da er gegen den Kaiser gepredigt hatte.
Für die Jungfernschule wurden Tische und Bänke angeschafft.
Pfr. H. Lasius wurde Ostern aus Wittenberg geholt. Die Kosten für das Holen und das Geschenk zum Arbeitsbeginn (Rindfleisch): 2 Schock 17 Gr.
In der Kirchenrechnung fand sich ein Buch für einen armen Schüler Zeleke (der 1600 als Superintendent in Berlin starb).
Philipp Melanchthon erhielt weiterhin Jahr für Jahr Bier, Wein, Fische und Geschenke gesandt.
Neuer Prediger war Moritz Böttcher für drei Jahre, sein Kollege Prediger Leonhard Sorge blieb fast 30 Jahre.
Das Magister Lasius erhielt halbjährlich 20 Gulden.
Strafeinnahmen kamen von Peter Tiedike (Pankow – wegen Ehebruchs mit der Magd), Tewes Deus, Schulze in Pankow (sein Sohn hat jemanden erstochen) und Simon Waehse, Schulze in Staaken (hat seine Magd beschlafen und ein Kind gezeugt).
1. Kirchenvorsteher war Urban Schulze.
Der Kantor erhielt vierteljährlich 4 Gulden.
Ein Gespräch des Kurfürsten mit B. Wittstock, B. Lonies, Joachim Kramer, Pfr. Mag. Lasius, Pfr. Moritz Bodiker und Martinus von Delitz (Schulmeister zu Berlin), wie es in der Kirche mit der Religion gehalten wurde, fand in Berlin statt
Am 2. Februar (Reinigung der Maria) wurde ein Gerüst in der Nikolaikirche aufgestellt (für 46 Gr.) und die Historie der Geburt Jesu und des Schicksals der unschuldigen Kinder durch Herodes gespielt.
Auf dem Moritz-Kirchhof wurde in Richtung auf die Stadtmauer ein Gehege gebaut. In der Kirche wurde noch gepredigt, besonders die Fastenpredigten, bezahlt aus dem gemeinen Kasten in St. Moritz und St. Nikolai.
In der Kirchenabrechnung gab es Einnahmen vom Gewandschneider-Altar, dem Schuster-, Schützen- und Knochenhauer-Altar.
Der Garten des Kaplans erhielt ein Schloss,
Das Totengräberhaus auf dem Moritz-Kirchhof wurde erwähnt.
Die Pfarre erhielt für 8 Gr einen Herd.
Neuer Schulmeister wurde Magister Joachim von Stargard
Die Kämmerei hatte Einnahmen von 4170 Schock, 1 Gr 1 Pf und Ausgaben in Höhe von 3127 Schock 56 Gr 4 Pf.
Beschwerden des Rates über den Kurfürsten:
„1. Dass der Churfürst ihnen die Jagd wider ihre Privilegien und altem Brauch auf ihrer Heide und vor der Stadt unverschuldeter Sache verbiete und nehme.
2. dass er, wenn ein unächtgeborener ohne Leibes Erben sterbe und Güter nach sich lasse, diese Güter zu sich nehme, ungeachtet, dass davon das den dritten Teil vorhin die Richter bekommen;
3. dass der Amtmann sich unterstehe, auch unverhörter Sache, die Bürger gefänglich anzunehmen und in die Türme zu setzen, beyde in der Stadt und auf dem Schloss, ungeachtet sie keine handsame Tat begangen; welches wider des Rats Privilegium sei;
4. dass der Rat mit den Fuhren nicht wie vor Alters, etwas bis Dyrotz und Pausin, sondern wohl bis Brandenburg und Ruppin beschweret werde;
5. dass, wenn der Churfürst auf der Jagd sei und des Rats Pferde habe, die Pferde lange zu Berlin aufgehalten würden, auf des Rats Unkosten; auch, wenn ein Pferd des Rats in Churfürstlichen Diensten umkäme, es ihm nicht bezahlet werde;
6. dass der Churfürst das Wasser der Mittelmühle vor Teltow in andere Wege leiten ließe, wodurch die Mühle verderbt werde und die Armen des hiesigen Heiligen Geist Hospitals ihre Pacht nicht richtig bekämen;
7. dass er den Einwohnern der Stadt die Hütung, die sie seit Alters her in der Woche zwei Tage vor dem Mühlentor gehabt, verbieten lasse;
8. dass, wenn ein Diener der Mühle von Spandow verstürbe und etwas Geld auf der Behns in des Rats Gerichten nach sich lasse, er nicht haben wollte, dass desselben Erben Abschoss, wie kürzlich geschehen, davon geben sollten, ohngeachtet, dass wieder die Kaiserlichen Rechte und alten Gebrauch sei.
16 Gr erhielt Matthies Persiken aus der Kirchenkasse dafür, dass er in der Oberstube der Pfarre einen neuen Boden legte.“
Ein Leiter-Haus wurde auf dem Kirchhof St. Moritz erwähnt.
Zu Michaelis (29.Sept.) wurde der neue Schulmeister Mag. Mirow begrüßt.
Wegen des teuren Getreides musste aus dem gemeinen Kasten wieder für 23 Schock, 21 Gr 1 Pf Brot für die Armen gebacken werden.
Lehrer und Baccalauräen erhalten aus der Kirchenkasse zusätzlich 1 Taler für 4 Wochen Vertretung des Kantors in der Schule.
24 Gr wurden für versehentlich zerbrochene Scheiben im Pfarrhaus ausgegeben. Am Zaun des Pfarrgartens wurden Latten ausgetauscht.
Für 50 Schock 25 Gr 1 Pf wurden auf dem Kirchhof zwei Diakonat- Häuser gebaut.
Der Kantor erhielt 8 Gr für das Registrieren der Bücher.
Die Kirche kaufte 1551 zwei Körbe Brot für die Armen.
Die Moritzkirche musste auf Befehl des Joachim II. eine Glocke nach Hennigsdorf abgeben.
Spandow sollte den begabtesten Prediger nach Cölln schicken, damit der Osiandrische Streit beigelegt werden konnte.
Der Osiandrische Streit wurde zur Zeit der kirchenpolitischen Reformation in Deutschland um die Rechtfertigungslehre geführt, der die ‚essentielle Gerechtigkeit‘ des neuen Menschen behauptete. Dies sollte bedeuten, dass die Rechtfertigung des Menschen vor Gott darin bestehe, dass Christus als ewiges Wort Gottes im Menschen real präsent sei und der Mensch so durch die Gerechtigkeit Christi gerecht werde. Die Lutherischen, vor allem Philipp Melanchthon, warfen Andreas Osiander vor, die Grenze zwischen Rechtfertigung und Heiligung zu verwischen und zu lehren, dass der Mensch vor Gott durch seine guten Werke gerecht werde. Das war eine grobe Verzeichnung der Position Osianders, setzte sich aber durch, wie die 1558 erschienene Confessio Augustana bezeugt. Der Nürnberger Reformator Andreas Osiander wurde 1549 von Herzog Albrecht von Brandenburg-Ansbach, Herzog in Preußen, als Theologie-Professor an die 1544 neu gegründete Universität nach Königsberg berufen. Bis zu seinem Tode (1568) hielt der Herzog an der Lehre fest, und erst, als er verstarb, endete der Streit, denn der Osiandrismus als besondere Bekenntnisform war gescheitert.
Mag. Leonard, der Capellan, der Augustin Liepens Tochter geehelicht hatte, erhielt 3 Gr für das Reinigen der Moritzkirche.
Wegen der Uneinigkeit der Theologen in Frankfurt wurde in Spandow eine Theologentagung abgehalten, wo die Berliner Theologen mit 37 Gr verköstigt wurden. (2. Abendmahlsstreit in Frankfurt / Oder von 1552-9).
Zu Neujahr wurde im Rat gesungen, dafür erhielten der Schulmeister und die Schulgesellen 16 Gr.
Am 6. Februar spielte ein Berliner Organist Chlavichordio in der Nikolaikirche und erhielt 14 Gr. Zudem wurde durch Pfr. Lasius die ‚Historie der Susanna‘ als Spiel organisiert.
Am Veitstag (28.Juni) musste der Tuchmacher Valentin Schulz wegen Ehebruchs 100 Gulden Strafe zahlen.
Am Andreastag (30. Nov.) ließ Mag. Lasius ‚Die Komödie Phormio‘ aufführe. Eine Entführungskomödie von Terenz. Die Kosten von 1 Schock 20 Gr übernahm der Rat.
Der Rat stellte die Hebamme Ilse an und zahlte ihr 20 Gr vierteljährlich.
Zwischen Kloster und Hospital wurde eine Bewässerung angeführt.
1553 waren Kirchenvorsteher: Urban Schulze, Michel Schmidt, Moritz Schwarzkopf und Caspar Thiel.
Für 16 Gr schaffte die Kirche ein neues Psalterium an.
Christi Himmelfahrt ließ der Schulmeister und seine Schulgesellen ‚Comedia Andria‘ (Komödie des Terenz) aufführen.
Schüler haben im Rathaus gesungen – Spende 20 Gr.
Die Kirchenrechnung ging am Johannistag (24.Juni 1554) ein: „Die Kirche nahm 20 Gr von Brauthauben; 40 Gr von den Kiezern von Potsdam. Bei Abnahme der Rechnung wurde gespeist. Überhaupt fingen die Kirchenvorsteher auch an, bei Gelegenheit merklich auf Kirchenkasse etwas zu verzehren.“
Die Witwe Joachim I., Kurfürstin Elisabeth, starb im Schloss zu Spandow, ihrem Altenruhesitz.
„Am Pfingsttage erfuhr der Kurfürst, dass sie schwach geworden, eilte nach der Vesper zu ihr her, holte sie nach Cölln und in die Dechaney nächst dem Dom, der damals ledig stand, wo sie nach wenigen Tagen entschlief und in vigilia corporis Christi im Domstift herrlich zur Erde bestattet wurde. Sie war 72 Jahre alt und hier sehr geliebt und verehrt.“
Ereignisse in der Mark Brandenburg
In den Jahren zwischen 1546 und 1555 erlebte die Mark Brandenburg eine entscheidende Phase in ihrer Geschichte, geprägt von politischen, religiösen und gesellschaftlichen Umwälzungen, die tiefgreifende Auswirkungen auf die Region und ihre Bevölkerung hatten. Diese Zeit war nicht nur von den Auswirkungen der Reformation geprägt, sondern auch von den politischen Machtkämpfen, die zwischen den verschiedenen evangelischen und katholischen Fürsten in Deutschland stattfanden.
Im Jahr 1546 brach der sogenannte „Schmalkaldische Krieg“ aus, ein Konflikt, der zwischen den lutherischen Fürsten des Schmalkaldischen Bundes und dem katholischen Kaiser Karl V. entbrannte. Die Mark Brandenburg, unter der Herrschaft des Kurfürsten Joachim II. von Brandenburg, war in dieser Zeit ein zentrales Spielfeld für die Auseinandersetzungen zwischen den evangelischen und katholischen Kräften. Joachim II. stand auf der Seite des Schmalkaldischen Bundes und versuchte, die protestantischen Lehren in seiner Mark zu festigen und gleichzeitig die Interessen der landesherrlichen Macht zu wahren. Dieser Krieg stellte die Widerstandskraft der lutherischen Fürsten auf eine harte Probe und führte zu einer tiefen Spaltung innerhalb des Reiches.
Mit der militärischen Niederlage des Schmalkaldischen Bundes 1547 und der darauffolgenden Habsburger Herrschaft über weite Teile Deutschlands kam es zu einer vorübergehenden Rückkehr zur katholischen Vorherrschaft in der Mark Brandenburg. Diese Phase war geprägt von einer verstärkten Unterdrückung der lutherischen Bewegung und von Versuchen Karl V. und seinen Nachfolgern, die katholische Kirche wieder zu etablieren. Trotz dieser politischen Rückschläge blieb der Protestantismus in der Mark Brandenburg für viele Menschen ein zentrales Glaubenselement, was zu einem anhaltenden Widerstand gegen die katholische Herrschaft führte.
Ein herausragendes Ereignis in dieser Zeit war der Wormser Religionsfriede von 1555, der einen vorläufigen Frieden zwischen den katholischen und lutherischen Fürsten herstellte und den Grundstein für die sogenannte „Cuius regio, eius religio“-Regel legte, die den Herrschern das Recht einräumte, die Religionszugehörigkeit ihrer Untertanen zu bestimmen. Dieser Friede bedeutete für die Mark Brandenburg eine wichtige Wende, da er es den lutherischen Volks- und Herrschern erlaubte, ihren Glauben quasi legal und ohne weitere Verfolgung zu praktizieren. Die Einigung war zwar nicht von Dauer, aber sie schuf einen Raum für die weitere Etablierung des Protestantismus in der Region.
Die Entwicklungen in der Mark Brandenburg während dieser Jahre waren nicht nur von theologischen und politischen Kämpfen geprägt, sondern auch von tiefen gesellschaftlichen Veränderungen. Die lutherische Lehre förderte einen neuen Zugang zur Bildung, da das individuelle Bibelstudium und das Lesen in den Vordergrund traten. Dies führte zur Gründung von Schulen und zur Förderung von Bildung und Wissen, was langfristig die soziale Struktur des Landes veränderte.
Zu den gesellschaftlichen Auswirkungen gehörte auch die verstärkte Herausbildung neuer sozialer Schichten. Bauern und Handwerker, die sich mit den reformatorischen Ideen identifizierten und gegen die soziale Ungerechtigkeit kämpften, suchten nach neuen Wegen, um sich in der neuen religiösen Landschaft zu positionieren. Diese Aufbrüche führten zu einem Umdenken in den sozialen und wirtschaftlichen Strukturen der Mark Brandenburg.
So gab es in den Jahren 1546 bis 1555 für die Mark Brandenburg eine Zeit des Umbruchs und der Neuorientierung. Die Konflikte zwischen den evangelischen und katholischen Kräften sowie die politischen Machtspiele auf Reichsebene hatten nachhaltige Auswirkungen auf die Region. Der Protestantismus fand, trotz der Herausforderungen, weiterhin Anklang und etablierte sich als wesentlicher Bestandteil der kulturellen Identität der Mark Brandenburg. Diese Epoche legte den Grundstein für die weitere Entwicklung der Region und formte deren religiöses, kulturelles und soziales Gefüge für die kommenden Jahrhunderte.
Das Erleben des Pfarrers Mag. Christoph Lasius in Spandow als Oberpfarrer
Die Lebensgeschichte von Magister Christoph Lasius, einem bedeutenden Pfarrer des 16. Jahrhunderts, ist ein faszinierendes Beispiel für die Herausforderungen und Errungenschaften eines Geistlichen in einer Zeit des Umbruchs und der religiösen Kontroversen. Lasius, geboren am 6. Juli 1504 in Straßburg, war nicht nur ein brillanter Prediger, sondern auch ein engagierter Theologe, der in verschiedenen Positionen in der lutherischen Kirche tätig war. Sein Wirken als Oberpfarrer in Spandow (1546-1555) stellt einen entscheidenden Abschnitt seiner Karriere dar, geprägt von theologischen Auseinandersetzungen, sozialen Herausforderungen und einer tiefen Verpflichtung zur Gemeinde.
Theologische Herausforderungen und Kontroversen
Lasius' Zeit als Oberpfarrer war durch die Spannungen zwischen der lutherischen und der katholischen Kirche gekennzeichnet, die vor allem durch die Reformation und die nachfolgenden Religionskriege verstärkt wurden. Lasius' mutige Predigten, in denen er gegen den Kaiser und die katholische Kirche auftrat, brachten ihm nicht nur Anerkennung, sondern auch Schwierigkeiten ein. Seine Einladung nach Berlin, um sich für seine kritischen Äußerungen zu rechtfertigen, ist ein Beispiel für die Risiken, die er einging, um seine Überzeugungen zu vertreten. Diese Ereignisse verdeutlichen, wie eng Glaube und Politik in dieser Zeit miteinander verwoben waren und wie sich die Kirche in die gesellschaftlichen und politischen Fragen einmischte.
Engagement in der Gemeinde
Als Oberpfarrer in Spandow war Lasius nicht nur für die spirituelle Leitung der Gemeinde verantwortlich, sondern auch für das soziale Wohl seiner Gemeindemitglieder. Die Kirchenrechnung zeigt, dass er sich um die Unterstützung der Armen kümmerte, indem er Brot für Bedürftige backen ließ und für die Ausstattung der Jungfernschule sorgte. Solche Maßnahmen belegen sein Engagement für soziale Gerechtigkeit und die Förderung von Bildung, was in einer Zeit, in der viele Menschen in Armut lebten, von großer Bedeutung war. Die Anschaffung von Tischen und Bänken für die Schule und die Unterstützung von Schülern, wie die Bereitstellung eines Buches für einen armen Schüler, zeugen von seiner Weitsicht und seinem Verständnis für die Bedürfnisse seiner Gemeinde.
Kulturelle Impulse und Gemeinschaftsleben
Lasius trug auch zur kulturellen Bereicherung der Gemeinde bei. Die Aufführungen von Theaterstücken, wie „Die Komödie Phormio“ und die „Historie der Susanna“, zeigen, dass er die Kunst als ein wichtiges Mittel ansah, um die Gemeinde und die Stadt zu unterhalten und zu erziehen. Diese kulturellen Veranstaltungen förderten nicht nur die Gemeinschaft, sondern boten auch eine Plattform für die Auseinandersetzung mit moralischen und theologischen Themen. Lasius verstand es, die Lehren der Kirche in einen breiteren kulturellen Kontext zu integrieren, was die Relevanz des Glaubens im Alltag der Menschen unterstrich.
Konflikte mit der Obrigkeit
Die Spannungen zwischen dem Rat der Stadt und dem Kurfürsten, die in den Beschwerden des Rates über die Jagdrechte und andere Privilegien zum Ausdruck kommen, zeigen die Schwierigkeiten, mit denen Lasius und die Gemeinde konfrontiert waren. In einem solchen politischen Klima musste Lasius oft zwischen den Erwartungen der Obrigkeit und den Bedürfnissen seiner Gemeindemitglieder navigieren. Diese Herausforderungen erforderten Geschick und Diplomatie, um die Interessen der Gemeinde zu wahren und gleichzeitig die Beziehungen zur weltlichen Macht aufrechtzuerhalten.
Man kann also sagen, die Zeit von Magister Christoph Lasius als Oberpfarrer in Spandow war geprägt von theologischen, sozialen und kulturellen Herausforderungen. Sein Engagement für die Gemeinde, seine mutigen Predigten und seine kulturellen Initiativen machen ihn zu einer zentralen Figur in der lutherischen Kirche des 16. Jahrhunderts. Lasius' Erbe lebt nicht nur in der Geschichte der Stadt Spandow weiter, sondern auch in der Erinnerung an einen Geistlichen, der sich unermüdlich für die Belange seiner Gemeinde eingesetzt hat und dabei die Werte der Reformation lebte und verkörperte. Sein Wirken zeigte, wie eng Glaube, Gemeinschaft und Kultur miteinander verbunden sind und wie ein Pfarrer in turbulenten Zeiten eine wichtige Rolle im Leben seiner Gemeinde spielen kann.
Lehrgespräch
Kurfürst Joachim II. und Oberpfarrer Mag. Christoph Lasius
(Der Ort ist der kurfürstliche Palast in Berlin-Cölln, ein schlicht eingerichteter Raum mit einem großen Tisch, umgeben von Bücherregalen. Kurfürst Joachim II. von Brandenburg hat Oberpfarrer Mag. Christoph Lasius 1552 als Berater holen lassen.)
Kurfürst Joachim II.: (setzt sich und blickt Lasius aufmerksam an) Magister Lasius, ich habe von den jüngsten Auseinandersetzungen über die Lehren von Andreas Osiander gehört. Seine Ansichten scheinen die Gemüter zu erregen. Was sind denn die Hauptargumente, die seine Verfechter anführen?
Magister Lasius: (nickt respektvoll) Eure Durchlaucht, die Osiandrischen Lehren betonen vor allem die innere Gerechtigkeit Christi. Osiander argumentiert, dass der Gläubige nicht nur durch den Glauben an Christus gerecht wird, sondern dass die Gerechtigkeit Christi in den Gläubigen selbst wirkt. Er sieht die Gerechtigkeit als eine innere, transformative Kraft, die den Menschen von innen heraus erneuert.
Kurfürst Joachim II.: (nachdenklich) Das klingt nach einer tiefen Spiritualität. Aber welche praktischen Implikationen hat diese Sichtweise für die Gläubigen?
Magister Lasius: (lehnt sich leicht vor) Das ist in der Tat ein zentraler Punkt. Osiander und seine Anhänger betonen, dass der Mensch durch die Gerechtigkeit Christi nicht nur gerechtfertigt, sondern auch heilig gemacht wird. Dies könnte dazu führen, dass die Gläubigen sich weniger auf die äußeren Handlungen und die Einhaltung von Geboten konzentrieren, da die innere Gerechtigkeit als ausreichend erachtet wird.
Kurfürst Joachim II.: (hebt die Augenbrauen) Das könnte zu einer gefährlichen Nachlässigkeit führen, nicht wahr? Wenn die Menschen glauben, dass sie allein durch diese innere Gerechtigkeit gerettet sind, könnte das ihre moralische Verantwortung mindern.
Magister Lasius: (nickt zustimmend) Genau das ist mein Hauptkritikpunkt. Die Lehre könnte zu einem Missverständnis über die Rolle der Werke im Glaubensleben führen. Die Heiligen Schrift lehrt uns, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Ich befürchte, dass Osianders Ansatz den Gläubigen die Notwendigkeit nimmt, in der Welt aktiv Gutes zu tun und sich um ihre Nächsten zu kümmern.
Kurfürst Joachim II.: (überlegt) Und was ist mit der Frage der Rechtfertigung? Osiander spricht von einer anderen Art von Gerechtigkeit als die, die wir durch den Glauben empfangen. Wie steht es damit?
Magister Lasius: (erhebt die Hand) Hier liegt ein weiterer Streitpunkt. Die lutherische Lehre, die wir vertreten, besagt, dass die Rechtfertigung allein durch den Glauben geschieht, nicht durch die Werke oder durch eine innere Umwandlung. Osianders Lehre könnte die zentralen Prinzipien der Reformation untergraben und die Gläubigen in die Irre führen, indem sie ihnen ein falsches Bild von der Erlösung vermittelt.
Kurfürst Joachim II.: (nickt) Es ist also nicht nur eine theologische Debatte, sondern auch eine Frage der praktischen Auswirkungen auf das Leben der Gläubigen. Wie sollten wir als Führungspersönlichkeiten in der Kirche damit umgehen?
Magister Lasius: