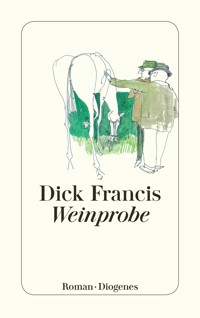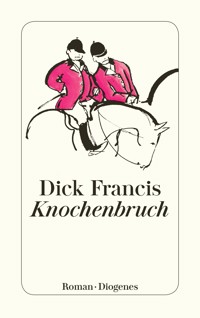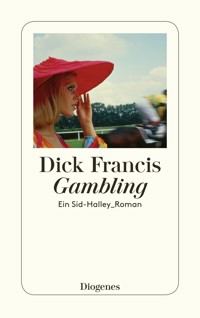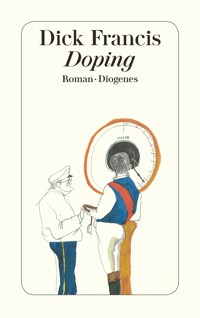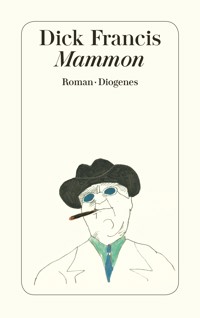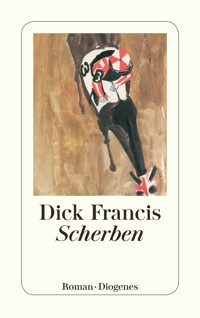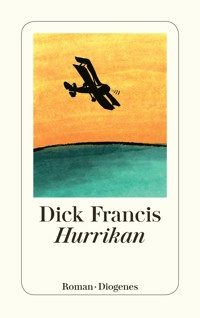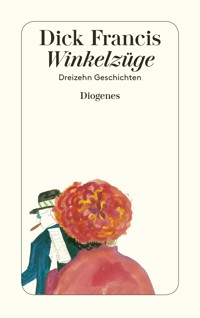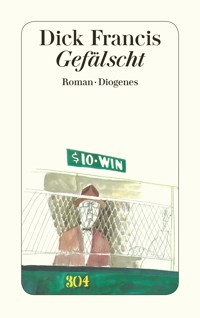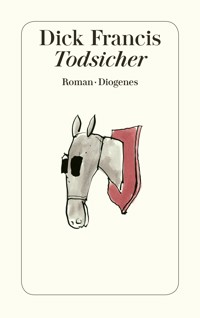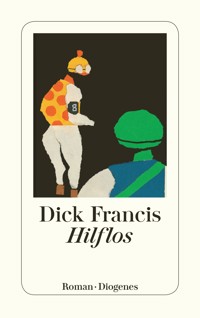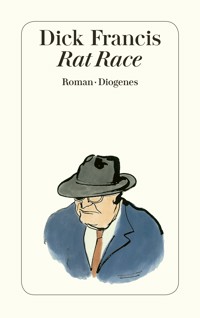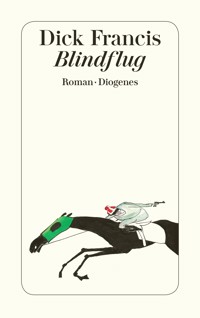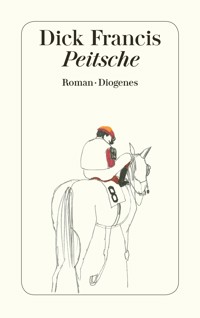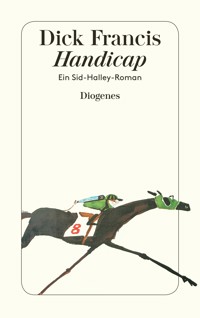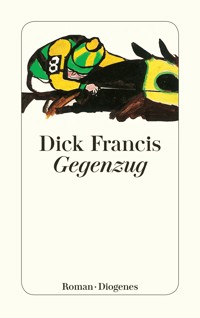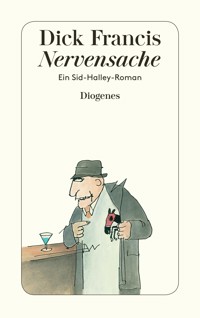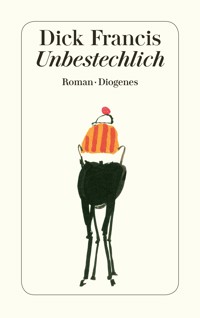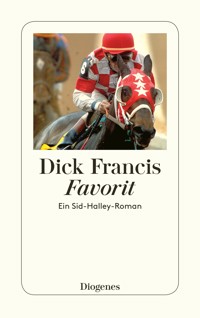
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Sid Halley
- Sprache: Deutsch
Gibt es etwas Heimtückischeres, als dem Pony eines todkranken Mädchens den Fuß abzuhacken? Ja, die Tatsache, dass Detektiv Sid Halley dem Schuldigen nichts anhaben kann. Denn der ist im ganzen Land bekannt – nicht als Täter, sondern als Talkmaster.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Dick Francis
Favorit
Ein Sid-Halley-Roman
Aus dem Englischen vonMalte Krutzsch
Titel der 1995 bei Michael Joseph Ltd.,
London, erschienenen Originalausgabe:
›Come to Grief‹
Copyright © 1995 by Dick Francis
Die deutsche Erstausgabe
erschien 1997 im Diogenes Verlag
Umschlagfoto von Rick Rickman (Ausschnitt)
Copyright © Rick Rickman/
New Sport/Corbis/Dukas
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright ©2015
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23093 2 (6. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60649 2
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
Im November 1994 hat BBC Radio 2 im Rahmen der Aktion Kinder in Not eine ›Auktion der unbezahlbaren Gelegenheiten‹ veranstaltet. Eines der Angebote lautete: »Ich leihe meinen Namen einer Figur im nächsten Roman von Dick Francis.«
Der Zuschlag erfolgte an Mrs.Patricia Huxford. Dick Francis war es eine große Freude, sie in Favorit auftreten zu lassen.
[7]1
Ich hatte einen Freund, und der war allgemein beliebt. (Mein Name ist Sid Halley.)
Ich hatte einen Freund, der war allgemein beliebt, und ich habe ihn vor Gericht gebracht.
Wenn man als Detektiv arbeitet, wie ich es seit annähernd fünf Jahren tue, dann bleibt es leider nicht aus, daß man hin und wieder Fakten zutage fördert, die Überraschungen und Entsetzen hervorrufen und Menschen für immer um ihren Frieden bringen.
Erst nach tagelangem innerem Kampf hatte ich mich entschließen können, meinen Ermittlungsergebnissen gemäß zu handeln. Dabei ging es mir elend, aber ich hatte nach Unglauben, Abwehr und Zorn schließlich doch auch das letzte Stadium der Trauer, die Hinnahme, erreicht. Ich trauerte um den Mann, den ich gekannt hatte. Den ich zu kennen geglaubt hatte, der aber immer nur eine Fassade gewesen war. Ich trauerte um den Verlust einer Freundschaft, um einen Mann, der noch so aussah wie sonst, aber ein anderer, ein Fremder geworden war… ein Gegenstand des Abscheus. Ich hätte viel leichter um ihn trauern können, wäre er tot gewesen.
Der Verwirrung, die ich insgeheim empfunden hatte, folgte ein allgemeiner Aufschrei, als ich mit meiner [8]Enthüllung an die Öffentlichkeit trat. Die Presse ergriff spontan und energisch für den Angeklagten Partei und ließ an mir, seinem Beschuldiger, kein gutes Haar. Auf den Rennbahnen, meinem Hauptarbeitsfeld, kannten mich alte Bekannte nicht mehr. Mein Freund wurde mit Zuneigung, Beistand und Trost überschüttet. Unglauben, Abwehr und Zorn herrschten vor: bis zur Hinnahme war es noch weit. Einstweilen wurde ich und nicht er zur Zielscheibe des Hasses erkoren. Ich wußte, es war nur auf Zeit. Man mußte es über sich ergehen lassen und abwarten.
Am Morgen, an dem sein Prozeß eröffnet wurde, brachte sich die Mutter meines Freundes um.
Die Nachricht erreichte sehr bald das Gericht in Reading, wo der vorsitzende Richter im schwarzen Talar bereits die Sachvorträge der Anklage und der Verteidigung gehört hatte und wo ich als Zeuge der Anklage allein in einem seelenlosen Nebenzimmer auf meinen Aufruf wartete. Ein Justizbeamter unterrichtete mich von dem Selbstmord und sagte mir, da der Richter die Verhandlung vertagt habe, könne ich nach Hause gehen.
»Die arme Frau«, rief ich in ungespieltem Entsetzen.
Der Justizbeamte hätte unparteiisch sein sollen, war aber doch auf der Seite des Beschuldigten. Er musterte mich ungnädig und sagte, ich solle am nächsten Morgen Punkt zehn wieder erscheinen.
Ich verließ das Zimmer und ging langsam durch den Korridor zum Ausgang, wurde aber vorher von einem Anwalt abgefangen, der mich beim Ellbogen faßte und beiseite zog.
»Seine Mutter hat sich ein Hotelzimmer genommen und ist aus dem sechzehnten Stock gesprungen«, sagte er ohne [9]Vorrede. »In einem Abschiedsbrief schrieb sie, sie könne die Zukunft nicht ertragen. Was halten Sie davon?«
Ich sah in die dunklen, intelligenten Augen von Davis Tatum, einem dicken, schwerfälligen Mann mit einem nüchternen, regen Verstand.
»Das wissen Sie besser als ich«, meinte ich.
»Sid!« Ein Anflug von Gereiztheit. »Sagen Sie mir, was Sie denken.«
»Vielleicht bekennt er sich jetzt schuldig.«
Er entspannte sich und lächelte ein wenig. »Sie haben Ihren Beruf verfehlt.«
Ich schüttelte dankend den Kopf. »Ich fange die Fische. Ausweiden könnt ihr sie.«
Er ließ meinen Arm wieder los, und ich ging vom Gericht geradewegs zum Bahnhof, fuhr eine halbe Stunde bis zur Endstation in London und nahm für die letzten anderthalb Kilometer bis nach Hause ein Taxi.
Ginnie Quint, dachte ich unterwegs. Arme, arme Ginnie Quint. Lieber war sie in den Tod gesprungen, als für alle Zeit unter der Schande ihres Sohnes zu leiden. Ein einsamer, plötzlicher Abgang. Ende der Tränen. Ende des Kummers.
Das Taxi hielt vor dem Haus am Pont Square (eine Seitenstraße von Cadogan Square), wo ich gegenwärtig ein Apartment im ersten Stock bewohnte und vom Balkon auf die eingezäunte, schattige Gartenanlage in der Platzmitte schauen konnte. Wie gewohnt war es ruhig auf dem abgelegenen kleinen Platz, nur ab und zu ein Auto und einige wenige Fußgänger. Es war Anfang Oktober – ein schwacher Herbstwind wehte in die schon welken Blätter der Linden und trug einzelne wie gelbe Schneeflocken zum Boden hin.
[10]Ich stieg aus und bezahlte den Taxifahrer durchs offene Fenster, und als ich mich umdrehte, um den Gehsteig zu überqueren und die wenigen Stufen zur Haustür hinaufzugehen, sprang ein dem Anschein nach ruhig daherkommender Mann mich plötzlich wütend an und machte Anstalten, mir mit einer langen schwarzen Metallstange den Schädel einzuschlagen.
Ich spürte mehr, als ich sah, wie er zum ersten bösen Schlag ausholte, und bewegte mich gerade noch so weit, daß die Stange statt meines Kopfes meine Schulter traf. Er schrie mich halb von Sinnen an, und ich wehrte einen zweiten brutalen Schlag mit dem Unterarm ab. Danach packte ich sein Handgelenk im Zangengriff, schob ihm ein Bein hinter die Kniekehle und kippte seinen schweren Körper hintenüber, so daß er mitsamt dem Eisen der Länge nach aufs Pflaster knallte. Er schimpfte, schrie, fluchte halb unverständliches Zeug und stieß Morddrohungen aus.
Das Taxi stand noch da, sein Dieselmotor lief, der Fahrer gaffte sprachlos mit offenem Mund, und daran änderte sich auch nichts, als ich den schwarzen Schlag aufriß und mich wieder auf die Rückbank fallen ließ. Mein Herz klopfte. Nun, was auch sonst?
»Fahren Sie«, sagte ich drängend. »Fahren Sie weiter.«
»Aber…«
»Machen Sie schon. Weg hier! Bevor er wieder auf die Beine kommt und Ihnen die Scheiben einschlägt.«
Der Fahrer klappte rasch den Mund zu, legte den Gang ein und fuhr ruckartig und nicht gerade schnell die Straße entlang.
»Hören Sie«, betonte er, halb zu mir gewandt, »ich habe [11]nichts gesehen. Sie sind meine letzte Fuhre, ich bin seit acht Stunden im Dienst und so gut wie auf dem Heimweg.«
»Fahren Sie bitte«, sagte ich. Zu wenig Atem. Zuviel Durcheinander im Kopf.
»Ich fahre ja… aber wohin?«
Gute Frage. Denk nach.
»Wie ein Straßenräuber sah der mir nicht aus«, stellte der Fahrer pikiert fest. »Aber heutzutage kann man nie wissen. Soll ich Sie bei der Polizei absetzen? Der hat Sie fürchterlich erwischt. Man konnte es richtig hören. Als ob er Ihnen den Arm gebrochen hätte.«
»Würden Sie einfach fahren, bitte?«
Der Fahrer war massig, um die Fünfzig und Londoner, aber nicht gerade selbstbewußt, und seine Kopfbewegungen und die bohrenden Blicke, die er mir wiederholt im Rückspiegel zuwarf, verrieten mir, daß er nicht in meine Probleme verwickelt werden wollte und es kaum erwarten konnte, mich loszuwerden.
Als sich mein Puls endlich beruhigte, fiel mir nur ein Ort ein, wo ich jetzt hinkonnte. Meine einzige Zuflucht in manchen früheren Notsituationen.
»Nach Paddington«, sagte ich. »Bitte.«
»Zum Krankenhaus, meinen Sie? St Mary’s?«
»Nein. Zum Bahnhof.«
»Aber da kommen Sie doch gerade her«, wandte er ein.
»Ja, aber fahren Sie mich bitte wieder hin.«
Gleich etwas fröhlicher gestimmt, wendete er und brachte mich zur Paddington Station, wo er mir abermals versicherte, daß er nichts gesehen und nichts gehört habe und sich in nichts hineinziehen lassen würde.
[12]Ich bezahlte ihn einfach, ließ ihn fahren und merkte mir seine Zulassungsnummer allenfalls aus Gewohnheit, nicht weil ich mir davon etwas versprach.
Als Teil meiner Standardausrüstung trug ich ein Mobiltelefon am Gürtel, und auf dem Weg in den hohen, luftigen Bahnhof tippte ich die Nummer des Mannes ein, dem ich am meisten auf der Welt vertraute. Konteradmiral a.D. Charles Roland, der Vater meiner Exfrau, meldete sich zu meiner großen Erleichterung nach dem zweiten Klingeln.
»Charles«, sagte ich. Meine Stimme kippte über, ohne daß ich es wollte.
Stille, dann: »Bist du das, Sid?«
»Kann ich… vorbeikommen?«
»Natürlich. Wo bist du?«
»Paddington. Ich nehme Bahn und Taxi.«
Er sagte ruhig: »Komm durch die Seitentür. Sie ist nicht abgeschlossen«, und legte auf.
Ich lächelte: Das war Charles, immer zuverlässig, ohne viel Worte. Als kühler, reservierter Mensch war er zwar nicht wie ein Vater zu mir und alles andere als nachsichtig, gab mir aber dennoch die Gewißheit, daß ihm an meinem Tun und Lassen sehr viel lag, und bot mir Halt und Unterstützung an, wenn ich sie brauchte. So wie ich sie jetzt gerade brauchte, aus verschiedenen mehr oder weniger zwingenden Gründen.
Da mitten am Tag weniger Züge nach Oxford fuhren, wurde es vier, bis das Oxforder Taxi den Weg zu Charles’ weitläufigem altem Haus in Aynsford zurückgelegt hatte und mich vor der Seitentür absetzte. Ich bezahlte ungeschickt den Fahrer – mein Arm war inzwischen steif [13]geworden – und betrat erleichtert den Riesenbau, den ich letztlich als mein Zuhause ansah, Fixpunkt in meinem mitunter ganz schön turbulenten Leben.
Charles saß wie so oft in dem großen Ledersessel, den ich unbequem hart fand, der aber ihm, dem Kompromißverächter, für sein schmales Hinterteil gerade richtig erschien. Irgendwann einmal hatte ich einen der weicheren, aber immer noch recht spartanischen alten Brokatsessel aus dem Wohnzimmer in das kleinere, von ihm »Offiziersmesse« genannte Zimmer gestellt, in dem wir immer saßen, wenn wir unter uns waren. Dort stand auch sein Schreibtisch, dort verwahrte er seine Angelfliegen, seine Bücher über die Seefahrt, seine unbezahlbare Sammlung historischer Orchesteraufnahmen und das speziell für ihn gefertigte Grammophon mit dem reibungsfrei laufenden Plattenteller, ein blitzendes Wunderding aus Marmor und Stahl, auf dem er sie abspielte. An den dunkelgrünen Wänden hingen Großaufnahmen von den Schiffen, die er befehligt hatte, sowie kleinere Fotos von Schiffskameraden, und vor kurzem hatte er auch ein Gemälde von mir als Jockey beim Sprung über ein Hindernis auf der Rennbahn von Cheltenham aufgehängt, ein Bild, das die Kraft und Energie, die man zum Rennreiten brauchte, genauestens einfing und das jahrelang weniger auffällig im Eßzimmer gehangen hatte.
Über dem schweren Goldrahmen war eine Beleuchtung angebracht, und als ich an diesem Nachmittag hereinkam, brannte sie.
Er legte das Buch, in dem er las, mit den Seiten nach unten auf seinen Schoß und musterte mich mit unbewegter Miene. Wie üblich verriet sein Gesichtsausdruck mir nichts. [14]Ich konnte die Gedanken anderer oft ziemlich gut lesen, aber seine kaum jemals.
»Hallo«, sagte ich.
Ich hörte, wie er Luft holte und sie langsam durch die Nase wieder ausstieß. Er musterte mich geschlagene fünf Sekunden lang, dann zeigte er auf das Tablett mit Getränken und Gläsern, das auf dem Tisch unter meinem Bild stand.
»Trink was«, sagte er knapp. Keine Einladung; ein Befehl.
»Es ist erst vier.«
»Egal. Was hast du gegessen heute?«
Ich schwieg, und das war ihm Antwort genug.
»Nichts«, meinte er nickend. »Das hab ich mir gedacht. Du siehst schmal aus. Daran ist dieser verfluchte Fall schuld. Ich dachte, du müßtest heute am Gericht sein.«
»Die Verhandlung ist auf morgen vertagt worden.«
»Nimm dir was zu trinken.«
Gehorsam ging ich zum Tisch hinüber und sah mir die Flaschen an. Altmodisch, wie er war, hatte er Brandy und Sherry in Karaffen umgefüllt. Der Scotch – Famous Grouse, seine Leibmarke – war noch in der Flasche mit dem Schraubverschluß. Ich würde Scotch nehmen müssen, dachte ich und war mir noch nicht einmal sicher, ob ich mir den selbst einschenken konnte.
Ich warf einen Blick auf mein Bild. Damals, vor sechs Jahren, hatte ich zwei Hände gehabt. Damals war ich britischer Champion der Hindernisjockeys gewesen: gesund, unversehrt und wohl auch fanatisch. Ein Horrorsturz hatte dazu geführt, daß der scharfe Huf eines Pferdes mir die linke Hand halb abriß – das Ende einer Laufbahn und, wenn man es so nennen konnte, die Geburt einer anderen: die schwere, [15]sich über zwei Jahre hinziehende Geburt eines Detektivs, während deren ich dem nachtrauerte, was ich verloren hatte, und dahintrieb wie ein steuerloses Wrack, das zwar nicht unterging, aber dennoch nicht seetüchtig war. Ich schämte mich dieser zwei Jahre. Sie endeten damit, daß ein brutaler Schurke mir die unbrauchbare Hand endgültig zerschlug und dadurch meine Lebensgeister so weit weckte, daß ich mir eine neue Hand zulegte – eine myoelektrische Prothese, die Nervenimpulse aus meinem Unterarmstumpf umsetzte und so lebensecht aussah und funktionierte, daß die Leute sie oft gar nicht als künstlich wahrnahmen.
Im Augenblick hatte ich das Problem, daß sich ihr Daumen nicht weit genug von den Fingern abspreizen ließ, um die schwere Glaskaraffe mit dem Brandy zu ergreifen, und daß auch meine rechte Hand nicht sonderlich zu gebrauchen war. Bevor ich noch Alkohol auf Charles’ Perserteppich schüttete, gab ich es lieber auf und setzte mich in den Goldbrokatsessel.
»Was ist los?« fragte Charles unvermittelt. »Weshalb bist du gekommen? Warum nimmst du dir nichts zu trinken?«
Nach einem Zögern sagte ich dumpf, in dem Bewußtsein, daß es ihm weh tun würde: »Ginnie Quint hat sich umgebracht.«
»Was?«
»Heute morgen«, sagte ich. »Sie ist aus einem Fenster im sechzehnten Stock gesprungen.«
Sein feinknochiges Gesicht erstarrte, und er sah gleich viel älter aus. Ein Schatten legte sich auf die freundlichen Augen, als wären sie in ihre Höhlen zurückgetreten.
Charles hatte Ginnie Quint seit mindestens dreißig [16]Jahren gekannt; er hatte sie gemocht und war oft Gast in ihrem Haus gewesen.
Auch ich hatte lebhafte Erinnerungen an sie. An eine freundliche, füllige, mütterliche Frau, die in ihrer Rolle als Dame eines großen Hauses aufging, mit ihrem Reichtum nicht angab, aus Überzeugung in mehreren karitativen Einrichtungen tätig war und sich am Ruhm und am Erfolg ihres prominenten, gutaussehenden einzigen Sohnes freute, der allseits beliebt war.
Ihr Sohn Ellis, den ich vor Gericht gebracht hatte.
Ginnie hatte mich, als wir uns zuletzt begegnet waren, mit ungläubiger Verachtung angestarrt und mich gefragt, wie in aller Welt ich dazu käme, ausgerechnet Ellis vernichten zu wollen, der mich als Freund ansah, mich mochte, mir oft sein Wohlwollen erwiesen hatte und der sein Leben in meine Hände gelegt haben würde.
Ich hatte ihren Wutanfall über mich ergehen lassen, ohne mich zu rechtfertigen. Ich wußte genau, was sie empfand. Unglauben, Abwehr und Zorn… Der Gedanke an das, was er getan hatte, war ihr so gräßlich, daß sie die Möglichkeit seiner Schuld von vornherein ausschloß, wie es fast alle anderen auch taten, nur daß der Vorwurf sie ins Herz traf.
Die meisten Leute meinten, ich sei im Irrtum und hätte nicht Ellis, sondern mir selbst das Leben ruiniert. Auch Charles hatte zunächst zweifelnd gefragt: »Sid, bist du sicher?«
Ja, hatte ich geantwortet. Und wie verzweifelt hatte ich nach einem Ausweg – irgendeinem Ausweg – gesucht, denn mir war völlig klar, was ich mir einhandelte, wenn ich konsequent blieb. Und es war dann mindestens so schlimm [17]gekommen, wie ich befürchtet hatte, ja in mancher Hinsicht schlimmer. Nachdem die Bombe geplatzt war und ein Verbrechen aufgeklärt zu sein schien, das halb England nach dem Kopf des Täters hatte schreien lassen (aber nicht nach Ellis’ Kopf, um Gottes willen, das war doch undenkbar!), danach also gab es den ersten Gerichtstermin, die Anordnung der Untersuchungshaft (ein Skandal, natürlich hätte er gleich gegen Kaution freigelassen werden müssen!), und danach schwieg die Presse über den Fall, wie das britische Gesetz es bei noch nicht entschiedenen Rechtssachen verlangt.
Nach diesem Gesetz darf zwischen Haftanordnung und Prozeß die Beweislage nicht öffentlich erörtert werden. Hinter den Kulissen konnte weiter ermittelt und eine Strategie für die Prozeßführung ausgearbeitet werden, doch weder potentielle Geschworene noch der Mann auf der Straße durften Einzelheiten darüber erfahren. Mangels Informationen war die öffentliche Meinung dann auch im »Ellis ist unschuldig«-Stadium steckengeblieben, und ich wurde seit nunmehr drei Monaten mit Dreck beworfen.
Ellis nämlich war ein Märchenprinz, ein Held. Ellis Quint, ehemals bester Amateurreiter über die Hindernisse, war am Fernsehhimmel auferstanden als Komet, ein strahlender, lachender, stets glänzend aufgelegter Unterhalter, dessen Sportquiz Millionen anschauten; er war der König der Talkmaster, das Kindern gepriesene Vorbild, der funkelnde Stern, dessen Auftritte Land und Leute regelmäßig froher stimmten und der sowohl Würdenträger wie auch Träger schirmverkehrt aufgesetzter Baseballmützen ansprach. Unternehmer rissen sich darum, ihn als Werber für [18]ihre Produkte zu gewinnen, und jeder zweite Jugendliche Englands präsentierte sich wie er als harter Bursche in Jeans und aufgestylten Reitstiefeln nach Jockeyart. Und diesen Mann, diesen Leitstern, wollte ich auslöschen.
Niemand widersprach dem Kolumnisten, der in einer Boulevardzeitung geschrieben hatte: »Grün vor Neid versucht der einst hochgeschätzte Sid Halley ein Talent zu demontieren, an das er nicht im Traum heranreicht…« Über ganze Spalten ging die Mär vom »gehässigen Kleingeist, der seine eigenen Schwächen zu kompensieren versucht«. Ich hatte Charles von all dem nichts gesagt, aber er wußte es von anderen.
Das Telefon an meinem Gürtel summte plötzlich, und ich nahm es ab.
»Sid… Sid…«
Die Frau am anderen Ende weinte.
»Sind Sie zu Hause?« fragte ich.
»Nein… im Krankenhaus.«
»Sagen Sie mir die Nummer, und ich rufe gleich zurück.«
Ich hörte Gemurmel im Hintergrund, dann kam jemand anders an den Apparat, sachlich, beherrscht, las eine Nummer vor und wiederholte sie langsam. Ich tippte die Zahlen in mein Handy, so daß sie auf der kleinen Anzeige erschienen.
»Gut«, sagte ich und ließ mir die Nummer noch einmal bestätigen. »Legen Sie bitte auf.« Dann fragte ich Charles: »Darf ich dein Telefon benutzen?«
Er winkte nonchalant zum Schreibtisch hin, und ich tippte die Nummer in seinen Apparat, um die Verbindung wiederherzustellen.
[19]Die sachliche Stimme meldete sich sofort.
»Ist Mrs.Ferns noch da?« sagte ich. »Hier ist Sid Halley.«
»Bleiben Sie dran.«
Linda Ferns drängte ihre Tränen zurück. »Sid… Rachels Zustand hat sich verschlechtert. Sie fragt nach Ihnen. Können Sie zu ihr kommen? Bitte.«
»Wie ernst ist es?«
»Ihre Temperatur steigt und steigt.« Ein Schluchzen unterbrach sie. »Sprechen Sie mit Schwester Grant.«
Ich sprach mit der sachlichen Stimme, Schwester Grant.
»Wie ernst ist es mit Rachel?«
»Sie fragt dauernd nach Ihnen. Wann können Sie sie besuchen?«
»Morgen.«
»Geht es nicht heute abend?«
Ich sagte: »Steht es so schlimm?«
Einen Augenblick war es still, weil sie wegen Linda, die bei ihr war, nicht frei sprechen konnte.
»Kommen Sie heute abend«, wiederholte sie.
Heute abend. Du guter Gott. Die neunjährige Rachel Ferns lag zweihundertfünfzig Kilometer entfernt in einem Krankenhaus in Kent. Todkrank, wie es sich jetzt anhörte.
»Versprechen Sie ihr«, sagte ich, »daß ich morgen komme.« Ich erklärte, wo ich war. »Morgen früh muß ich in Reading am Gericht sein, aber sobald ich da fertig bin, komme ich Rachel besuchen. Sie kann sich darauf verlassen. Ich komme bestimmt. Sagen Sie ihr, daß ich ihr sechs Perücken mitbringe und einen Engelbarsch.«
Die sachliche Stimme versicherte: »Ich sage es ihr«, und fügte dann hinzu: »Ist es wahr, daß die Mutter von Ellis [20]Quint sich umgebracht hat? Mrs.Ferns sagt, jemand, der es im Radio gehört hat, habe es ihr erzählt. Sie möchte wissen, ob es stimmt.«
»Es stimmt.«
»Kommen Sie, sobald Sie können«, sagte die Schwester und hängte ein.
Ich legte den Hörer auf. Charles sagte: »Die Kleine?«
»Es hört sich an, als ob sie stirbt.«
»Du wußtest, daß das kommen würde.«
»Für die Eltern wird es darum nicht leichter.« Ich setzte mich langsam wieder in den Goldbrokatsessel. »Ich würde ja heute abend fahren, wenn sie damit zu retten wäre, aber…« Ich brach ab, da ich nicht weiterwußte, denn wie hätte ich erklären sollen, warum ich nicht fuhr? Nicht fahren konnte. Nur gefahren wäre, wenn ich ihr die Rettung hätte bringen können, die es nicht gab, so sehnlich man es sich auch wünschte.
Charles sagte knapp: »Du bist doch gerade erst angekommen.«
»Ja.«
»Was enthältst du mir denn sonst noch vor?«
Ich schaute ihn an.
»Ich kenne dich zu gut, Sid«, sagte er. »Es ist nicht nur Ginnie. Das hättest du mir auch am Telefon erzählen können.« Er schwieg. »Mir kommt es vor, als seist du aus dem üblichen Grund gekommen.« Er hielt wieder inne, aber ich sagte nichts. »Weil du Schutz suchst«, sagte er.
Ich setzte mich anders hin. »Bin ich so durchsichtig?«
»Schutz wovor?« fragte er. »Was ist passiert… wenn es so dringend ist?«
[21]Ich seufzte. Ich sagte so ruhig wie möglich: »Gordon Quint hat versucht, mich umzubringen.«
Gordon Quint war Ginnies Mann. Ellis war ihr Sohn.
Charles verschlug es die Sprache; er saß da mit offenem Mund, und das wollte bei ihm etwas heißen.
Nach einer Weile sagte ich: »Als sie vertagt hatten, bin ich per Bahn und Taxi nach Hause gefahren. Gordon Quint hat am Pont Square auf mich gewartet. Gott weiß, wie lange er schon dort war, seit wann er gewartet hatte, aber jedenfalls hat er mir mit einer Eisenstange aufgelauert.« Ich schluckte. »Er wollte sie mir an den Kopf schlagen, aber ich konnte irgendwie ausweichen, und so traf er die Schulter. Er holte noch mal aus… Na ja, meine Roboterhand ist nicht ohne. Ich habe ihn damit am Arm gepackt, mein schwer erarbeitetes Judo an ihm praktiziert und ihn auf den Rücken geworfen… und er schrie immer nur, ich hätte Ginnie umgebracht… ich hätte sie umgebracht.«
»Sid.«
»Er war halb verrückt… wirklich durchgedreht… Er sagte, ich hätte seine ganze Familie auf dem Gewissen. Ich hätte ihnen allen das Leben ruiniert… Dafür würde ich sterben… er würde mich schon kriegen… Dich krieg ich… Ich glaube nicht, daß er wußte, was er da sagte, es ist so aus ihm rausgeplatzt.«
Charles sagte benommen: »Und was hast du gemacht?«
»Der Taxifahrer war noch dort, er saß da wie betäubt, also bin ich wieder eingestiegen.«
»Du bist wieder…? Ja, aber… was war mit Gordon?«
»Den ließ ich da liegen – auf dem Gehsteig. Er schwor mir Rache und rappelte sich schon wieder auf und… schwang [22]die Eisenstange. Ich, ehm… ich möchte heute lieber nicht nach Hause fahren, wenn ich hierbleiben kann.«
Charles sagte leise: »Natürlich. Das weißt du doch. Du hast mir selbst schon gesagt, hier sei dein Zuhause.«
»Ja.«
»Dann handle auch danach.«
Ich handelte danach, sonst wäre ich gar nicht zu ihm gefahren. Charles und seine Zuverlässigkeit, seine Bestimmtheit, hatten mich schon früher vor dem Zusammenbruch bewahrt, und eigenartigerweise war durch das Scheitern meiner Ehe mit seiner Tochter Jenny und durch unsere Scheidung mein Vertrauen in ihn nicht verlorengegangen, sondern gestärkt worden.
Aynsford bedeutete mir eine Atempause. Ich würde schon beizeiten zurückfahren und die Bombe Gordon Quint entschärfen; ich würde unter Eid vor Gericht aussagen und einen Mann in seine Bestandteile zerlegen; ich würde Linda Ferns in den Arm nehmen und, wenn es noch ging, Rachel zum Lachen bringen; aber heute nacht wollte ich mich bei Charles in meinem gewohnten Zimmer ausschlafen, damit der versiegte Brunnen innerer Widerstandskraft sich wieder füllen konnte.
Charles sagte: »Hat Gordon dich, ehm… mit dem Eisen verletzt?«
»Eine Prellung oder so.«
»Deine Prellungen kenne ich.«
Ich seufzte wieder. »Ich glaube, er hat mir… einen Knochen gebrochen. Am Arm.«
Sein Blick ging sofort zu meinem linken Arm, dem mit der Prothese.
[23]»Nein«, sagte ich, »am anderen.«
Entgeistert sagte er: »Am rechten Arm?«
»Ja, schon. Aber nur die Elle, das ist der Unterarmknochen auf der Seite, wo der kleine Finger liegt. Zum Glück nicht auch die Speiche. Der Speichenknochen wirkt jetzt als natürliche Schiene.«
»Aber Sid…«
»Besser als mein Schädel. Ich hatte die Wahl.«
»Wie kannst du dich darüber lustig machen?«
»Ja, nicht wahr? Ist doch wirklich zum Heulen.« Ich lächelte ungezwungen. »Gräm dich nicht so, Charles. Das heilt schon. Beim Rennreiten habe ich mir denselben Knochen schon mal schlimmer gebrochen.«
»Aber da hattest du noch zwei Hände.«
»Ja, das stimmt. Wärst du also so gut und würdest mir aus der verdammt schweren Brandykaraffe einen kräftigen schmerzstillenden Schluck in ein Glas gießen?«
Wortlos stand er auf und kam meinem Wunsch nach. Ich dankte ihm. Er nickte. Ende der Transaktion.
Als er sich wieder hingesetzt hatte, sagte er: »Der Taxifahrer war also Zeuge.«
»Der Taxifahrer will damit nichts zu tun haben.«
»Wenn er’s aber gesehen hat… Er muß doch gehört haben…«
»Er sei blind und taub, hat er betont.« Ich trank genüßlich das pure Feuerwasser. »Mir ist das auch ganz recht so.«
»Aber Sid… «
»Hör mal«, argumentierte ich, »was soll ich denn machen? Anzeige erstatten? Klagen? Gordon Quint ist normalerweise ein besonnener, biederer Bürger um die Sechzig. [24]Er ist nicht irgendein Totschläger. Zudem ist er ein alter Freund von dir, und auch ich war schon bei ihm zu Gast. Aber er haßt mich dafür, daß ich seinem heißgeliebten Ellis am Zeug flicke, und jetzt hört er auch noch, daß Ginnie sich umgebracht hat, weil sie nicht ertragen konnte, was auf sie zukam. Was meinst du also, wie Gordon zumute ist?« Ich schwieg. »Ich bin bloß froh, daß er mir nicht den Hirnkasten eingeschlagen hat. Und damit du’s weißt, das freut mich für ihn genauso wie für mich.«
Charles schüttelte resigniert den Kopf.
»Kummer kann gefährlich sein«, sagte ich.
Das konnte er nicht bestreiten. Tödliche Rache war so alt wie die Menschheit.
Wir saßen in stiller Eintracht beieinander. Ich trank Brandy und fühlte mich schon besser. Knoten der Anspannung lösten sich in meinem Bauch. Ich versprach mir, nahm mir vor, gelobte, in Zukunft keine allzu gefährlichen Gauner mehr zu jagen – aber ich hatte solche Vorsätze schon öfter gefaßt und mich nie daran gehalten.
Warum ich es machte, fragte ich mich längst nicht mehr. Es gab tausend andere Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben und seine Brötchen zu verdienen. Andere Exjockeys wurden Trainer oder Kommentatoren oder übernahmen amtliche Funktionen im Rennsport; nur mich drängte es anscheinend, in den verborgenen Randzonen herumzupaddeln und die Sorgen und Zweifel von Leuten auszuräumen, die aus irgendeinem Grund nicht die Polizei oder die Rennsportbehörden bemühen wollten.
Es war ein Bedarf vorhanden, den ich mit meiner Arbeit deckte, sonst hätte ich wohl untätig herumgesessen und [25]Däumchen gedreht. Aber selbst im derzeitigen Klima der allgemeinen Ächtung wurden mir mehr Aufträge angeboten, als ich annehmen konnte.
Für die meisten Ermittlungen brauchte ich weniger als eine Woche, besonders wenn es darum ging, jemandes Solidität und Kreditwürdigkeit zu überprüfen. Buchmacher kamen gern zu mir, bevor sie neue Kontokorrentkunden annahmen, und Trainer engagierten mich, um sicherzugehen, daß sie für diesen und jenen neuen Besitzer teure Zweijährige ersteigern konnten, ohne nachher mit billigen Ausreden abgespeist zu werden und mit einem Berg von Schulden dazustehen. Ich hatte alle möglichen Geschäftsvorhaben überprüft und viele Leute vor Betrügern bewahrt, ich hatte flüchtige Schuldner und Diebe aller Art ertappt und einfallsreichen Schurken böse Kopfschmerzen bereitet.
Manche Leute hatten sich vor Freude und Erleichterung an meiner Schulter ausgeweint, andere hatten mir gedroht oder Prügel verabreicht, um mich loszuwerden. Linda Ferns würde mich umarmen, Gordon Quint würde mich hassen, und zwei andere Fälle, die ich zur Zeit etwas vernachlässigte, standen noch offen. Warum also gab ich es nicht auf und verlegte mich auf ein ruhiges, ungefährliches Leben in der Finanzplanung, von der ich auch etwas verstand? Ich spürte die Wirkung der Eisenstange vom Nacken bis zu den Fingern… und wußte die Antwort nicht.
Das Handy an meinem Gürtel summte, ich nahm wieder ab, und am Apparat war der Rechtsanwalt, der mich am Gericht auf dem Gang angesprochen hatte.
»Sid, hier ist Davis Tatum. Ich habe Neuigkeiten für Sie«, sagte er.
[26]»Geben Sie mir Ihre Nummer, und ich rufe Sie zurück.«
»Hm? Oh, auch gut.« Er gab mir seine Nummer zum Mittippen durch, und ich benutzte wieder den Apparat auf Charles’ Schreibtisch, um das Gespräch fortzusetzen.
»Sid«, Tatum kam wie gewöhnlich gleich zur Sache, »Ellis Quint zieht den Antrag auf Freispruch zurück und bekennt sich jetzt schuldig, macht aber verminderte Zurechnungsfähigkeit geltend. Nach dem deutlichen Mißtrauensvotum seiner Mutter hat die Verteidigung anscheinend Fracksausen bekommen.«
»Himmel«, sagte ich.
Tatum lachte leise. Ich sah sein wabbelndes Doppelkinn vor mir. »Die Verhandlung wird jetzt um eine Woche vertagt, damit psychiatrische Gutachten eingeholt werden können. Mit anderen Worten, Sie brauchen morgen nicht zu erscheinen.«
»Gut.«
»Ich hoffe aber, Sie kommen trotzdem.«
»Wie soll ich das verstehen?«
»Es gibt Arbeit für Sie.«
»Was für Arbeit?«
»Ermittlungen natürlich. Was sonst? Ich würde Sie gern unter vier Augen sprechen.«
»Gut«, sagte ich, »aber irgendwann morgen muß ich in Kent das Kind besuchen, Rachel Ferns. Sie ist wieder im Krankenhaus, und es hört sich gar nicht gut an.«
»Verdammt.«
»Tja.«
»Wo sind Sie?« fragte er. »Die Presse sucht Sie.«
»Die kann ruhig einen Tag warten.«
[27]»Ich habe den Leuten von The Pump gesagt, nachdem die so über Sie hergefallen sind, wäre es ein Wunder, wenn Sie noch ein Wort mit ihnen reden.«
»Herzlichen Dank«, meinte ich lächelnd.
Er lachte leise. »Was morgen angeht…«
»Ich fahre morgen früh nach Kent«, sagte ich. »Wie lange ich dableibe, weiß ich noch nicht, das hängt von Rachel ab. Sagen wir, um fünf in London? Wäre Ihnen das recht? Dann haben Sie Feierabend.«
»Gut, und wo? Nicht in meinem Büro. Bei Ihnen? Nein, besser nicht, wenn The Pump Sie im Visier hat.«
»Was halten Sie von der Bar neben dem Restaurant im zweiten Stock des Hotels Le Meridien am Piccadilly?«
»Die kenne ich nicht.«
»Um so besser.«
»Wenn ich umdisponieren muß«, sagte er, »erreiche ich Sie dann weiterhin über Ihr Handy?«
»Immer.«
»Gut. Also bis morgen.«
Ich legte Charles’ Hörer auf und setzte mich wieder in den Brokatsessel. Charles sah auf das Mobiltelefon, das ich diesmal neben mein Glas auf den Tisch gelegt hatte, und stellte die naheliegende Frage.
»Wieso rufst du zurück? Warum sprichst du nicht einfach?«
»Weil«, sagte ich, »den Apparat jemand abhört.«
»Er wird abgehört?«
Ich erklärte ihm, daß bei der offenen Funkübertragung jeder, der sich damit auskannte und technisch versiert war, Gespräche belauschen konnte, die ihn nichts angingen.
[28]Charles sagte: »Und woher weißt du, daß du belauscht wirst?«
»Das sehe ich an Kleinigkeiten, die die Leute neuerdings über mich wissen, obwohl ich sie ihnen nicht erzählt habe.«
»Wer steckt dahinter?«
»Ich weiß es nicht genau. Meinen Computer hat auch jemand übers Telefon angezapft, und auch da weiß ich nicht, wer. Es ist für den Fachmann heutzutage erschreckend einfach, Paßwörter auszuknobeln und Geheimdateien zu lesen.«
Er sagte mit einem Anflug von Gereiztheit: »Computer sind mir zu hoch.«
»Ich mußte mich da auch erst einarbeiten«, erwiderte ich lächelnd. »Schon etwas anderes, als wenn man in Plumpton bei Regenwetter über die Hürden geht.«
»Was du nicht alles tust.«
»Ich wünschte, ich würde noch Rennen reiten.«
»Ja, ich weiß. Aber der Spaß ginge doch auf jeden Fall jetzt bald zu Ende. Wie alt bist du? Vierunddreißig?«
Ich nickte. Fünfunddreißig fast schon.
»Die wenigsten guten Hindernisjockeys halten sich länger.«
»Du bist so herrlich direkt, Charles.«
»Und mit dem, was du machst, nützt du der Allgemeinheit mehr.«
Charles neigte dazu, mich aufzumuntern, wenn er meinte, ich hätte es nötig. Mir war es ein Rätsel, wie er das merkte. Er hatte einmal gesagt, mein Gesicht sei dann wie eine Wand. Wenn ich die Welt aussperrte und mich in mich selbst zurückzöge, stünden die Dinge schlecht. Vielleicht [29]hatte er recht damit. Der innere Rückzug ersparte mir den äußeren, und diese Technik hatte ich wohl fast von Geburt an gelernt.
Jenny, meine geliebte frühere Frau, hatte gesagt, sie könne damit nicht leben. Sie hatte sich gewünscht, ich würde das Rennreiten aufgeben und mir eine weichere Schale zulegen, und als ich darauf nicht eingehen wollte oder konnte, hatten wir uns im Bösen getrennt. Seit kurzem war sie wieder verheiratet, und diesmal hatte sie sich nicht ein dünnes, dunkelhaariges, risikofreudiges Bündel von Komplexen angelacht, sondern einen Mann nach ihren Bedürfnissen, älter und ruhiger, einen gutmütigen, unkomplizierten Menschen mit einem Adelstitel. Aus Jenny, der hadernden, unglücklichen Mrs.Halley, war eine abgeklärte Lady Wingham geworden. Ein Foto von ihr und dem strahlenden, gutaussehenden Sir Anthony stand im Silberrahmen neben dem Telefon auf Charles’ Schreibtisch.
»Wie geht’s Jenny?« fragte ich höflich.
»Bestens«, erwiderte Charles ausdruckslos.
»Gut.«
»Er ist ein Langweiler, verglichen mit dir«, bemerkte Charles.
»So was kannst du doch nicht sagen.«
»In meinem Haus sage ich verdammt noch mal, was ich will.«
In Harmonie und gegenseitiger Wertschätzung verbrachten wir einen ruhigen Abend, gestört nur durch fünf weitere Anrufe auf meinem Funktelefon, von Leuten, die mehr oder minder herrisch zu wissen verlangten, wo Sid Halley zu erreichen sei.
[30]Ich sagte jedesmal: »Sie sprechen mit dem Auftragsdienst. Hinterlassen Sie bitte Ihre Nummer, und wir geben Ihre Nachricht weiter.«
Alle Anrufer arbeiteten offenbar für Zeitungen, was mich besonders stutzig machte.
»Ich weiß nicht, woher die alle meine Nummer haben«, erklärte ich Charles. »Die steht in keinem Telefonbuch. Ich gebe Sie nur Leuten, für die ich arbeite, damit sie mich Tag und Nacht erreichen können, und gegebenenfalls anderen, deren Anrufe ich nicht verpassen möchte. Ich sage immer dazu, daß es eine Geheimnummer ist und nur für den persönlichen Gebrauch. Ich verteile die Nummer nicht per Geschäftskarte, und sie steht nicht auf meinem Briefpapier. Oft leite ich Anrufe von dem Apparat in meiner Wohnung auf das Handy um, aber dazu kam ich heute nicht, weil Gordon Quint mich draußen angefallen hat und ich nicht reinkonnte. Wie kommt also die halbe Londoner Journaille zu der Nummer?«
»Wie willst du das rausfinden?« fragte Charles.
»Hm… man sollte vielleicht Sid Halley darauf ansetzen.«
Charles lachte. Mir war trotzdem unbehaglich zumute. Jemand hörte mich ab, und jetzt hatte jemand die Nummer herumgereicht. Nicht, daß meine Telefongespräche streng geheim gewesen wären; ich hatte mir die inoffizielle Nummer eigentlich nur zugelegt, damit der Apparat nicht bei jeder unpassenden Gelegenheit summte, aber jetzt hatte ich den Eindruck, daß mich jemand vorsätzlich bedrängte. Er zapfte meinen Computer an, wenn da auch weiter nichts zu holen war, denn ich kannte viele Abwehrmittel. Er griff mich auf elektronischem Weg an. Rückte mir auf die Pelle.
[31]Jetzt reichte es. Fünf Zeitungen waren zuviel. Sid Halley würde sich effektiv mit seinem eigenen Fall beschäftigen müssen.
Charles’ seit langem im Haus wohnende Wirtschafterin Mrs.Cross mit ihren Sommersprossen und dem sonnigen Gemüt kochte uns ein schlichtes Abendessen und umhegte mich wie eine Glucke. Manchmal fand ich sie zwar ein wenig erdrückend, aber zum Geburtstag bekam sie immer eine Karte von mir.
Ich ging früh zu Bett und sah, daß Mrs.Cross wie gewohnt das schöne warme Licht in meinem Zimmer angelassen und einen frischen Schlafanzug und flauschige Handtücher bereitgelegt hatte.
Schade, daß die Sorgen des Tages sich so leicht nicht schlafen legen ließen.
[32]2
Der Morgen brachte wenig Besserung.
Gelegentlich nahm ich einen Londoner Autoverleih mit Chauffeurdienst in Anspruch, um Menschen oder Sachen vor neugierigen Blicken geschützt zu transportieren, und so rief ich, als ich mit zwei defekten Armen aufwachte, von Charles’ sicherem Telefon aus meine Freunde bei TeleDrive an.
»Bob?« sagte ich. »Ich muß von oberhalb Oxford nach Canterbury in Kent. Unterwegs müßte ich ein paarmal kurz anhalten. Und irgendwann am Nachmittag zurück nach London. Kann das so kurzfristig jemand übernehmen?«
»Geben Sie mir die Adresse«, sagte er nur. »Wir sind auf dem Weg.«
Ich frühstückte mit Charles. Das heißt, wir setzten uns ins Eßzimmer, wo Mrs.Cross auf ihre altmodische Art den Tisch mit Toast, Kaffee, Frühstücksflocken und warmgestelltem Rührei gedeckt hatte.
Für Charles begann kein Tag ohne Rührei. Er aß es auf Toast und sah zu, wie ich linkshändig meinen Kaffee trank. Als alter Freund wußte er, daß ich Aufhebens nicht leiden konnte, und unterließ es, von Eisenstangen und Schlagwirkungen zu sprechen.
Er las eine großformatige Tageszeitung, die, wie er mir [33]zeigte, ausführlich, aber taktvoll über den Tod von Ginnie Quint berichtete. Ihr freundliches, so lebhaft lächelndes Gesicht erstreckte sich über zwei Spalten. Ich mied es bewußt, mir vorzustellen, wie sie nach ihrem Sprung aus dem sechzehnten Stock ausgesehen haben mochte.
Charles las vor: »›Freunden zufolge war sie deprimiert wegen des bevorstehenden Prozesses gegen ihren Sohn. Von Gordon, ihrem Mann, war noch keine Stellungnahme zu bekommen.‹ Mit anderen Worten, die Presse hat ihn nicht finden können.«
Im Mediendschungel zu bestehende Zerreißprobe, dachte ich, die moderne Art der Folter.
»Ernstlich, Sid«, sagte Charles in seinem ruhigsten, höflichsten Ton, »war Gordons Wut auf dich ein Aussetzer oder, ehm… krankhaft?«
»Ernstlich«, griff ich seine Wendung auf, »ich weiß es nicht.« Ich seufzte. »Es ist wohl noch zu früh, um diese Frage zu beantworten. Gordon weiß es wahrscheinlich selbst nicht.«
»Paß bloß auf, Sid.«
»Sicher.« Ich ließ die flüchtigen Eindrücke an mir vorbeiziehen, die ich in den Sekunden der Gewalt am Pont Square erlebt hatte. »Ich weiß nicht, wo Ginnie sich aus dem Fenster gestürzt hat«, sagte ich, »aber ich glaube nicht, daß Gordon bei ihr war. Ich meine, als er mich anfiel, hatte er Räuberzivil an. Werktagskleidung: Dreck an den Stiefeln, Cordhosen, alte Tweedjacke, offenes blaues Hemd. Er kam nicht aus einem 16-Etagen-Hotel. Und die Stange, mit der er mich geschlagen hat… das war nicht einfach ein Stück Metall, sondern ein anderthalb Meter langes Winkeleisen, [34]wie man es zum Einzäunen verwendet. Ich habe die Löcher gesehen, durch die der Draht gezogen wird.«
Gordon Quint war ein Grundbesitzer, der bei der Verwaltung seines großen Gutes gern mit anfaßte. Er fuhr Traktoren, mähte Unkraut an Bachufern, besserte zusammen mit seinen Leuten die Grundstücksbegrenzungen aus, legte Schafhürden an und lichtete Waldstücke, ebensosehr aus Freude am körperlichen Einsatz wie an ordentlich getaner Arbeit.
Ich wußte auch, daß er sehr von sich eingenommen war und von allen – auch von Ginnie – Respekt erwartete. Er gefiel sich in der Rolle des großzügigen Gastgebers, des seine Gäste an Bedeutung fraglos überragenden Hausherrn.
Der Mann, den ich am Pont Square gesehen hatte, war ganz unvornehm wild, verletzt, empört und auf merkwürdige Weise authentischer gewesen als der Gordon, den ich von vorher kannte; aber solange ich nicht genau wußte, wie sein inneres Gleichgewicht sich nach der Explosion wieder einpendelte, würde ich mich von Zaunpfählen und anderem landwirtschaftlichem Gerät, das er möglicherweise bei sich trug, fernhalten.
Ich sagte Charles, daß jemand von TeleDrive kommen und mich abholen würde. Da er die Brauen hochzog, erklärte ich ihm, ich könne die Fahrtkosten absetzen. Und als was? Als Geschäftsunkosten, sagte ich.
»Bezahlt dich Mrs.Ferns?« fragte Charles mit unbeteiligter Stimme.
»Jetzt nicht mehr.«
»Wer denn überhaupt?« Er wollte, daß ich Geld verdiente. Ich verdiente auch, aber er glaubte nicht recht daran.
[35]»Ich verhungere schon nicht«, sagte ich, meinen Kaffee trinkend. »Hast du mal Pilzsuppe, schaumig gerührt mit drei, vier Eiern probiert? In die Pfanne, und fertig ist das Pilzomelett.«
»Ekelhaft«, sagte Charles.
»Man ißt anders, wenn man allein lebt.«
»Du brauchst wieder eine Frau«, sagte Charles. »Was ist mit der, die in Oxford mit Jenny zusammengewohnt hat?«
»Louise McInnes?«
»Ja. Ich dachte, du hättest eine Liebelei mit ihr.«
Niemand hatte mehr ›Liebeleien‹. Charles’ Ausdrucksweise war wirklich von gestern. Aber wenn man es jetzt auch vielleicht anders nannte, der Sinn blieb derselbe.
»Ein Sommerspaß. Mit dem ersten Frost war er vorbei.«
»Wieso?«
»Was sie für mich empfand, war mehr Neugier als Liebe.«
Das verstand er völlig. Jenny hatte ihrer Freundin so vieles und so Vertrauliches, meist Abträgliches über mich erzählt, daß es die Freundin, wie mir rückblickend klarwurde, vor allem gereizt hatte, das Gehörte selbst zu überprüfen. Wir hatten uns leicht gefunden und leicht wieder getrennt. Es war eine schöne Zeit gewesen, aber nichts weiter.
Als der Wagen kam, dankte ich Charles für die gewährte Zuflucht.
»Gern geschehen«, sagte er und nickte.
Wir trennten uns wie üblich, ohne uns anzufassen. Es stand alles in den Augen.
Ich ließ mich von dem Fahrer durch die labyrinthische Einkaufszone von Kingston in Surrey kutschieren, bis ich in [36]einem Faschingsgeschäft sechs Partyperücken gefunden und in einer Zoohandlung einen Engelbarsch in einem Plastikgefäß erstanden hatte, und so bewaffnet traf ich schließlich in der Kinderkrebsstation ein, auf der Rachel Ferns lag.
Linda begrüßte mich mit tränenglitzernden Augen, aber ihre Tochter lebte noch. Auf Grund einer jener unvorhersagbaren Launen, die Leukämie zu einem solchen Wechselbad von Hoffnung und Verzweiflung werden lassen, ging es Rachel sogar wieder etwas besser. Sie war wach, saß halb im Bett und freute sich, daß ich da war.
»Hast du den Engelbarsch mitgebracht?« fragte sie zur Begrüßung.
Ich hielt den Plastikeimer hoch, der an meiner Plastikhand baumelte. Linda ergriff ihn, nahm den wasserdicht schließenden Deckel ab und zeigte ihrer Tochter den schwarz-silbernen Fisch, der forsch im Innern schwamm.
Rachel entspannte sich. »Ich werde ihn Sid nennen«, sagte sie. Ihren Fotos nach war sie einmal ein lebhaftes, hübsches blondes Kind gewesen; jetzt schien sie nur noch aus großen Augen in einem kahlen Kopf zu bestehen. Mattigkeit und Blutarmut hatten sie erschreckend hinfällig werden lassen.
Als ihre Mutter mich engagiert hatte, um einen Anschlag auf Rachels Pony aufzuklären, war die Krankheit vorübergehend zurückgegangen – der Drache eingeschlafen. Rachel wuchs mir ans Herz, und ich schenkte ihr ein beleuchtetes Aquarium mit Luftzufuhr, Wasserpflanzen, versunkenem Schloß, Sand und buntbeschuppten, schwimmenden tropischen Bewohnern. Linda weinte. Rachel brachte Stunden [37]damit zu, die Gewohnheiten ihrer neuen Freunde kennenzulernen, der Ungeselligen und dessen, der alle anderen herumscheuchte. Die Hälfte der Fische hieß Sid.
Das Aquarium stand bei den Ferns zu Hause im Wohnzimmer, und es schien jetzt fraglich, ob Rachel den neuen Sid je im Kreis seiner Genossen sehen würde.
Dort in dem gemütlichen, mittelgroßen Wohnzimmer mit den teuren, aber nicht zu teuren modernen Sofas, den Glastischen und den Tiffanylampen aus Buntglas hatte ich meine Klienten Linda und Rachel Ferns kennengelernt.
Es waren keine Bücher in dem Zimmer, nur ein paar Zeitschriften über Kleidermode und Pferde. Glänzende rot und beige gestreifte Vorhänge; geometrisch gemusterter Teppich in hellen Braun- und Grautönen; Blumendrucke an blaßrosa Wänden. Zusammen wirkte das Ganze ein wenig uneinheitlich und ließ auf impulsive Bewohner ohne stark ausgeprägte Persönlichkeit schließen. Die Ferns waren vermutlich kein alter Geldadel, aber offenbar sehr vermögend.
Linda Ferns hatte mich am Telefon gebeten vorbeizukommen. Fünf oder sechs Ponys in ihrem Bezirk seien von Vandalen mißhandelt worden, darunter auch das Pony ihrer Tochter Rachel. Die Polizei habe die Täter nicht ermittelt, und jetzt seien Monate vergangen, ihre Tochter sei noch immer sehr unglücklich, und ich möchte doch bitte, bitte sehen, ob ich helfen könne.
»Man hat mir gesagt, Sie seien meine einzige Hoffnung. Ich gebe alles dafür, wenn Sie Rachel helfen. Sie hat so schreckliche Alpträume. Bitte!«
Ich nannte mein Honorar.
»Soviel Sie wollen«, sagte sie.
[38]Sie hatte mir, bevor ich in das ausgedehnte Dorf hinter Canterbury kam, nichts davon gesagt, daß Rachel todkrank war.
Als ich der großäugigen, kahlköpfigen schlanken Tochter schließlich gegenüberstand, schüttelte sie mir ernst die Hand.
»Sind Sie wirklich Sid Halley?« fragte sie.
Ich nickte.
»Mami hat gesagt, Sie würden kommen. Papa meinte, Sie arbeiten nicht für Kinder.«
»Manchmal schon.«
»Meine Haare wachsen wieder«, sagte sie; und ich sah dann auch den feinen, dünnen blonden Flaum auf der hellen Kopfhaut.
»Das freut mich.«
Sie nickte. »Ziemlich oft trage ich eine Perücke, aber das juckt. Stört es Sie, wenn ich keine aufhabe?«
»Überhaupt nicht.«
»Ich habe Leukämie«, sagte sie ruhig.
»Ach so.«
Sie musterte mein Gesicht; ein weit über sein Alter gereiftes Kind, wie alle so jung Erkrankten, die ich kannte.
»Sie finden doch raus, wer Silverboy umgebracht hat, ja?«
»Ich will es versuchen«, sagte ich. »Wie ist er gestorben?«
»Nein, nein«, unterbrach Linda. »Fragen Sie sie das nicht. Ich sage es Ihnen. Sie regt sich sonst auf. Sagen Sie nur, daß Sie sie kriegen, die Schweine. Und Rachel, jetzt schnapp dir Pegotty und fahr ihn durch den Garten, damit er sich die Blumen ansehen kann.«
Pegotty entpuppte sich als ein zufriedenes, in einem [39]Kinderwagen festgeschnalltes Baby. Rachel schob ihn ohne Widerrede nach draußen, und bald darauf sah man durchs Fenster, wie sie ihm aus nächster Nähe eine Azalee vorführte.
Linda Ferns schaute zu und weinte die ersten von vielen Tränen.
»Sie braucht eine Knochenmarktransplantation«, sagte sie, bemüht, ihr Schluchzen zu unterdrücken. »Man sollte meinen, das wäre einfach, aber bis jetzt hat sich kein genetisch passender Spender gefunden, nicht mal im internationalen Verzeichnis der Anthony-Nolan-Stiftung.«
Ich sagte hilflos: »Das tut mir leid.«
»Ihr Vater und ich sind geschieden«, sagte Linda. »Wir haben uns vor fünf Jahren scheiden lassen, und er hat wieder geheiratet.« Sie sprach ohne Bitterkeit. »So geht es nun mal.«
»Ja«, sagte ich.
Ich war Anfang Juni bei den Ferns zu Hause, zu Beginn eines nach Ferien und Rosen duftenden Sommers, einer Zeit, die zum Träumen einlud, fern von Angst und Schrecken.
»Eine Bande von Vandalen–«, sagte Linda und bebte vor Zorn am ganzen Körper, »sie haben überall in Kent Ponys massakriert… besonders hier in der Gegend… Kinder kamen auf die Koppel, um nach ihren geliebten Ponys zu sehen, und sie waren verstümmelt. Wie krank muß einer sein, der einem harmlosen armen Pony, das keinem je etwas getan hat, die Augen aussticht? Drei Ponys hier bei uns waren geblendet, und anderen hatten sie Messer hinten reingesteckt.« Sie zwinkerte ihre Tränen weg. »Rachel war außer sich. Im Umkreis von Kilometern haben die Kinder nur [40]noch geheult. Und die Polizei konnte nicht einen Fall aufklären.«
»Wurde Silverboy geblendet?« fragte ich.
»Nein… nein… Es war schlimmer… Rachel hat ihn gefunden, draußen auf der Koppel…« Linda schluchzte laut. »Rachel wollte in einem provisorischen Stall schlafen… einem Unterstand eigentlich. Sie wollte Silverboy da anbinden und neben ihm schlafen. Das habe ich ihr nicht erlaubt. Sie ist schon fast drei Jahre krank. Es ist eine furchtbare Krankheit, und ich komme mir so hilflos vor…« Sie zog ein Papiertuch aus einer halbleeren Schachtel und wischte sich die Augen. »Immer wieder sagt sie mir, daß es nicht meine Schuld war, aber ich weiß, daß sie meint, wenn ich sie da hätte schlafen lassen, wäre Silverboy noch am Leben.«
»Was ist mit ihm passiert?« fragte ich, ohne zu drängen.
Linda schüttelte unglücklich den Kopf, konnte es mir noch nicht sagen. Sie war eine gutaussehende Frau um die Dreißig, schlanke Figur, gepflegtes blondes Haar, eine bewundernswerte Umsetzung der Illustriertentips für Schönheit und Gesundheit. Nur das Fehlen von Glanz in ihren Augen und die gelegentlich auftretenden nervösen Gesichtszuckungen deuteten auf den Leidensdruck hin, dem sie seit langem ausgesetzt war.
»Sie ging auf die Koppel«, sagte sie schließlich, »obwohl es bitterkalt war und anfing zu regnen… Es war im Februar… Sie schaute immer nach, ob seine Tränke voll war, ob das Wasser sauber und auch nicht vereist war… Ich hatte darauf bestanden, daß sie sich warm anzieht, Schal, Handschuhe und eine ganz dicke Wollmütze… und sie kam schreiend… schreiend heimgelaufen…«
[41]Ich wartete, während Linda mit ihren unerträglichen Erinnerungen rang.
Sie sagte nüchtern: »Rachel hat seinen Fuß gefunden.«
Einen Moment lang war es völlig still, eine Stille, in der vielleicht die Fassungslosigkeit, das Grauen jenes Morgens nachklang.
»Es stand in allen Zeitungen«, sagte Linda.
Ich verlagerte mein Gewicht und nickte. Vor Monaten hatte ich von den geblendeten Ponys in Kent gelesen. Ich war mit den Gedanken woanders gewesen, hatte Namen und Einzelheiten nicht richtig aufgenommen, nicht registriert, daß eines der Ponys einen Fuß verloren hatte.
»Nach Ihrem Anruf«, sagte ich, »habe ich festgestellt, daß landesweit, nicht nur hier in Kent, noch ungefähr ein halbes Dutzend Pferde und Ponys auf der Weide von Vandalen malträtiert worden sind.«
Sie sagte unglücklich: »Ich habe eine Meldung über ein Pferd in Lancashire gesehen, aber die Zeitung weggeworfen, damit Rachel das nicht liest. Immer wenn sie etwas an Silverboy erinnert, hat sie eine Woche lang Alpträume. Sie wacht schluchzend auf. Sie kommt zu mir ins Bett und zittert und heult. Bitte finden Sie heraus, warum… finden Sie heraus, wer… Sie ist so krank… und jetzt, wo sie gerade in Remission ist, kann sie zwar halbwegs normal leben, aber das hält mit ziemlicher Sicherheit nicht an. Die Ärzte sagen, sie braucht die Transplantation.«
Ich sagte: »Kennt Rachel eins von den anderen Kindern, deren Ponys mißhandelt worden sind?«
Linda schüttelte den Kopf. »Die meisten waren vom Ponyclub, glaube ich – Rachel hat sich zu schlecht gefühlt, [42]um dem Club beizutreten. Sie hatte Silverboy gern – er war ein Geschenk ihres Vaters–, aber sie konnte gerade nur im Sattel sitzen, während wir sie herumführten. Er war ein liebes, ruhiges Pony, ein bildhübscher Grauer mit einer rauchgrau abgesetzten Mähne. Rachel hat ihn Silverboy genannt, aber der Name auf seinem Pedigree war viel vornehmer. Sie brauchte etwas zum Gernhaben, verstehen Sie, und sie hatte sich das Pony so sehr gewünscht.«
Ich fragte: »Haben Sie noch irgendwelche Zeitungsberichte über Silverboy und die anderen mißhandelten Ponys? Wenn ja, könnte ich die mal sehen?«
»Ja«, erwiderte sie zweifelnd, »aber ich wüßte nicht, was die bringen sollten. Der Polizei haben sie auch nichts genützt.«
»Sie wären ein Anfang«, sagte ich.
»Also gut.« Sie ging aus dem Zimmer und kam bald darauf mit einem kleinen blauen Koffer zurück, der etwa so groß war wie die Handkoffer, die man im Flugzeug unterm Sitz verstauen kann. »Da ist alles drin«, sagte sie und gab ihn mir, »auch die Aufzeichnung einer Fernsehsendung, an der Rachel und ich teilgenommen haben. Verlieren Sie die bitte nicht! Wir zeigen sie zwar keinem, aber ich will nicht, daß sie wegkommt.« Sie blinzelte Tränen fort. »Es war eigentlich das einzig Gute, was uns passiert ist. Ellis Quint hat die Kinder besucht, und er war unheimlich lieb zu ihnen. Rachel mochte ihn sehr. Er war so verständnisvoll.«
»Ich kenne ihn ganz gut«, sagte ich. »Wenn einer die Kinder trösten konnte, dann er.«
»Ein wirklich netter Mann«, sagte Linda.
Ich nahm den blauen Koffer voll kleiner Tragödien mit [43]nach London und vertiefte mich stundenlang in die empörenden schriftlichen Berichte von Tierquälereien, deren blutige Realität die tierlieben Kinder, die sie entdeckten, zutiefst verstört haben mußte.
Das zwanzigminütige Videoband zeigte Ellis Quint in Hochform: der sanfte, mitfühlende Freund, der unerträglichem Kummer abhilft; der umsichtige, fürsorgliche Moderator, der die Polizei anhält, diese Verbrechen nicht weniger ernst zu nehmen als Morde. Wie gut er es verstand, sein Engagement zu dosieren, dachte ich. Er legte die Arme um Rachel und redete ganz sachlich mit ihr, und erst am Ende der Sendung, als die Kinder schon aus dem Bild waren, sagte er, daß der Verlust des Ponys für sie nur ein weiterer unerträglicher Schlag sei in einem leidgeprüften Leben.
In der Sendung hatte Rachel eine hübsche blonde Perücke getragen, mit der sie aussah wie vor der Chemotherapie. Als dramatischen Schlußpunkt hatte Ellis ein paar Sekunden lang ein Foto der kahlen, verletzlichen Rachel gezeigt: unmöglich, davon nicht betroffen zu sein.
Ich hatte die Sendung nicht gesehen, als sie ausgestrahlt wurde. Im März, auf den das Band datiert war, hatte ich in Amerika die Spur eines flüchtigen Besitzers verfolgt, der einen Berg offener Trainingsrechnungen hinterlassen hatte. Aber auch sonst verpaßte ich Ellis’ Sendung häufig: Er präsentierte seine 20-Minuten-Beiträge zweimal wöchentlich im Rahmen eines einstündigen Sportnachrichten-Medleys und war so oft auf dem Bildschirm zu sehen, daß seine Auftritte nicht noch eigens angekündigt wurden.
Als ich Ellis wieder einmal auf der Rennbahn traf, erzählte ich ihm, daß Linda Ferns mich engagiert hatte, und [44]fragte ihn, ob er zum Fall der in Kent verstümmelten Ponys noch etwas Neues erfahren habe.
»Mein lieber Sid«, meinte er lächelnd, »das Ganze liegt doch Monate zurück, oder nicht?«
»Die Ponys wurden im Januar und Februar überfallen, und deine Sendung wurde im März ausgestrahlt.«
»Und jetzt haben wir Juni, stimmt’s?« Er schüttelte den Kopf, weder bekümmert noch überrascht. »Du weißt doch, wie das bei mir geht, ich habe Rechercheure, die für mich Storys ausgraben. Das Fernsehen ist unersättlich. Natürlich hätte ich davon gehört, wenn sich mit den Ponys noch was ergeben hätte, und wir hätten einen zweiten Beitrag gemacht, aber mir ist nichts zu Ohren gekommen.«
Ich sagte: »Rachel Ferns, das leukämiekranke Kind, hat immer noch Alpträume.«
»Armes Mädchen.«
»Sie sagt, du warst sehr freundlich.«
»Tja…« Er zog in einer selbstverachtenden Gebärde den Kopf ein, »das ist ja auch nicht schwer. Die Sendung hat mir ganz fantastische Einschaltquoten gebracht.« Er hielt inne. »Sid, weißt du irgendwas über den Buchmacher-Schmiergeldskandal, den ich nächste Woche aufgreifen soll?«
»Überhaupt nichts«, bedauerte ich. »Aber um auf die Verstümmelungen zurückzukommen, Ellis, seid ihr den anderen Anschlägen auf Pferde im Land mal nachgegangen?«
Er runzelte leicht die Stirn und schüttelte den Kopf. »Die Rechercheure meinten, es reicht, wenn man die nebenbei erwähnt. Das waren Nachäffer. Ich meine, das gab nicht annähernd so viel her wie die Story mit den Kindern.« Er grinste. »An den anderen Sachen hing kein Herzblut.«
[45]»Du bist ein Zyniker«, sagte ich.
»Sind wir das nicht alle?«
Wir waren seit Jahren gut befreundet, Ellis und ich. Wir waren in Rennen gegeneinander angetreten, er als begnadeter Amateur, ich als engagierter Profi, beide aber Feuer und Flamme und ganz davon überzeugt, daß es eine durchaus annehmbare Form der Nachmittagsgestaltung sei, auf einem halbwilden Zehnzentnerpferd mit fünzig Stundenkilometern schwierige Hindernisse zu überfliegen.
Obwohl ich eigentlich annahm, daß auch ich die Vandalen, die nach drei oder vier Monaten Polizeiarbeit und nach Ellis Quints Sendung immer noch frei herumliefen, nicht finden würde, wollte ich alles Erdenkliche tun für mein Geld und ging das Problem nach Krebsart von der Seite an, indem ich statt der Ponybesitzer die Reporter befragte, die in den Zeitungen darüber berichtet hatten.