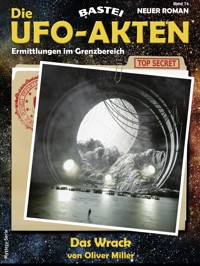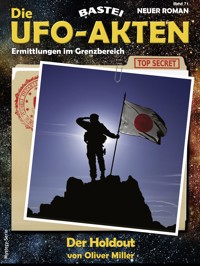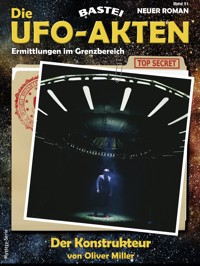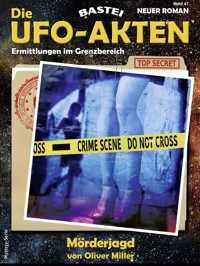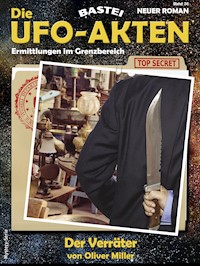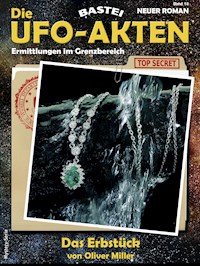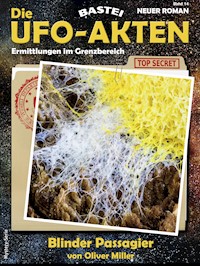1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gespenster-Krimi
- Sprache: Deutsch
Westfront - in der Nähe der Marne - Februar 1917
Der junge Mann versuchte, mit einem Streichholz eine dünne Zigarette anzuzünden, die in seinem Mundwinkel hing. Doch seine Hände zitterten so stark, dass er es nicht schaffte, mit dem Phosphorköpfchen des Holzes die Reibefläche der Schachtel zu treffen. Frustriert und wütend warf er beides vor sich auf den erdigen Boden des provisorischen Schutzstands.
"Hier, Junge", brummte der Soldat, der neben ihm auf der Holzpritsche saß, und reichte ihm seine Zigarette.
Der junge Mann deute ein kurzes Lächeln an, griff gierig danach und inhalierte den Rauch des billigen Tabaks. Er war neu hier - nicht nur an diesem Frontabschnitt, nein, in diesem ganzen Krieg ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 121
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Ewige Schuld
Vorschau
Impressum
Ewige Schuld
von Oliver Miller
Westfront – in der Nähe der Marne – Februar 1917
Der junge Mann versuchte, mit einem Streichholz eine dünne Zigarette anzuzünden, die in seinem Mundwinkel hing. Doch seine Hände zitterten so stark, dass er es nicht schaffte, mit dem Phosphorköpfchen des Holzes die Reibefläche der Schachtel zu treffen. Frustriert und wütend warf er beides vor sich auf den erdigen Boden des provisorischen Schutzstands.
»Hier, Junge«, brummte der Soldat, der neben ihm auf der Holzpritsche saß, und reichte ihm seine Zigarette.
Der junge Mann deute ein kurzes Lächeln an, griff gierig danach und inhalierte den Rauch des billigen Tabaks. Er war neu hier – nicht nur an diesem Frontabschnitt, nein, in diesem ganzen Krieg ...
Vor wenigen Wochen noch hatte er sich in seiner süddeutschen Heimat auf ein Studium vorbereitet. Das Abitur lag nur wenige Monate zurück, und innerlich hatte er noch nicht mit seiner Schulzeit abgeschlossen.
Natürlich war es eine gute Schule gewesen – etwas anderes war für seinen Vater auch nicht infrage gekommen. Dafür hatte sein alter Herr auch das nötige Schulgeld gerne bezahlt.
Ja, sein Vater ...
Voller Groll dachte er an ihn, während er an der Zigarette zog. Ihm hatte er dies alles zu verdanken. Der reiche Kaufmann aus Heidelberg hatte ihn nicht nur auf ein Gymnasium geprügelt, sondern auch dafür gesorgt, dass er sein Abitur auch tatsächlich bestand. Eine großzügige Spende an die Schulstiftung hatte die Korrektur seiner Reifeprüfung äußerst milde ausfallen lassen. Nicht etwa, weil er ihn in seinem kleinen Kaufhaus gebraucht hätte, nein, sondern weil er »in den Krieg sollte, bevor dieser vorbei wäre« ...
Ja, sein Vater, ein kleiner dicker Mann, mit einem grauen Haarkranz, dafür einem riesigen Bart, wie ihn nur noch der ehrwürdige, mittlerweile verstorbene österreichische Kaiser Franz Joseph trug, in seinem immer leicht geröteten Bulldoggengesicht. National-kaisertreu bis ins Mark, hatte er ihn »zum Mann« machen wollen, sah in seinem in der Schule durchgedrückten Abschluss ein Geschenk an seinen Sohn.
Er hatte dessen Tränen überhaupt nicht verstanden, als dieser nach der Freiwilligenmeldung, die er selbst für seinen Sohn unterschrieben hatte, in die Kaserne einrücken musste.
Seine Mutter hatte eine Ahnung, was sein Vater ihm da antat, aber sie selbst war hin und her gerissen, zwischen der Angst vor ihrem cholerischen Ehemann und der Angst um ihren einzigen Sohn, der nun in die Hölle des Krieges geschickt wurde.
Die Verabschiedung von Martha war ebenfalls hochemotional verlaufen. Sie war die Tochter eines Geschäftspartners seines Vater – also sogar für ihn eine ideale Verbindung. Eng umschlungen hatten sie am Bahnsteig gestanden, sie hatte bitterlich geweint, während er versucht hatte, möglichst erwachsen zu wirken, da sie in Hörweite seiner Eltern gestanden hatten.
Sechs Wochen Grundausbildung in einer Kaserne bei Freiburg waren schrecklich und sinnlos zugleich gewesen. Überrascht hatte er dort festgestellt, dass er mit neunzehn Jahren nicht etwa zu den Jüngsten gehörte, die einrückten. Es gab tatsächlich gerade Sechzehnjährige, die sich gemeldet hatten oder, wie er auch, von überambitionierten Eltern gemeldet wurden.
Aus Freiburg hatte sich eine komplette Abschlussklasse samt Lehrer freiwillig gemeldet. Doch die Stimmung, die bei einigen zu Anfang noch naiv-euphorisch gewesen sein mochte, schlug bald um. Die Ausbilder waren häufig Kriegsversehrte, die an der Front nicht mehr eingesetzt werden konnten.
So war ihr Kompaniechef ein einäugiger Hauptfeldwebel gewesen, der ihnen schonungslos offenbart hatte, dass die Hälfte von ihnen die ersten drei Wochen nicht überleben würde. Nicht erst ab diesem Zeitpunkt hatte er die ersten heimlichen Schluchzer nachts in den Schlafhallen gehört, wenn einige der Jüngsten sich in den Schlaf heulten.
Die Ausbildung war für ihn die Hölle – nicht etwa die technische Seite, für die er durchaus Begabung zeigte: Schießen, Granatentwurf und Derartiges lagen ihm, aber er war für sein Alter relativ klein und schmächtig – gerade einmal knappe einssiebzig bei etwa sechzig Kilo. Körperlicher Drill und Anstrengung war er nicht gewohnt.
Allein das Schleppen des Tornisters samt Ausrüstung über Dutzende von Kilometern führte ihn über den Rand seiner Leistungsfähigkeit hinaus. Dadurch geriet er häufig in den Fokus seiner Ausbilder, die ihm seine körperlichen Defizite genüsslich unter die Nase rieben.
Nach der Schnellausbildung ging es via Zug nach Frankreich. Schon die Fahrt ließ ihn erahnen, was auf ihn zukam. Der Militärzug ab Freiburg war gefüllt mit Soldaten, die zurückkehrten aus Lazaretten und Heimaturlauben. Er sah leere, traurige Gesichter, faltig und frühzeitig gealtert.
Die Stille im Abteil verunsicherte ihn – alles glich der Atmosphäre eines Friedhofs. Es wurde nur wenig geredet – einzelne zeigten sich schweigend Fotos ihrer Lieben, die zu Hause auf ihre Rückkehr warten würden.
Die Frischlinge wie er hatten am Anfang noch aufgeregt miteinander gesprochen, doch dann senkte sich auch über sie das dumpfe Schweigen, das ihn zunehmend an den Fatalismus vor einer Hinrichtung erinnerte.
Da hatte er es zum ersten Mal gespürt – das Gefühl, das ihn seitdem nicht mehr losgelassen hatte. Es begleitete ihn morgens, wenn er sich aus seinem Loch herausschälte und den dünnen Tee in sein verbeultes Metallgeschirr geschüttet bekam und wenn er sich abends nach einem Stoßgebet wieder auf in seine provisorische Pritsche legte. Mal war es stechend scharf, mal ein dumpfer Hintergrund: das Gefühl der Todesangst.
Als er das erste Mal das Dröhnen des Trommelfeuers der französischen Artillerie auf seinen Unterstand prasseln hörte, war er vor Panik durchgedreht. Er war heulend zum Ausgang des Unterstands gerannt und wollte hinaus ... egal wohin ... hinaus.
Der Mann, der ihm gerade eine Zigarette geschenkt hatte, war daraufhin ruhig auf ihn zugegangen, hatte ihn mit fester Hand zurückgehalten und ihm einen wuchtigen Schlag ins Gesicht verpasst.
Dazu hatte er nur gemurmelt: »Junge, da draußen ist der Tod.«
Er war daraufhin schluchzend zusammengesackt. Die anderen Soldaten seiner Kompanie, die teilweise ebenfalls in diesem Loch von Unterstand untergebracht waren, hatten das Schauspiel nur stumpf betrachtet – sie hatten Derartiges schon zu oft gesehen, viele von ihnen waren bereits an seiner Stelle gewesen.
Namenloses Grauen hatte ihn beim ersten Anblick eines Schlachtfelds ergriffen. Die graue, von hunderten von Granaten umgepflügte Erde des Niemandslandes zwischen den verfeindeten Schützengräben glich einem Land aus einer anderen Welt, einer dunklen, düsteren Welt des Todes. Der Geruch von Schießpulver, Rauch, Moder und Verwesung hing über ihm. Nein, hier wollte er nicht sterben, schwor er sich, egal wie, er würde überleben. Doch die Angst blieb und nagte weiter an ihm.
Als er zu seiner neuen Kompanie gelangte, war er einer von rund dreißig Frischlingen, die Gefallene oder Verwundete ersetzen sollten. Zunächst nahm man sie überhaupt nicht zur Kenntnis.
Der Kompaniefeldwebel, eben jener Mann, der ihn später vor dem sicheren Selbstmord bewahrte, erklärte ihm gleich zu Beginn, dass man mit den Neuen immer erst nach den ersten vier Wochen näher Bekanntschaft schloss – da bis dahin die meisten sowieso schon tot waren. Wer diese Art von Probezeit überlebte, hatte Chancen, länger dabei zu bleiben, hatte er ihm grinsend mitgeteilt.
Er mochte den Feldwebel irgendwie. Sein Name war Karl Kutowski, er war wohl früher Bäcker gewesen und kam aus dem Schlesischen. Wie alt er war, konnte man nicht schätzen. Die drei Jahre an der Westfront hatten Spuren in seinem Gesicht hinterlassen – er konnte fünfzig sein, aber genauso gut erst dreißig. Alter war hier sowieso einerlei. Es zählten lediglich die Tage, Wochen und Monate, die man bisher hier überlebt hatte.
Sein erstes Ziel war das Ende der angeblichen Probezeit – mit ihr fiel zufällig die Ablösung vom direkten Frontabschnitt zurück in die Etappe für seine Kompanie zusammen: Das hieß, man würde zur Erholung einige Zeit hinter die direkte Frontlinie versetzt, raus aus dem Trommelfeuer, weg von den Angriffen über das Niemandsland hinweg, direkt in die feindlichen Maschinengewehrnester.
Der junge Mann warf den letzten Rest der Zigarette auf den Boden, wo die festgestampfte, aber dennoch feuchte Erde die Glut sofort verlöschen ließ. Seine Hände zitterten immer noch.
Kutowski neben ihm sah auf seine Taschenuhr und grunzte: »Noch zehn Minuten. Wir gehen also in Stellung.«
Der Soldat stand mühevoll, beinahe wie ein alter Mann auf und öffnete die Tür des in den Boden gegrabenen Verschlags, der für die Gruppe Männer zu einer Heimat geworden war. »Los, raus in Angriffsposition!«
Lautlos, nur mit ein paar Seufzern verbunden, standen die etwa zwanzig Männer auf, die sich in die Nischen des Lochs verkrochen hatten. Das Sturmgewehr in der Hand, traten sie hinaus.
Das ferne Wummern der eigenen Artillerie erwartete sie, am Horizont, jenseits des Todesgebiets sahen sie die Einschläge der deutschen Kanonen aufblitzen. Geduckt gingen sie im Gänsemarsch durch die verschiedenen Gänge des Schützengrabens, bis sie an der Hauptlinie angekommen waren. Dort war bereits der Rest ihrer Kompanie in Stellung gegangen.
Der junge Mann atmete schwer. Er stand in Griffweite einer Leiter, auf die er nach dem Angriffssignal springen und in das Niemandsland vordringen würde. Auf diesen etwa zweihundert Metern bis zur gegnerischen Stellung lagen nicht nur Stacheldrahtverhaue beider Kriegsseiten, sondern der Gegner hatte auch mehr oder weniger freies Schussfeld auf sie.
Die einzige Hoffnung war, dass die Artillerie die feindlichen Maschinengewehrstellungen zumindest teilweise ausgeschaltet hatte.
Er klammerte sich fest an das Gewehr, das er in der Hand hielt. Seine Gedanke drehten sich um sein Zuhause, um Martha und um seine Familie. Am liebsten hätte er das Foto hervorgeholt, das sie ihm am Bahnsteig gegeben hatte, kurz bevor er zur Grundausbildung gefahren war. Das Foto war eine jener Aufnahmen, die man mittlerweile für wenig Geld bei einem Porträtfotografien anfertigen lassen konnte. Sie hatte darauf sein Lieblingskleid angezogen und zauberhaft gelächelt. Der Gedanke daran wärmte sein Herz.
Kutowski stand neben ihm und sah ihn ruhig, nein eher fatalistisch an. Er wusste, dass das Sterben gleich beginnen würde. Schlagartig hörte das Wummern auf. Die eigene Artillerie hatte den Beschuss eingestellt. Der Feldwebel griff mit der Linken zu einer Trillerpfeife und beobachtete den Sekundenzeiger seiner Uhr, die er in der Rechten hielt.
Tränen stiegen ihm in die Augen, als er sah, wie der Feldwebel die Uhr nahezu beiläufig in der Uniformtasche verschwinden ließ, ihm kurz zunickte und mit einem kräftigen Atemstoß das Pfeifsignal gab. Dieses schrille Flöten tönte binnen Sekunden vielfach am ganzen Frontabschnitt auf. Der Feldwebel packte die Leiter, schwang sich auf sie und hastete hinauf, fortwährend brüllend: »Angriff!«
Der junge Mann schluckte und stieg seinem Vorgesetzten hinterher – hinauf ins Niemandsland, in das Grauen des Krieges.
†
Ein kleines Dorf zwischen München und Füssen, Gegenwart
Einzelne Tränen rannen über das faltige Gesicht der alten Frau und vermischten sich mit dem eiskalten Regen, der in Strömen vom Himmel fiel. Grauschwarze Wolken verdunkelten den späten Nachmittag und schufen eine durchaus passende Atmosphäre für eine Beerdigung, wie sie fand. Ihr gebrechlicher Körper zitterte vor der Kälte und Nässe des Regens, den auch ein Schirm nicht abzuhalten vermochte.
Sie hatte schon viele Beerdigungen miterlebt, das brachte schlicht ihr fortgeschrittenes Alter mit sich, ab einem gewissen Zeitpunkt im Leben wurden die Beerdigungen häufiger als die Hochzeiten und die Taufen – irgendwann waren es dann die einzigen kirchlich-sozialen Events, die man noch besuchte.
Aber diese hier schien alle übrigen hinsichtlich der düsteren und traurigen Stimmung zu übertreffen. Nicht, dass eine Schar von Angehörigen am Grab stünde, oder noch schlimmer die üblichen alten Frauen aus dem Dorf, die sich derartige kirchliche Schauspiele nie entgehen ließen, egal, ob sie den Verstorbenen gut, weniger gut oder gar nicht kannten. Klageweiber, wie sie sie immer nannte und auch schimpfte. Nein, sie war allein am Grab. Vor ihr stand lediglich der Gemeindepfarrer, der mit einer offensichtlich zur Schau getragenen Lustlosigkeit sein Werk vollbrachte.
Dazu kam dieses fürchterliche Wetter. Selbst für Oktober schien es unnatürlich kalt zu sein. Der düstere Himmel und der Regen, der kurz vor dem Gefrieren war, taten ihr Übriges.
Sie hatte zwar immer gewusst, dass der Verstorbene zurückgezogen gelebt hatte, aber dass sie an diesem Tag allein war, verwunderte sie dann doch – gerade in so einem kleinen Ort gab es immer jemanden, der einen kannte und hoffentlich auch betrauerte.
Doch somit erklärte sich auch die Art des Grabs. Es war eine schlichte Steinplatte von der Größe eines normalen Briefbogens, auf dem sein Name in einfachen Lettern eingelassen war. Darunter lag die Urne. Ein Grab, vielleicht sogar finanziert vom Staat.
Früher nannte man so etwas Armengrab, dachte sie bei sich und spürte Wut in ihr hochsteigen.
Ein Blick bei der Ankunft zur Beerdigung hatte genügt, um zu sehen, dass die heutigen Sozialgräber oder auch die billigsten Grabstätten immer noch am äußersten Rand des Friedhofs waren, dem Teil, der erst vor etwa zehn Jahren überhaupt zum Friedhof dazugekommen war – vorher waren diese Gräber, wie es sich auf dem Land gehörte, noch außerhalb des heiligen Gemeindeackers gewesen.
Der Pfarrer hatte mittlerweile seine sakralen Worte schnell beendet – mehr als ein Murmeln war es sowieso nicht gewesen –, nickte ihr knapp zu und hastete durch den eisigen Regen Richtung Pfarrhaus.
Sie mochte den Pfarrer nicht, er war ein komischer Kauz, dem man irgendwie den Gemeindehirten nicht abnahm. Er stammte zwar aus diesem Dorf, aber sein Vater war schon ein Taugenichts gewesen und hatte Haus und Hof versoffen, bevor ihn der Teufel auf dem Heimweg aus der Dorfkneipe geholt hatte.
Mutter und Sohn waren vor dem tyrannischen Alten in den Glauben geflüchtet, hatten mehr Zeit versteckt in der Kirche als zu Hause verbracht. Als der Alte endlich tot war, war nichts mehr da, wovon man hätte leben können.
Mein Gott, das ist alles über vierzig Jahre her, dachte die alte Frau stirnrunzelnd. Sie sah noch die Mutter vor sich, ein junges Ding, Tochter eines Bauern, die nicht viel im Kopf hatte, aber hübsch war – und ihr Junge mochte vielleicht acht oder neun gewesen sein, als den Säufer der Schlag getroffen hatte.
Sie waren dann nach München gegangen, erzählte man sich, dort habe sie in einer Wäscherei geschuftet. Aber der Junge war kaum volljährig, da starb auch sie. Vor zwanzig Jahren kam der Sohn dann in die Gemeinde zurück – als Pfarrer, das war Mitte der 1990er Jahre. Seitdem wurde es in der Kirche immer leerer. Er machte seine Arbeit gut, aber er war kein Seelsorger, kein Herzensmensch – strahlte keine Wärme aus. Mittlerweile fuhren die alten Weiber sogar mit dem Fahrrad ins Nachbardorf für den Gottesdienst.
Einerlei, dachte die alte Dame und trat einen Schritt an die steinerne Platte heran. Es war ein seltsamer Tod gewesen. Auf einer Reise verstorben, irgendwo in Fernost. Sie hatte gewusst, dass er einen Urlaub plante – aber so weit weg? Und wie konnte er sich eine solche Fernreise leisten, aber kein richtiges Grab? Alles seltsam ...