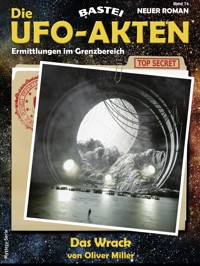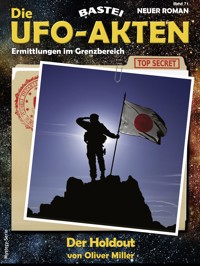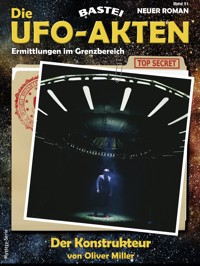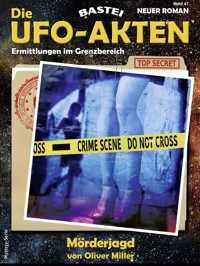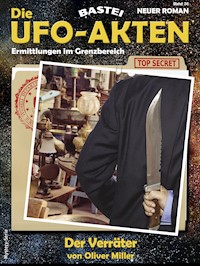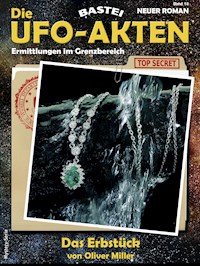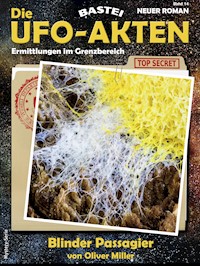1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Cliff Conroy und Judy Davenport sind gerade auf der Road 65 in der Nähe von Millersville unterwegs, als Cliff plötzlich einen Anruf von Professor Davies erhält. Der den Bundesmarshals bereits bekannte Wissenschaftler berichtet ihnen vom Verschwinden seines Freundes Professor Al-Hadary. Dieser befasst sich genau wie er selbst mit dem Kinderschreck-Phänomen, gilt als Experte für die altägyptische und sumerische Schrift - sympathisiert allerdings auch mit der umstrittenen Prä-Astronautik. Zuletzt soll Al-Hadary an einem besonderen Artefakt geforscht haben, das aus Oklahoma zu ihm gelangt war. Vor ein paar Tagen brach dann völlig unerwartet der Kontakt ab. Als Cliff und Judy von dieser Entwicklung erfahren, beschließen sie, dem Professor zu helfen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Der Würfel
UFO-Archiv
Vorschau
Impressum
Oliver Miller
Der Würfel
Forschungsbasis »Pandoras Box«
Oklahoma, 22. September 2023, 02:45 Uhr
Jamie Wilkes nippte an ihrer lauwarmen Tasse Kaffee und starrte dabei auf den Bildschirm vor ihr. Auf der Tasse war ein durch viele Spülungen verblasstes Foto eines kleinen Kindes zu sehen, das auf einem Schaukelpferd saß.
Hin und wieder dachte Jamie an Charlene. Wo mochte sie nun leben? Sie war jetzt fast acht Jahre alt. Abgesehen von den monatlichen Unterhaltszahlungen, die sie weiterhin leistete, hatte Jamie keinerlei Kontakt zu ihrer Tochter. Hinzu kam, dass ihr Mann Richard es nicht wollte. Obzwar es ein ziemlich bitteres Eingeständnis für eine Mutter ist, musste Jamie zugeben, dass sie kein Mensch für Beziehungen war. Das Leben hatte ihr dies wiederholt vor Augen geführt. Letztendlich gab es für sie nur die Welt der Wissenschaft ...
Richard war damals so etwas wie der letzte Versuch gewesen, ein Leben zu führen, das der Gesellschaft mehr entsprach.
Er war ein intelligenter junger Mann, sah gut aus und arbeitete an der Universität. Rein logisch betrachtet, stellte er eine hervorragende Partnerwahl dar.
Nach wenigen Monaten drängte sie ihn zur Heirat, denn es sollte alles seine Richtigkeit haben. Nach einem halben Jahr war sie schwanger.
Richard bemühte sich wirklich: Er war ein herzlicher, ein liebenswerter Mensch. Tief in ihrem Innersten wusste sie, dass sie so einen Partner gar nicht verdient hatte. Er besorgte ihnen ein kleines Häuschen in einer spießigen Vorstadt. Dadurch war das Glück eigentlich perfekt und alles genauso, wie Jamies Eltern sich die Zukunft ihrer Tochter vorgestellt hatten.
Doch Jamie betrachtete das Ganze zunehmend als ein großes, soziales Experiment. Bereits wenige Monate nach der Geburt von Charlene war ihr klar geworden, dass diese gebastelte Idylle keine Zukunft hatte, denn sie lebte praktisch in einer für sie völlig fremden Welt.
Ja, sie versorgte den Säugling, ja, sie kümmerte sich um den Haushalt und auch gelegentlich um ihren Mann. Doch im Grunde hatte sie zu beiden keinerlei Beziehung. Dabei war es nicht einmal so, dass sie das Kind ablehnte oder ihren Mann verachtete – sie spürte einfach gar nichts.
Als Richard dies eines Abends ihr gegenüber äußerte, hätte es in einer vermeintlich normalen Ehe, die sich in der Krise befand, einen riesigen Streit gegeben, doch nicht so bei Jamie.
Sie stimmte ihm in allen Belangen zu und schlug einen detaillierten Plan zur finanziellen Abwicklung der Partnerschaft, ihres Experiments, vor. Keine zwei Stunden später zog Jamie aus dem gemeinsamen Haus aus. Auch das Sorgerecht gab sie komplett ohne juristischen Widerstand ab und einigte sich auf eine großzügige Unterhaltszahlung an ihren Mann, verbunden mit einer weiteren finanziellen Absicherung des Kindes, die sie in verschiedenen Investmentfonds und anderen hohe Rendite versprechenden Wertpapieren anlegte.
Daraufhin folgte eine Phase, in der Jamie noch einmal versuchte, ihre Tochter in unregelmäßigen Abständen zu besuchen. Doch schnell merkten Richard und sie, dass dies nicht unbedingt zielführend war.
Als er schließlich seine neue Partnerin kennenlernte, die sich mit mütterlicher Begeisterung auf Charlene stürzte, war Jamie ein Stück weit erleichtert.
Danach schlief der Kontakt aber auch immer weiter ein. Seit zwei Jahren bekam Jamie nicht einmal mehr Fotos ihrer Tochter. Die an ihrer sozialen Empathielosigkeit gescheiterte Beziehung beendete bald auch das Verhältnis zu ihrer Restfamilie, insbesondere zu ihren Eltern, die ihr dies nie verziehen hatten.
Seltsamerweise hatte sie sich nie gefragt, wie sich Richard bei diesem ganzen Experiment gefühlt hatte. Die Trennung hatte er aus ihrer Sicht recht gut verkraftet. Vor allem das Wohl des Kindes war ihm dabei wichtig gewesen. Und dazu gehörte eben auch eine neue Frau, die ihm und seiner Tochter das bot, was Jamie ihm nicht bieten konnte. Insofern war bei ihm jetzt wieder so etwas wie eine Normalität eingekehrt.
Und was hatte sie selbst aus der Beziehung mitgenommen? Die Erkenntnis der sozialen Inkompatibilität. Manchmal verspürte sie – insbesondere, wenn sie die Tasse mit dem Bild von Charlene betrachtete – auch ganz tief in sich einen dumpfen Schmerz. Es handelte sich wohl um so etwas wie unterdrückte Mutterinstinkte oder einen verdrängten Trennungsschmerz. Doch diese Gefühle ließ Jamie nie an sich heran.
Im nächsten Augenblick stellten sich die Ziffern auf dem kleinen digitalen Wecker um, der auf dem Schreibtisch stand. Da es nun genau drei Uhr morgens war, leuchtete das Display kurz bläulich auf und ein Piepton erklang.
Der kleine Raum mit dem Tisch, der Jamies Büro beherbergte, war kaum größer als eine normale Garage. Trotzdem war er zusätzlich mit zwei großen, metallenen Regalen ausgestattet worden, die von Akten nur so überquollen. Eine der schmaleren Wände des Raumes verfügte über eine massive Stahltür, während die gegenüberliegende aus Panzerglas bestand und den Blick auf die eigentliche Forschungshalle freigab. In dieser befand sich das Objekt, um das sich in diesem Moment ihr ganzes Leben drehte: der Dimensionsportalgenerator.
Jamie hatte auf dieses winzige Büro bestanden, weil es praktisch das einzige Zimmer neben den vielen Überwachungsräumen war, das einen direkten Blick auf das Tor bot. Sie war dafür sogar bereit gewesen, die beengten Verhältnisse in Kauf zu nehmen, weil sie die meiste Zeit des Tages ohnehin an den verschiedenen Kontroll- und Forschungsstationen arbeitete. Das Büro diente insofern hauptsächlich dazu, den bürokratischen Papierkram zu erledigen, den sie normalerweise nachts abarbeitete. Daher störte es sie nicht besonders.
Der Kaffee entfaltet keine Wirkung mehr, stellte sie knapp fest und beschloss, nun doch für ein paar Stunden zu schlafen.
Mehr als drei oder vier Stunden gönnte sie sich nie. Wozu auch? Schlaf war für sie keine Erholungsphase, sondern lediglich eine körperliche Notwendigkeit.
Sie rieb sich kurz über die Augen und erhob sich langsam von ihrem Arbeitsplatz. Den Computer ließ sie angeschaltet, es lohnte schlichtweg nicht, ihn für die wenigen Stunden herunterzufahren. Dann schob sie den Bürostuhl an den Tisch und trug die leere Kaffeetasse fast vorsichtig zu dem kleinen Waschbecken, das sich in einer Ecke des Raumes befand. Geschickt spülte sie das Gefäß aus und stellte es zum Trocknen in eines der Aktenregale.
Im nächsten Augenblick ging ihre Hand in Richtung des Lichtschalters, als plötzlich das Telefon auf ihrem Schreibtisch zu klingeln begann. Der Ton durchschnitt die nächtliche Ruhe, und sie eilte mit zwei flinken Schritten zurück zu ihrem Arbeitsplatz. Das Display zeigte an, dass der Anruf aus Abteilung ›Fünf‹ kam.
Ungewöhnlich ... um diese Uhrzeit, äußerst ungewöhnlich, dachte sie und nahm das Gespräch entgegen.
»Ja?«, sagte sie und sparte sich damit die Nennung ihres Namens, da nur sie selbst Zugang zu diesem Apparat hatte.
»Hier ist Niwa. Ich bin die wissenschaftliche Aufsicht in Abteilung ›Fünf‹ heute Nacht«, erklang eine junge männliche Stimme.
»Ja, was gibt es, Mr. Niwa«, sagte Jamie Wilkes, ohne dass sie jemals von Niwa gehört hätte. Er war einer der unzähligen jungen wissenschaftlichen Mitarbeiter, die vor allem in der Nachtschicht zu Überwachungszwecken eingesetzt wurden. Und gerade in Abteilung ›Fünf‹ gab es nicht wirklich etwas zu tun, sodass man dort auch nicht unbedingt die hochqualifizierten Leute zu dieser späten Stunde arbeiten ließ.
»Mr. Fleury ist ...«, entgegnete er und zögerte kurz, »... aufgewacht.«
Über Wilkes Gesicht huschte dabei ein Hauch von Irritation: Was meinte Niwa damit? Doch bevor sie Erklärungen am Telefon einforderte, beschloss sie, sich der Sache trotz der nächtlichen Uhrzeit selbst anzunehmen und antwortete nur knapp: »Ich komme zu Ihnen!«
Die Abteilung ›Fünf‹ befand sich im unterirdischen Teil der Forschungsanlage und bestand aus zwei Zellen. Letztere waren mit gummierten Matten ausgelegt, und eine der Wände bestand komplett aus Glas, um die Insassen besser beobachten zu können.
Ursprünglich hatten sie diesen Bereich, den die Mitarbeiter oft nur als »den Kerker« bezeichneten, in großer Hast eingerichtet, als das Problem mit den beiden Soldaten auftrat, die aus dem Dimensionstor zurückgekehrt waren*.
Nur widerwillig dachte Wilkes an den Soldaten Pronger zurück, der nach seinem Besuch auf der anderen Seite als eine Art angstfressender Serienkiller hier sein Unwesen getrieben hatte. Dabei taten ihr weniger dessen Opfer leid, sondern vielmehr der Umstand, dass diese Angelegenheit eine Menge Staub aufgewirbelt hatte, der sie in ihren Forschungsarbeiten nur behindert hatte.
Aber Pronger wurde gefangen, hier eingesperrt und ist mittlerweile schon lange tot: Der Soldat, der zu einer Art Hybrid aus Mensch und Angstesser geworden war, verstarb nur wenige Wochen nach seiner Gefangennahme.
Er ist eingegangen wie eine Pflanze ohne Wasser, erinnerte sich Wilkes immer noch voller Faszination, als sie neben der leeren Zelle auf Niwa zuging.
Im Grunde war Pronger verhungert, denn ihr Team hatte es trotz mehrerer Versuche nicht geschafft, ihn dauerhaft mit seiner Nahrung zu versorgen – der menschlichen Angst.
»Mr. Niwa, was gibt es?«, fragte sie kühl, als sie dem schlaksigen, ja fast dünnen Afroamerikaner gegenüberstand, der sie mit unsicherem Blick ansah. Er mochte vielleicht Mitte zwanzig sein und war von irgendeiner Universität abgeworben worden, gelockt mit Geld und der Aussicht, an einem Geheimprojekt mitzuwirken.
Wahrscheinlich realisiert er noch nicht einmal, dass er seine Seele bereits an uns verkauft hat, überlegte sie kurz.
»Ms. Wilkes, gut dass Sie da sind!«, platzte es fast erleichtert aus ihm heraus. Er deutete auf die zweite Zelle, die hell erleuchtet hinter ihm lag.
Fleury, der zweite Soldat, der lebend aus dem Dimensionstor zurückgekehrt war, lief auf den gummierten Matten aufgeregt hin und her. Der Anblick des stark abgemagerten Mannes mit ungepflegtem Haar und Bart, der einen Krankenhausmantel trug und wild gestikulierte, wirkte beinahe amüsant. Die letzten Monate hatte er in einem fast katatonischen Zustand verbracht, sich praktisch kaum bewegt und nur gelegentlich Nahrung zu sich genommen.
Zuvor war Matt Fleury in einer Veteranen-Heilanstalt in Denver untergebracht gewesen. Doch nach der Gefangennahme von Pronger hatte Wilkes durchgesetzt, dass auch er hierher verlegt wurde. Offiziell wurde der Soldat Matt Fleury als Folge einer Lungeninfektion in der Pflegeeinrichtung für verstorben erklärt, und seine Eltern hatten sogar eine Beerdigung abgehalten. Was die beiden natürlich nicht wussten, war, dass der Sarg im Krematorium völlig leer war und ihr Sohn zu diesem Zeitpunkt bereits hier unten in seiner Zelle saß.
Wilkes betrachtete den umherwandernden Fleury und meinte dann nur knapp: »Öffnen Sie die Tür, ich will zu ihm!«
»Aber Ms. Wilkes ...«, intervenierte der junge Mann, »... wir können per Funk mit ihm kommunizieren. Dann müssen Sie da nicht rein!«
»Machen Sie auf, Niwa!«
»Ist das nicht ein bisschen zu gefährlich? Immerhin könnte er Sie angreifen!«
Ein eisiger Blick von Dr. Wilkes brachte den wissenschaftlichen Mitarbeiter zum Schweigen.
»Ich vertraue auf Ihr schnelles Eingreifen, falls es soweit kommen sollte!«
Mit seiner Schlüsselkarte entriegelte Mr. Niwa die in die Scheibe eingelassene Glas-Sicherheitstür.
Fleury nahm nicht einmal Notiz davon.
Vorsichtig öffnete Niwa dann die Tür, immer bereit, sie im Notfall schnell zuzuwerfen.
Dr. Wilkes trat nun langsam in den Raum.
Fleury lief immer noch auf und ab, plapperte vor sich hin und starrte auf den Boden.
»Mr. Fleury, schön dass Sie wieder bei uns sind!«, begrüßte Wilkes ihn, ohne dass dieser reagierte.
Mit bedachten Schritten ging sie näher auf ihn zu, um sein Gerede besser verstehen zu können.
»Er wird kommen. Bald wird er ankommen!«, plapperte er, unterbrochen von dem einen oder anderen Gekicher.
Etwas ratlos trat Wilkes daraufhin noch näher an ihn heran, berührte ihn fast: »Wer wird kommen?«
»Bald ist er da!«, sagte der Soldat und beachtete sie immer noch nicht.
Mit einer Hand packte sie nun den dünnen Unterarm von Fleury: »Wer wird kommen, Mr. Fleury?«
Der Mann hielt inne und sah sie vollkommen verständnislos an: »Der Nächste wird kommen!«
Unbeirrt hielt sie ihn weiterhin fest, wobei er kaum Gegenwehr leistete.
»Welcher Nächste?«
Er begreift nicht, wo er sich befindet oder wer ich bin. Er ist nicht wirklich wieder da, dachte sie, als sie das Irrlichtern in seinen Augen sah.
»Der nächste Baustein!«, hauchte er.
Sie wich jetzt ein Stück zurück, ohne ihn loszulassen. »Was für ein Baustein?«
»Es ist der nächste Baustein!«, wiederholte er und wandte sich von ihr ab. Wilkes entließ ihn nun aus ihrem Griff, und er nahm wieder seinen Gang auf. »Er wird kommen! Aus dem Tor! Der nächste Baustein!«
Immer wieder wiederholte er seine Aussagen.
Wilkes beobachtete ihn noch kurze Zeit, wandte sich dann ab und verließ die Zelle.
Niwa schloss hinter ihr die Tür.
Ohne den Wissenschaftler nur eines Blickes zu würdigen, wies sie ihn an: »Zeichnen Sie jedes Wort auf, was er von sich gibt ...«
Dann eilte sie zum Ausgang, noch bevor er zu einer Reaktion ansetzen konnte. Schließlich erwartete sie Sensationelles. Da war keine Zeit für lange Gespräche. Nein, und Schlaf sollte es heute wohl auch keinen geben.
Ich werde die Vormittagsschicht für das Portal wecken lassen. Ab sofort gilt die höchste Beobachtungsstufe. Mal sehen, ob uns wirklich etwas durch das Tor erreicht, dachte sie.
Auf der Road 65
In der Nähe von Millersville, Tennessee, 04. Oktober 2023, 18:12 Uhr
»Ich hätte nicht gedacht, dass du es wirklich ernst meinst!«, stellte Cliff fest und sah zu Judy herüber, die am Steuer des Winnebagos saß.
»Was willst du damit sagen?«, fragte sie lächelnd, ohne den Blick von der vor ihr liegenden Straße zu nehmen.
»Naja, diesen Trip nach Nashville! Ich habe nicht erwartet, dass du tatsächlich dorthin fahren willst!«
»Wieso? Ich finde, dass wir uns nach all der Zeit auch einmal einen kleinen Ausflug außerhalb unserer Einsätze für Campbell erlauben können.«
Cliff lachte laut auf. »Aber, dass du ausgerechnet nach Nashville willst, verwundert mich dann doch!«
»Wieso? Unsere Fälle haben uns bereits nach Tennessee geführt, und ich wollte schon immer mal die dortigen Musikmuseen besuchen. Das hat aber bisher noch nie geklappt. Außerdem erinnere ich dich an unsere Diskussion um deinen sehr seltsamen Musikgeschmack. Es wird also Zeit, dir diesbezüglich ein wenig Kultur näherzubringen.«
Er nickte schmunzelnd. »Ja, du hast ja recht. Campbell hat sich seit unserem letzten Auftrag in Alaska erfreulicherweise nicht mehr gemeldet, nutzen wir die Pause also für etwas Erholung. Was deine Anspielung bezüglich meines Musikgeschmacks angeht ... kann ich dir leider nicht ganz folgen.«
Judy gab ihrem Partner einen scherzhaften Hieb auf die Schulter, während sie das Wohnmobil mit der anderen Hand weiterlenkte.
Spielerisch nahm er die Hände schützend hoch. »Ist ja gut, ist ja gut!«
Als in diesem Augenblick das Mobiltelefon von Cliff zu klingeln begann, warf Judy ihm einen mitleidsvollen Blick zu und meinte lediglich lakonisch: »Wenn man vom Teufel spricht ...«
Cliff nahm zügig das Telefon von der Ablage und betrachtete mit einem verwunderten Gesichtsausdruck die Nummer, die auf dem Display angezeigt wurde.
»Nein, das ist nicht Campbell. Ich kenne die Nummer nicht.«
Mittels einer Displayberührung nahm er dann das Gespräch entgegen und hielt das Smartphone an sein Ohr. Nach wenigen Augenblicken wurde sein Gesichtsausdruck nur noch erstaunter.
»Bitte, wer ist da?«